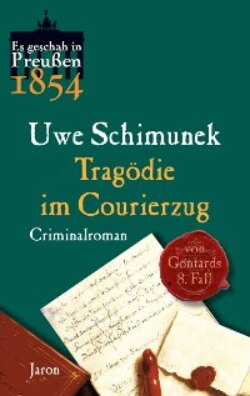Читать книгу Tragödie im Courierzug - Uwe Schimunek - Страница 9
13. Januar, 12 Uhr mittags
ОглавлениеFerdinand von Gontard lief den Flur der Kommandantur des Grenadierregiments König Friedrich Wilhelm II. Nr. 10, genannt 1. Schlesisches, hinunter. Der Gang flößte ihm Respekt ein. Oft kam er als kleiner Lieutenant nicht in diesen Teil der Kasernenanlage, und wenn es jemanden aus dem Fußvolk hierher verschlug, dann drohte nicht selten Ärger.
Wen Ferdinand von seinen Vorgesetzten auch ansprach wegen des Leichenfundes, alle wimmelten ihn ab und verwiesen auf den Kommandeur des 1. Bataillons, Generalmajor Meinrad von Frohwitz. Bei dem liefen alle Fäden der Garnison in Breslau zusammen, er war nur noch dem Kommandeur des gesamten Grenadierregiments, von Kortzfleisch, unterstellt. Also blieb Ferdinand nichts anderes übrig, er musste zum »Alten«, wie Frohwitz in der gesamten Garnison genannt wurde. Wer immer über den Bataillonskommandeur redete, sprach dessen Spitznamen mit einer Mischung aus Spott und Ehrfurcht aus. Frohwitz’ offensichtlicher Gebrechlichkeit bei Appellen stand sein scharfer Verstand gegenüber. Altgediente Offiziere behaupteten gar, Frohwitz könne Gedanken lesen. Das hielt Ferdinand zwar für übertrieben, aber es war auch ihm in den wenigen Begegnungen mit Frohwitz bisher schwergefallen, dessen durchdringendem Blick standzuhalten.
Im ersten Stock hingen die Porträts verdienter Offiziere der Garnison. Die Uniformen auf den Gemälden waren über und über mit Orden, Ehrenzeichen und Kordeln besetzt. Da erzählten die alten Offiziere immer etwas von Blut und Treue, und dann behängten sie sich mit opulentem Glitzerkram wie Weiber. Ferdinand dachte an seinen Vater, der sich über die hohen Offiziere und deren pompöse Abbildungen stets lustig machte. An dieser Galerie hätte er seine helle Freude gehabt. Ferdinand dagegen bekam bei jedem weiteren ernsten Gesichtsausdruck ein mulmigeres Gefühl.
Am Ende der Galerie bog der Gang zu Frohwitz’ Dienstzimmer ab. An der Ecke saß ein Corporal und gähnte.
»Ich möchte zu Herrn Generalmajor von Frohwitz, um eine Meldung zu machen«, sagte Ferdinand.
»Geht nicht«, nuschelte der Mann.
Ferdinand zögerte einen Augenblick. Vor ihm saß zwar lediglich ein Corporal, dem eine solch unhöfliche Rede einem Lieutenant gegenüber nicht zustand, aber immerhin handelte es sich um den Diensthabenden vor dem Zimmer des Bataillonskommandeurs. Zudem war der Kerl bestimmt zehn Jahre älter als Ferdinand. Wie würde sein Vater, der Oberst-Lieutenant von Gontard, sich in dieser Situation verhalten? Zumindest würde er sicher nicht vor einem Corporal kuschen.
»Ich habe etwas Wichtiges zu melden, Herr Corporal.« Ferdinands Stimme wurde mit jedem Wort fester. »Und reden Sie gefälligst in vollständigen Sätzen mit mir!«
Der Corporal guckte wie ein Saufkumpan kurz vor einer Kneipenschlägerei. Wenigstens gähnte er nicht mehr, sondern sagte laut: »Ich habe meine Befehle, Herr Lieutenant. Der Generalmajor möchte nicht gestört werden.«
»Was ist denn das für ein Gebrüll?«, hallte es aus dem Gang.
Ferdinand erkannte die Stimme des Kommandeurs. Der Alte klang müde, so als habe er gerade ein Vormittagsschläfchen beendet. Frohwitz näherte sich mit gemessenen Schritten – oder schlurfte er?
Der Corporal sprang auf und zeigte auf Ferdinand. »Der junge Lieutenant missachtet Ihre Befehle, Herr Generalmajor!«
»Mit Verlaub, ich habe eine wichtige Meldung zu machen.« Ferdinand wandte sich direkt dem Alten zu. »Ich habe nur versucht, das dem Corporal zu vermitteln.«
»Hm.« Der Alte schaute Ferdinand eindringlich an. Da war er wieder, dieser forschende Blick. Nach einem Moment fuhr der Kommandeur fort: »Dann kommen Sie doch mit, Herr Lieutenant!« Frohwitz trottete gen Dienstzimmer, und Ferdinand folgte ihm.
Der Corporal hätte mit seinem Blick das Fegefeuer einfrieren können. Ferdinand genoss den Erfolg.
Im Dienstzimmer setzte sich der Kommandeur hinter einen barocken Secretär und sagte: »Sie müssen dem Corporal sein ungehobeltes Verhalten verzeihen. Wenn die Diensthabenden nicht so abweisend wären, fände ich nie Ruhe.«
Ferdinand merkte, wie seine Kinnlade herunterklappte. Grinste der Alte ihn an?
»Nun, mein junger Herr Lieutenant, ich habe gehört, Sie haben interessante Neuigkeiten.«
Wusste der Alte schon Bescheid? Und wenn ja, woher?
»Berichten Sie!«
»Ich habe an der Oderwiese eine Leiche entdeckt.«
»Das ist mir bekannt, Herr Lieutenant.«
Also tatsächlich … Ferdinand wusste nicht, was er dem Kommandeur noch berichten sollte. Er sagte: »Ich bin nicht sicher, ob ich die Zivilbehörden unterrichten soll. Ich habe meinen direkten Vorgesetzten bereits über den Fund informiert, aber keine klare Anweisung erhalten.«
Frohwitz hob einen Brieföffner vom Schreibtisch und richtete die Klinge auf Ferdinand. »Haben Sie bei der Leiche Hinweise auf eine Zugehörigkeit zur Armee Seiner Majestät gefunden?«
»Nein, Herr Generalmajor. Wobei die Kleidung kaum noch zu erkennen war. Einen Helm habe ich jedenfalls nicht entdeckt.«
Der Kommandeur tippte mit der Spitze des Brieföffners gegen den Zeigefinger seiner linken Hand. »Bei einem toten Zivilisten gäbe es keinen Zweifel, den würden wir den Zivilbehörden überlassen. Bei einem Armee-Angehörigen würden wir uns hingegen der Sache annehmen …«
»Ich kann Ihnen dahingehend leider keine zuverlässige Auskunft geben.«
Frohwitz legte den Brieföffner zurück auf die Tischplatte und schaute auf wie ein Großvater vom Märchenbuch. »Ihrem Vater eilt der Ruf voraus, solchen Fällen selbst auf den Grund zu gehen. Sie haben keine derartigen Ambitionen?«
»Sie meinen …«
»Ich würde sagen, Sie melden sich am Nachmittag wieder bei mir, Herr Lieutenant, und dann sehen wir, welche Informationen Sie zusammengetragen haben. Bis dahin behandeln wir die Sache vertraulich.«
Christian Philipp von Gontard lief die Linden entlang. Um genau zu sein, drängte er sich durch das Gewimmel – zwischen den Waschweibern mit ihren Körben hindurch, vorbei an Lumpensammlern, Bürgersleuten und Landeiern, die auf der Suche nach Halt in der großen Stadt waren. Alle paar Schritte bot ein Kolporteur brüllend seine Ware feil. Und das war nur das Fußvolk, das sich die Straße mit den Kutschen, Reitern und Pferdeomnibussen teilen musste. Gontard kam es so vor, als ob der Verkehr im Herzen der Residenzstadt immer dichter würde. Die Menschen schienen kaum zum Luftholen zu kommen vor lauter Eile. Wurde er einfach zu alt für diesen Trubel?
An der Friedrichstraße hatte sich ein Menschenauflauf gebildet. Ein fliegender Händler pries eine Zeitschrift an: Die Gartenlaube. Vor allem einfaches Volk umringte den Kolporteur und riss ihm die Blätter förmlich aus der Hand. Gontard kannte Die Gartenlaube von der Küchenmamsell. Die hatte das illustrierte Familienblatt im vergangenen Jahr erstmals mitgebracht und in jeder freien Minute darin geschmökert. Inzwischen kaufte sogar Gontards Frau Henriette gelegentlich die Zeitschrift. Er selbst hatte einzelne Artikel überflogen und für harmlos befunden. Sollten die Frauen ihren Spaß haben. Wenn ihm die vielen Käufer nur nicht den Weg versperrten! »Platz da!«, rief er.
Tatsächlich versuchten einige der Mamsellen, zur Seite auszuweichen. Nur war da kein Platz. Die Frauen zeterten wie aufgescheuchte Hühner. Doch als sie zu Gontard glotzten, riefen sie eilig Entschuldigungen.
Gontard lief einen großen Bogen um den Pulk und trat auf die Friedrichstraße. Hier bewegten sich die Fuhrwerke im Schritttempo durch das Gedränge. Auf der anderen Straßenseite sah es kaum besser aus. Erst in Richtung der Dorotheenstraße wurde die Menge lichter. Zum Glück war das sein Weg. Gontard legte einen finsteren Blick auf, und tatsächlich machten ein paar arme Schlucker Platz. Mit jedem Schritt kam er leichter voran. Nach ein paar Metern achtete er gar auf einzelne Gesichter in der Masse. War das nicht … Oje!
»Herr Oberst-Lieutenant, was für ein schöner Zufall!« Criminal-Commissarius Waldemar Werpel kam ihm entgegen und war so gut gelaunt, als sei er auf dem Weg zu seiner Beförderung.
»Herr Criminal-Commissarius, ich bin etwas in Eile«, flunkerte Gontard. Eigentlich war es egal, ob er in fünf, zehn oder zwanzig Minuten zum Mittagessen in seinem Haus um die Ecke ankam.
»Ach, ich dachte, Sie wollen vielleicht etwas über die aktuellen Criminalfälle hören …« Werpels Grinsen wurde immer breiter.
»Gibt es etwas zu berichten?«, fragte Gontard und fand, dass er eine Spur zu interessiert klang.
»Gestern stand der Tagelöhner Helm vor Gericht und wurde verurteilt.«
Gontard kannte die Geschichte aus der Gerichts-Zeitung. Der Arbeiter hatte einen Kollegen erstochen, ein anderer Arbeitskamerad hatte danebengestanden und alles bezeugen können. Die Tat war vor ein paar Monaten geschehen, gar nicht weit von hier, in der Großen Friedrichstraße No. 219. Im Hof des Geheimen Justizraths Bode hatten die drei Tagelöhner Holz geschlagen, als es zu dem Streit gekommen war. Da hatte es nicht viel zu ermitteln gegeben.
»Stellen Sie sich vor, Herr Oberst-Lieutenant, der Kerl hat noch in der Verhandlung das Unschuldslamm gespielt, obwohl er längst überführt war!« Werpel stemmte seinen rechten Arm in die Seite.
Gontard fiel auf, dass der Polizist immer dicker wurde – noch ein paar Pfund mehr, und er würde den Arm strecken müssen, um bis zum Gürtel zu gelangen. »Wie hat dieser Helm denn versucht, sich aus der Sache herauszuwinden?«, fragte Gontard. »Der Fall lag doch ziemlich klar.«
»Der Beschuldigte hat angegeben, vom Opfer und dem Zeugen angegriffen worden zu sein und in Notwehr gehandelt zu haben.« Werpel hob die Hand und fuchtelte mit dem Zeigefinger herum. »Doch von seiner Aussage kurz nach der Tat ist ein genaues Protokoll vorhanden. Im Verhör hatte Helm mir gegenüber zugegeben, dem Opfer zugerufen zu haben: ›Siehst du, Schweinehund, das geschieht dir recht!‹ In der Verhandlung hat er davon nichts mehr wissen wollen und sich als Unschuldslamm gegeben.«
Eine solche Wandlung kannte Gontard nur zu gut. In der Zelle hatten selbst die übelsten Gesellen genug Zeit, nach einer Ausrede zu suchen.
»Der Richter hat sich von dem Burschen nicht blenden lassen. Fünf Jahre darf der Kerl hinter Gittern schmoren.« Werpels Brust schwoll vor Stolz. Das machte allem Anschein nach sogar Eindruck auf die Passanten. Sie strömten herbei und ließen dabei einen ehrfürchtigen Abstand zu Gontard und Werpel von bestimmt einer halben Elle.
Gontard fand das Gehabe des Commissarius übertrieben. Der hatte lediglich einen Hitzkopf seiner gerechten Strafe zugeführt. Gontard dachte an die Criminalfälle, die er selbst in den vergangenen Jahren gelöst hatte. Bei den Tätern hatte es sich um ganz andere Kaliber gehandelt, Verbrecher, die nicht einfach vor Zeugen zustachen und sich alsbald von herbeigerufenen Polizisten in die Vogtei abführen ließen. In diesen Fällen hatte der Commissarius selten eine so selbstgefällige Miene aufgesetzt wie jetzt. Werpel übte sich bei kniffligen Angelegenheiten eher in der Kunst des Im-Weg-Stehens.
»Und Sie, Herr Oberst-Lieutenant, ermitteln Sie derzeit in einem Criminalfall?«, fragte Werpel gut gelaunt.
»Ach, Herr Commissarius«, antwortete Gontard, »ich habe derzeit viel zu tun. Seit mein neuer Bursche krank daniederliegt, merke ich, dass mir der Strohkopf bei allem Ärger doch das Leben erleichtert hat. Selbst wenn ich über eine Leiche stolpern würde, bliebe mir keine Zeit für Ermittlungen. Vermutlich würde ich mich einfach an Sie wenden.«
Die Küchenmamsell wuchtete den Suppentopf auf den Tisch in der Essküche. Sie verteilte die Portionen: eine Kelle für Henriette von Gontard, eine halbe für Luise, die Tochter des Hauses, und drei für Gontard. Es roch nach Kartoffeln, und Gontard verspürte Hunger.
Die Mamsell verließ die Küche. Henriette faltete die Hände zum Gebet. Gontard tat es seiner Frau gleich und blickte zu Luise. Die war mit ihren siebzehn Jahren eine junge Frau geworden. Gontard staunte beinahe jeden Tag über seine herangewachsene Tochter. Er wunderte sich nicht nur über die rundlichen Formen seiner Kleinen, noch mehr verwirrten ihn die erwachsenen Gesichtszüge Luises. In ihrem Antlitz zeichnete sich durchaus Anmut ab, aber für Gontards Geschmack hätte seine Tochter öfter lächeln dürfen.
Nach einem kurzen Nicken von Henriette sprach Gontard das Tischgebet, dann aßen alle. Gontards Hunger schien eigentümlicherweise mit jedem Löffel größer zu werden. Er zwang sich, die Suppe nicht hinunterzuschlingen, und blickte zu seiner Frau.
Vielleicht deutete Henriette das als Aufforderung, etwas zu sagen. »Es sind milde Tage«, stellte sie fest.
Luise nickte so ernsthaft, als sei sie in einer Behörde für Wetterangelegenheiten beschäftigt.
Gontard löffelte die Suppe. Draußen auf der Straße lag kein Schnee, aber immer wenn er ins Haus kam, war er doch froh über die wohlige Wärme des Heimes. In der Küche reichte der Herd sogar, ihn ins Schwitzen zu bringen. Gontard öffnete einen Knopf seiner Uniformjacke. Die Blicke von Frau und Tochter ruhten auf ihm. Er hielt das Wetter nicht für ein passendes Gesprächsthema, insbesondere wenn es nur um den Austausch von Belanglosigkeiten ging. Mit Schweigen würde er jedoch allem Anschein nach nicht davonkommen. Also erwiderte er: »Wenn ich den Himmel anschaue und den Wind bedenke, steht wohl Kälte bevor.« Damit schien alles gesagt. Sie aßen schweigend weiter. Mit jeder Minute erschien Gontard die Stille drückender. Noch vor einer halben Stunde hatte ihm die Hektik Unter den Linden fast die Nerven geraubt, und nun ertrug er die Ruhe nicht.
Luise hatte ihre Mahlzeit bereits beendet und legte den Löffel zur Seite.
Gontard überlegte, ob das Mädchen genug aß, war aber dann sicher, dass Henriette sich um so etwas kümmerte.
»Hast du nach dem Mahl noch Zeit, das neue Klavierstück anzuhören, das deine Tochter gerade lernt?«, fragte Henriette und schob dabei ihren leeren Teller beiseite.
»Selbstverständlich. Was spielst du gerade, Luise?«
Die Tochter schluckte.
»Sie übt am ersten Satz der Schumann’schen Phantasie. Ich finde, sie macht das ganz bezaubernd.«
Gontard teilte Henriettes Enthusiasmus für Luises Klavierspiel nur selten. Eine Clara Schumann würde sie wohl nicht werden. Allerdings spielte sie gut genug, um später in der eigenen Familie zu feierlichen Anlässen ein Ständchen zu geben. Das war zu begrüßen, wie er fand, auch wenn die Kleine sich für seinen Geschmack mit der Familiengründung noch ein paar Jahre Zeit lassen konnte.
»Sie hat mich heute Morgen ganz vorzüglich mit ihrem Spiel unterhalten«, fuhr Henriette fort.
Luise hob den Kopf, als wolle sie etwas sagen, hielt die Worte aber zurück.
»Auch die schwierigen Phrasen in d-Moll klingen nun gut. Ich bin so stolz auf unsere kleine Pianistin.«
»Mutter, bitte!«, zischte Luise.
Henriette zuckte zusammen und schaute zu ihrer Tochter. Plötzlich sah sie müde aus und alt. Sie drehte den Kopf und blickte fragend zu Gontard. Sekunden verronnen. »Luise, kannst du mir bitte erklären, was das soll?«, fragte Henriette, ohne ihren Kopf zu wenden.
»Entschuldige bitte. Es ist doch nur …« Luise vollendete den Satz nicht.
»Ich weiß manchmal nicht, was mit ihr los ist«, sagte Henriette.
Vermutlich sollte Gontard als Familienvorstand jetzt eingreifen und ein Machtwort sprechen. Doch zum einen fiel ihm nichts ein, was er hätte sagen können, und zum anderen wusste er nicht einmal, an wen er seine Worte hätte richten sollen. Worum ging es hier überhaupt? Luise sprach schon seit Jahren nicht allzu viel mit ihm. Gontard fragte seine Tochter gelegentlich nach ihrem Befinden, und sie erklärte in hübscher Regelmäßigkeit, ihr gehe es ausgezeichnet. Henriette hatte bislang nicht von Sorgen berichtet, was ihre Tochter anging, deshalb beließ Gontard es beim Schweigen.
»Mutter, ich bitte noch einmal um Verzeihung, aber ich fühle mich noch nicht so weit, die Phantasie jemandem vorzuspielen.«
War er denn ein Fremder?, fragte sich Gontard.
Henriette sah ihn unentwegt an, als erwarte sie etwas von ihm. Auch Luises Blick wanderte von der Mutter zu ihm.
»Lass das Mädchen doch!«, sagte Gontard.
Das schien nicht der rechte Satz gewesen zu sein. Sowohl Henriette als auch Luise runzelten die Stirn. Dabei sahen sie einander so ähnlich, dass Gontard beinahe lachen musste.