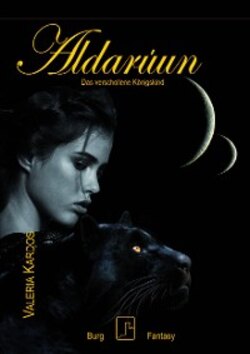Читать книгу Aldarúun - Valeria Kardos - Страница 1
ОглавлениеValeria Kardos
Aldaruun
Das verschollene Königskind
Prolog
Die Sonne verschwindet hinter den Häusern und taucht sie in tiefe Orange- und Rottöne. Eine friedliche Ruhe hat sich über Budapest ausgebreitet, und langsam gehen überall in der Stadt die Lichter an. Es ist erst Mitte Februar, aber die Temperaturen klettern tagsüber bereits auf über zehn Grad.
Alvar blickt zu der Frau an der Brüstung, die ihm den Rücken zuwendet. Ihr graues Haar ist mit einer kostbaren Spange hochgesteckt. Sie trägt ein bodenlanges dunkelblaues Samtkleid, das mit einem weißen Spitzenkragen versehen ist. Wie elegant Sophia noch ist, denkt Alvar. Und so diszipliniert. Ihre Haltung wirkt geradezu majestätisch. Mit schlanken Fingern streicht sie über das Messinggeländer, das im Abendlicht glänzt. Dann dreht sie sich abrupt um. Ihr Blick verrät große Sorge und ihre Gedanken scheinen weltenentrückt zu sein.
„Das Wettrennen hat also begonnen“, sagt sie und seufzt. „Wir werden sehen, wer das Kind als Erstes findet: unsere Spione oder die Bestien.“ Sie schließt verzweifelt ihre Augen. „Wenn die Bestien das Kind vor uns finden, werden sie es töten – und damit jede Hoffnung.“
„Ich weiß“, sagt Alvar und zieht an seiner Pfeife. Er steht mühsam auf; langsam spürt er die Bürde seines hohen Alters. Dann streicht er seinen Brokatgehrock glatt, tritt aus dem Schatten ins Licht auf Sophia zu und legt seine linke Hand auf ihre Schulter. „Ich habe die Prüfung der Rekruten abgeschlossen und eine, wie ich meine, gelungene Wahl getroffen. Sie sind bereit, ihre Pflichten zu übernehmen.“
Sophia strafft ihren Körper. „Nach welchen Attributen hast du sie ausgesucht, Alvar?“
Er zieht eine Augenbraue hoch und lächelt. Sie wird seinem Urteil vertrauen, das tut sie schon seit vielen Jahrzehnten. Er lässt seine Pfeife sinken und beobachtet ihr Gesicht, während er nachdenklich seinen langen Bart krault. Seine Worte wählt er mit Bedacht.
„Nach den Attributen, die das höchste Maß an Sicherheit versprechen: Tapferkeit, Loyalität und Liebe.“
„Liebe?“, schnaubt sie verächtlich. „Was soll Liebe für ein Attribut sein? Eloni-Krieger müssen starke Kämpfer sein. Demut, Tapferkeit und bedingungsloser Gehorsam sind Attribute, nach denen sie ausgewählt werden müssen. Das hat sich in der Vergangenheit stets bewährt!“
Sie ist noch vom alten Schlag, denkt Alvar düster. Sie zu neuen Pfaden zu führen, könnte schwierig werden.
„Du weißt“, sagt er, „dass das Verhältnis zwischen den Eloni und den Menschen in den letzten Jahrhunderten sehr gelitten hat und brüchig geworden ist. Wenn wir auf den alten Bündnissen aufbauen wollen, müssen wir auf ursprüngliche Werte wie Toleranz und Vertrauen zurückgreifen. Uns stehen dunkle Zeiten bevor! Der Krieg, der sich auf Aldarúun anbahnt, kann uns vernichten! Das Wohl und die Sicherheit des Kindes müssen unter allen Umständen gewährleistet sein. Das ist nur möglich, wenn es von seiner Leibgarde nicht nur mit Verstand und Kraft, sondern auch mit dem Herzen beschützt wird.“
Sophia verschränkt ihre Arme und blickt wieder über die Stadt hinweg. „Meine Spione haben berichtet, dass der Dunkle Orden den letzten Nachfahren in Deutschland vermutet und bereits die ersten Bestien zum Portal entsandt hat. Wir werden die Eloni-Krieger blind losschicken und uns auf ihre angeborenen Instinkte verlassen müssen.“ Sie seufzt, bevor sie leise weiterspricht. „Ich hoffe sehr, du weißt, was du tust, Alvar! Das Kind ist unsere letzte Hoffnung. Wenn wir nur einen Fehler machen, könnte das unseren Untergang bedeuten!“ Stirnrunzelnd dreht sie sich zu Alvar um. „Warum Liebe? Das musst du mir erklären.“
Er lächelt und zieht an seiner Pfeife. „Sophia, die EloniKrieger sollen ihr Leben für das Kind, sollte es erforderlich sein, aufs Spiel setzen. Dazu gehört mehr als Treue zur Krone und Pflichtbewusstsein.“
„Aber es ist ihre Pflicht, dem Hause Gollnir zu dienen! Das ist ihre Aufgabe, Alvar, schon seit vielen Jahrhunderten. Woher dieser plötzliche Sinneswandel?“
Nachdenklich krault er seinen Bart. „Die Zeiten haben sich gewandelt. Sie sind dunkel und unbestimmt. Wir müssen lernen, in neuen Maßstäben zu denken und die Ketten unserer eingefahrenen Regeln zu sprengen. Dazu gehört auch, der Garde einen gewissen Freiraum zu lassen. Sie dürfen nicht in das höfische Regelwerk eingezwängt werden – nur dann können sie und werden sie über sich hinauswachsen. Ich habe es in meinen Visionen gesehen.“
Sie schließt für einen Moment ihre Augen und atmet tief durch. Alvar weiß, wie traditionsbewusst Sophia ist und dass er in diesem Augenblick viel von ihr verlangt.
Resigniert zieht sie die Schultern hoch. „Nun gut, alter Freund, ich vertraue deinem Urteil. Wann kann ich sie sehen?“
„Sie sind hier und warten unten in der großen Halle auf uns.“
„Sie sind hier?“, fragt sie erstaunt.
„Du sagtest selbst, der Dunkle Orden hat bereits seine Bestien entsandt. Wir sollten auf gar keinen Fall unnötig Zeit verlieren. Komm mit, ich bringe dich zu ihnen.“
Alvar bietet ihr seinen Arm an, und sie legt ihre linke Hand in seine Armbeuge. Mit der rechten Hand spielt sie an ihrer Perlenkette – das einzige Anzeichen, dass es unter dieser perfekten Fassade brodelt. Alvar führt sie von der Dachterrasse durch ein doppeltüriges Glasportal. Sie durchqueren das große Wohnzimmer und betreten den offenen Gang einer Galerie. Ein Kronleuchter von drei Metern Durchmesser erleuchtet das Stockwerk darunter, das die Eingangshalle der Villa bildet. Der Boden des unteren Stockwerks ist mit italienischem Marmor gefliest. Weiße Säulen zieren die Halle. In der Mitte steht ein großer Springbrunnen, der seine Fontäne bis ins nächste Stockwerk schießt.
An diesem Brunnen warten drei kräftig gebaute Männer, die sich schüchtern und etwas hilflos umschauen.
„Sie sind jung – sehr jung – zu jung“, sagt Sophia entsetzt.
„Sie sind die Tapfersten“, bemerkt Alvar ruhig.
„Junge Elonis sind zu unbeherrscht, zu wild! Sie lassen sich viel zu schwer kontrollieren“, zischt sie wütend.
„Sie sind unbefangen und voller Neugierde auf die Welt und sind bereit, auch neue Wege zu gehen“, erwidert er sanft.
„Unsere Gegner sind übermächtig und stark. Den dreien dort unten fehlt jegliche Erfahrung, Alvar. Besonnenheit, nicht jugendlicher Übermut sollte sie leiten.“
Sie blickt wieder hinunter zu den drei jungen Männern und schüttelt verhalten ihren Kopf.
„Ihre Unerfahrenheit werden sie kompensieren durch Hingabe, Mut und Einfallsreichtum“, sagt Alvar und macht eine kurze Pause, bevor er etwas leiser weiterspricht, „und natürlich durch die Liebe, die sie für das Kind empfinden werden.“
„Du sprichst, als ob du dir sicher wärst. Woher nimmst du nur diese Gewissheit?“, fragt Sophia erstaunt und dreht sich wieder zu ihm.
„Ich habe in ihre Seelen geblickt, Sophia. Sie sind reinen Herzens, Falschheit ist ihnen fremd. Sie werden ihre Pflichten unkonventionell erfüllen und uns alle überraschen.“
„Was hast du nur in deiner Vision gesehen?“, fragt sie ungläubig, als sie das Aufblitzen in seinen Augen sieht. Lächelnd legt er wieder ihre Hand in seine Armbeuge und führt sie die breite Treppe hinunter.
„Hoffnung, Sophia, Hoffnung!“
Veränderungen
1
Die Tür knallt hinter Irma zu, als sie mit hochrotem Kopf aus Herrn Meinels Büro stolpert. Ihre Hände zittern, während sie sich mit ihren Unterlagen wieder auf ihren Platz setzt. Ich erkenne, wie ihre Augen langsam feucht werden und sie mit ihrem kleinen Finger verstohlen eine Träne wegwischt. Die jähzornigen Ausbrüche unseres Chefs bringen sie selbst nach vielen Jahren noch immer aus der Fassung.
„Der Kerl hat wieder eine Laune, dass die Milch sauer wird“, schnaubt sie wütend und putzt sich die Nase.
Herr Meinel ist der stellvertretende Geschäftsführer des Speditionsunternehmens, in dem ich als Teilzeitkraft angestellt bin. Seine schlechten Launen – und schlecht gelaunt ist er so ziemlich immer – lässt er stets an seinen Mitarbeitern aus. Irma, die ihm direkt unterstellt ist, bekommt oft das meiste ab.
Ich bin Gott sei Dank nur noch ein paar Monate hier. Mein Abitur habe ich vor einem halben Jahr gemacht und ich will meine Ausbildung zur Tierarzthelferin in einer ganz bestimmten Praxis beginnen. Zur Überbrückung der Zeit habe ich die letzten Monate ein wenig gejobbt, was nach der ganzen Lernerei auf die Abi-Klausuren eine Wohltat ist. Es tut gut, abends nach Hause zu kommen und nicht über den Büchern sitzen zu müssen.
Irma schnieft, putzt sich nochmals die Nase und macht sich wieder an die Arbeit. Trotz der täglichen Ausbrüche unseres Chefs kämpft sie tapfer weiter. Ich beobachte sie aus dem Augenwinkel und bewundere sie angesichts ihres Durchhaltevermögens.
Die Tür wird aufgerissen und Stefanie, die zweite Sachbearbeiterin von Herrn Meinel, stürmt aufgeregt herein. Irma und ich drehen uns neugierig zu ihr um, während sie sich mit einem lauten Rums auf einen der Schreibtischstühle fallen lässt. „Es haben sich weitere zwei Fahrer krankgemeldet. Ich habe keine Ahnung, wie ich die nächsten Touren besetzen soll“, sagt sie und schielt verzweifelt in Richtung Meinels Büro. „Der Alte wird mir den Kopf abreißen, obwohl ich gar nichts dafür kann.“
„Ich würde dir den Botengang ja abnehmen, aber ich habe heute meinen Einlauf schon erhalten“, winkt Irma ab. „Einen zweiten stehe ich nicht mehr durch – nicht vor dem Wochenende.“
Nun schauen mich beide erwartungsvoll an. Ich seufze, und noch bevor eine von ihnen den Mund aufmachen kann, schnappe ich mir die Krankmeldungen und sage im Vorbeigehen: „Also, da sollte mindestens ein Cappuccino für mich nächste Woche drin sein.“
„Cappuccino, Kuchen, Eis … was immer du möchtest, Anja“, ruft Stefanie und lächelt erleichtert.
Es hat sich in der Vergangenheit herausgestellt, dass ich irgendwie einen beruhigenden Einfluss auf die Menschen in meinem Umfeld habe. Selbst Choleriker wie Herr Meinel kommen in meiner Gegenwart erstaunlich schnell wieder runter.
„Du hast auf Menschen eine Wirkung wie Valium“, hat mal Ramona, meine beste Freundin, lachend zu mir gesagt. Das habe ich zwar nicht unbedingt als Kompliment aufgefasst, aber es trifft den Kern ziemlich genau. Selbst während meiner Schulzeit wurde ich gern zum Schlichten von Streitereien herangezogen.
Auch meine beiden Kolleginnen haben das sehr schnell erkannt und schicken nur allzu gerne mich in die Höhle des Löwen, wenn der Löwe wieder mal in Fressstimmung ist.
Ich klopfe vorsichtig an seine Tür und warte sein brummiges „Herein!“ ab, bevor ich eintrete. Herr Meinel ist ein Mann um die fünfzig, etwas korpulent und – durch seinen hohen Blutdruck – stets ein wenig rot im Gesicht. Er schaut mich kurz über seinen Brillenrand hinweg an, bevor er sich wieder seinen Unterlagen widmet.
„Was gibt es, Frau Horvath?“, fragt er leicht gereizt wie immer.
Ich trete an seinen Schreibtisch und atme einmal tief durch. „Herr Meinel, ich fürchte, ich habe eine schlechte Nachricht. Zwei weitere Fahrer haben sich heute krankgemeldet. Da scheint ein ganz böser Virus zu …“
„Was?“, schreit er laut auf und wirft dabei seine Brille achtlos auf den Schreibtisch. „Die sind nicht krank, da gehe ich jede Wette mit Ihnen ein!“
Ich lege ihm die Krankmeldungen hin, die er nur mit einem giftigen Blick quittiert.
„Es sind doch immer dieselben, die krank werden, und dann am besten noch vor Feiertagen oder vor dem Wochenende. Ich weiß genau, dass Günter gerade ein Haus baut und viel Zeit braucht. Wahrscheinlich benutzt der auch noch unsere Lkws zum Transportieren. Wenn ich den erwische …“
Ich tue, was ich immer tue, wenn er mit seinen Schimpftiraden beginnt – ich schalte auf Durchzug. So bekomme ich nur mit halbem Ohr mit, wie er alle Angestellten als Schmarotzer bezeichnet, die sich doch nur auf seine Kosten bereichern … bla bla bla.
Dr. Fuchs, nicht mehr lange!, denke ich sehnsüchtig an den liebenswertesten Tierarzt der Welt, der bald mein Chef werden wird.
„… man sollte sie nur noch nach Leistung bezahlen! Man muss da ansetzen, wo es richtig wehtut – am Geldbeutel!“
„Warum nehmen wir nicht einen der neuen Aushilfsfahrer, dafür haben wir sie doch eingestellt?“, unterbreche ich ihn, als sein Gekeife zu mir durchdringt. Ich lächele freundlich und erwarte, dass er gleich wieder lospoltert, aber überraschenderweise bleibt das aus. Sein Atem wird ruhiger und die Ader an seinem Hals schwillt langsam wieder ab. Bisher hatte ich über dieses Phänomen nicht weiter nachgedacht, aber seit ich hier arbeite und Stefanie mal zu mir gesagt hat, ich hätte wieder den Drachen besänftigt, beginne ich das Verhalten meiner Mitmenschen mir gegenüber etwas genauer zu beobachten. Es fällt mir mittlerweile täglich auf, im Supermarkt, während der Arbeit oder im Privatleben – und es scheint sich zu verstärken. Als ich Ramona darauf mal ansprach, sagte sie zu mir, ich solle in den diplomatischen Dienst gehen oder noch besser in den Verkauf. So wie ich die Menschen beeinflussen könne, würde ich schnell ein kleines Vermögen machen.
Herr Meinel reißt mich aus meinen Gedanken. Er drückt mir die Krankmeldungen in die Hand und murmelt, dass Stefanie sich um alles Weitere kümmern soll. Er wendet sich wieder seinen Unterlagen zu, was bedeutet, dass ich gehen kann.
Ich atme auf, als ich die Tür hinter mir schließe und in die erwartungsvollen Gesichter meiner beiden Kolleginnen blicke.
„Und?“, fragen sie mich gleichzeitig.
„Nun, du sollst die Aushilfsfahrer einsetzen“, sage ich grinsend und schaue in ihre verblüfften Gesichter.
„Mehr nicht?“, fragt Stefanie perplex.
„Nein, mehr nicht.“
„Anja, ganz im Ernst, wir werden dich nicht gehen lassen. Ohne dich wird dieser Laden wieder zur Hölle!“, sagt sie und Irma nickt eifrig. Ich mag die beiden wirklich sehr, aber ich werde keine Sekunde länger in dieser Firma bleiben als nötig.
Es piepst aus meiner Handtasche. Ich setze mich wieder an meinen Platz und hole mein Handy heraus. Auf dem Display sehe ich, dass ich eine WhatsApp-Nachricht von Ramona erhalten habe. Meine Laune verbessert sich sekündlich, während ich mich zur Nachricht durchklicke: Heute Abend 19:00 Uhr – Abendessen – Köln – übliches Restaurant – Widerstand ist ZWECKLOS – bis nachher Süße
Wenn Ramona sich etwas in den Kopf gesetzt hat, muss man schon eine Ausrede wie überfahren vom Bus oder entführt von Aliens vorweisen, sonst ist Ärger angesagt. Aber das ist nicht nötig. Ich freue mich auf unser Abendessen. Der richtige Ausklang einer nervigen Arbeitswoche.
Endlich ist es halb sechs. Irma und ich lassen buchstäblich die Kugelschreiber fallen und eilen aus dem Büro. Am Parkplatz verabschiede ich mich und wünsche ihr ein schönes Wochenende. Dann schlendere ich langsam zu meinem kleinen Fiat Panda, der am anderen Ende des Parkplatzes steht.
Ich sehe aus dem Augenwinkel, wie sich Irma in ihren Wagen setzt und mir nochmals zuwinkt, bevor sie vom Hof fährt. Ich winke zurück und laufe weiter über den Parkplatz, während ich in der Handtasche nach meinem Autoschlüssel krame.
Es ist Mitte April, und wir haben schon den ganzen Tag über schönes Wetter. Nach dem langen Winter, der sogar für Kölner Verhältnisse sehr kalt war, hatte mich heute Morgen das Frühlingsfieber gepackt. Ich hatte mich für eine mintgrüne Bluse mit der passenden Strickjacke und eine helle Baumwollhose entschieden. Eine Wohltat nach den dicken Winterklamotten.
Es ist jetzt, um halb sechs, noch immer warm, aber ich fröstele. Während ich noch in meiner Tasche krame, überkommt mich eine seltsame Beklommenheit. Ich hebe den Kopf und schaue mich um, aber ich bin völlig allein auf dem Parkplatz. Alles, was ich sehe, sind Lastwagen, Gebäude, Müllcontainer und die ans Firmengelände angrenzenden Felder. Aus der Ferne höre ich die Autos auf der Landstraße. Das gleiche Szenario, das sich mir jeden Abend bietet … aber ich fühle mich befangen.
Es ist seltsam ruhig. Noch nicht einmal lustiges Vogelgezwitscher ist zu hören. Ich drehe mich langsam um die eigene Achse und starre in jeden Schatten, den die Lkw werfen.
Kein Lufthauch ist zu spüren, es ist totenstill. Es ist, als ob alle Alltagsgeräusche ausgeblendet wären, als ob die Zeit stehengeblieben wäre – ich fühle mich wie in einem Vakuum.
Mein Magen krampft sich zusammen, und fröstelnd ziehe ich meine Strickjacke enger, während ich nochmals jeden einzelnen Schatten mit den Augen abtaste. Ich werde das Gefühl nicht los, beobachtet zu werden.
Verärgert drehe ich mich wieder zu meinem Wagen um. Endlich finde ich auch die Schlüssel in meiner Handtasche und stelle mit Befremden fest, dass meine Hände leicht zittern. Noch während ich die Tür aufschließe, denke ich, wie albern mein Verhalten ist und dass ich bestimmt gleich mit Ramona herzlich darüber lachen werde. Aber das unbehagliche Gefühl will nicht weichen. Ich setze mich, so schnell es geht, hinter das Lenkrad und gebe Gas. Mit überhöhter Geschwindigkeit fahre ich über den Parkplatz auf die Straße hinaus.
Allgemeine Alltagsgeräusche dringen an mein Ohr, als ich in Richtung Innenstadt fahre, und langsam verliert sich dieses dumpfe Gefühl. Ich versuche über mich selbst zu lachen, aber es will mir einfach nicht gelingen.
2
„Wie viele Kalorien hat so ein Steak eigentlich noch mal?“
Mit gerunzelter Stirn zerschneidet Ramona das letzte Stück Fleisch auf ihrem Teller und schiebt es sich genüsslich in den Mund. „Wenn ich nicht bald anfange, disziplinierter zu werden, bekomme ich nie die drei Kilo bis zum Sommer herunter“, sagt sie kauend.
Ich kann mir ein kleines Grinsen nicht verkneifen, denn Ramona ist bildhübsch und vor allem gertenschlank, aber wie die meisten Frauen nie wirklich mit sich zufrieden. Sie hat kurze rote Haare, die in alle Richtungen stieben, und eine süße kleine Stupsnase, umrahmt von Sommersprossen. Sie ist stets ein wenig lauter als andere Frauen, ein wenig frecher und fröhlicher. Eigentlich eine typische Rheinländerin.
„Wo willst du eigentlich noch abnehmen? An deinen Ohrläppchen?“, frage ich grinsend.
„Hör mal, du Schlaumeier, ich habe ein Schweinegeld für diesen Versace-Bikini ausgegeben, der aus einem kleinen Hauch von Nichts besteht. Da darf kein Millimeter Fett überquellen.“ Sie funkelt mich mit ihren hübschen blau-grauen Augen angriffslustig an.
„Warum hast du dir keinen Badeanzug gekauft? Du hättest weniger Stress und könntest auch von dem Schokoeis naschen, das ich gleich zum Nachtisch bestellen werde“, entgegne ich mit Unschuldsmiene.
Ich verschlucke mich fast beim Lachen, als ich in Ramonas Gesicht blicke. Wenn sie wütend ist, dann wird einfach alles in ihrem Gesicht noch roter – sogar ihre Sommersprossen scheinen dann zu glühen.
„Du bist so ein Miststück“, faucht sie mich an, „du wirst kein Eis bestellen, hörst du? Du weißt genau, Eis ist meine persönliche Droge – ich bin quasi ein Eis-Junkie!“
Grinsend beiße ich in mein Knoblauchbrot und unterdrücke ein weiteres Kichern, zum Ersten, weil die anderen Gäste im Restaurant uns bereits pikiert beobachten, und zum Zweiten, weil die kleine rothaarige Wildkatze mich mit einer Erbse auf ihrer Gabel bedroht.
„Kein Eis, verstanden, Anja?“
„Schon gut, kein Eis“, antworte ich und nippe an meinem Bitter Lemon, um mein Grinsen zu verbergen.
Ramona und ich kennen uns schon aus der Schulzeit. Wir hatten uns in der siebten Klasse kennengelernt, nachdem meine Mutter und ich nach Köln gezogen waren. Die Chemie zwischen uns beiden stimmte von der ersten Sekunde an, und daran hat sich bis heute nichts geändert. Ramona ist eine Waise und hat in der Vergangenheit mehr Zeit bei uns als bei ihren diversen Pflegefamilien verbracht. Das hat sie stark an uns gebunden.
„Ich habe dir doch von Marc erzählt, den ich auf Miriams Hochzeit kennengelernt habe. Wir haben ein paar Mal telefoniert und uns endlich für nächsten Dienstag verabredet. Gott, der Junge ist so süß, das gehört schon verboten. Normalerweise gehe ich ja nicht mit Jungs aus, die besser aussehen als ich, aber ich konnte seinen Grübchen einfach nicht widerstehen.“ Kichernd nippt sie an ihrer Cola. „Ich habe keine Ahnung, was ich anziehen soll“, murmelt sie eher zu sich selbst.
Ich betrachte sie aufmerksam und komme zu dem Schluss, dass sie eigentlich tragen kann, was sie will, sie sieht in allem sexy aus. Sie hat ein absolutes Gespür für Mode. Ich bin da eher pragmatisch veranlagt. Auch, was unser Naturell angeht, könnten wir nicht unterschiedlicher sein. Ramona ist wild, ungestüm und spontan, ich hingegen ruhig, kontrolliert und auf Sicherheit bedacht. Aber irgendwie funktioniert unsere Freundschaft – auf eine sehr seltsame Art und Weise.
Auch was Männer angeht, ist Ramona stets hungrig. Sie kommt mir manchmal vor wie ein kleines Kind in einem Süßigkeitenladen, das mit großen Augen das üppige Angebot an Leckereien betrachtet und am liebsten von allem probieren möchte. Ich hingegen habe gerade mal zwei feste Freunde gehabt und beide Beziehungen endeten in einem Trauerspiel.
Marc scheint die neueste Attraktion im Süßigkeitenladen zu sein. „Was ist denn mit dem braunen Hosenanzug mit den weißen Streifen an der Seite und dem tiefen Ausschnitt?“, schlage ich vor. Sie überlegt kurz, dann hellt sich ihr Gesicht auf. „Das ist eine gute Idee! Darin habe ich wenigstens ein bisschen Busen. Ich weiß auch schon genau, welche Pumps ich dazu anziehen werde.“
„Sag mal, was ist denn aus diesem Kevin geworden, den du letztens noch so umwerfend fandest?“, will ich wissen.
„Wie kommst du jetzt auf Kevin? Den hatte ich doch noch vor Markus abgeschossen.“
„Markus? Wer ist Markus? Hast du mir da einen unterschlagen?“ Überrascht lasse ich die Gabel sinken.
Ramona rollt mit den Augen. „Markus war doch der mit dem scheußlichen Mundgeruch.“
„Ich dachte, der mit dem Mundgeruch war Björn?“
„Och, Anja, du musst mir auch mal zuhören, wenn ich dir etwas erzähle“, mault sie und schiebt sich kopfschüttelnd eine kleine glasierte Karotte in den Mund.
„Moni, Süße, ich liebe dich, aber von deinen Männergeschichten bekomme ich echt Migräne.“
Als wir uns draußen vor dem Restaurant verabschieden, ist es bereits kurz nach elf. Ramona gibt mir einen herzlichen Kuss auf die Wange und trollt sich lachend davon. Ich sehe ihr kurz nach, dann drehe ich mich um und mache mich auf den Weg zu meinem Wagen.
Die Dreiviertelarm-Bluse sowie die helle Baumwollhose schienen heute Mittag noch eine gute Idee gewesen zu sein, aber jetzt zieht langsam die Kälte an meinen Beinen hoch. Ich wickele mich noch enger in meine Strickjacke und versuche, mich zu orientieren. Das Restaurant befindet sich auf der Hohen Straße, einer der normalerweise belebtesten Einkaufsstraßen, aber um diese Uhrzeit ist sie wie leergefegt. Es kommen mir nur noch vereinzelt ein paar Menschen entgegen, die wohl, genauso wie ich, auf dem Weg zu ihren Fahrzeugen sind.
Das Parkhaus, in dem ich meinen Wagen abgestellt habe, ist älter und liegt abseits der beliebten Einkaufsmeile. Auf dem Weg zum Restaurant hatte ich mich schon verlaufen und jetzt – im Dunkeln – habe ich vollkommen die Orientierung verloren.
Ich laufe durch ein Wohngebiet und es befindet sich keine Menschenseele mehr auf der Straße. Der Weg bis zum Restaurant hatte keine zehn Minuten gedauert, doch ich bin mittlerweile fast zwanzig Minuten unterwegs. Ich erinnere mich, dass ein großes blaues Neonschild über dem Eingang des Parkhauses hing und daneben eine Apotheke war. Das Klackern meiner Absätze hallt von den Wänden wider. Die Kälte zieht mir unangenehm unter die Kleidung und ich beschleunige meine Schritte.
Sobald ich im Auto sitze, drehe ich die Heizung bis zum Anschlag auf.
Meine Zähne beginnen zu klappern.
Ich biege um die Ecke und blicke in beide Richtungen. Verdammt! Wieder falsch. Ich drehe mich um und nehme die Seitenstraße davor. Nichts kommt mir mehr bekannt vor, aber im Dunkeln sieht sowieso alles anders aus. Weit dürfte ich aber nicht sein, denn ich habe irgendwie das Gefühl, im Kreis zu laufen. Die nächste Seitenstraße ist noch dunkler, aber ich glaube am Ende der Straße das blaue Neonschild wiederzuerkennen. Ich biege in die Straße ein und laufe auf das Licht zu, als ich plötzlich etwas Merkwürdiges höre.
Es klingt wie ein Knurren, das langsam in ein Fauchen übergeht – ein Geräusch, das mir Schauer über den Rücken jagt!
Ich halte abrupt inne und schaue mich um. Hinter mir stehen nur die geparkten Autos, Stoßstange an Stoßstange, und der Wind wirbelt ein paar Papierschnipsel in die Luft. Trotz der Straßenbeleuchtung ist es recht dunkel, da es hier so gut wie keine Geschäfte gibt, die durch Neonreklame erleuchtet werden.
Wieder dieses Knurren, das dieses Mal in ein Zischen übergeht – und es klingt näher!
Noch nie in meinem Leben habe ich solche Geräusche gehört. Mein erster Gedanke sind herrenlose Hunde, aber so klingen keine Hunde. So klingt einfach gar nichts, was ich kenne.
Als ich meine Schritte in Richtung Parkhaus beschleunige, wird das Knurren lauter, aggressiver. Vor Schreck bleibe ich wieder stehen und blicke mich ängstlich um.
Zu meiner Linken erkenne ich einen großen Parkplatz, auf dem etliche Autos stehen. Er wird nur von einer Straßenlaterne beleuchtet, da die anderen außer Betrieb sind. Hinter jedem dieser Autos könnte sich etwas oder jemand verstecken.
Starr vor Angst versuche ich in der Dunkelheit etwas zu erkennen, da höre ich wieder dieses schaurige Geräusch – grollender, wütender und gefährlicher. Eine eisige Kälte erfasst mich, die nichts mit den Temperaturen zu tun hat, und zieht langsam an meinen Beinen hoch, als wollte sie mich lähmen.
Ich nehme ein Geräusch hinter mir wahr und drehe vorsichtig den Kopf. Mein Atem wird immer flacher. Im Augenwinkel sehe ich einen dunklen Schatten hinter einem der parkenden Autos hervorschleichen, nur um sofort wieder hinter einem Mauervorsprung zu verschwinden.
Das ist definitiv kein Hund, Hunde können nicht aufrecht gehen.
Aber es ist kein richtiges Aufrechtgehen, eher eine gebückte Haltung mit nach vorne hängenden Armen, wie bei Schimpansen. Frei herumlaufende Affen in der Kölner Innenstadt? Noch absurder!
Vom dunklen Parkplatz weht wieder ein Knurren herüber, das in ein schauriges Kreischen übergeht. Schweißperlen bilden sich auf meiner Stirn, obwohl ich friere, da sehe ich plötzlich ein gelb funkelndes Augenpaar, das sich langsam auf mich zubewegt. Ein Schrei bleibt irgendwo auf dem Weg zu meiner Kehle stecken und meine Beine gehorchen mir nicht mehr.
Paralysiert starre ich auf dieses unheimliche Ding, das immer näher kommt.
Wie viele Meter sind noch zwischen uns? Zwanzig? Fünfzehn?
Ich habe jegliches Gefühl für Zeit oder Entfernung verloren. Dann taucht ein weiteres gelbes Augenpaar auf sowie ein drittes. Es sind keine Schritte zu hören, nur ein seltsames, leises Klackern.
Lauf!, schreit nur noch eine Stimme in mir und endlich reagiert auch mein Körper. Aber als ich mich rühre, registriere ich ein Geräusch hinter mir.
Verdammt! Das Ding hinter dem Mauervorsprung habe ich fast vergessen. Ich schiele zu dem blauen Neonschild des Parkhauses. Es ist eigentlich gar nicht mehr so weit, vielleicht zehn, fünfzehn Meter? Vorsichtig und sehr langsam beginne ich einen Fuß vor den anderen zu setzen, darauf bedacht, keine ruckartigen Bewegungen zu machen. Die Augen dieser Wesen, was auch immer sie sind, folgen mir stetig. Es ist alles so surreal. Panisch krame ich in meiner Handtasche nach der Parkkarte. Es sind jetzt nur noch wenige Schritte bis zur Eingangstür, aber ich höre, wie auch sie näher kommen.
Als ich das Parkhaus endlich erreiche, schiebe ich mit zitternden Händen die Karte durch das Lesegerät und warte, dass das grüne Lämpchen angeht. Aber ich muss sie nicht ordnungsgemäß durchgezogen haben, denn es passiert nichts.
Anja, konzentrier dich, verdammt noch mal!
Nächster Versuch. Das Klackern hinter mir wird lauter.
Das grüne Lämpchen blinkt auf und mit einem leisen Klick geht die schwere Metalltür auf.
Ein wütendes Kreischen erhebt sich hinter mir, und als ich mich umdrehe, schießen vier gelbe Augenpaare aus der Dunkelheit auf mich zu.
Ich schlüpfe durch die Öffnung und reiße panisch an der Klinke, aber es handelt sich um eine Brandschutztür mit einem Dämpfer, der die zufallende Tür abbremst. Etwas Schweres knallt von außen dagegen und erschüttert sie in ihren Grundfesten.
… noch zwanzig Zentimeter …
Vier riesige Krallen schieben sich um den Türrahmen, da fällt sie endlich mit einem dumpfen Knall ins Schloss.
Ein schrilles Kreischen ertönt und ich halte mir taumelnd die Ohren zu. Meine Beine sind kurz davor, zu versagen, als mein Blick auf den Boden fällt.
So etwas passiert nicht im realen Leben! Das ist nur ein Albtraum und ich wache gleich auf!
Vier abgetrennte klauenartige Finger liegen dort und zucken noch. In meinem Kopf beginnt sich alles zu drehen und ich stütze mich an der Wand ab, als mir plötzlich auffällt, dass es wieder still ist. Aber warum? Keine Schmerzensschreie mehr?
Egal, bloß weg hier!
Ich drehe mich um und haste zur Treppe. Taumelnd nehme ich zwei Stufen auf einmal und muss aufpassen, nicht wegzurutschen. Trotz meiner Panik registriere ich, wie muffig es in diesem Gebäude riecht. Die Wände sind mit Graffiti beschmiert und das Licht spärlich, da fast die Hälfte der Neonröhren kaputt ist. Mein kleiner Fiat steht im untersten Parkdeck, auf Ebene drei, und ist vermutlich das letzte Auto um diese Uhrzeit.
Ich überlege fieberhaft, was ich jetzt tun soll.
… noch zwei Parkdecks …
Polizei rufen! Ja, das ist naheliegend, aber was soll ich ihnen sagen? Ich werde von gelben Augen verfolgt? Lächerlich!
… noch ein Parkdeck …
Plötzlich schießt mir durch den Kopf, dass ich die Treppe für die Fußgänger genommen habe. Ob sich bei diesem Parkhaus ein Rollgitter über Nacht senkt?Sind diese Wesen eventuell schon im Gebäude?
Ich versuche meine Gedanken zu ordnen und reiße die Tür zu Parkdeck drei auf – und stolpere direkt auf ein wütendes gelbes Augenpaar zu.
Die hässlichste Fratze, die mir je begegnet ist, blickt mir entgegen, da durchfährt mich auch schon ein stechender Schmerz. Das Ding hat seine Krallen tief in meine Schulter gejagt, reißt mich herum und schleudert mich gegen die Betonwand gegenüber. Schreiend fliege ich durch die Luft und pralle mit einem dumpfen Knall gegen die Mauer. Irgendetwas knackt und für einen kurzen Augenblick wird mir die komplette Luft aus meinen Lungen gepresst. Ich japse wie ein Fisch an Land, dann beginnen sich meine Lungenflügel wieder langsam mit Sauerstoff zu füllen. Vorsichtig setze ich mich auf und lehne mich gegen die Wand. Die Schmerzen sind fast unerträglich, mindestens eine Rippe dürfte gebrochen sein.
Das Licht hier unten ist genauso spärlich wie im Treppenhaus, aber ich sehe genug – und was ich sehe, kann nur einem Albtraum entsprungen sein.
Die vier Wesen haben die aufrechte Haltung aufgegeben und schleichen knurrend auf mich zu. Sie sind groß und ihre grauen Körper sind schwer und massig, trotzdem bewegen sie sich mit einer erstaunlich agilen Eleganz. Ihre Haut wirkt ledern, fast schon panzerartig wie die Haut einer Schildkröte, und sie haben klauenartige Hände und Füße mit immens langen Krallen. Sie sind kahlköpfig und haben lange gelbe Zähne. Ihre Augen glühen vor Hass.
Die Panikattacke, die mich erfasst, lässt sogar die Schmerzen vergessen. In meinem Körper funktioniert nichts mehr, ich kann mich weder bewegen noch schreien.
Drei von ihnen bleiben abrupt stehen, während die größte Bestie, wohl das Alphatier, weiter auf mich zuschleicht. Es sind keine Geräusche zu hören, bis auf die mächtigen Krallen, die auf dem asphaltierten Boden klackern. Das war also das Klackern vorhin gewesen. Nur wenige Zentimeter vor mir bleibt es stehen und fixiert mich mit stechenden Augen. Ein Geruch von Fäulnis weht mir entgegen und ich muss unwillkürlich würgen. Da zischt es plötzlich: „Súrrr.“
Sein Atem stinkt bestialisch. Wieder zischt es mich an: „beszéjj súrrr“, und sein hässlicher Kopf kommt immer näher. Es bleckt seine langen Eckzähne und sein Speichel tropft auf meine Hose. Trotz meiner Panik begreife ich, dass dieses Tier gerade gesprochen hat, und obwohl es beim Reden die Lippen nicht bewegt, kann ich es hören. Es wiederholt diese seltsamen Worte immer wieder, aber ich starre es nur mit offenem Mund an.
Meine Reglosigkeit und mein Unverständnis scheinen es nur wütender zu machen, und es beginnt die Worte regelrecht zu brüllen, zumindest nehme ich es in meinem Kopf so wahr. Heftig atmend drücke ich mich gegen die Wand, als es plötzlich seine Klaue hebt und mit enormer Wucht in die Wand hinter mir niederfahren lässt. Seine Krallen fräsen sich durch die Betonwand wie durch Butter und hinterlassen tiefe Krater. Es schüttelt wild seinen großen, kahlen Kopf, sodass der Speichel nur so in alle Richtungen spritzt, dann nimmt es mich wieder ins Visier. Es flüstert etwas Unverständliches, und obwohl ich es nicht verstehe, weiß ich, dass es etwas Bedrohliches ist. Da bäumt es sich auf und gibt ein widerliches Kreischen von sich. An seinem Blick erkenne ich, dass der Small Talk hiermit beendet ist.
Als es seine riesige Klaue zum zweiten Mal hebt, schließe ich die Augen und bete, es möge nur schnell vorbei sein.
3
Plötzlich ertönt ein röhrender Motor auf einem der oberen Parkdecks und kommt rasch näher.
Ich öffne vorsichtig meine Augen und versuche zu begreifen, warum meine Eingeweide noch nicht verstreut auf dem Boden liegen. Die vier Wesen ducken sich fauchend und wirken für einen Augenblick verwirrt. Der Anführer zischt etwas in dieser seltsamen Sprache und sie verändern ihre Position. Knurrend gehen sie in eine Angriffsformation über und starren in die Richtung, wo der Motor röhrt.
Eine schwarze Harley-Davidson schießt um die Ecke und bleibt mit quietschenden Reifen stehen. Der Fahrer scheint in keinster Weise überrascht zu sein, vier zähnefletschende, gelbäugige Monster anzutreffen. Lauernd steigt er von seinem Motorrad und greift hinter sich, wo er zwei lange, glänzende Schwerter hervorzieht. Surrend dreht er sie in seinen Handgelenken und so etwas wie ein Knurren kommt tief aus seiner Kehle, nur dass es bei ihm fast menschlich klingt. Er ist groß, mit einem athletischen Körperbau, und er trägt eine dieser typischen Motorradlederhosen und die dazu passenden Stiefel. Ansonsten passt aber nichts in das Bild eines typischen Bikers – oder eines normalen Menschen. Er hat lange, dunkle Haare, die teilweise am Hinterkopf verflochten sind, aber auch Stränge seitlich am Kopf. Seine Haut ist etwas dunkler als meine, zumindest sieht es bei diesem Licht so aus, dadurch erinnert er mich ein wenig an einen Indianer auf Büffeljagd. Er trägt eine Art Lederwams und einen Gürtel, der mit Krallen und Zähnen – genau wie die der Bestien – verziert ist.
Trophäen! Ich erschaudere.
Der Fremde stößt einen Kampfschrei aus und springt auf die vier Bestien zu, die nun ebenfalls zum Angriff übergehen. Noch während des Sprungs zieht er seine Schwerter mit unglaublicher Geschwindigkeit durch und landet direkt hinter seinen Gegnern. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand – beinahe aus dem Stand – so hoch und weit springen kann, noch nicht einmal bei den Olympischen Spielen.
Er hat zwei von ihnen enthauptet und einer der Köpfe rollt mir direkt vor die Füße. Zwei leere Augen starren mir entgegen und ich bin so gebannt von diesem Anblick, dass ich das restliche Kampfgeschehen nur noch am Rande mitbekomme. Ich höre im Hintergrund das Zischen des Anführers und wie Knochen zerschmettert werden sowie ein paar tierische Laute im Todeskampf. Wenige Sekunden später ist alles vorbei.
Als ich hochblicke, sehe ich, dass eine der Bestien buchstäblich in der Mitte zerteilt ist und zähes, fast schwarzes Blut langsam über den Asphalt fließt.
Der mysteriöse Fremde wischt seine Schwerter an einem der Körper ab und steckt sie wieder zurück in die Lederscheiden. Ich halte die Luft an, als er sich umdreht und mit langen Schritten auf mich zukommt. Er kniet sich zu mir und schaut mich durchdringend an. Trotz der spärlichen Lichtverhältnisse erkenne ich, dass seine Augen tiefgrün sind – die schönsten Augen, die ich je gesehen habe –, aber sein Blick ist hart, beinahe aggressiv.
„Név et hang?“, fragt er mich mit wütender Stimme in einer seltsamen Sprache. Als ich nicht reagiere, wiederholt er seine Frage ungeduldig.
„Bitte – ich verstehe nicht“, wispere ich und traue mich kaum, einen Muskel zu bewegen.
Überrascht zieht er eine Augenbraue hoch und runzelt die Stirn. Dann beugt er sich vor und beginnt an mir zu schnüffeln. Ich blicke ihn irritiert an.
Er betrachtet mich kopfschüttelnd. „Du bist ein Mensch?! … ich meine, ein Erden-Mensch?“, sagt er mit leichtem Akzent und reibt sich verwundert das Kinn. Die Aggressivität ist urplötzlich aus seiner Stimme gewichen, was dazu führt, dass auch seine Gesichtszüge weicher werden.
„Ähm, ja“, antworte ich leise und versuche aus dieser Feststellung schlau zu werden.
Er legt seinen Kopf schief, sodass eine seiner Haarsträhnen verrutscht, da fällt es mir urplötzlich auf. Wie konnte ich das nur übersehen?
Er hat lange, spitze Ohren!
Wie bei Mr. Spock!
Verabschiedet sich mein Verstand jetzt ins Lala-Land?
Seine Frage holt mich wieder zurück.
„Was wollten sie? Haben sie zu dir gesprochen?“
Er schaut mir mit einer Intensität in die Augen, dass ich einen trockenen Mund bekomme.
„Haben sie etwa dich gejagt?“, fragt er stirnrunzelnd, und obwohl seine Stimme ruhig bleibt, ist das Misstrauen klar herauszuhören.
Hatten sie mich gejagt? Offensichtlich! Mein Verstand versucht immer noch die jüngsten Ereignisse zu sortieren und zu verarbeiten.
„Wenn ja, wüsste ich nicht, warum“, antworte ich leise.
„Sie greifen normalerweise keine Erden-Menschen an, das ist ungewöhnlich“, sagt er nachdenklich. „Haben sie etwas zu dir gesagt?“
„Nur unverständliche Worte“, antworte ich wahrheitsgemäß und spüre, wie meine verletzte Schulter zu pochen beginnt. Langsam werde ich der Schmerzen bewusst. Außerdem sitze ich auf dem eiskalten Boden, und vor Kälte sind meine Gelenke schon ganz steif.
„Wie lauteten die Worte?“ Seine Stimme ist nicht laut, aber bedrohlich. Da packt er mich an den Schultern und sagt mit Nachdruck: „Versuche, dich an die Worte zu erinnern!“
„Aaauuu“, schreie ich, als ich den bohrenden Schmerz spüre. Erschrocken lässt er mich los und blickt irritiert auf meine Verletzung. Er stößt geräuschvoll die Luft aus.
„Ich dachte, es wären nur oberflächliche Verletzungen. Bitte vergib mir meine Ignoranz.“
Die Wut und Anspannung, die ich die ganze Zeit in seinen Augen gesehen habe, weichen Mitgefühl und Wärme. Er überlegt kurz, dann zieht er plötzlich ein Messer aus seinem Stiefel und zerschneidet meine Strickjacke in breite Streifen. Ich bin versucht zu protestieren, aber im Grunde weiß ich, was er vorhat.
„Du hast viel Blut verloren“, sagt er in einem milden Tonfall, da packt er den rechten Ärmel meiner Bluse und reißt ihn mit einem Ruck runter.
„Was –“, setze ich an, aber bevor ich weitersprechen kann, höre ich ein weiteres Ratsch, und der andere Ärmel ist ebenfalls abgerissen. Mit ein paar geschickten Handgriffen legt er mir aus den Stofffetzen einen Notverband an. „Du musst dringend in ein Koraláss!“, murmelt er leise.
„Ein was?“
„Ein – wie heißt das in deiner Sprache? Der Ort, wo Menschen Heilung erfahren?“
„Ein Krankenhaus?“
„Ja, ein Krankenhaus“, sagt der Fremde und schaut mich entschuldigend an. „Die Wunde muss gereinigt und genäht werden. Meinst du, dass du fahren kannst?“
Ich nicke benommen. Autofahren – sitzen – ja, das werde ich hinbekommen.
„Kannst du aufstehen?“, fragt er und zum ersten Mal sehe ich so etwas wie echte Besorgnis in seinen Augen.
„Ich denke schon“, antworte ich und will meine Beine anwinkeln, aber sie gehorchen mir nicht. Sie sind in den letzten Minuten eingeschlafen.
„Ich brauche einen Augenblick, meine Beine wollen nicht“, sage ich und versuche, so etwas wie ein entschuldigendes Lächeln hinzubekommen, bringe aber nur eine Grimasse zustande.
Er fährt sich nachdenklich durch die Haare, dann streckt er seine Arme nach mir aus. „Halte dich an mir fest.“ Ich umklammere mit meinem gesunden Arm seinen Hals, während er seine Hände um meine Taille legt und mich vorsichtig hochzieht. Es fühlt sich an wie tausend kleine Nadelstiche, als das Blut wieder in meinen Beinen zu zirkulieren beginnt, aber aus eigener Kraft stehen funktioniert nicht, da sie sofort wieder wegknicken. Sein Griff um meine Taille wird sofort fester und ich werde gegen seine Brust gepresst. Die Schmerzen, die in diesem Augenblick durch meine Schulter jagen, sind so höllisch, dass ich laut aufschreie. Ich spüre deutlich, wie warmes Blut langsam meine Bluse tränkt. Habe ich wirklich gesagt, ich könne fahren? Welcher Teufel hat mich da nur geritten?
Verkrampft halte ich mich an diesem seltsamen Mann fest und kämpfe gegen die Tränen, die sich langsam einen Weg in meine Augen bahnen. Aber ich will aus irgendeinem Grund vor ihm nicht ganz so jämmerlich wirken und beiße die Zähne zusammen.
„Ich nehme an, das dort ist dein Gefährt?“, sagt er plötzlich und deutet auf etwas hinter mir.
„J-ja, das ist meiner“, stammele ich unbeholfen und blicke zu dem kleinen Auto, das einsam und verlassen auf diesem Parkdeck auf mich wartet. Da verliere ich plötzlich den Boden unter den Füßen. Er hat mich auf die Arme gehoben und trägt mich zu meinem Wagen. Behutsam stellt er mich wieder auf die Beine und schaut besorgt an mir herunter. „Kannst du stehen?“, fragt er stirnrunzelnd, als er langsam meine Taille loslässt. Sehr langsam, falls ich doch wieder umkippen sollte. Aber ich bleibe wacklig stehen.
„Danke“, flüstere ich und lehne mich an meinen Wagen. Das Pochen in der Schulter wird immer schlimmer.
„Es wäre vielleicht besser, wir rufen nach einem … Krankenwagen. Du kannst dieses Gefährt in deinem Zustand nicht mehr fahren. Hast du eines dieser mobilen Telefone?“, fragt er und blickt besorgt auf meine Schulter.
„Ja, habe ich, aber ich will keinen Krankenwagen!“, sage ich entschlossen.
Er schaut mich fragend an und ich deute mit meinem Kopf auf die toten Körper.
„Ich habe keine Ahnung, wie ich das erklären soll.“
„Um die musst du dich nicht sorgen, sie werden gleich verschwinden.“
„Was meinst du damit, sie verschwinden?“
„Sie werden wieder zurückgeholt – warte, es geht gleich los, dann wirst du verstehen.“
Er lehnt sich neben mir gegen den Wagen und wir starren eine Weile auf die Leichen, aber es passiert gar nichts.
„Also, ich weiß nicht …“, sage ich skeptisch, da flimmert plötzlich die Luft wie an heißen Sommertagen. Ein mattes Leuchten erscheint aus dem Inneren der Körper und beginnt sie komplett zu umhüllen. Ein Rauschen ist zu hören, das in einem leisen Plopp endet – wie ein Vakuum, das wieder mit Luft gefüllt wird. Dann tritt Stille ein.
Völlig perplex starre ich auf die Stelle, wo die Leiber gerade noch gelegen haben, aber da ist nichts mehr – nicht mal mehr ein Blutfleck ist zu sehen.
„Das ist ja unheimlich! Wo sind sie hin?“, frage ich ungläubig.
„Sie sind zurückgeholt worden“, antwortet der Fremde.
„Wohin zurückgeholt? Wo sind sie denn überhaupt hergekommen? Und wer bist du?“
Er dreht sich zu mir und schaut mich mit einem sonderbaren Blick an. „Du solltest über all das hier mit niemandem sprechen. Was deine Wunde angeht … sag, du bist von einem Hund angefallen worden.“
„Von einem Hund? Ich sehe eher aus …“
Plötzlich hören wir Stimmen auf einem der oberen Parkdecks und mein Retter blickt sich nervös um. „Es wird Zeit für mich zu gehen. Wo sind die Schlüssel deines Gefährts?“
Verwirrt deute ich auf meine Handtasche, die noch an der Betonwand liegt, gegen die ich geprallt bin. Er hebt sie auf und holt die Schlüssel heraus, dann schließt er meinen Wagen auf. In meinem Kopf sprudeln die Fragen fast über, aber mir ist auch schwindelig und ich will mich nur noch hinsetzen. Vorsichtig hilft er mir auf den Fahrersitz. Bei jeder Bewegung habe ich das Gefühl, von Pfeilen durchbohrt zu werden.
„Kann ich dich wirklich so fahren lassen?“, fragt er mit gerunzelter Stirn, als er mir die Schlüssel hinhält.
„Ja, ich schaffe das“, antworte ich und bekomme sogar irgendwie ein krampfhaftes Lächeln zustande.
Er bedenkt mich mit einem seltsamen langen Blick, bevor er mir zunickt und leise weiterspricht: „Ich würde dich gerne selbst in ein Koraláss bringen, aber aus … nun ja, gewissen Gründen ist es besser, wenn ich mit den hiesigen Behörden nicht in Kontakt komme.“
Ich nicke nur stumm.
„Gut! Bitte fahr vorsichtig“, sagt er mit einem so fürsorglichen Lächeln, dass ich erröte. Mit einem leisen Seufzer dreht er sich um und läuft zu seiner Harley. Er schwingt sein Bein darüber und dreht sich noch mal zu mir um. Sein Blick ist eindringlich und auch in seinen Augen stehen Fragen, aber dann gibt er nur noch wortlos Gas und verschwindet innerhalb von Sekunden aus meinem Blickfeld.
Ich blicke auf die Stelle, an der er gerade noch gestanden hat, dann schließe ich meine Augen und lehne mich in meinem Auto zurück.
Alles beginnt sich zu drehen.
Die Fahrertür meines Fiats steht noch offen – ich lehne mich raus und übergebe mich.
4
Die Sonne blendet, als ich meine bleischweren Augenlider öffne. Mein Schädel brummt wie nach einer durchzechten Nacht. Ich reibe mir die schmerzenden Schläfen und versuche mich zu orientieren. Es ist ein heller Raum, mit weißen Gardinen und einem Monet-Druck an der Wand. Ich erkenne einen Infusionsschlauch, der irgendwo in meinem Handgelenk endet. Ich will mich aufrichten, aber ein stechender Schmerz schießt durch meine Schulter und ich sacke zurück ins Kissen. Mein Hals ist trocken und ich habe einen bitteren Geschmack im Mund. Vorsichtig drehe ich meinen Kopf und blicke mich in meinem Krankenzimmer um. Links von mir steht ein leeres Bett, rechts, auf einem Nachttisch, eine Flasche Wasser und frische Blumen. Unter nicht unerheblichen Schmerzen gieße ich mir ein Glas ein und betrachte stirnrunzelnd die Blumen. Wie lange ich wohl schon hier bin?
Meine Gedanken beginnen zu kreisen und die Erinnerung kommt stückweise zurück.
Ich erinnere mich an das ältere Pärchen, das mich im Wagen fand und den Notdienst alarmierte. Keine zwanzig Minuten später lag ich bereits auf einem dieser fahrbaren Betten und wurde in einen OP geschoben. Ich faselte noch etwas von einem Hundeangriff, da verpasste mir bereits jemand eine Spritze und ich fiel augenblicklich in einen ruhigen und schmerzlosen Schlaf.
Irgendwie versuche ich das Erlebte zu begreifen und lasse alles noch mal Revue passieren. Es begann mit einem harmlosen Essen und endete in einem Albtraum! Grauenvolle Bestien mit gelben Augen haben mich angegriffen – aber solche Tiere gibt es nicht! Im Amazonasgebiet vermutet man noch unentdeckte Tierarten, ebenso in den Tiefen der Ozeane, aber ich lebe in einem der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt. Wo sind sie so plötzlich hergekommen? Irgendjemandem hätte ihr Auftauchen doch auffallen müssen?
Außerdem löst sich nichts einfach in einem Licht auf. Das widerspricht allen gängigen physikalischen Gesetzen!
Und wer war mein seltsamer Retter? Auf den ersten Blick wirkte er menschlich, aber auf den zweiten Blick konnte er auch sonst was sein. Ich schließe die Augen, um mir sein Gesicht nochmals ins Gedächtnis zu rufen. In meinem Leben habe ich schon einige schöne Männer gesehen, aber ich bin noch nie jemandem begegnet, der eine fast überirdische Ausstrahlung hat.
In meinem Kopf sprudeln die Fragen fast über, und keine Antworten zu erhalten, ist sehr frustrierend.
Die Tür geht auf und eine rundliche Schwester, um die fünfzig, kommt herein. Überrascht schaut sie mich über ihren Brillenrand hinweg an. „Guten Morgen, Frau Horvath“, sagt sie freundlich und tritt an mein Bett.
„Guten Morgen“, antworte ich heiser und will mich aufsetzen. Vorsichtig, aber bestimmt drückt sie mich wieder ins Kissen zurück. „Sie haben schwere Verletzungen erlitten, also bleiben Sie bitte liegen. Dr. Wacek, Ihr behandelnder Arzt, wird im Laufe des Vormittags noch nach Ihnen sehen. Ich bin übrigens Schwester Claudia“, sagt sie lächelnd und schiebt meinen Ärmel hoch, um meinen Blutdruck zu messen.
„Wie lange liege ich hier schon, Schwester Claudia?“
Sie schiebt mir den Ärmel wieder herunter. „Heute ist Montag, also seit drei Tagen. Sie haben ziemlich starke Schmerz- und Beruhigungsmittel verabreicht bekommen, somit werden Sie in den nächsten Tagen auch noch viel schlafen.“
„Verstehe“, murmele ich. „Von wem sind die Blumen?“
„Von Ihrer Mutter.“
„Meiner Mutter? Wie hat sie davon erfahren?“
„Wir haben Ihren Ausweis in Ihrer Handtasche gefunden und die Polizei informiert. Die wiederum hat sie dann benachrichtigt.“
Polizei? Verdammt! Das ist nicht gut. Keine Ahnung, was ich denen erzählen soll!
Am liebsten würde ich mir die Decke über den Kopf ziehen.
Schwester Claudia wechselt die Infusionsflasche aus. „Das ist Kochsalzlösung“, erklärt sie mir, als sie meinen fragenden Blick sieht. „Sie haben viel Blut verloren. Durch einen so hohen Flüssigkeitsverlust kann der Kreislauf versagen. Wir wollten Ihnen Blutkonserven verabreichen, konnten aber die Gruppe nicht bestimmen?!“ Sie schaut mich fragend an. „Sie haben sehr ungewöhnliches Blut, junge Dame!“
„Ach ja?“ Ich zucke nur mit den Achseln.
Stirnrunzelnd beendet sie ihre Arbeit. „Die Beamten werden noch einmal im Laufe des Tages vorbeikommen, um Sie zu diesem Hundeangriff zu befragen“, sagt sie. „Ruhen Sie sich schön aus. Wenn Sie etwas benötigen, klingeln Sie einfach. Der Knopf befindet sich links neben Ihrem Bett.“ Sie nickt mir zu und verlässt geschäftig mein Zimmer.
Nun, da ich wieder alleine bin, muss ich an Liliana, meine Mutter, denken. Als ich geboren wurde, war sie selbst noch fast ein Kind; so kommt es, dass ich eine junge Mutter von gerade mal siebenunddreißig Jahren habe. Von meinem Vater weiß ich bis auf seinen Namen – Hakon – nichts. Er war noch vor meiner Geburt gestorben.
Das energische Klackern von spitzen Absätzen ist auf dem Gang zu hören.
Der kleine General ist unterwegs, denke ich grinsend.
Diesen Titel hat sie Ramona zu verdanken, die es immer sehr amüsant findet, wenn meine Mutter mich in einem manchmal höchst militärischen Tonfall durch die Gegend scheucht.
Die Tür wird schwungvoll geöffnet und ein apartes, schlankes Persönchen mit kurzen blonden Haaren stürmt herein. Sie trägt ein schickes Twin-Set aus altrosafarbener Seide mit dazu passenden hochhackigen Pumps. Sie sieht einfach hinreißend aus. Im Gegensatz zu mir legt Liliana stets großen Wert auf schicke Garderobe. Von uns beiden ist eindeutig sie das Modepüppchen.
Den Pappbecher in der Hand, bleibt sie für einen Augenblick wie angewurzelt im Türrahmen stehen, stöckelt dann aber mit kleinen Trippelschritten zu meinem Bett rüber.
„Angyalom“, begrüßt sie mich auf Ungarisch, was übersetzt mein Engel heißt. Sie stellt ihren Kaffee auf dem Nachttisch ab, nimmt vorsichtig mein Gesicht in ihre Hände und küsst mich auf den Mund.
„Ich bin fast gestorben vor Sorge“, sagt sie mit ihrem niedlichen Akzent, wobei sie das R immer so herrlich rollt. „Was ist bloß passiert, Liebes? Die Ärzte haben gesagt, ein Hund hätte dich angefallen, aber die Wunden würden eher nach Spuren eines Kampfes mit einem Bären aussehen.“
„Es ist auch schön, dich zu sehen, Mama“, sage ich grinsend.
Liliana entspricht dem typischen Klischee einer Ungarin: wild, temperamentvoll und leidenschaftlich. Gute Laune und eine positive Lebenseinstellung scheint sie dauerhaft gepachtet zu haben. Aber jetzt sehe ich zum ersten Mal tiefe Besorgnis in ihren Augen. Stirnrunzelnd betrachtet sie zuerst meine Schulter und dann – sehr eindringlich – mich.
Oje, wenn der kleine General so guckt, sollte ich auf der Hut sein! Ich rutsche etwas tiefer unter die Decke. Was soll ich ihr erzählen? Die Wahrheit? Die würde sie mir eh nicht glauben. Niemand würde mir glauben. Soll ich sie anlügen? Sie ist meine Mutter, sie erkennt sofort, wenn ich lüge.
„Junge Dame“, sagt sie mit hochgezogener Augenbraue, „ich erwarte, dass du mir alles erzählst, und zwar wirklich alles! Die Wahrheit, nicht dieses Märchen, das du den Ärzten aufgetischt hast.“
Kann diese Frau Gedanken lesen?
„Mama, ich weiß selbst nicht genau, was ich da eigentlich erlebt habe.“
„Wie meinst du das, Angyalom?“
„Die Erinnerung ist zwar da, aber es kommt mir so unwirklich vor – wie ein böser Traum.“
Dass ich meiner Mutter nichts vormachen kann, ist mir bewusst, aber wie soll ich ihr eine so abstruse Geschichte erklären?
Ihr Gesichtsausdruck wird ernst und eine kleine Falte bildet sich auf ihrer sonst so makellosen Stirn. „Versuch es doch einfach. Erzähl deiner Mamicska, was passiert ist – und nichts auslassen, verstanden?“ Sie lächelt mir aufmunternd zu und zieht sich einen Stuhl heran.
Ich beginne vom Abendessen im Restaurant zu berichten. Liliana hört mir geduldig zu und lächelt, als ich Ramonas Namen erwähne. Doch dann komme ich an die Stelle, wo mir eine der Bestien ihre Klaue in meine Schulter rammt. Ihre Augen weiten sich vor Entsetzen und sie murmelt etwas auf Ungarisch. Ich beende meine Geschichte und es tritt eine merkwürdige Stille ein. Sie mustert mich mit einem eigenartigen Gesichtsausdruck. Überlegt sie, ob sie mich einweisen lassen soll? Oder folgt gleich ein Vortrag darüber, dass Kinder ihre Eltern nicht anflunkern dürfen?
„Mama, ich weiß, es klingt verrückt, aber genau so ist es passiert“, sage ich nachdrücklich.
Ihr Gesichtsausdruck verändert sich nicht, da beugt sie sich vor und gibt mir einen Kuss auf die Stirn.
„Mama?“
„Dann sollten wir Gott danken, dass du noch am Leben bist, Angyalom.“
Ihre Stimme ist seltsam belegt und eine kleine Träne bahnt sich ihren Weg über ihr hübsches Gesicht, die sie sich verstohlen wegwischt. Sie weint sonst nie.
„Du glaubst mir?“, frage ich ungläubig. „Einfach so?“
„Du bist meine Tochter und ich vertraue dir.“ Ihr Blick ist unergründlich. Kein Anzeichen von Zweifel. „Anja, die Polizei wird heute noch vorbeikommen und wir sollten uns überlegen, was du sagen wirst. Mit der Wahrheit sollten wir vorsichtig sein.“
„Polizei … die habe ich ganz vergessen“, flüstere ich und atme geräuschvoll aus.
„Bleib bei der Geschichte mit den Hunden, alles andere wäre zu … fantastisch.“
„Du weißt, ich kann nicht gut lügen. Die werden mir kein Wort glauben, Mama.“
„Das könnte passieren, aber was sollen sie machen? Du bist das Opfer! Selbst wenn sie deine Geschichte anzweifeln, müssen sie deine Aussage so hinnehmen.“
„Du hast wohl recht“, antworte ich leise.
„Natürlich, mein Schatz, Mamas haben immer recht!“ Sie streicht liebevoll über meine Wange. „Ich fahre jetzt kurz nach Hause, bin aber heute Nachmittag wieder da. Ich werde ein paar Zeitungen mitbringen und dann schauen wir mal, ob über den Angriff oder über sonstige seltsame Vorkommnisse etwas berichtet wurde.“
Nachdem sie gegangen ist, komme ich ins Grübeln. Irgendetwas sehr Seltsames geht hier vor. Liliana ist eine bodenständige Frau, die nicht viel von Fantastereien hält. Es wundert mich daher, wie schnell sie mir glaubte. Sie hat meine Geschichte noch nicht mal für eine Sekunde angezweifelt oder hinterfragt, beinahe so, als ob sie etwas Derartiges schon erwartet hätte.
Es wird immer merkwürdiger.
Es ist Nachmittag und Liliana hat die Zeitungen mitgebracht. Der Überfall wird nicht mit einer Silbe erwähnt, auch sonst steht nichts Außergewöhnliches drin. Keine Berichte über seltsame Sichtungen, noch nicht einmal in der Boulevardpresse. Es ist unheimlich, als hätte es diese Bestien nie gegeben und dieser Vorfall niemals stattgefunden. Nur der stechende Schmerz in meiner Schulter ist Beweis dafür, dass ich es mir nicht eingebildet habe.
Kurz nach ihrem Eintreffen erscheinen auch zwei Polizisten. Sie sind sehr höflich und rücksichtsvoll, aber man sieht ihnen an, dass sie meinen stotternden Ausführungen keinen Glauben schenken. Hilfesuchend schiele ich zu Liliana, die im Hintergrund steht, aber auch sie zieht nur ratlos die Schultern hoch. Als die beiden Beamten endlich weg sind, fühle ich mich noch elender.
5
Dienstag.
Ramona besucht mich. Sie hat einen Blumenstrauß und einen überdimensionalen Teddybären auf dem Arm.
„Süße, was um alles in der Welt ist nur passiert?“, fragt sie mit kreisrunden Augen und setzt sich neben mein Bett. „Liliana erwähnte etwas von einem Hundeangriff? Mir ist vor Schreck fast der Telefonhörer aus der Hand gefallen.“
„Ja, möchte man nicht glauben, gell? Und das mitten in der Innenstadt“, antworte ich und betrachte belustigt ihren entsetzten Gesichtsausdruck.
„Das ist wirklich passiert, nachdem wir uns verabschiedet hatten?“, fragt sie und umklammert den Stoffbären.
„Ja, nur zwanzig Minuten später.“
„Himmel, du musst mir alles erzählen, jede Einzelheit! … Isst du das noch?“, fragt sie unvermittelt und deutet auf den Pudding, der von meinem Mittagessen übrig ist. Grinsend schiebe ich ihr den Becher zu.
„Wenn ich nervös bin, muss ich was Süßes essen“, murmelt sie entschuldigend.
„Schon klar“, erwidere ich, so ernst es mir in diesem Augenblick möglich ist, und betrachte meine beste Freundin etwas genauer. Sie trägt einen kurzen lila Minirock und einen knatschgelben bauchnabelfreien Rolli. Ihre schlanken Beine stecken in hohen Overknee-Stiefeln mit Absätzen, in denen ich gewiss nicht laufen könnte. Meine sonst so stilsichere Freundin hat sich wohl etwas im Schrank vergriffen.
„Hast du deine Pläne geändert? Willst du dein Glück neuerdings an der Stange versuchen?“, frage ich und werfe schmunzelnd einen Blick auf ihr neuestes Outfit.
„Noch so’n Spruch – Kieferbruch!“, schnaubt sie, „du kannst von Glück reden, dass du in einem Krankenbett liegst.“
Es tut weh, wenn ich lache, und ich halte meine Hand auf den Verband.
Sie stupst mich an und löffelt meinen Pudding weiter.
„Nun erzähl schon, was ist am Freitag passiert? Und lass ja nichts aus!“
Die Wahrheit kann ich wohl kaum erzählen, also erfinde ich eine etwas harmlosere, glaubwürdigere Version von einem aggressiven streunenden Hund. Aber selbst die ist für Ramona schon schlimm genug. Sie hört irgendwann sogar auf zu essen.
„Oh mein Gott, ich glaube, ich wäre vor lauter Angst gestorben“, flüstert sie kreidebleich und schaut mich wie ein gebanntes Kaninchen an. Würde jetzt jemand hinter ihr die Tür zuschlagen, dann würde sie wohl ohnmächtig vom Stuhl fallen.
„Heilige Scheiße, wie bist du da nur heil … ähm … halbwegs heil wieder rausgekommen?“ Voller Ehrfurcht schielt sie auf meinen dicken Verband.
„Ein Mann auf einer Harley hat mich unter Einsatz seines Lebens gerettet.“
Peng – oje!
Ich sehe das Funkeln in Ramonas Augen. „Wie sah er aus? Hast du seinen Namen? War er groß? Größer als Kevin?“, beginnt sie mich zu löchern.
Ich verdrehe die Augen, aber das übersieht sie geflissentlich.
„Moni, ich war schwer verletzt! Ich hatte in diesem Augenblick wirklich andere Sorgen."
„Dann beschreibe ihn mir doch wenigstens … bitttteee!“
Aus der Nummer komme ich nicht mehr raus, also erzähle ich weiter, verschweige aber die spitzen Ohren und die Zähne an seinem Gürtel. Sie starrt mich mit kreisrunden Augen an und ihre Sommersprossen beginnen regelrecht zu glühen. Das ist ein Ende genau nach Ramonas Geschmack!
„Und wie heißt er?“
Ich hebe entschuldigend meine Schultern.
„Du weißt nicht, wie er heißt? Aber du hast ihm doch deine Telefonnummer gegeben? Ich meine, es könnte ja sein, dass er sich nach dir erkundigen will“, sagt sie und versucht es beiläufig klingen zu lassen. „Hat er dir seine Nummer gegeben?“
„Nein, hat er nicht und meine hat er auch nicht.“
„Aahh!“ Sie hebt ihre Hände theatralisch in die Höhe und schaut mich fassungslos an. „Jetzt pass gut auf und lies es mir von den Lippen ab: Wenn ein junger Gott dir das Leben rettet, dann fragst du gefälligst nach seiner Telefonnummer!“
„Ich habe nie behauptet, dass er wie ein junger Gott aussieht.“
„Ach, halt die Klappe!“, zischt sie. „Hast du denn gar nichts von mir gelernt?“
„Hm“, überlege ich laut, „meinst du vielleicht die Lektion, wie ich mich schneller abschleppen lasse? Oder wie ich einen Knutschfleck – den ich übrigens noch nie hatte – am besten abdecke?“
Ramona stemmt wütend ihre zierlichen Hände in die Taille, als ich sie frech angrinse. „Nun mach mal ’n Punkt!“, fährt sie mich an. „Ich habe dir auch schon sehr viele wertvolle Ratschläge gegeben. Und, Schätzelein, du musst ja wohl zugeben, dass deine Erfahrung in punkto Männer bisher noch sehr unterentwickelt ist.“
Wo sie recht hat, hat sie recht. Allein die Tatsache, dass ich noch nie einen Knutschfleck hatte, spricht für sich.
„Ich gelobe Besserung, Meister Yoda“, säusele ich mit Unschuldsmiene. Das verfehlt nie seine Wirkung. Es zuckt bereits um ihre Mundwinkel.
6
Zwei Wochen später.
Meine Entlassungspapiere habe ich unterschrieben. Zwar war Dr. Wacek, mein behandelnder Arzt, gar nicht begeistert und versuchte mehrere Male, mir ins Gewissen zu reden. Doch er musste zugeben, dass er noch nie in seiner langjährigen Berufspraxis einen so schnellen Heilungsprozess erlebt hat. Normalerweise müsste ich noch mindestens einen Monat im Krankenhaus bleiben und anschließend zur Reha, aber meine Schulter ist auf dem besten Weg der Genesung.
Mein Taxi wartet bereits unten.
Liliana und ich wohnen nicht unmittelbar in Köln, sondern etwas ländlicher, wo das Bergische Land beginnt. Unser kleines Haus liegt am Rand eines Walds und ist nur über einen ungesicherten Feldweg zu erreichen. Wir wohnen so versteckt, dass Besucher, die das erste Mal zu uns kommen, sich häufig hoffnungslos verfahren. Unser kleines Domizil war ursprünglich ein altes Bauernhaus aus dem neunzehnten Jahrhundert, das dann in den Sechzigern aufgestockt und in den Achtzigern von Grund auf saniert wurde. Nur am alten Gewölbekeller kann man noch sein ursprüngliches Alter erkennen.
Als das Taxi in den Feldweg einbiegt, macht mein Herz einen Sprung. Endlich wieder zu Hause! Liliana sieht mich bereits aus dem Küchenfenster und läuft mir strahlend entgegen. „Angyalom, da bist du ja endlich!“ Sie umarmt mich vorsichtig, um meine Schulter zu schonen. Dann schiebt sie mich etwas von sich weg und betrachtet mich genauer.
„Du bist dir sicher mit der frühzeitigen Entlassung?“, fragt sie stirnrunzelnd.
„Absolut sicher! Ich hätte es da keine Minute länger ausgehalten.“
Lächelnd nimmt sie mir die kleine Reisetasche ab und verschwindet im Haus, während ich das Taxi bezahle.
Aber ich will noch nicht rein. Zwei Wochen Krankenhaus reichen! Ich schließe meine Augen und sauge tief die klare Waldluft ein. Home, sweet home, denke ich lächelnd.
Es ist kühl und der Himmel wolkenverhangen. Fröstelnd reibe ich mir die Oberarme und fahre dabei auch vorsichtig über meine Schulter. Es tut nur noch wenig weh, hauptsächlich wenn ich eine ruckartige Bewegung mache. Irgendwo muhen ein paar Kühe. Langsam drehe ich meinen Kopf und betrachte glücklich die Umgebung, die mir so vertraut ist. Die große Wiese von Bauer Rossner, die Felder, die sich in sanften Hügeln über mehrere Kilometer erstrecken. In der Ferne ist die Pferdekoppel von Familie Burkhardt zu erkennen, wo die kleine Natalie oft auf ihrem Pony reitet. Ich blicke zum Wald rüber. Die Laubbäume bekommen langsam wieder ein grünes Kleid.
Ich beschließe, am nächsten Tag einen ausgedehnten Spaziergang durch den Wald zu machen, da ich aufgrund meiner Verletzung noch nicht joggen darf. Gerade als ich mich umdrehen und Liliana folgen will, sehe ich im dunklen Unterholz etwas, das dort eindeutig nicht hingehört.
Gelbe Augen!
Ein spitzer Schrei entfährt mir, ich stolpere rückwärts und falle fast über einen Blumenkübel. Benommen schaue ich wieder zum Wald hinüber, aber dort ist nichts – oder nicht mehr. Nur Bäume, Büsche und Dunkelheit, dort wo der Wald fast zugewachsen ist. Jedes Härchen auf meinem Oberarm hat sich aufgerichtet und ich vergesse fast zu atmen. Etwas berührt meine Hand und ich schreie wieder auf.
„Meine Güte, ich bin es doch nur“, sagt Liliana kopfschüttelnd.
„Mama, schau dorthin, siehst du was?“
Verwundert blickt sie in die Richtung, in die ich deute. „Bäume, Blätter und … oooohhhh.“
„Was!“, rufe ich fast hysterisch.
„Ein Eichhörnchen!“ Sie schnalzt mit der Zunge. „Also das ist in der Tat ungewöhnlich.“ Mit einem breiten Grinsen dreht sie sich wieder zu mir.
„Vergackeiern kann ich mich selber, Mama. Ich habe gelbe Augen gesehen! Ich schwöre es dir.“
Lilianas Gesicht verfinstert sich und sie blickt wieder zum Wald, aber nach einer Weile dreht sie sich zu mir und legt ihren Kopf schief. In ihrem Blick liegt so viel Mitgefühl. Sie nimmt mich wortlos in den Arm und drückt mich sanft.
„Denkst du, ich habe mir das gerade nur eingebildet?“, frage ich gequält.
„Einbilden ist das falsche Wort“, sagt sie nachdenklich. „Angyalom, was du erlebt hast, war traumatisch! Dein Gehirn wird dir möglicherweise noch in nächster Zeit hinter Bäumen oder Sträuchern Monster vorgaukeln. Lass dir Zeit und versuche an schöne Dinge zu denken.“
Wahrscheinlich hat sie recht. Ich versuche zu lächeln, aber das dumpfe Gefühl bleibt.
7
Zum Abendessen haben wir uns eine große Schüssel Spaghetti gemacht und sitzen schmatzend vor dem Fernseher. Normalerweise legt Liliana Wert darauf, Mahlzeiten ordentlich am Esstisch einzunehmen, aber heute Abend läuft im Fernsehen Notting Hill, die ich weiß nicht wievielte Wiederholung. Sie bekommt einfach nie genug davon. Ich wiederum bin einfach nur glücklich, wieder zu Hause zu sein.
Als der Film zu Ende ist, steht Liliana gähnend auf und gibt mir im Vorbeigehen einen Kuss auf meinen Hinterkopf. Dann steigt sie mit schlurfenden Schritten die Treppe hinauf. Eine Weile zappe ich noch durch das Fernsehprogramm, nur um festzustellen, dass bei so vielen Kanälen doch nichts Vernünftiges läuft. Die Holzscheite im Kaminofen sind komplett runtergebrannt, es wird also bald kalt werden. Ich schalte den Fernseher und alle Lichter aus, dann folge ich Liliana nach oben.
Endlich wieder im eigenen Bett schlafen!
Mein Kopf ist noch nicht ganz in der waagerechten Haltung, da bin ich schon weggetreten.
Ein erdbebenartiges Rütteln weckt mich mitten in der Nacht.
„Anja, wach auf“, flüstert Liliana aufgeregt und rüttelt heftig an meinem Arm.
„Was ist denn?“, murmele ich müde.
„Sscht! Steh auf, aber sei leise“, befiehlt sie mir in einem Ton, der keinen Widerspruch duldet. Sie hat sich in ihren Bademantel gewickelt und umklammert den Schürhaken.
„Meine Güte, was ist denn los, Mama?“, frage ich erstaunt und schiebe schlaftrunken meine Beine über den Bettrand.
„Irgendjemand schleicht um unser Haus herum! Ich habe die Polizei bereits angerufen, aber die haben keinen Streifenwagen in der Nähe.“
Der Feldweg ist schon bei Tageslicht schnell zu übersehen. Es kann also ein wenig dauern, bis sie hier sind.
Sie deutet mit einer Kopfbewegung an, ihr zu folgen, aber ich halte sie am Ärmel fest. „Was hast du denn vor? Meinst du nicht, wir sollten lieber auf die Polizei warten?“
Ungehalten dreht sie sich um. „Ich werde auf keinen Fall kampflos hier herumsitzen und zuschauen, wie unser Hab und Gut gestohlen wird. Wir haben keine Versicherung und du weißt, dass es uns finanziell nicht sehr berauschend geht.“
„Meine Güte, willst du für das bisschen Zeug dein Leben aufs Spiel setzen?“
„Also unseren Plasmafernseher kriegen die kleinen Scheißer auf keinen Fall! Die letzte Rate habe ich erst vor zwei Monaten bezahlt!“ Sie funkelt mich an und umklammert den Schürhaken noch fester. Dann dreht sie sich um und schleicht weiter Richtung Treppe.
Trotz der beängstigenden Situation muss ich schmunzeln und mir tun die Einbrecher fast ein wenig leid. Niemand mit gesundem Menschenverstand legt sich mit dem kleinen General an. Aber dann fallen mir wieder die gelben Augen ein und ich frage mich, ob ich an diesem Freitagabend möglicherweise nicht nur zur falschen Zeit am falschen Ort war. Dies würde doch dann bedeuten, dass sie ganz gezielt hinter mir her waren?! Aber warum sollten irgendwelche Monster aus der Hölle hinter einem Niemand wie mir her sein? Schlichtweg absurd!
An der Treppe bleiben wir stehen und blicken in die untere Etage, wo ich schemenhaft die Umrisse unserer Möbel erkenne. Vorsichtig, darauf achtend, das Knirschen der Treppe nicht allzu sehr herauszufordern, laufen wir hinunter. Liliana bedeutet mir, zu warten, während sie langsam in die Küche schleicht. Kopfschüttelnd schaue ich ihr hinterher und empfinde unser Verhalten in diesem Augenblick als reichlich überspannt. Das Wohnzimmerfenster ist nur wenige Schritte entfernt. Ich gehe rüber und schiebe vorsichtig den dicken Vorhang zur Seite. Die Wolkendecke ist aufgerissen und man hat einen recht guten Blick auf die Terrasse. Unsere alte Hollywoodschaukel, die langsam im Wind wippt, die Blumentöpfe, die Liliana bei den ersten Sonnenstrahlen rausgestellt hat. Bei Vollmond kann man sogar bis zu der Pferdekoppel der Burkhardts schauen.
„Anja, geh sofort vom Fenster weg!“, zischt Liliana wütend, als sie durch die Verbindungstür der Küche kommt.
„Also, Mama, ich finde das albern. Schau dir doch unser Häuschen an, hier gibt es nichts zu holen. Einbrecher nehmen in der Regel Villen ins Visier. Keiner würde sich die Mühe machen, hier einzubrechen.“
„Ich habe doch keine Halluzinationen. Als ich gerade im Bad war, habe ich aus dem Fenster mindestens zwei Gestalten unten in den Büschen herumschleichen sehen“, sagt sie wütend. „Vielleicht sind es auch nur Landstreicher, aber ich will kein Risiko eingehen.“
„Diebe sind keine potenziellen Gewaltverbrecher. Wir sollten kurz die Lichter anmachen, dann sehen sie, dass die Bewohner zuhause sind, und verschwinden wieder“, erwidere ich beschwichtigend.
„Und was ist, wenn du dich irrst? Wir haben keine Nachbarn. Im Grunde genommen sitzen wir hier wie auf einem Präsentierteller. Warte, ich prüfe schnell, ob die Hintertür verschlossen ist“, sagt sie und verschwindet mit wenigen Schritten.
„Als ob ich gegen eine Wand rede …“, murmele ich vor mich hin.
„Das habe ich gehört, junge Dame!“, zischt es leise aus der Dunkelheit.
Ernsthaft jetzt? Das hat sie gehört?
Die Wolkendecke hat sich wieder zugezogen und es ist stockfinster draußen. Mir schießt durch den Kopf, dass ich vielleicht das Licht auf der Veranda einschalten sollte, damit die Polizeibeamten leichter den Weg finden. Ein lautes Poltern im Hintergrund ist zu hören, gefolgt von einigen sehr unschönen ungarischen Flüchen.
„Alles okay bei dir?“, rufe ich nach hinten.
„Morgen räumen wir als Erstes diesen blöden Flur auf! Hier bricht sich noch jemand das Genick“, antwortet sie schimpfend.
Grinsend drehe ich mich wieder zum Fenster – und blicke direkt in ein wütendes gelbes Augenpaar, das mich durch die Scheibe fixiert!
Mit einem entsetzten Aufschrei stolpere ich zurück und falle über den Sessel, in dem ich mich vor Kurzem noch gefläzt habe. Mit schmerzverzerrtem Gesicht taste ich nach meiner Schulter, die nach dem Aufprall wieder pocht, als mit einem ohrenbetäubenden Krachen das Fenster zu Bruch geht und ein mächtiger grauer Körper in den Raum springt. Der Vorhang hat sich in seiner Klaue verfangen und er reißt ihn samt Schiene aus der Wand und schleudert ihn quer durch den Raum.
Vorsichtig luge ich über den Rand des umgestürzten Sessels. Dieses Ding hat sich auf seine Hinterbeine gestellt und stößt dabei mit seinem Kopf gegen die Wohnzimmerdecke. Ein tiefes Grollen dringt aus seiner Kehle und mein Herz setzt für einen Moment aus.
Sie sind wieder da! Hier! In unserem Haus!
Es geht auf alle Viere runter und setzt sich langsam in Bewegung. Seine scharfen Krallen zerfetzen den dünnen Teppich und sein wuchtiger Körper stößt alles um, was ihm im Weg ist. Gelähmt vor Angst beobachte ich, wie es sich langsam über den Sessel beugt. Sein hässliches, ledernes Gesicht kommt mir immer näher. Lauf!, schreit eine innere Stimme und ich erwache endlich aus meiner Lethargie. Ich versuche wegzukrabbeln, da stößt es wütend mit seinem Hinterlauf gegen den Sessel, der daraufhin laut polternd gegen ein Regal knallt. Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie sich die Bestie gerade knurrend auf mich stürzen will, als sie plötzlich hart von einem Schürhaken am Kopf getroffen wird. Taumelnd prallt sie gegen eine Glasvitrine.
„Weg hier!“, ruft Liliana. Sie zerrt an meinem Arm und irgendwie komme ich stolpernd auf die Beine. Die Schmerzen in meiner Schulter verdränge ich. Im Hintergrund bricht ein wütendes Geheul los. Als ich einen kurzen Blick zurück riskiere, sehe ich, dass es ein Auge verloren hat und sich vor Schmerzen hin und her wirft.
Wir laufen auf den Gang hinaus und von dort ins Esszimmer, das in der entgegengesetzten Richtung liegt.
„Ich habe aus dem Küchenfenster noch weitere drei draußen gesehen“, erzählt sie mir, als wir keuchend eine alte Truhe vor die Tür schieben.
„Ich fürchte, das wird nicht viel bringen“, sage ich und betrachte zweifelnd unser Werk. Diese Wesen haben enorme Kräfte und Möbel sind wohl kaum ein Hindernis für sie.
„Es soll sie nur etwas aufhalten“, antwortet Liliana. „Wir werden uns unten im Gewölbekeller verbarrikadieren. Die Tür zum Keller besteht aus schwerem Eichenholz, daran dürften diese Teufel etwas zu knabbern haben!“
Sie hat Angst, das spüre ich, aber trotz der Gefahr wirkt sie erstaunlich kontrolliert.
BUMM!
Etwas Schweres hat sich gegen die Esszimmertür geworfen und jedes einzelne Möbelstück in diesem Raum erzittert. Noch höchstens zwei Stöße und sie sind durch.
„Wenn wir uns im Keller verbarrikadieren, gewinnen wir etwas Zeit“, sagt Liliana. „Die Polizei müsste jeden Augenblick hier sein.“
„Aber Polizisten sind doch für solche Monster gar nicht geschult?“
„Anja, sind wir etwa geschult? Niemand auf der ganzen verdammten Welt ist auf solche Teufel geschult, weil es so etwas wie die gar nicht geben darf. Aber Polizisten haben wenigstens Waffen. Ein gezielter Schuss zwischen die Augen und die Biester sind Geschichte!“ Sie fährt sich erschöpft durch die Haare. „Los, komm.“
Es gibt wieder einen lauten Knall und das Holz zersplittert mit einem lauten Krachen. Aus dem Augenwinkel sehe ich noch, wie drei von ihnen über unsere jämmerliche Barrikade springen, als ich mit Liliana im hinteren Teil des Flures verschwinde. Wir hechten die wenigen Meter zur Eichentür, die die Begrenzung zum ursprünglichen, alten Haus ist. Nachdem wir durchgeschlüpft sind, schiebe ich den schweren Riegel vor und folge meiner Mutter die schmale Steintreppe hinunter. Die einzige Lichtquelle im Keller ist eine Glühbirne, die schwach von der Decke leuchtet.
Liliana hat wenigstens ihren Schürhaken, aber ich habe gar nichts. Ich brauche ebenfalls dringend eine Waffe und schaue mich verzweifelt im Keller um. Eine alte Kartoffelkiste ohne Kartoffeln, ein klappriges Regal mit ein paar Einmachgläsern, alte Möbel, die wir hierhin ausgelagert haben … absolut nichts Brauchbares.
Etwas Schweres prallt dumpf gegen die Eichentür und ich bilde mir ein, die Erschütterung selbst im Keller zu spüren.