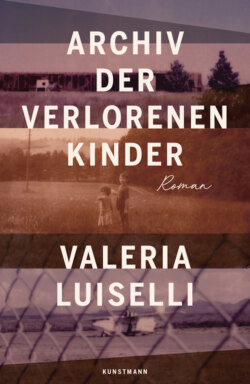Читать книгу Archiv der verlorenen Kinder - Valeria Luiselli - Страница 10
WEGE & WURZELN
ОглавлениеBuscar las raíces no más que una forma
subterránea de andarse por las ramas.
(Die Suche nach den Wurzeln ist nur der latente Versuch, das eigentliche Thema zu umgehen.)
JOSÉ BERGAMÍN
Wenn du dich unterwegs verirrst
Läufst du ins Ungewisse
FRANK STANFORD
SARGASSOSEE
Es ist nach Mittag, als wir schließlich das Aquarium in Baltimore erreichen. Der Junge führt uns durch die Menge direkt zum Hauptbecken, wo die Riesenschildkröte ist. Wir müssen stehen bleiben und zusehen, wie das traurige, schöne Tier pausenlos durch sein Wasserrevier paddelt und dabei an die Seele einer schwangeren Frau erinnert – ruhelos, unpässlich, gefangen in der Zeit. Nach ein paar Minuten fällt dem Mädchen die fehlende Flosse auf:
Wo ist ihr anderer Arm? fragt sie entsetzt ihren Bruder.
Diese Schildkröten brauchen nur eine Flosse, darum haben sie im Lauf der Zeit nur eine entwickelt, und das nennt man Darwinismus, erklärt er.
Wir sind nicht sicher, ob seine Antwort ein Zeichen von plötzlicher Reife ist, die seine Schwester vor der Wahrheit schützen soll, oder ein falsches Verständnis der Evolutionstheorie. Wahrscheinlich Letzteres. Wir lassen es so stehen. Der Wandtext, den wir alle lesen können, nur das Mädchen nicht, liefert die Erklärung, dass die Schildkröte ihre Flosse im Long Island Sound verlor, wo sie vor elf Jahren gerettet wurde.
Elf: Mein Alter plus eins! sagt der Junge mit heller Begeisterung, die er normalerweise unterdrückt.
Während ich dastehe und die gewaltige Schildkröte beobachte, fällt es mir schwer, sie nicht als Metapher für etwas zu sehen. Doch bevor ich herausfinde, wofür, fängt der Junge an, uns zu aufzuklären. Schildkröten wie Calypso, sagt er, werden an der Ostküste geboren und schwimmen sofort in den Atlantik hinaus, ganz allein. Manchmal kehren sie erst nach zehn Jahren in Küstengewässer zurück. Die Schlüpflinge beginnen ihre Reise im Osten und werden mit den warmen Strömungen des Golfstroms ins Tiefe getragen. Irgendwann erreichen sie die Sargassosee, deren Name, so der Junge, von den enormen Mengen der Sargassum-Alge stammt, die dort fast bewegungslos umhertreiben, gefangen von Strömungen, die sich im Uhrzeigersinn drehen.
Das Wort Sargasso ist mir nicht unbekannt, aber ich wusste nie, was es bedeutet. In einem Gedicht von Ezra Pound, an dessen Titel ich mich nicht erinnere, heißt es in einer Zeile, aus der ich nie so recht schlau wurde: »Dein Verstand und du sind unsere Sargassosee.« Während der Junge über die Schildkröte und ihre Reise in die Gewässer des Nordatlantiks weiterdoziert, gerate ich ins Grübeln. Dachte Pound bei dieser Zeile an Unfruchtbarkeit? Dachte er an Verschwendung? Steht das Bild für ein Schiff, das durch Jahrhunderte von Müll fährt? Oder geht es nur um den menschlichen Geist, der in sinnlos kreisenden Gedanken gefangen ist, unfähig, sich jemals von destruktiven Mustern zu lösen?
Bevor wir das Aquarium verlassen, will der Junge sein erstes Polaroid-Bild machen. Sein Vater und ich müssen uns vor das Hauptbecken stellen, mit dem Rücken zur Schildkröte. Er hält seine neue Kamera fest. Das Mädchen steht neben ihm – sie hält eine unsichtbare Kamera –, und während wir erstarren und sie verlegen anlächeln, betrachten sie uns, als wären wir die Kinder und sie die Eltern:
Sagt cheese.
Wir grinsen und sagen:
Cheese.
Cheese.
Aber das Bild kommt cremeweiß heraus, als zeige es unsere Zukunft und nicht die Gegenwart. Oder vielleicht ist es kein Bild unserer greifbaren Körper, sondern unserer Gedanken, die sich verloren im Kreis drehen – und fragen warum, denken wohin, sagen was jetzt?
LANDKARTEN
Hätten wir unser Leben in der Stadt festgehalten und eine Karte der täglichen Wege und Abläufe gezeichnet, dann sähe sie völlig anders aus als die Straßenkarte, der wir jetzt durch dieses weite Land folgen. Unser Alltag in der Stadt zog Linien, die sich nach außen verzweigten – Schule, Arbeit, Einkaufen, Termine, Treffen, Buchladen, Deli, Notar, Arztpraxis –, aber diese Linien verliefen immer im Kreis und kehrten am Ende des Tages zu einem einzigen Punkt zurück. Dieser Punkt war die Wohnung, in der wir vier Jahre zusammengelebt hatten. Ein kleiner, aber lichter Raum, in dem wir eine Familie geworden waren. Der Mittelpunkt, den wir jetzt plötzlich verloren hatten.
Obwohl wir im Auto nah beisammensitzen, sind wir vier unverbundene Punkte – jeder auf seinem Platz, in eigene Gedanken versunken, beschäftigt mit unterschiedlichen Stimmungen und unausgesprochenen Ängsten. Auf dem Beifahrersitz studiere ich mit einem Bleistift in der Hand die Karte. Ein Netz von Autobahnen und Straßen überzieht das gewaltige, mehrfach gefaltete Stück Papier (es ist eine Karte vom ganzen Land, zu groß, um sie im Auto auszubreiten). Ich folge langen Linien, rot, gelb, oder schwarz, zu schönen Namen wie Memphis, zu unpassenden Namen wie Truth or Consequences oder Shakespeare, zu alten Namen, die durch neue Mythologien mittlerweile neue Bedeutung erlangt haben: Arizona, Apachen, Cochise Stronghold. Und wenn ich von der Karte aufblicke, sehe ich vor mir die lange gerade Straße, die uns in eine ungewisse Zukunft führt.
AKUSTEMOLOGIE
Klang und Raum sind auf eine weitaus tiefere Weise miteinander verbunden, als wir gewöhnlich annehmen. Wir erkennen, verstehen und fühlen unseren Weg im Raum durch Töne und Klänge – die offensichtliche Verbindung zwischen beidem –, aber wir erfahren Raum auch durch die vorhandenen Neben- und Hintergrundgeräusche. Für uns als Familie war es immer das Radio, das den dreifachen Übergang vom Schlaf, in dem jeder allein war, zu unserem engen Beisammensein am frühen Morgen und schließlich zur weiten Welt außerhalb unseres Heims darstellte. Den Klang des Radios kennen wir besser als alles andere. Es war das Erste, was wir jeden Morgen in unserer Wohnung in New York hörten, wenn mein Mann aufstand und es einschaltete. Wir hörten seinen Klang, der irgendwo tief in unseren Kissen oder in unseren Gedanken nachhallte, standen auf und gingen langsam in die Küche. Dann wurde der Morgen von Meinungen, Dringlichkeit, Fakten und dem Geruch von Kaffeebohnen erfüllt, während wir alle am Tisch saßen und sagten:
Gib mir die Milch.
Hier ist das Salz.
Danke.
Hast du das eben gehört?
Schreckliche Nachrichten.
Wenn wir jetzt im Auto durch dichter besiedelte Gegenden fahren, suchen wir eine Radiofrequenz und schalten ein. Bei jeder Nachricht über die Lage an der Grenze drehe ich lauter und wir hören zu: Hunderte Kinder kommen jeden Tag allein an, Tausende jede Woche. Die Ansager sprechen von einer Einwanderungskrise. Einen Massenzustrom von Kindern, nennen sie es, eine plötzliche Welle. Sie besitzen keine Papiere, sind Illegale, Fremde, sagen einige. Sie sind Flüchtlinge, haben einen Rechtsanspruch auf Schutz, argumentieren andere. Laut diesem Gesetz steht ihnen Schutz zu; ein anderer Zusatz spricht ihnen diesen Schutz ab. Der Kongress ist gespalten, die öffentliche Meinung ebenfalls, die Presse blüht bei diesem Überschuss von Kontroversen förmlich auf, Non-Profit-Organisationen machen Überstunden. Jeder hat eine Meinung zu dem Thema; niemand kann sich auf etwas einigen.
VORAHNUNG, DIESER LANGE SCHATTEN
Wir beschließen, heute und an den folgenden Tagen nur bis Einbruch der Dunkelheit zu fahren. Nicht länger. Sobald das Licht schwindet, werden die Kinder schwierig. Sie spüren das Ende des Tages, und die Vorahnung längerer Schatten, die sich über die Welt senken, verändert ihre Stimmung, drängt ihre weicheren Tagespersönlichkeiten in den Hintergrund. Der Junge, normalerweise so sanftmütig, wird launisch und gereizt; das Mädchen, immer begeistert und vor Leben strotzend, wird anstrengend und leicht melancholisch.
JUKEBOXES & SÄRGE
Die Stadt in Virginia heißt Front Royal. Die Sonne geht unter, und in der Tankstelle, wo wir angehalten haben, um den Tank aufzufüllen, läuft in voller Lautstärke irgendein weißer reaktionärer Song. Die Kassiererin bekreuzigt sich rasch und vermeidet Augenkontakt, als wir 66,60 Dollar zahlen müssen. Eigentlich hatten wir vor, ein Restaurant oder Diner zu suchen, doch nach diesem Stopp wollen wir lieber unbemerkt weiterfahren. Keine zwei Kilometer von der Tankstelle entfernt entdecken wir ein Motel 6 und biegen auf den Parkplatz ein. Bezahlt wird im Voraus, in der Rezeption gibt es durchgehend Kaffee, und ein langer, kalter Flur führt zu unserem Zimmer. Wir haben nur das Nötigste aus dem Kofferraum mitgenommen. Beim Öffnen der Tür empfängt uns ein Zimmer, dessen Licht selbst einen seelenlosen Raum wie diesen in eine schöne Kindheitserinnerung verwandelt: blumenbedruckte, fest unter die Matratze gezurrte Bettlaken, durch einen Spalt der grünen Samtvorhänge fällt ein Sonnenstrahl, in dem Staubpartikel schweben.
Die Kinder nehmen das Zimmer sofort in Beschlag, springen zwischen den beiden Betten hin und her, schalten den Fernseher ein und wieder aus, trinken Wasser aus der Leitung. Zum Abendessen gibt es trockenes Müsli aus der Schachtel, das wir uns auf der Bettkante sitzend schmecken lassen. Als wir fertig sind, wollen die Kinder ein Bad nehmen. Ich lasse die Wanne halb volllaufen, dann gehe ich nach draußen zu meinem Mann und lasse die Tür einen Spaltbreit offen, falls eines der Kinder nach uns ruft. Bei den vielen kleinen Verrichtungen im Bad brauchen sie oft Hilfe. Zumindest was Waschgewohnheiten angeht, empfinde ich Elternschaft manchmal wie das Lehren einer ausgestorbenen, komplizierten Religion. Sie beruhen eher auf Ritualen als auf logischen Prinzipien, auf Glauben als auf Vernunft: dreh den Deckel von der Zahnpastatube so ab, dann drückst du von unten; nimm nur ein paar Blatt Toilettenpapier, dann faltest du es entweder so oder du zerknüllst es vor dem Abwischen; gib das Shampoo erst auf die Hand, nicht direkt auf den Kopf; zieh den Stöpsel erst aus der Wanne, wenn du rausgestiegen bist.
Mein Mann hat seine Aufnahmegeräte bei sich und sitzt mit hochgehaltener Tonangel neben unserer Zimmertür. Ich setze mich leise zu ihm, um ihn nicht zu stören. Mit dem Rücken an der Wand sitzen wir im Schneidersitz auf dem Steinboden. Wir öffnen Bierdosen und drehen Zigaretten. Im Zimmer nebenan bellt ununterbrochen ein Hund. Vier Türen weiter erscheint ein Mann mit seiner jugendlichen Tochter. Er ist kräftig und geht behäbig; sie hat Spargelbeine, trägt nur einen Badeanzug und eine offene Jacke. Sie gehen zu einem vor der Tür geparkten Pick-up und steigen ein. Als der Motor röhrt, hört der Hund auf zu bellen, um dann noch ängstlicher wieder anzufangen. Ich nippe an meinem Bier und sehe zu, wie der Pick-up wegfährt. Das Bild dieser beiden Fremden – Vater, Tochter, keine Mutter –, die in einen Pick-up steigen und vermutlich in ein Schwimmbad in einer nahe gelegenen Stadt fahren, erinnert mich an einen Satz, den Jack Kerouac mal über Amerikaner sagte: Wenn man sie gesehen hat, »weiß man nicht mehr, was trauriger ist, eine Jukebox oder ein Sarg«. Vielleicht war es auch nur Kerouacs Kommentar über die Fotos in Robert Franks Buch The Americans und nicht über Amerikaner im Allgemeinen. Mein Mann schneidet noch ein paar Minuten lang das Hundegebell mit, bis wir, von den Kindern gerufen – sie brauchen dringend Hilfe bei Zahnpasta und Handtüchern –, zurück ins Zimmer gehen.
KONTROLLPUNKT
Da ich weiß, dass ich nicht schlafen kann, gehe ich, als die Kinder endlich im Bett liegen, durch den langen Flur nach draußen zum Auto und öffne den Kofferraum. Ich stehe vor unserem tragbaren Chaos und betrachte es, als läse ich ein Inhaltsverzeichnis, um zu entscheiden, welche Seite ich aufschlagen soll.
Auf der linken Seite des Kofferraums sind ordentlich gestapelt unsere Schachteln, fünf enthalten unser Archiv – wobei unser Chaos ein Archiv zu nennen optimistisch ist –, plus die beiden leeren Schachteln für das künftige Archiv der Kinder. Ich werfe einen Blick in die Schachteln I und II meines Mannes. Einige Bücher gehen ums Dokumentieren oder um Archivführung und -nutzung während des Dokumentationsprozesses, dann ein paar Fotobände. In Schachtel II entdecke ich Sally Manns Unmittelbare Familie. Ich setze mich auf den Randstein und blättere es durch. Ich mochte immer ihre Sicht auf Kinder und was sie mit Kindheit verbindet: Kotze, blaue Flecken, Nacktheit, nasse Betten, trotzige Blicke, Verwirrung, Unschuld, ungebändigte Wildheit. Mir gefällt außerdem die Spannung in ihren Bildern, eine Spannung zwischen Dokument und Erfindung, zwischen dem Einfangen eines einmaligen flüchtigen Augenblicks und einem inszenierten Augenblick. Irgendwo schrieb sie, dass Fotos ihre eigenen Erinnerungen schaffen und die Vergangenheit ersetzen. Ihre Bilder zeigen nicht die Sehnsucht nach dem flüchtigen Moment, der zufällig mit der Kamera eingefangen wird. Sie sind vielmehr ein Geständnis: Dieser eingefangene Augenblick ist nicht durch Zufall entstanden, es ist ein aus einer ganzen Bandbreite von Erfahrungen entnommener und erhaltener Augenblick.
Mir geht durch den Sinn, dass ein gelegentliches unbeobachtetes Herumschnüffeln in den Schachteln meines Mannes und das Abhören seines Tonarchivs mir vielleicht einen Hinweis geben, wie ich meine eigene Geschichte aufbauen und welche Form ich ihr geben könnte. Ein Archiv ist etwas Ähnliches wie ein Tal, das die eigenen Gedanken in veränderter Form zurückwerfen kann. Man flüstert Ahnungen und Gedanken ins Leere und hofft, eine Antwort zu erhalten. Und wenn man schließlich den richtigen Ton getroffen und die richtige Oberfläche gefunden hat, kommt manchmal, nur manchmal, tatsächlich ein Echo zurück, ein echter, klarer Nachhall.
Der Inhalt der dritten Schachtel kommt mir auf den ersten Blick wie eine sehr männliche Zusammenstellung von Büchern zum Thema »auf Reisen gehen« vor, denn in allen wird erobert und kolonisiert: Herz der Finsternis, Die Cantos, Das wüste Land, Herr der Fliegen, Unterwegs, 2666, die Bibel. Des Weiteren finde ich ein kleines weißes Buch – die Fahnen eines Romans von Nathalie Léger, Untitled for Barbara Loden. Es wirkt ein bisschen deplatziert, eingezwängt und stumm, deshalb nehme ich es heraus und gehe zurück ins Zimmer.
ARCHIV
In ihren Betten klingen sie alle warm und verletzlich, wie ein Rudel schlafender Wölfe. Ich erkenne jeden an der Art seines Atmens: mein Mann neben mir, die beiden Kinder nebeneinander im benachbarten Doppelbett. Am leichtesten ist das Mädchen herauszuhören, das fast schnurrt, während es ungleichmäßig am Daumen lutscht.
Ich liege im Bett und lausche ihnen. Im Zimmer ist es dunkel, das Licht vom Parkplatz umrahmt die Vorhänge mit einem whiskeygelben Schimmer. Auf dem Highway ist kein Verkehr. Wenn ich die Augen schließe, vermischen sich beunruhigende Bilder und Gedanken in meinen Augenhöhlen und ergießen sich in mein Gehirn. Mit offenen Augen versuche ich mir die Augen meines schlafenden Stamms vorzustellen. Die des Jungen sind haselnussbraun, meist verträumt und mit sanftem Blick, können aber plötzlich vor Freude oder Wut auflodern wie die meteorischen Augen von Seelen, zu groß und zu wild, um gelassen zu sein – »gelassen in die gute Nacht«. Die Augen des Mädchens sind schwarz und riesig. Wenn sie weint, werden die Ränder sofort rot. Ihre plötzlichen Stimmungsschwankungen spiegeln sich unübersehbar darin wider. Als Kind war es bei mir genauso. Heute sind meine Augen vermutlich fester, unnachgiebiger und doppeldeutiger, wenn meine Stimmung schwankt. Die Augen meines Mannes sind grau, schräg und oft unruhig. Beim Autofahren blickt er mit gerunzelter Stirn auf die Straße, als lese er ein schwieriges Buch. Dieselbe Miene setzt er bei der Arbeit auf. Ich weiß nicht, was er sieht, wenn er mir in die Augen blickt; in letzter Zeit kommt es nicht mehr oft vor.
Ich schalte die Nachttischlampe ein, lese den Roman von Nathalie Léger und unterstreiche Stellen bis tief in die Nacht:
»Gewalt, ja, aber die annehmbare Seite der Gewalt, die Art von banaler Grausamkeit, wie sie in der Familie stattfindet«
»das Summen des normalen Lebens«
»die Geschichte einer Frau, die etwas Wichtiges verloren hat, aber nicht genau weiß, was«
»eine Frau auf der Flucht oder im Untergrund, die ihren Schmerz und ihre Ablehnung verbirgt und etwas vortäuscht, um sich befreien zu können«
Ich lese immer noch, als der Junge vor Sonnenaufgang am nächsten Morgen aufwacht. Seine Schwester und sein Vater schlafen noch. Ich habe die ganze Nacht kaum geschlafen. Er tut so, als wäre er schon ewig wach oder als wäre er nie eingeschlafen und wir hätten uns zwischenzeitlich unterhalten, stützt sich auf und fragt mit lauter, klarer Stimme, was ich lese.
Ein französisches Buch, flüstere ich.
Wovon handelt es?
Eigentlich von nichts. Es geht um eine Frau, die etwas sucht.
Und was sucht sie?
Das weiß ich noch nicht; sie weiß es auch nicht.
Sind die alle so?
Wie meinst du das?
Die französischen Bücher, die du liest, sind die alle so?
Wie so?
Wie das, weiß und klein, ohne Bilder auf dem Cover.
GPS
An diesem Vormittag fahren wir durch das Shenandoah Valley, eine mir unbekannte Gegend, die mir jedoch erst gestern Abend – in kleinen Splittern und geborgten Erinnerungen – in Sally Manns Fotos begegnet ist, die sie in diesem Tal aufnahm.
Um die Kinder zu beruhigen und die elend langen Stunden auf den Straßen in die Berge zu füllen, erzählt mein Mann Geschichten über den alten amerikanischen Südwesten. Er erzählt von den Strategien, die Häuptling Cochise anwandte, um sich vor seinen Feinden in den Dragoon und Chiricahua Mountains zu verstecken, und dass er noch nach seinem Tod zurückkam, um sie heimzusuchen. Es hieß, dass man ihn selbst heute noch bei den Dos Cabezas Peaks sichte. Die Kinder hören noch aufmerksamer zu, als ihr Vater vom Leben Geronimos erzählt. Seine Worte bringen uns die Zeit näher, halten sie im Auto fest, sie erstreckt sich nicht mehr vor uns wie ein unerreichbares Ziel. Er hat ihre volle Aufmerksamkeit, und auch ich höre zu: Geronimo war der letzte Mann in Nord-. Mittel- und Südamerika, der sich den Bleichgesichtern ergab. Er wurde Medizinmann. Eigentlich war er gebürtiger Mexikaner, aber er hasste Mexikaner, die von den Apachen nakaiye genannt wurden, »jene, die kommen und gehen«. Mexikanische Soldaten hatten seine drei Kinder, seine Mutter und seine Frau getötet. Er lernte nie Englisch. Für Häuptling Cochise trat er als Dolmetscher zwischen Apachen und Spaniern auf. Geronimo war eine Art heiliger Hieronymus, sagt mein Mann.
Wieso heiliger Hieronymus? frage ich.
Er rückt seine Mütze zurecht und erklärt in langatmiger professoraler Detailverliebtheit, dass der heilige Hieronymus die Bibel ins Lateinische übersetzte, bis ich das Interesse verliere, die Kinder einschlafen und wir beide verstummen, abgelenkt von den plötzlichen Anforderungen des Verkehrs: Autobahnkreuze, Geschwindigkeitskontrollen, Bauarbeiten, gefährliche Kurven, eine Zahlstelle – hast du Kleingeld und reich mir den Kaffee.
Wir folgen einer Karte. Entgegen allen Empfehlungen beschlossen wir, kein GPS zu benutzen. Ich habe eine gute Freundin, deren Vater bis zu seinem siebzigsten Lebensjahr unglücklich in einer Firma gearbeitet und dann genügend gespart hatte, um seiner wahren Leidenschaft zu folgen und sein eigenes Geschäft zu gründen. Einen Verlag, The New Frontier, der Tausende wunderschöner kleiner Seekarten herstellte, gewissenhaft und liebevoll zugeschnitten auf die Schifffahrt im Mittelmeer. Sechs Monate nach der Gründung seines Verlags wurde das GPS erfunden. Und das war’s: ein ganzes Leben futsch. Als meine Freundin mir die Geschichte erzählte, schwor ich, nie ein GPS zu benutzen. Deshalb verfahren wir uns natürlich oft, besonders wenn wir eine Stadt verlassen wollen. Gerade stellen wir fest, dass wir fast eine Stunde lang im Kreis gefahren und wieder in Front Royal gelandet sind.
STOPP
Auf einer Straße namens Happy Creek werden wir von einer Polizeistreife angehalten. Mein Mann schaltet den Motor aus, nimmt seine Mütze ab, rollt sein Fenster herunter und lächelt der Polizistin zu. Sie will Fahrerlaubnis, Zulassung und Versicherungsschein sehen. Auf dem Beifahrersitz murmele ich missmutig vor mich hin, unfähig, meine tief sitzende, unreife Reaktion auf jede Form von Maßregelung seitens einer Autoritätsperson zu zügeln. Wie ein Teenager beim Abwasch greife ich schwerfällig und genervt ins Handschuhfach, hole die verlangten Papiere heraus und klatsche sie meinem Mann in die Hand. Er wiederum überreicht sie ihr feierlich, als kredenze er ihr heißen Tee in einer Porzellantasse. Sie erklärt, wir seien angehalten worden, weil wir bei dem Stoppschild nicht richtig angehalten haben. Sie zeigt darauf – ein knallrotes achteckiges Ding, das eindeutig die Kreuzung Happy Creek Road und Dismal Hollow Road markiert und eine sehr schlichte Anweisung gibt: »Stopp.« Erst jetzt sehe ich die andere Straße, Dismal Hollow Road; der Name steht in schwarzen Großbuchstaben auf dem weißen Aluminiumschild, eine treffende Bezeichnung für den Ort, den er kennzeichnet. Mein Mann nickt immer wieder, sagt, tut mir leid, und wieder, tut mir leid. Die inzwischen von unserer Unschuld überzeugte Polizistin gibt die Papiere zurück, doch bevor wir weiterfahren dürfen, stellt sie noch eine Frage:
Und wie alt sind diese hübschen Kinder, Gott schütze sie?
Neun und fünf, antwortet mein Mann.
Zehn! verbessert ihn der Junge von hinten.
Sorry, sorry, sorry, klar, zehn und fünf.
Ich weiß, das Mädchen möchte auch etwas sagen und sich irgendwie einmischen, dazu muss ich sie gar nicht ansehen. Wahrscheinlich möchte sie erklären, dass sie bald sechs ist und nicht mehr fünf. Aber sie öffnet nicht mal den Mund. Wie mein Mann und im Gegensatz zu mir, hat sie eine lähmende, angeborene Angst vor Autoritätspersonen, eine Angst, die sich bei beiden in Form von großem Respekt bis hin zur Unterwürfigkeit zeigt. Bei mir äußert sich dieser Instinkt als trotziger Widerwille, einen Fehler einzugestehen. Mein Mann weiß das und sorgt deshalb dafür, dass ich in brenzligen Situationen den Mund halte.
Sir, sagt die Polizistin jetzt, wir in Virginia sorgen für unsere Kinder. Jedes Kind unter sieben Jahren braucht einen richtigen Kindersitz. Zur Sicherheit des Kindes, Gott möge das Mädchen schützen.
Sieben, Ma’am? Nicht fünf?
Sieben, Sir.
Tut mir leid, Officer, wirklich. Ich – wir – hatten keine Ahnung. Wo können wir hier in der Gegend einen Kindersitz kaufen?
Entgegen meinen Erwartungen lässt sie seinen zugestandenen Fehler im Raum stehen und benutzt seine Niederlage nicht, ihre eigene Macht mit der Verhängung eines Bußgelds auszuspielen. Stattdessen öffnet sie ihre hellrosa geschminkten Lippen und lächelt. Eigentlich ein schönes Lächeln – scheu, aber auch offenherzig. Sie gibt uns eine äußerst detaillierte Wegbeschreibung zu einem Geschäft, ändert dann ihren Tonfall und erklärt uns, welchen Kindersitz genau wir kaufen sollen: Am besten sind die ohne Rückenlehne, und wir sollen darauf achten, dass die Gurtschnallen aus Metall und nicht aus Plastik sind. Am Ende jedoch kann ich meinen Mann überzeugen, nicht anzuhalten, um den Kindersitz zu kaufen. Als Gegenleistung verspreche ich, nur dieses eine Mal den Google Maps GPS zu benutzen, damit wir aus dieser labyrinthischen Stadt hinaus und wieder auf die Straße kommen.
LANDKARTE
Wir fahren weiter Richtung Südwesten und hören die Nachrichten im Radio, Nachrichten über die vielen Kinder unterwegs in den Norden. Sie reisen allein, auf Zügen und zu Fuß. Sie reisen ohne ihre Väter und Mütter, ohne Koffer, ohne Pässe. Und immer ohne Landkarte. Sie müssen Staatsgrenzen und Flüsse überqueren, Wüsten und Schrecken durchstehen. Und wenn sie endlich ankommen, sagt man ihnen, sie sollen warten, und lässt sie im Ungewissen.
Hast du eigentlich was von Manuela und ihren zwei Mädchen gehört? fragt mein Mann.
Ich verneine, nichts. Als ich das letzte Mal von ihr hörte, kurz vor unserer Abreise aus New York, waren ihre Mädchen noch immer in einer Unterkunft in New Mexico und warteten auf die gesetzliche Erlaubnis, zu ihrer Mutter geschickt zu werden, oder auf den endgültigen Abschiebungsbescheid. Ich habe mehrmals versucht, sie anzurufen, aber sie geht nicht ran. Wahrscheinlich wartet sie immer noch auf eine Nachricht, was mit ihren Töchtern geschieht, und hofft, dass man ihnen Flüchtlingsstatus gewährt.
Was bedeutet »Flüchtling«, Mama? fragt das Mädchen von hinten.
Ich suche nach möglichen Antworten. Ich nehme an, jemand, der flüchtet, ist noch kein Flüchtling. Ein Flüchtling ist jemand, der schon irgendwo angekommen ist, in einem fremden Land, aber noch unbestimmte Zeit warten muss, bevor er tatsächlich ganz angekommen ist. Flüchtlinge warten in Untersuchungsgefängnissen, Notunterkünften oder Lagern; in Bundeshaft und unter der Aufsicht von bewaffneten Männern. Sie warten in langen Schlangen auf Essen, auf ein Bett zum Schlafen, warten mit erhobenen Händen, um zu fragen, ob sie die Toilette benutzen dürfen. Sie warten darauf, dass man sie freilässt, auf einen Telefonanruf, auf jemanden, der nach ihnen fragt oder sie abholt. Und dann gibt es Flüchtlinge, die das große Glück haben, endlich wieder mit ihren Familien vereint zu sein und in einem neuen Zuhause zu leben. Aber selbst die müssen weiter warten. Sie warten auf die Mitteilung, vor Gericht zu erscheinen, auf den Gerichtsentscheid, ob sie abgeschoben werden oder ob man ihnen Asyl gewährt, auf die Nachricht, wo sie am Ende leben werden und unter welchen Umständen. Sie warten darauf, dass eine Schule sie aufnimmt, dass sich ihnen eine Arbeitsmöglichkeit bietet, dass ein Arzt sie untersucht. Sie warten auf Visa, Dokumente, Erlaubnis. Sie warten auf einen Hinweis, auf Anordnungen, und dann warten sie weiter. Sie warten auf die Wiederherstellung ihrer Würde.
Was heißt es, ein Flüchtling zu sein? Wahrscheinlich könnte ich dem Mädchen antworten:
Ein Flüchtlingskind ist jemand, der wartet.
Stattdessen lautet meine Antwort, dass ein Flüchtling jemand ist, der ein neues Zuhause suchen muss. Dann suche ich, um die Unterhaltung etwas abzumildern und sie von alldem abzulenken, nach einer Playlist und drücke die Zufallswiedergabe. Und als würde eine Strömung über uns hinwegspülen, wird augenblicklich alles in eine unbeschwertere Wirklichkeit zurückgeschoben oder zumindest in eine überschaubarere Unwirklichkeit:
Von wem ist dieser Fa-fa-fa-fa-fa-Song? fragt das Mädchen.
Talking Heads.
Haben die auch Haare?
Ja, klar.
Lange oder kurze?
Kurze.
Unser Tank ist fast leer. Wir müssen einen Umweg fahren und eine Stadt suchen, sagt mein Mann, in der es eine Tankstelle gibt. Ich hole die Karte aus dem Handschuhfach und studiere sie.
GLAUBHAFTE ANGST
Wenn Kinder ohne Papiere die Grenze erreichen, werden sie von einem Officer der Border Patrol verhört. Man nennt diese Befragung »credible fear interview« und will damit feststellen, ob das Kind triftige Gründe hat, Asyl in dem Land zu suchen. Gestellt werden immer die halbwegs gleichen Fragen:
Warum bist du in die Vereinigten Staaten gekommen?
Wann genau hast du dein Land verlassen?
Warum hast du dein Land verlassen?
Hat dir jemand gedroht, dich umzubringen?
Hast du Angst, in dein Land zurückzukehren? Warum?
Ich stelle mir die vielen Kinder vor, die ohne Papiere in den Händen eines Schleppers Mexiko durchqueren, auf den Dächern von Zugwaggons, wo sie versuchen, nicht herunterzufallen, nicht in die Fänge der Einwanderungsbehörde oder von Drogenbossen zu geraten, die sie in den Mohnfeldern versklaven würden, sofern sie sie nicht umbringen. Wenn die Kinder es an die amerikanische Grenze schaffen, versuchen sie sich zu stellen, aber wenn sie keinen Officer der Border Patrol finden, laufen sie in die Wüste. Wenn sie einen Officer finden oder von einem gefunden werden, nimmt man sie in Gewahrsam und unterzieht sie einer Befragung:
Warum bist du in die Vereinigten Staaten gekommen?
Vorsicht! rufe ich und blicke von der Karte auf die Straße. Mein Mann reißt das Steuer herum. Das Auto schlingert ein wenig, aber er bringt es wieder unter Kontrolle.
Konzentrier dich einfach auf die Karte, und ich konzentriere mich auf die Straße, sagt mein Mann und wischt sich mit dem Handrücken über die Stirn.
Okay, antworte ich, aber du wärst fast gegen diesen Stein oder Waschbären oder was das war gefahren.
Herrgott, sagt er.
Herrgott was?
Herrgott noch mal, sagt er.
Was?
Führ uns einfach zur nächsten Tankstelle.
Das Mädchen nimmt grummelnd den Daumen aus dem Mund, schnaubt und sagt, wir sollen damit aufhören, unterbricht unser formloses, exzentrisches, ungrammatikalisches Gekläffe mit der Entschlossenheit ihres gesitteten Ärgers. Ohne die Fassung zu verlieren, setzt sie tief und müde seufzend einen Punkt in unseren Wortwechsel und räuspert sich. Wir verstummen. Und als sie merkt, dass sie unsere volle, stille, zerknirschte Aufmerksamkeit hat, gibt sie uns, als Zusammenfassung ihrer Intervention, einen letzten Rat. Manchmal spricht sie mit uns – obwohl sie noch keine sechs ist, immer noch Daumen lutscht und gelegentlich ins Bett macht – mit derselben versöhnlichen Haltung, die Psychiater ausstrahlen, wenn sie ihren wankelmütigen Patienten Rezepte ausstellen:
Hör zu, Papa. Ich glaube, es wird Zeit, dass du eine von deinen Kippen rauchst. Und du, Mama, du musst dich nur auf deine Karte und auf dein Radio konzentrieren. Okay? Ihr müsst jetzt beide mal das ganze Bild im Blick haben.
FRAGEN & ANTWORTEN
Niemand sieht die ganze Karte, weder historisch noch geografisch, wenn es um die Migrationswege einer Flüchtlingspopulation geht. Für die meisten Menschen sind Flüchtlinge und Migranten ein ausländisches Problem. Die wenigsten begreifen Migration als eine schlichte nationale Realität. Bei meiner Suche im Netz zur Krise der Kinder stoße ich auf einen mehrere Jahre alten Artikel aus der New York Times mit der Überschrift »Kinder an der Grenze«. Der Artikel ist im Frage-Antwort-Stil verfasst, allerdings stellt der Autor die Fragen und beantwortet sie selbst. Auf die Frage, woher die Kinder kommen, antwortet der Autor, dass drei Viertel aus »vorwiegend armen und gewaltgeprägten Städten« in El Salvador, Guatemala und Honduras kommen. Bedenklich finde ich die Worte »vorwiegend arme und gewaltgeprägte Städte« und die möglichen Folgerungen dieser schematischen Art der geografischen Zuordnung der Kinder, die in die Vereinigten Staaten abwandern. Diese Kinder, scheint diese Formulierung nahezulegen, sind uns vollkommen fremd. Sie kommen aus einer barbarischen Realität. Sie sind außerdem höchstwahrscheinlich nicht weiß. Auf die Frage, warum die Kinder nicht sofort abgeschoben werden, wird dem Leser erzählt: »Laut einem parteiübergreifend verabschiedeten Statut gegen den Menschenhandel … dürfen Minderjährige aus Zentralamerika nicht sofort abgeschoben werden und haben das Recht auf eine Anhörung vor Gericht, bevor sie abgeschoben werden. Eine Richtlinie der Vereinigten Staaten gestattet es, dass mexikanische Minderjährige, die beim Überqueren der Grenze aufgegriffen werden, unverzüglich zurückgeschickt werden.« Allein dieses Wort »gestattet« im letzten Satz! Man könnte meinen, der Autor wollte mit seiner Antwort auf die Frage »Warum werden die Kinder nicht sofort abgeschoben?« Trost spenden, indem er sagt, keine Sorge, zumindest die mexikanischen Kinder behalten wir nicht, denn zum Glück gibt es eine Richtlinie, die es uns gestattet, sie unverzüglich zurückzuschicken. Auch Manuelas Mädchen wären sofort zurückgeschickt worden, hätte ein freundlicher Officer sie nicht im Land gelassen. Aber wie viele Kinder werden zurückgeschickt, ohne auch nur die Chance zu erhalten, ihre glaubhaften oder nicht glaubhaften Ängste auszusprechen?
Niemand denkt an die Kinder, die heute als Flüchtlinge vor einem hemisphärischen Krieg ankommen, der sich von genau diesen Bergen hier quer durch das Land in den Süden der Vereinigten Staaten und die Wüsten im Norden Mexikos erstreckt, der sich weiter über die mexikanischen Sierras, Wälder und südlichen Regenwälder nach Guatemala, El Salvador bis zum Nationalpark Celaque in Honduras erstreckt. Niemand denkt an diese Kinder als Folge eines historischen Kriegs, der Jahrzehnte zurückreicht. Alle fragen ständig: Welcher Krieg? Wo? Warum sind sie hier? Warum kommen sie in die Vereinigten Staaten? Was sollen wir mit ihnen anfangen? Niemand fragt: Warum sind sie aus ihrer Heimat geflohen?
KEIN ZURÜCK
Warum können wir nicht einfach wieder nach Hause fahren? fragt der Junge.
Er fummelt auf dem Rücksitz an seiner Polaroidkamera herum, liest stöhnend die Anleitung und lernt, wie sie zu handhaben ist.
Hier gibt es sowieso nichts zu fotografieren, klagt er. Alles, woran wir vorbeikommen, ist alt und hässlich und sieht aus, als würden da nur Geister wohnen.
Stimmt das? Wohnen hier Geister? fragt das Mädchen.
Nein, Baby, sage ich, es gibt keine Geister.
Obwohl der Gedanke gar nicht so abwegig ist. Je tiefer wir in das Land fahren, umso mehr habe ich den Eindruck, nur noch Trümmer und Ruinen zu sehen. Als wir an einer verlassenen Milchfarm vorbeifahren, sagt der Junge:
Stellt euch den ersten Menschen vor, der eine Kuh gemolken hat.
Zoophilie, denke ich, spreche es aber nicht aus. Ich weiß nicht, was mein Mann denkt, aber auch er schweigt. Das Mädchen vermutet, dass der erste Kuhmelker vielleicht dachte, er müsse nur fest genug ziehen – da unten –, dann würde die Glocke am Hals der Kuh läuten.
Bimmeln, verbessert der Junge sie.
Und dann kam plötzlich Milch raus, schlussfolgert sie, ohne ihren Bruder zu beachten.
Ich rücke den Spiegel zurecht und betrachte sie: ein breites Lächeln, ruhig und verschmitzt zugleich. Mir fällt eine etwas logischere Erklärung ein:
Vielleicht war es eine Menschenmutter, die ihrem Baby keine Milch geben konnte und deshalb beschloss, sie von der Kuh zu holen.
Doch die Kinder sind nicht überzeugt:
Eine Mutter ohne Milch?
Das ist verrückt, Mama.
Das ist lächerlich, Ma, bitte.
GIPFEL & PUNKTE
Als Teenager hatte ich eine Freundin, die immer eine erhöhte Stelle aufsuchte, wenn sie eine Entscheidung treffen musste oder ein schwieriges Problem verstehen wollte. Ein Hausdach, eine Brücke, ein Berg, falls vorhanden, ein Etagenbett, alles, was hoch war. Ihrer Theorie zufolge ließ sich ohne die schwindelerregende Klarheit, wie Höhen sie vermitteln, keine gute Entscheidung treffen oder eine wichtige Schlussfolgerung ziehen. Vielleicht.
Während wir in den Appalachen die Bergstraßen hochkriechen, denke ich zum ersten Mal klarer über die Entwicklungen der letzten Monate in unserer Familie nach – oder besser, zwischen uns als Paar. Ich glaube, mein Mann hatte im Laufe der Zeit das Gefühl, dass ihn unsere Verpflichtungen als Paar und als Familie – Miete, Rechnungen, Krankenversicherung – in eine zunehmend spießige Richtung drängten, immer weiter weg von der Arbeit, der er sich widmen wollte. Und Jahre später wurde ihm klar, dass unser gemeinsam aufgebautes Leben im Widerspruch zu seinen Wünschen stand. Ich versuchte monatelang zu begreifen, was da mit uns passierte, und war in dieser Zeit wütend, machte ihm Vorwürfe und fand ihn launisch – weil ihm Neues fehlte, Abwechslung, andere Frauen, was auch immer. Jetzt aber, auf unserer Reise, wo wir uns näher sind denn je und gleichzeitig weit entfernt von dem Gerüst, das den Alltag unseres Familienlebens stützte, und ohne das Projekt, das uns einst zusammenbrachte, wird mir klar, dass ich ähnliche Gefühle entwickelt hatte. Auch ich war nicht schuldlos: Ich hatte zwar nicht das Streichholz entzündet und das Feuer in Gang gesetzt, aber ich hatte monatelang zu dem Zündstoff beigetragen, der es jetzt schürte.
Die Höchstgeschwindigkeit auf den Straßen in den Appalachen beträgt 25 Meilen pro Stunde, was meinen Mann ärgert, ich hingegen finde es ideal. Trotz des langsamen Tempos fällt mir erst jetzt, Stunden später auf, dass die Bäume entlang der Bergstraße von Kudzu überwuchert sind. Auf dem Weg in dieses Hochtal waren wir nur durch Waldgebiet gefahren, aber jetzt sehen wir es ganz deutlich. Mein Mann erklärt den Kindern, dass Kudzu im neunzehnten Jahrhundert aus Japan eingeführt wurde und Farmer dafür bezahlt wurden, die Pflanze auf abgeernteten Feldern anzubauen, um die Bodenerosion einzudämmen. Natürlich übertrieb man es, und irgendwann breitete sich Kudzu auch auf den bewaldeten Berghängen aus. Die Pflanze nimmt den Bäumen das Sonnenlicht und entzieht ihnen Wasser. Die Bäume haben keinen Abwehrmechanismus. Auf den höher gelegenen Strecken der Bergstraße ist der Anblick erschreckend: Große Flecken von gelben Baumwipfeln sprenkeln die Wälder Virginias wie krebsartige Geschwüre.
All diese Bäume werden sterben, erstickt, ausgesaugt von diesen Kletterpflanzen, sagt mein Mann und fährt langsamer, weil eine Kurve kommt.
Aber du stirbst auch, Pa, genau wie wir und alle anderen, sagt der Junge.
Na ja, klar, räumt sein Vater ein und grinst. Aber das ist nicht der Punkt.
Worauf das Mädchen aufschlussreich erwidert:
Der Punkt ist, der Punkt ist, der Punkt ist immer rund.
TÄLER
Wir kriechen auf der schmalen, gewundenen Straße auf und ab durch die Blue Ridge Mountains und fahren, erneut auf der Suche nach einer Tankstelle, in westlicher Richtung in ein enges Tal, eingekeilt zwischen den beiden Armen der Gebirgskette. Als wir keinen Empfang mehr haben, schalte ich das Radio aus, und der Junge bittet seinen Vater, Geschichten über die Vergangenheit zu erzählen. Das Mädchen unterbricht ihn gelegentlich mit sehr konkreten Fragen.
Was ist mit Apachen-Mädchen? Gab es die auch?
Wie meinst du das? sagt er.
Du redest immer nur von Apachen-Männern und manchmal von Jungen, aber wo bleiben die Mädchen?
Er denkt kurz nach und sagt schließlich:
Ja, stimmt. Es gab zum Beispiel Lozen.
Er erzählt ihr, dass Lozen das beste und mutigste Apachen-Mädchen war. Ihr Name bedeutete »geschickte Pferdediebin«. Sie wuchs in einer für die Apachen harten Zeit auf, nachdem die mexikanische Regierung eine Belohnung auf Indianerskalps ausgesetzt hatte und hohe Summen für ihr langes schwarzes Haar zahlte. Aber Lozen erwischten sie nie; sie war zu schnell und zu schlau.
Hatte sie langes oder kurzes Haar?
Lozen trug ihr Haar in zwei langen Zöpfen. Sie war bekannt als Hellseherin, die wusste, wann ihrem Volk Gefahr drohte, und bewahrte es oft vor dem Schlimmsten. Sie war außerdem Kriegerin und Heilerin. Und später wurde sie Hebamme.
Was ist eine Hebamme? fragt das Mädchen.
Jemand, der Babys bringt.
Wie die Postbotin?
Ja, sagt er, wie die Postbotin.
FUSSABDRÜCKE
In der ersten Stadt, durch die wir tief im Herzen Virginias fahren, sehen wir mehr Kirchen als Menschen und mehr Hinweisschilder auf Lokalitäten als Lokalitäten selbst. Alles wirkt ausgehöhlt und entkernt, und was übrig ist, sind nur Worte: Namen, die auf ein Vakuum verweisen. Wir durchqueren ein Land, das nur aus Schildern besteht. Eines dieser Schilder kündigt ein familienbetriebenes Restaurant an und verspricht Gastfreundschaft; dahinter befindet sich lediglich ein baufälliges Eisengerippe, wunderschön leuchtend im Sonnenlicht.
Nachdem wir meilenweit an verlassenen Tankstellen vorbeigefahren sind, an denen Büsche durch jeden Riss im Beton sprießen, erreichen wir eine, die nur halb verlassen wirkt. Wir halten neben der einzigen einsatzbereiten Zapfsäule und steigen aus, um uns die Beine zu vertreten. Das Mädchen sieht seine Chance, sich hinters Steuer zu setzen, und bleibt im Auto, während mein Mann den Tank auffüllt. Der Junge und ich beschäftigen uns im Freien mit seiner Kamera.
Was soll ich denn machen? fragt er.
Ich erkläre ihm – indem ich zwischen einer mir wohlbekannten und einer mir nicht sehr geläufigen Sprache zu übersetzen versuche –, dass er sich das Fotografieren wie das Mitschneiden eines Echos vorstellen müsse. Aber eigentlich lassen sich nur schwer Parallelen zwischen Sonografie und Fotografie ziehen. Eine Kamera kann einen ganzen Ausschnitt von einer Landschaft in einem einzigen Bild einfangen; ein Mikrofon hingegen, selbst ein parabolisches, kann nur Fragmente und Einzelheiten aufzeichnen.
Ma, ich will nur wissen, welchen Knopf ich wann drücken muss.
Ich zeige ihm Sucher, Linse, Schärferegulierung und Verschluss, und als er durch den Sucher sieht, schlage ich vor:
Vielleicht könntest du diesen Baum fotografieren, der aus dem Beton wächst.
Und warum?
Keine Ahnung – einfach um ihn zu dokumentieren, schätze ich.
Und wozu soll das gut sein, Ma?
Er hat recht. Wozu etwas dokumentieren, ein Objekt, unser Leben, eine Geschichte? Das Dokumentieren von Dingen – durch die Linse einer Kamera, auf Papier oder mit einem Tonaufnahmegerät – ist im Grunde nur eine Möglichkeit, allem Vorhandenen, das sich im kollektiven Verständnis der Welt abgesetzt hat, eine weitere Schicht, etwas wie Ruß hinzuzufügen. Ich schlage vor, unser Auto zu fotografieren, um die Kamera noch einmal zu testen und vielleicht herauszufinden, warum die Bilder verschwommen weiß herauskommen. Der Junge hält die Kamera in den Händen wie ein Amateurtorhüter, der gleich den Ball abschießt, späht in die Linse und drückt ab.
Hast du scharfgestellt?
Glaube schon.
War das Bild klar zu sehen?
Irgendwie ja.
Vergeblich; das Polaroid kommt blau heraus und wird dann langsam cremeweiß. Er behauptet, die Kamera sei kaputt, ein Fabrikfehler, wahrscheinlich nur eine Spielzeugkamera und keine richtige. Ich versichere ihm, dass es kein Spielzeug ist, und lege ihm eine Theorie dar:
Vielleicht kommen sie nicht weiß heraus, weil die Kamera kaputt oder nur eine Spielzeugkamera ist, sondern weil das Fotografierte gar nicht vorhanden ist. Und wenn etwas nicht vorhanden ist, gibt es kein Echo, das zurückgeworfen werden kann. Wie Geister, die nicht in Bildern erscheinen, oder Vampire, die man nicht in Spiegeln sieht, weil sie gar nicht vorhanden sind.
Er ist weder beeindruckt noch amüsiert und findet meine Echo-Theorie weder überzeugend noch lustig. Er drückt mir die Kamera in den Bauch und hüpft wieder auf seinen Platz.
Im Auto geht die Diskussion über das Problem mit der Kamera noch eine Weile weiter. Der Junge wiederholt, dass ich ihm eine kaputte, nutzlose Kamera geschenkt habe. Sein Vater schaltet sich ein und versucht zu vermitteln. Er erzählt ihm von Man Rays »Rayogrammen« und der merkwürdigen Methode, mit der er sie komponierte, ohne Kamera, indem er kleine Objekte wie Scheren, Reißzwecken, Schrauben oder Kompasse auf lichtempfindliches Papier legte und dann dem Licht aussetzte. Dass die Bilder, die Ray mit dieser Methode schuf, immer den gespenstischen Spuren nicht mehr vorhandener Objekte glichen, wie visuelle Echos oder Fußabdrücke im Matsch, die jemand vor langer Zeit hinterlassen hatte.
LÄRM
Ziemlich spät erreichen wir ein hoch in den Appalachen thronendes Dorf. Wir beschließen anzuhalten. Die Kinder verhalten sich im Auto seit einiger Zeit wie böse mittelalterliche Mönche – im Spiel liefern sie sich beunruhigende Wortgefechte, in denen sie einander lebendig begraben, Katzen töten, Städte niederbrennen. Wenn ich sie höre, scheint mir die Theorie der Wiedergeburt ziemlich plausibel: der Junge muss in Salem im fünfzehnten Jahrhundert Hexen gejagt haben, und das Mädchen war vermutlich in Mussolinis Italien ein faschistischer Soldat. Sie spielen im Mikromaßstab Geschichte nach.
Vor dem einzigen Lebensmittelladen im Ort verkündet ein Schild: »Cottages zu vermieten. Auskunft im Laden.« Wir mieten ein Cottage, klein, aber gemütlich, ein Stück weg von der Hauptstraße. Am Abend hat der Junge im Bett eine Angstattacke. Er nennt es nicht so, sagt aber, er kann nicht richtig atmen, seine Augen wollen nicht zubleiben, er kann nicht richtig denken. Er ruft mich zu sich:
Glaubst du wirklich, dass manche Dinge gar nicht vorhanden sind? fragt er. Dass wir sie sehen, sie aber gar nicht da sind?
Wie meinst du das?
Das hast du heute gesagt.
Was hab ich gesagt?
Du hast gesagt, wenn ich dich, dieses Zimmer und alles andere sehe, aber nichts davon ist wirklich da, dann kann es kein Echo erzeugen und also auch nicht fotografiert werden.
War doch nur ein Scherz, Liebling.
Okay.
Schlaf jetzt, ja?
Okay.
Später am Abend stehe ich ratlos mit einer Taschenlampe vor dem offenen Kofferraum unseres Autos und versuche zu entscheiden, welche Schachtel ich öffnen soll, um ein geeignetes Buch zu finden. Ich muss über mein Hörprojekt nachdenken, und fremde Texte zu lesen und mich vorübergehend in die Gedankenwelt anderer einzuloggen hat mir schon oft den Zugang zu meinen eigenen Gedanken erleichtert. Aber wo anfangen? Ich stehe vor den sieben Schachteln und frage mich, was wohl ein Fremder mit dieser Sammlung von Papieren anfangen würde, die jetzt in einer vorläufigen, gewissen Ordnung in den Schachteln archiviert ist. Wie viele möglichen Kombinationen dieser Dokumente gab es wohl? Und welche anderen Geschichten würden erzählt werden, wenn man sie mischen, vertauschen und neu ordnen würde?
In der zweiten Schachtel meines Mannes liegt unter einigen Notizbüchern ein Buch mit dem Titel Die Ordnung der Klänge von R. Murray Schafer. Ich erinnere mich, es vor vielen Jahren gelesen und nur einen Bruchteil davon verstanden zu haben, aber zumindest wurde mir klar, dass es ein gigantisches und wahrscheinlich vergebliches Unterfangen war, den Überschuss an Geräuschen und Klängen, die den Menschen umgeben, zu ordnen. Durch das Trennen und Katalogisieren von Lauten wollte Schafer den Lärm loswerden. Ich blättere die Seiten durch – eine Fülle von komplizierten Diagrammen, symbolischen Darstellungen unterschiedlicher Arten von Geräuschen und ein riesiges Verzeichnis, das die Laute dessen katalogisiert, was Schafer als World Soundscape Project bezeichnete. Das Verzeichnis umfasst »Laute des Wassers« ebenso wie »Laute der Jahreszeiten« oder »Laute des Körpers«, »Häusliche Laute«, »Verbrennungsmaschinen«, »Kriegs- und Zerstörungsgeräte«, »Laute der Zeit«. Jede dieser Kategorien ist in einzelne Punkte unterteilt. Unter »Laute des Körpers« etwa finden sich: Herzschlag, Atem, Schritte, Hände (Klatschen, Kratzen et cetera), Essen, Trinken, Ausscheidung, Geschlechtsverkehr, Nervensystem, Laute des Traums und des Schlafs. Beendet wird das Verzeichnis mit der Kategorie »Indikatoren künftiger Geschehnisse«, unter der natürlich nichts aufgelistet ist.
Ich lege das Buch zurück, öffne Schachtel I, sehe vorsichtig den Inhalt durch und nehme ein braunes Notizbuch heraus, auf dessen erste Seite mein Mann »Über Sammeln« geschrieben hat. Ich schlage eine beliebige Seite auf und lese eine Notiz: »Sammeln ist eine Form von erfolgreicher Prokrastination und Trägheit, die viele Möglichkeiten erschließt.« Ein paar Zeilen darunter steht ein abgeschriebenes Zitat aus einem Buch von Marina Zwetajewa: »Genie ist die höchste Stufe des Ausgeliefertseins an das Überkommenwerden – das zum einen, und des Fertigwerdens mit diesem Überkommenwerden – das zum zweiten.« Das Buch Kunst im Licht des Gewissens gehört mir, und diesen Satz hatte ich wahrscheinlich mal unterstrichen. Ihn jetzt in seinem Notizbuch zu lesen empfinde ich als kleinen geistigen Diebstahl, als hätte er eine meiner inneren Erfahrungen an sich genommen und sie sich zu eigen gemacht. Aber irgendwie bin ich auch stolz, geplündert zu werden. Schließlich nehme ich, auch wenn es mir vermutlich wenig beim Nachdenken über mein Tonprojekt oder über Soundscaping im Allgemeinen hilft, Susan Sontags Wiedergeboren. Tagebücher 1947–1963 aus der Schachtel.
BEWUSSTSEIN & ELEKTRIZITÄT
Ich bleibe auf der Veranda und lese Sontags Tagebücher. Meine Arme und Beine, ein Festmahl für die Moskitos. Über mir knallen sture Käfer mit ihren Außenskeletten gegen die einzige Glühbirne; weiße Motten wirbeln um ihren Heiligenschein und fallen dann herunter. Eine kleine Spinne webt im Schnittpunkt eines Balkens und einer Säule eine Falle. Und vor der Veranda ziert ein hübsches Sternbild aus Glühwürmchen die dunkle Grenzenlosigkeit.
Ich führe kein Tagebuch. Meine Tagebücher sind die Unterstreichungen in Büchern. Ich würde niemandem ein Buch ausleihen, nachdem ich es gelesen habe, denn ich unterstreiche zu viel, manchmal ganze Seiten, manchmal doppelt. Mein Mann und ich lasen diese Ausgabe von Sontags Tagebüchern gemeinsam. Wir hatten uns gerade kennengelernt. Begeistert, fast fieberhaft unterstrichen wir beide ganze Passagen. Die nackten Beine auf dem Doppelbett ineinander verschlungen, lasen wir uns abwechselnd laut vor und blätterten die Seiten um, als befragten wir ein Orakel. Ich nehme an, dass Worte, zum richtigen Zeitpunkt und in der richtigen Reihenfolge, ein Nachglühen hinterlassen. Wenn man solche Worte in einem Buch liest, wunderschöne Worte, stellt sich ein starkes, wenn auch flüchtiges Gefühl ein. Aber man weiß, dies alles wird bald verschwunden sein: die Idee, die man gerade verstanden, und das Gefühl, das sie ausgelöst hat. Dann folgt der Wunsch, dieses seltsame, kurzlebige Nachglühen zu besitzen und das Gefühl festzuhalten. Also liest man ein zweites Mal, unterstreicht, lernt manches vielleicht sogar auswendig und schreibt das Gelesene irgendwo auf – in einem Notizbuch, auf eine Serviette, auf die Hand. In unserer Ausgabe von Sontags Tagebüchern sind folgende Stellen einfach und doppelt unterstrichen, manchmal eingerahmt oder am Rand markiert:
»Eine der wichtigsten (sozialen) Funktionen eines Tagebuchs besteht genau darin, heimlich von anderen gelesen zu werden, von den Leuten (wie Eltern & Geliebte), über die man sich nur in seinem Tagebuch mit grausamer Ehrlichkeit geäußert hat.«
»In einer Zeit, in der das Dekor keine Rolle spielt, eignet man sich unmoderne Tugenden an.«
»1831: Hegel gestorben.«
»Und wir hocken hier in diesem Rattenloch auf unseren Ärschen und werden bedeutend und immer älter …«
»Moralische Buchführung verlangt eine Abrechnung.«
»In der Ehe habe ich einen gewissen Persönlichkeitsverlust erlitten – zunächst war dieser Verlust angenehm, wohltuend …«
»Ehe basiert auf dem Prinzip der Trägheit.«
»Der Himmel aus städtischer Perspektive ist ein Negativum – die Abwesenheit von Häusern.«
»Der Abschied war vage, denn die Trennung hat immer noch etwas Unwirkliches.«
Diese letzte Zeile ist mit Bleistift unterstrichen, dann mit schwarzer Tinte umkreist und am Rand mit einem Ausrufezeichen versehen. Von mir oder ihm unterstrichen? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich erinnere mich noch, dass es mir, als ich Sontag zum ersten Mal las, ähnlich erging wie bei der ersten Lektüre von Hannah Arendt, Emily Dickinson und Pascal und ich immer wieder jähe, subtile und vermutlich mikrochemisch bedingte Hochgefühle empfand – kleine, tief im Hirngewebe flackernde Lichter –, wie manche Menschen sie erleben, wenn sie ein sehr einfaches, bis zu diesem Zeitpunkt jedoch unaussprechliches Gefühl plötzlich in Worte fassen können. Wenn die Worte eines Fremden auf diese Weise in das eigene Bewusstsein dringen, werden sie kleine gedankliche Lichtmarken. Sie sind nicht unbedingt erhellend. Ein Streichholz, angezündet in einem dunklen Flur, die glühende Spitze einer Zigarette, um Mitternacht im Bett geraucht, Aschenglut in einem erlöschenden Feuer: nichts davon besitzt genügend eigenes Licht, um etwas zu offenbaren. Ebenso wenig wie die Worte von anderen. Manchmal aber lässt einen ein kleines Licht den dunklen, unbekannten Raum erkennen, der es umgibt, das gewaltige Unwissen, das alles umhüllt, was wir zu wissen glauben. Und diese Erkenntnis und das Verarbeiten der Dunkelheit sind wertvoller als jedes angehäufte Faktenwissen.
Während ich die unterstrichenen Passagen in Sontags Tagebüchern wieder lese und sie noch Jahre später kraftvoll finde, manche sogar neu unterstreiche – besonders die Betrachtungen über die Ehe –, wird mir bewusst, dass alles Gelesene zwischen 1957 und 1958 geschrieben wurde. Ich zähle mit den Fingern nach. Sontag war damals erst vierundzwanzig, neun Jahre jünger, als ich es heute bin. Plötzlich bin ich peinlich berührt, als wäre ich dabei erwischt worden, wie ich vor der Pointe über einen Witz lache oder als hätte ich bei einem Konzert zwischen zwei Sätzen applaudiert. Deshalb springe ich zu 1963, als Sontag um die dreißig war, inzwischen geschieden, und Aktuelles und Künftiges vielleicht klarer sah. Ich bin zu müde, um weiterzulesen. Ich markiere die Seite, schließe das Buch, schalte das Verandalicht aus – bedrängt von Insekten und Motten – und gehe ins Bett.
ARCHIV
Am nächsten Morgen wache ich früh auf, gehe durch die Küche in den Wohnbereich und öffne die Verandatür. Hinter den Bergen geht die Sonne auf. Zum ersten Mal seit Jahren verspüre ich das Bedürfnis, Einzelheiten aus unserem Privatleben aufzunehmen, möchte ich Geräusche dokumentieren und aufbewahren. Vielleicht liegt es daran, dass Neues, neue Umstände, eine Aura von Vergangenem umgibt. Anfänge werden oft mit Enden verwechselt. Wir betrachten sie wie eine Ziege oder ein Stinktier, das dämlich die Sonne am Horizont anstarrt, ohne zu wissen, ob das gelbe Gestirn dort auf- oder untergeht.
Vielleicht will ich die ersten Geräusche unserer gemeinsamen Reise festhalten, weil sie die letzten von etwas sein könnten. Gleichzeitig möchte ich es nicht tun, weil ich Arbeit und Privates nicht gerne vermische; dieser besondere Moment unseres Zusammenseins soll kein Dokument für ein künftiges Archiv werden. Am liebsten würde ich bestimmte Eindrücke einfach im Kopf unterstreichen: dieses Licht, das durch das Küchenfenster hereinfällt und den Raum in warmes Gold taucht, während ich die Kaffeemaschine vorbereite; die sanfte Brise, die zur offenen Tür hereinweht und meine Beine umschmeichelt, als ich den Herd einschalte; die tapsenden Schritte – verursacht von kleinen, bloßen, warmen Füßen –, als das Mädchen aus dem Bett steigt, von hinten an mich herantritt und verkündet:
Mama, ich bin wach!
Ich stehe am Herd und warte, dass der Kaffee fertig ist. Sie sieht mich lächelnd an und reibt sich die Augen, als ich ihr Guten Morgen wünsche. Ich kenne niemanden, für den Aufwachen etwas so Schönes und Erfreuliches ist. Ihre Augen sind verblüffend groß, und ihr weißes, viel zu großes Höschen bauscht sich unter ihrem nackten Oberkörper. Ernst und überaus höflich sagt sie:
Ich habe eine Frage, Mama.
Ja?
Ich möchte wissen: Wer ist Herrgott Nochmal?
Statt einer Antwort reiche ich ihr ein großes Glas Milch.
ORDNUNG
Der Junge und sein Vater schlafen noch, und wir – Mutter und Tochter – setzen uns in dem kleinen, lichten Wohnzimmer auf die Couch. Sie trinkt ihre Milch in kleinen Schlucken und schlägt ihr Skizzenbuch auf. Nach ein paar misslungenen Zeichenversuchen bittet sie mich, vier Quadrate für sie zu malen – zwei oben, zwei unten – und sie dann in dieser Reihenfolge zu beschriften: »Figur«, »Schauplatz«, »Problem«, »Lösung.« Als ich fertig bin und wissen will, wozu die Quadrate gut sind, erklärt sie mir, in der Schule hätte sie gelernt, dass man so Geschichten erzählt. Schlechter Literaturunterricht beginnt schon früh und dauert viel zu lange. Ich erinnere mich noch, wie ich einmal, als der Junge in die zweite Klasse ging und ich ihm bei den Hausaufgaben half, plötzlich feststellte, dass er den Unterschied zwischen einem Substantiv und einem Verb nicht kannte. Also fragte ich ihn. Er schaute theatralisch an die Decke und sagte ein paar Sekunden später, doch, natürlich kenne er den Unterschied: Substantive seien die Buchstaben auf den gelben Karten über der Tafel, Verben seien die auf den blauen Karten unter der Tafel.
Das Mädchen füllt jetzt konzentriert die Quadrate aus. Ich trinke meinen Kaffee, öffne wieder Sontags Tagebücher und lese erneut einzelne Zeilen und Worte. Ehe, Scheidung, moralische Buchführung, Trennung: Haben unsere Unterstreichungen die Probleme angedeutet? Wann begann unser Ende? Ich kann nicht sagen, wann oder warum. Ich bin mir nicht sicher, wie es passiert ist. Als ich kurz vor unserer Abreise ein paar Freunden erzählte, dass meine Ehe wahrscheinlich zerbrechen wird oder zumindest in einer Krise steckt, fragten sie:
Was ist passiert?
Sie wollten ein genaues Datum:
Wann genau hast du es gemerkt? Vor diesem oder nach jenem?
Sie wollten einen Grund:
Politik? Langeweile? Emotionale Gewalt?
Sie wollten einen Auslöser:
Hat er dich betrogen? Du ihn?
Ich hatte alles verneint, nichts war passiert. Das heißt, doch, alles, was sie aufzählten, war vermutlich passiert, doch es war nicht das Problem. Trotzdem bohrten sie weiter. Sie wollten Gründe, Motive, und vor allem wollten sie einen Anfang:
Wann, wann genau?
Ich erinnere mich, dass ich eines Tages, kurz vor dieser Reise, in den Supermarkt ging. Der Junge und das Mädchen stritten sich über die bessere Geschmacksrichtung eines Snacks. Mein Mann beklagte sich, dass ich ein bestimmtes Produkt ausgewählt hatte, vielleicht Milch, vielleicht Waschmittel, vielleicht Pasta. Ich entsinne mich, dass ich mir zum ersten Mal seit unserem Zusammenleben vorstellte, wie es wäre, nur für das Mädchen und mich einzukaufen, in einer Zukunft, in der wir keine vierköpfige Familie mehr wären. Ich entsinne mich an mein fast augenblickliches Reuegefühl bei diesen Gedanken. Und dann ein viel tieferes Gefühl – vielleicht Trauer um die Zukunft oder vielleicht eine innere melancholische Leere, die Gegenwärtiges aufsaugt und Abwesenheit verbreitet –, als ich das von dem Jungen ausgewählte Shampoo, Vanilleduft für den täglichen Gebrauch, auf das Förderband legte.
Aber es war bestimmt nicht an diesem Tag im Supermarkt, dass ich begriff, was mit uns geschah. Anfang, Mitte und Ende sieht man immer erst rückblickend. Wenn wir gezwungen sind, im Nachhinein mit einer Geschichte aufzuwarten, beschränkt sich unsere Erzählung selektiv auf die wichtigen Momente und umgeht alle anderen.
Das Mädchen ist fertig mit seiner Zeichnung und zeigt sie mir zufrieden. In das erste Quadrat hat sie einen Hai gemalt. Im zweiten ist der Hai unter Wasser von anderen Meerestieren und Algen umgeben, die Sonne ganz oben in einer Ecke. Im dritten Quadrat betrachtet der Hai verstört eine Art Unterwasserkiefer. Im vierten und letzten beißt der Hai einen anderen großen Fisch, vielleicht ebenfalls ein Hai, den er wahrscheinlich auffrisst.
Und wie geht die Geschichte dazu?
Sag du’s mir, Mama, rate.
Also, erstens ist da ein Hai; zweitens ist er im Meer, wo er lebt; drittens ist das Problem, dass es nur Bäume zu fressen gibt, und ein Hai ist kein Vegetarier; und viertens findet er schließlich Futter und frisst es auf.
Nein, Mama. Ganz falsch. Haie fressen keine Haie.
Okay. Was ist dann die Geschichte? frage ich sie.
Die Geschichte ist, Figur: ein Hai. Schauplatz: das Meer. Problem: Der Hai ist traurig und verwirrt, weil ein anderer ihn gebissen hat, deshalb geht er zu seinem Nachdenk-Baum. Lösung: Er trifft eine Entscheidung.
Und welche?
Dass er den anderen Hai nur zurückbeißen muss, weil der ihn gebissen hat.
CHAOS
Der Junge und sein Vater wachen schließlich auf, und beim Frühstück besprechen wir unsere Pläne. Mein Mann und ich finden, dass wir weiter müssen. Die Kinder beklagen sich und wollen länger bleiben. Das ist kein normaler Urlaub, erinnern wir sie; wir können zwar gelegentlich anhalten und etwas Schönes unternehmen, aber wir müssen beide arbeiten. Ich muss anfangen, Material für meine Dokumentation zu sammeln. Den Radionachrichten und meinen Netzrecherchen zufolge spitzt sich die Lage im Süden an der Grenze mit jedem Tag zu. Mit Unterstützung der Gerichte hat die Regierung soeben die Schaffung einer Prioritätenliste für Kinder ohne Papiere angekündigt, und das heißt, dass Kinder, die an der Grenze ankommen, vorrangig abgeschoben werden. Die Bundeseinwanderungsgerichte werden die Bearbeitung ihrer Fälle allen anderen vorziehen, und wenn sie keinen Anwalt finden, der sie innerhalb der absurd kurzen Frist von einundzwanzig Tagen verteidigt, haben sie keine Chance und erhalten von einem Richter einen endgültigen Abschiebungsbefehl.
Natürlich erzähle ich das nicht alles den Kindern. Aber dem Jungen erkläre ich, dass mein aktuelles Projekt zeitempfindlich ist und ich so schnell wie möglich zur Grenze im Süden muss. Mein Mann hingegen möchte so bald wie möglich nach Oklahoma, um einen Apachen-Friedhof zu besuchen. Der Junge wirft uns im Tonfall einer kleinbürgerlichen Hausfrau aus den 1950ern vor, dass wir immer »die Arbeit vor die Familie stellen«. Wenn er älter ist, erwidere ich, wird er verstehen, dass beides nicht voneinander zu trennen ist. Er verdreht die Augen, findet mich berechenbar und selbstbezogen – zwei Adjektive, die ich von ihm noch nie gehört habe. Ich tadle ihn und sage, er und seine Schwester sollen das Frühstücksgeschirr abwaschen.
Erinnerst du dich noch, als wir andere Eltern hatten? fragt er sie, als die beiden mit dem Abwasch und wir mit dem Packen anfangen.
Wie meinst du das? antwortet sie verwirrt und reicht ihm das Spülmittel.
Wir hatten mal Eltern, die besser waren als unsere jetzigen.
Ich höre ihm zu, wundere mich und mache mir Sorgen. Ich würde ihm gern sagen, dass ich ihn liebe, bedingungslos, dass er mir nichts beweisen muss, dass ich seine Mutter bin und ihn immer in meiner Nähe haben will, und dass auch ich ihn brauche. Das alles sollte ich ihm sagen, aber wenn er sich verhält wie jetzt, werde ich distanziert, zurückhaltend und vielleicht sogar ziemlich kalt. Es ärgert mich, dass ich seine Wut nicht beschwichtigen kann. Normalerweise wende ich es nach außen, wenn ich durcheinander bin, und schimpfe ihn für Kleinigkeiten: Zieh deine Schuhe an, kämm dir die Haare, heb diese Tasche auf. Sein Vater behält seinen Ärger meistens für sich, er schimpft ihn nicht, sagt und tut nichts. Er wird nur passiv – ein trauriger Betrachter unseres Familienlebens, als sehe er einen Stummfilm in einem leeren Kino.
Als wir den Jungen kurz vor der Abfahrt bitten, beim Einräumen der Sachen im Kofferraum zu helfen, kriegt er einen noch größeren Wutanfall. Er sagt schreckliche Dinge, wünscht sich, er könne in einer anderen Welt und einer besseren Familie leben. Wahrscheinlich glaubt er, wir sind nur dazu da, um ihn unglücklich zu machen: Iss dieses Spiegelei, das dich ekelt; los jetzt, beeil dich; lerne auf diesem Fahrrad zu fahren, vor dem du Angst hast; zieh diese Hose an, die wir dir gekauft haben, obwohl sie dir nicht gefällt – sie war teuer, sei gefälligst dankbar; spiel mit diesem Jungen im Park, der dir vorübergehend Freundschaft und seinen Ball anbietet; sei normal, sei glücklich, sei ein Kind.
Er schreit immer lauter und wünscht, wir wären weg, wir wären tot, und tritt gegen die Autoreifen, schmeißt mit Steinen und Kies. Wenn er sich so in Rage redet, klingt seine Stimme für mich weit weg, unnahbar, fremd, als hörte ich sie auf einem alten analogen Tonbandgerät, durch Metalldrähte und mit Störgeräuschen, oder als wäre ich eine Telefonistin und lauschte ihm in einem weit entfernten Land. Irgendwo im Hintergrund erkenne ich noch den vertrauten Klang seiner Stimme, aber ich bin mir nicht sicher, ob er unsere Nähe sucht und sich nach Liebe und ungeteilter Aufmerksamkeit sehnt oder ob er uns zu verstehen gibt, wir sollen wegbleiben, uns aus seinem zehn Jahre alten Leben scheren und ihn aus unserem kleinen Familienkreis herauswachsen lassen. Ich höre zu, wundere mich und mache mir Sorgen.
Sein Anfall geht so lange, bis sein Vater schließlich die Geduld verliert, zu ihm geht, ihn fest an den Schultern packt und schreit. Der Junge windet sich aus seinem Griff, tritt gegen seine Knöchel und Knie – die Tritte sollen nicht schaden oder wehtun, aber es sind Tritte. Als Reaktion nimmt sein Vater seine Mütze ab und haut ihn damit ein paar Mal auf den Hintern. Die Strafe ist nicht schmerzhaft, aber für einen Zehnjährigen ist es demütigend, mit einer Mütze versohlt zu werden. Die Folge ist absehbar, aber auch entwaffnend: Tränen, Schniefen, Schluchzer und gestottertes okay, tut mir leid, schon gut.
Als der Junge sich endlich beruhigt hat, geht seine Schwester zu ihm und fragt, leicht hoffnungsvoll und leicht zögernd, ob er ein bisschen mit ihr spielen will. Sie braucht die Bestätigung, dass er und sie noch immer ein Leben teilen, in dem sie zusammen sind, unauflösbar verbunden, trotz der beiden Eltern und ihrer Fehler. Freundlich, aber bestimmt gibt der Junge ihr zunächst einen Korb:
Lass mich eine Weile allein.
Doch letztendlich ist er immer noch klein und immer noch empfänglich für unsere zerbrechlichen, privaten Familienmythologien. Als sein Vater vorschlägt, die Abfahrt aufzuschieben und vorher noch das Apachen-Spiel zu spielen, ist der Junge überglücklich. Er sammelt Federn, holt seinen Plastikbogen samt Pfeilen, putzt seine Schwester als Indianerprinzessin heraus, bindet ihr einen Baumwollgürtel um den Kopf, nicht zu fest und nicht zu locker, und rennt dann wie ein verrücktes Kind heulend im Kreis herum, wild und unbeschwert. Er erfüllt unser Leben mit seinem Atem, mit seiner plötzlichen Wärme, mit seiner besonderen Art, in lautes Lachen auszubrechen.
ARCHIV
Im trägen Vormittagslicht spielen die Kinder mit ihrem Vater das Apachen-Spiel. Das Cottage steht auf einem Hügelkamm in einem Hochtal, das sich wellenförmig in Richtung der für uns nicht sichtbaren Hauptstraße erstreckt. Häuser sind nicht zu sehen, nur Ackerland und Wiesen, hie und da gesprenkelt mit Wildblumen, deren Namen wir nicht kennen. Sie sind weiß und violett, ich entdecke auch ein paar orangefarbene Kleckse. Ein Stück weiter entfernt grast eine Gruppe von Kühen, die leicht verschwörerisch wirkt.
Soweit ich es von meinem Platz auf der Veranda beurteilen kann, besteht das Spiel nur darin, Stöcke im Wald zu sammeln, sie zurückzubringen und dann nebeneinander in den Boden zu stecken. Zwischendurch würzen kleine Auseinandersetzungen das Spiel: Das Mädchen will plötzlich ein Cowgirl sein und keine Indianerprinzessin, gar keine Art von Prinzessin. Mein Mann erklärt ihr, dass es in diesem Spiel keine Bleichgesichter gibt. Sie streiten. Am Ende gibt sie zögernd nach. Sie will weiter ein Apache sein, aber nur, wenn sie Lozen sein und trotzdem den Cowboyhut tragen darf, den wir in der Hütte gefunden haben, und nicht das Stirnband, das ständig rutscht.
Ich sitze auf der Bank, lese manchmal in meinem Buch, blicke hin und wieder zu den dreien. Sie sehen denkwürdig aus, so, als sollten sie fotografiert werden. Ich fotografiere meine Kinder fast nie. Sie sind nicht gern auf Bildern und boykottieren regelmäßig fotogene Familienmomente. Wenn sie für ein Porträt posieren sollen, sorgen sie dafür, dass ihr Widerwille sichtbar ist, und grinsen zynisch. Wenn sie machen dürfen, was sie wollen, ziehen sie Schweineschnuten, strecken die Zunge raus und winden sich wie halb irre Außerirdische in einem Hollywoodfilm. Sie üben asoziale Verhaltensweisen. Vielleicht sind alle Kinder so. Erwachsene hingegen legen einen fast religiösen Respekt vor fotografischen Ritualen an den Tag. Sie nehmen ernste Gesten an oder lächeln berechnend; sie blicken mit patrizischer Eitelkeit in die Ferne oder mit der einsamen Versunkenheit von Pornostars in die Kameralinse. Erwachsene posieren für die Ewigkeit, Kinder für den Augenblick.
Ich gehe in die Hütte, um die Polaroidkamera und die Bedienungsanleitung zu suchen. Ich hatte dem Jungen versprochen, sie zu studieren, weil wir mit Sicherheit etwas falsch machen, wenn seine Bilder immer weiß herauskommen. Ich finde beides in seinem Rucksack, unter Spielzeugautos, Gummibändern, Comics und seinem leuchtend roten Schweizer Armeemesser. Wie kommt es, dass das Stöbern in fremden Sachen irgendwie immer etwas zugleich Trauriges und Rührendes hat, als zeigte sich die große Zerbrechlichkeit der abwesenden Person in ihrem Hab und Gut? Einmal musste ich einen Ausweis suchen, den meine Schwester in ihrer Schublade vergessen hatte, und wischte mir plötzlich mit dem Ärmel Tränen ab, als ich ihre gut geordneten Bleistifte, bunten Büroklammern und ihre an sich selbst adressierten Post-it-Notizen durchsah – diese Woche Mama besuchen, langsamer sprechen, Blumen und lange Ohrringe kaufen, öfter zu Fuß gehen. Schwer zu sagen, warum solche Gegenstände wichtige Dinge über einen Menschen enthüllen; und ebenso schwer ist zu verstehen, warum diese Sachen in der Abwesenheit der betreffenden Person eine plötzliche Melancholie auslösen. Vielleicht liegt es daran, dass Gegenstände ihre Besitzer oft überdauern und unser Verstand sie deshalb mühelos in eine Zukunft projizieren kann, in der es den Besitzer nicht mehr gibt. Wir nehmen die zukünftige Abwesenheit unserer Lieben durch die materielle Anwesenheit ihrer Sachen vorweg.
Zurück auf der Veranda, studiere ich die Anleitung. Inzwischen sammeln die Kinder und ihr Vater Steine, die sie zwischen die im Boden steckenden Stöcke legen, abwechselnd Stein, Stock, Stein. Die Anleitung ist kompliziert. Neuer Polaroidfilm muss vor Licht geschützt werden, sobald das Foto ausgeworfen wird, sonst ist die Aufnahme zerstört. Die Kinder und ihr Vater übernehmen jetzt die Macht in Texas, verteidigen es gegen die amerikanische Armee, übergeben es ihren Apachen-Brüdern und trennen es mit einem Zaun aus Stein, Stock, Stein ab. Farbfilm braucht zum Entwickeln dreißig Minuten, schwarz-weiß nur zehn. In dieser Zeit muss das Bild horizontal in völliger Dunkelheit bleiben. Ein einziger Lichtstrahl hinterlässt eine Spur, einen Fehler. Es wird empfohlen, ein Polaroid während der Entwicklung in einer speziellen Dunkelbox aufzubewahren, erhältlich im Geschäft. Man kann es auch zwischen zwei Buchseiten legen und warten, bis alle Farben und Schattierungen fixiert sind.
Natürlich habe ich keine spezielle Dunkelbox. Aber ich habe ein Buch, Sontags Tagebücher, das ich benutzen kann, wenn das Polaroid aus der Kamera kommt. Ich schlage das Buch auf einer beliebigen Seite auf: 142. Bevor ich es neben mich lege, lese ich noch ein bisschen, um sicherzustellen, dass die gefundene Seite etwas Gutes verheißt. Ich konnte noch nie dem abergläubischen Impuls widerstehen, eine wahllos aufgeschlagene Seite zu lesen, als enthielte sie das Tageshoroskop. Einer dieser kleinen, aber ungewöhnlichen Zufälle: die aufgeschlagene Seite spiegelt seltsamerweise eine Szene wider, wie ich sie vor mir sehe. Die Kinder spielen mit ihrem Vater das Apachen-Spiel, und Sontag beschreibt ein Erlebnis mit ihrem Sohn: »Um fünf hat David aufgeschrien – ich bin in sein Zimmer gestürzt + wir haben eine Stunde lang geschmust. Er war ein mexikanischer Soldat (& deshalb war ich auch einer); wir haben die Geschichte umgeschrieben, sodass Mexiko Texas behalten durfte. ›Daddy‹ war ein amerikanischer Soldat.«
Ich nehme die Kamera und suche durch die Linse die Umgebung ab. Schließlich finde ich die Kinder – stelle scharf, noch schärfer und drücke ab. Sobald die Kamera die Aufnahme ausspuckt, nehme ich sie mit Zeigefinger und Daumen und lege sie zwischen die Seiten 142 und 143.
DOKUMENT
Das Bild kommt in Brauntönen heraus: sepia, ecru, weizengelb und sandfarben. Junge und Mädchen, die mich nicht bemerken, stehen ein Stück von der Veranda entfernt neben einem Zaun. Er hält einen Stock in der rechten Hand, sie zeigt auf eine Lichtung im Wald hinter der Hütte, vielleicht schlägt sie vor, noch mehr Stöcke zu suchen. Hinter ihnen befindet sich ein schmaler Weg, und dahinter eine Reihe von Bäumen, die dem abfallenden Hügel von der Hütte in Richtung Hauptstraße folgt. Ich kann es nicht erklären, aber sie sehen aus, als wären sie nicht wirklich da, als wären sie nur eine Erinnerung und nicht auf einem Foto.