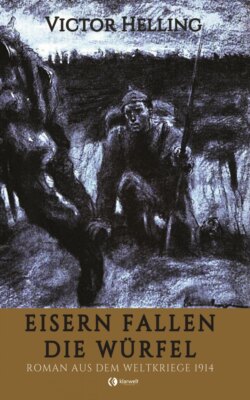Читать книгу Eisern fallen die Würfel - Victor Heling - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II.
ОглавлениеNichts deutete darauf hin, dass dieser erste Sonntag des August ein besonderer Tag war, als Grete v. Babenberg gleichzeitig mit Miss Scoolfield das Frühstückszimmer des Kaiserhofes aufsuchte. Der strahlende Morgen schickte seinen Sonnenglanz bis auf die Tische mit den Damastdecken, wo das Geschirr zumeist noch unberührt stand. Ein Page rückte den beiden jungen Damen die Stühle zurecht, ein anderer Angestellter machte sich an den hohen Fenstern zu schaffen.
Der Wilhelmplatz und die Nebenstraßen lagen still und friedlich: ein paar Spaziergänger im Feierstaat; ein halbes Dutzend junge Leute in der „Uniform“ der Straßenkehrer, die den Platz von den letzten zerknüllten Extrablättern säuberten; ein paar Droschken und Autos weniger vorm Hotel — nichts schien die sonntägliche Stille zu stören.
Aber dort an der Ecke der Mauerstraße, an der Litfaßsäule, drängten sich Männer und Frauen und lasen mit ernsten Mienen die Anschläge des Oberkommandierenden und des Oberbürgermeisters, und vor allem das knallrote Papier, auf dem kurz und knapp, in schwerwiegenden Worten, der Mobilmachungsbefehl zu lesen stand.
Und dann in der Wilhelmstraße da drüben selbst, wo des Reiches Kanzler wohnt, jagten schon wieder unablässig die Wagen.
Grete trat vom Fenster zurück. „Der arme Bethmann“, sagte sie, „wieviel Nächte mag er für uns gewacht haben! Wer weiß, ob er überhaupt schon zu Hause ist. Als wir ihn nachts durch die Linden fahren sahen, wie furchtbar bleich sah er aus!“
Miss Grace Scoolfield zuckte die Achseln. „Es ist dies das Los von Ministern, es ist bei uns genauso. Wir haben auch für unsere Minister das größte Interesse.“
„Ja, ja doch — aber wie er gestern umjubelt wurde! Wie er ernst aus dem Wagen heraus grüßte — alles wird mir unvergesslich sein. Ich habe vor Aufregung kein Auge zu tun können!“
„Ich fand den Lärm furchtbar verletzend, bei uns würde man weniger schreien, aber ich habe trotzdem außerordentlich gut geschlafen. Ich bin immer über diese guten Berliner Hotels entzückt.“
Grete v. Babenberg überhörte die Worte der Miss, die in ihrem knapp sitzenden Reisekleid schon am Tische Platz genommen hatte. Ein Gegensatz hatte sich gestern zwischen ihr und der englischen Freundin aufgetan, der einfach nicht zu überbrücken war. Klar und deutlich hatte sie das gestern Abend gefühlt, als die Familie noch bis Mitternacht hier im Hotel zusammengesessen hatte, ganz erfüllt und durchdrungen vom heiligen Ernst der Stunde. Hier gab es einen Wendepunkt in der Freundschaft. Jede, auch die scheinbar nebensächlichste Bemerkung der Engländerin, die nun schon seit Jahr und Tag auf Haus Müncheberg wie ein Gast gehalten wurde, obwohl sie eigentlich die Stelle einer Gouvernante für den zehnjährigen Heinz innehatte, hatte Grete gestern verletzt. Ihre Wege gingen auseinander, sie verstand die Miss nicht mehr und Miss Grace, die den ganzen Abend in einer Haltung dagesessen hatte, die ein Gemisch von Nachlässigkeit und Gefallsucht war, verstand nicht die große, erschütternde Bewegung und Begeisterung, die die Herzen jedes Deutschen rasender schlagen ließ.
Der Kellner kam und fragte, ob er das Frühstück auftragen dürfe oder ob die Damen auf die anderen Herrschaften warten wollten. „Nein, bringen Sie den Tee“, antwortete Grete. Es sollte keine Minute Zeit verloren werden, und die Mutter musste jeden Augenblick kommen. Man hatte ja noch so unendlich viel vor und zu besorgen! Für Bruder Werner und für Gottfried, der selbstverständlich sofort auf seine Marineschule nach Mürwik oder gleich aufs Schiff musste. Und Werner, der sich also richtig gestern Abend, nachdem ihn Onkel Fritz am Schloss erwischt hatte, auf eine knappe Stunde hatte freimachen können, musste natürlich auch jede Minute darauf gefasst sein, dass es fortging. „Ein Glück, dass heute die Sonntagsruhe aufgehoben ist“, sagte sie wie in Gedanken. Miss Scoolfield schürzte die Lippen. „Das ist mir unbegreiflich. Die Herren, besonders Dein Bruder, der in diesem russischen Regiment steht, betonten, dass sie keinen Krieg gewollt hätten, und nun rüsten sie ganz unbändig an einem Sonntag —“
Grete war blutrot geworden, aber sie sagte ruhig: „Das dürftest Du, wie so manches, doch etwas missverstanden haben, und ganz dringend muss ich Dich bitten, nicht noch einmal von einem russischen Regiment meines Bruders Werner zu reden. Er ist Alexandriner, das ist ein alter historischer Name, der mit dieser unseligen Überrumpelung, die uns Russland bereitet, nicht das Geringste zu tun hat!“
„Dein Herr Bruder hätte den Ausdruck sicher nicht übel genommen — wenigstens nicht, wenn ich ihn gebraucht hätte.“
„Das bezweifle ich sehr!“
„Ich habe mich mit diesem Oberleutnant ausgezeichnet unterhalten.“
Mit geheimer Freude gewahrte sie, dass ein Schatten über Gretes Gesicht flog. Die törichte Närrin! Ein harmloser Flirt, ein ganz klein wenig Koketterie war das gewesen, als sie sich mit dem blonden, lachenden Gardeleutnant unterhalten hatte, und nun fiel die Schwester genauso darauf herein, wie gestern der gute Junge, und dabei dachte sie doch nicht im entferntesten daran, sich einem Offizier, und ausgerechnet einem deutschen Offizier, an den Hals zu werfen! Überaus komisch hatte sie das Pathos gefunden, mit dem gestern dieser Werner und sein eben flügge gewordener Bruder Gottfried und gar noch der Oheim und schließlich alle, die am Tisch gesessen hatten, von diesem großen Kriege und ihren künftigen Heldentaten gesprochen hatten. Die Offiziere waren zweifellos mit Leib und Seele Soldat, und die Uniform stand ihnen wirklich prächtig, mit dem Munde aber schlug man keine Schlachten. Hinter der russischen Grenze stand ein Millionenheer, der riesige Bär, der seine Tatzen zum gewaltigen Schlag reckte! und das blieb höchstwahrscheinlich nicht der einzige Feind, mit dem die Deutschen abrechnen mussten. Hinter den Vogesenpassen, im Schutze seiner uneinnehmbaren Festungen und Sperrforts, so hieß es allgemein, wartete ja der treue Bundesgenosse der Russen nur auf den längst ersehnten Augenblick, um die große Revanche nehmen zu können und sein geliebtes „Alsace-Lorraine“ mit kühnem Handstreich wieder zurückzuholen. Nein, so simpel, wie diese Herren Deutschman sich das dachten, war die Lage gewiss nicht! Und es blieb nur gut, dass vorläufig England sich völlig abwartend verhielt, denn das ging aus der „Times“ und den „News“ doch wohl unverhüllt hervor, die sich Miss Scoolfield gestern auf dem Bahnhof Friedrichstraße erstanden hatte. Aber wenn es doch, was sie nicht für möglich hielt, anders kommen sollte, was dann? Würden die deutschen Offiziere dann auch noch so zuversichtlich und fast tollkühn sich gebärden. Nein, dann würden sie kleinlaut werden, dachte sie. Wie lächerlich war ihr das vor wenigen Tagen vorgekommen, als der blonde Kapitänleutnant Hermann auf Westerland das Loblied der deutschen Flotte gesungen hatte, und nun gar erst gestern der junge Fähnrich z. S., dem noch nie die richtige Seeluft um die Wangen geblasen hatte. Wirklich lächerlich — sie fand keinen andern Ausdruck dafür — war diese Großmannssucht des Volkes mit der „Luxusflotte“. Wenn die Musterflotte ihre eisernen Flossen nur regen würde, da würden sich die winzigen Fischchen, die auf der Nord- und Ostsee schwammen, eiligst verkriechen, aber zu diesem erschütternden Ende brauchte es ja nicht gleich zu kommen. Im Grunde hatte Miss Grace die braven Deutschen mit ihrem unbesiegbaren Idealismus, ihren hausbackenen Ansichten und mit ihrem Fleiß und dem guten Willen, es den Engländern gleich zu tun — was sich natürlich letzten Endes im Köpfchen der hübschen Miss Grace als ein Ding der Unmöglichkeit malte — so etwas wie achten gelernt.
Der gestrige Abend, vorausgesetzt, dass die „Hurrastimmung“ nicht ebenso schnell verpuffte, wie sie entzündet worden war, hatte sogar zu denken gegeben. Dieses Volk, das von Parteien zerrissen sein sollte, wo immer und ewig ein heilloses Nichtverstehen zwischen den Besitzenden und den vielen, vielen Arbeitern herrschte, hatte sich gestern als die einmütigste Masse gezeigt, die sich denken ließ.
Unwillkürlich musste Miss Grace an ihr Vaterland denken, und sie fragte sich betroffen, ob man dort dieses selben Begeisterungstaumels fähig sei, wie sie ihn hier miterlebt hatte.
In England neigte die große Masse nicht zum Kriege. Der Kaufmann und die Heere der Arbeiter hatten nicht den Wunsch, ihre Geschäfte stillstehen und ihren Verdienst fahren zu lassen. Eine Kriegsstimmung, wie sie dieses „Volk in Waffen“ zeigte, war bei ihren Landsleuten undenkbar.
Grete hatte die Tassen gefüllt. Die Engländerin dankte.
„Es ist gut“, sagte sie, „ich werde es vermeiden von einem russischen Regiment zu sprechen, schon weil es zu Verwechslungen führen würde. Aber es ist trotzdem richtig, dass der Zar Nikolaus der Chef des Alexander-Garde-Regiments ist.“
„Aber die längste Zeit gewesen! Mein Bruder hatte einen russischen Orden und hat nichts eiliger gehabt, als ihn zu entfernen —“ „Bravo! Davon weiß ich ja noch gar nichts!“ Onkel Fritz Schmellin reichte den beiden jungen Damen die Hand. „Morjen, Greteken! Morjen, meine verehrte Miss Grace! Ja, selbstredend! Die russischen Orden müssen ‘runter! Auf die Heldenbrust gehört ein Kreuz von Eisen. Denn ein eiserner Krieg wird’s. Hier bitte: Feind Nummero zwei!“ Er schwang ein Extrablatt in der Hand. „Hab’ ich grade einem Chauffeur aus der Hand gerissen.“ In der Halle des Hotels hörte man lautes Stimmengewirr. „Der Krieg von Russland und von Frankreich eröffnet!“ stand in fetten Buchstaben über dem Blatte. Onkel Fritz las vor: „Russland hat heute Nacht an zwei Stellen deutsches Reichsgebiet angegriffen und damit den Krieg gegen uns eröffnet. Frankreich hat die volle Mobilisierung der französischen Streitkräfte angeordnet!1 — Na, was sagste nu, Greteken?“
„Lass sehen, was steht denn noch darunter?“
„Na, dass wir sie, wie zu erwarten war, abgeschmiert haben. Unsere Leutchens an der Grenze sind doch nicht von gestern! Hier hast Du’s: Heute Nacht hat ein Angriff russischer Patrouillen gegen die Brücke über die Warthe bei Eichenried stattgefunden, der Angriff ist abgewiesen. Kosaken reiten auf Johannisburg. — Schöne Geschichte! Hiernach steht’s also bombenfest, dass die Moskowiter deutsches Gebiet anzutasten wagten. Na warte, Euer frevles Spiel soll Euch teuer zu stehen kommen, und der Schlag, den sie gegen uns zu führen versuchen, wird auf die Friedensstörer zurückfallen. Das besorgen schon unsere ostpreußischen Jungen!“
„Also ist auch die letzte Hoffnung hin, dass noch Frieden bliebe?“
„Endgültig! Jetzt reden lediglich noch die Flinten und Kanonen — an der Weichsel, wie am Rhein! Denn der gallische Hahn spektakelt ja auch schon, wie wir das nicht anders erwartet hatten. Krieg gegen zwei Fronten! Längst vorgesehen! Bleibt noch England —“
„Darüber kann ich Sie beruhigen, Herr von Schmellin“, unterbrach ihn die Miss. „England wird sich nicht einmischen. Ich kann es Ihnen vorlesen.“ Tatsächlich erschien diese Meldung, soweit sie die Kriegseröffnung durch Russland betrifft, erst am 2. August mittags 1 Uhr. Die Mobilisierung Frankreichs wurde 1 Uhr 30 nachts gemeldet und in Morgenausgaben der Tageszeitungen vom 2. August zuerst bekanntgegeben.
„Danke sehr!“ Er wehrte lächelnd ab. „Und zu beruhigen brauchen Sie mich nicht. Sie haben gehört, dass wir uns nicht fürchten, weder vor zwei Gegnern, noch auch vor mehr — wenn’s sein muss. Und ob wir zur See auch noch unsere Ehre verteidigen sollen, uns soll die Welt unserer Feinde und Neider auch da gerüstet finden. Wenn sich Ihr schönes Britannien neutral hält, umso besser! Sein Schade ist’s nicht, wenn’s nicht mit den Slawen und Königsmördern gemeinsame Sache macht.“
„Nein, das tut es niemals! England wird sich seiner Ehre bewusst bleiben. England wird Schiedsmann sein!“
„Hoffen wir’s! Stolz lob’ ich — die Briten mir! Warten wir also ab und trinken wir Tee! Wo steckten denn Gottfried?“
„Er ist schon in der Stadt, es ließ ihm keine Ruhe.“
„Versteh’ ich! Und Mama? — Ah, da ist sie ja selbst!“ Er erhob sich und ging den beiden eintretenden Damen entgegen. Es war seine Schwester Charlotte v. Babenberg und seine Schwägerin, die Gattin des Majors Kurt v. Schmellin, die gestern keinen Anschluss mehr nach Hannover bekommen hatte. Der Gatte war schon drei Tage früher als die übrige Familie von Westerland abgereist. Eine geheime Depesche des Kommandierenden Generals v. Emmich, dessen Stab der Major Kurt Schmellin angehörte, war das erste Sturmzeichen gewesen, das die friedlich an der blauen See weilenden Verwandten aufgeschreckt hatte. Auch andere von den Herren, Mit denen man an der See bekannt geworden war, waren Hals über Kopf abgereist; als einer der ersten der Kapitänleutnant Hermann. Und schließlich war der Sierstädter, er, der Junggeselle und „Vaterlandskrüppel“ (wie er sich selbst verspottete), Fritz Schmellin, mit den Damen und den jüngeren Söhnen allein gewesen. Aber der drohende Kriegszustand hatte auch ihrem sonnigen Aufenthalt an der Nordsee wenige Tage später ein Ende gemacht. Fast fluchtartig hatten alle Badegäste die Insel verlassen, und unter ihnen, die mit genauer Not in drangvoller Enge gestern nach Berlin geeilt waren, waren auch die sieben Personen gewesen, die jetzt am Frühstückstische saßen: Onkel Fritz, die Majorin mit ihrem Sohn Wichard, Charlotte v. Babenberg mit Grete, dem zehnjährigen Heinz und der Miss, und als achter kam noch Gottfried Babenberg hinzu, der, wie der Kadett Wichard sagte, ins Reichsmarineamt an der Königin Augusta-Straße gefahren war.
Man beeilte sich mit dem Frühstück. Die Damen waren ruhig und gefasst, oder verbargen wenigstens ihre Unruhe. Es ist auch für eine Offiziersfrau nichts Leichtes, über den plötzlichen Trennungsschmerz hinwegzukommen. Die Majorin sah den Gatten, vielleicht auch ihren Wichard in den Kampf gehen, und Frau Charlotte hatte zwei Söhne, die zu den Fahnen eilten. Aber es war doch wieder etwas Schönes, wie diese beiden Frauen ihr Leid nicht laut werden ließen, sondern tapfer und demütig und voll frohen Gottvertrauens dem Unabwendbaren ins Auge sahen.
„Auf keinen Fall möchte ich den Frühgottesdienst im Dom versäumen“, sagte Frau v. Babenberg.
„Und ich schließe mich an“, setzte die Schwägerin hinzu. „Vor ein Uhr geht auch mein Zug nicht nach Hannover. Ich habe soeben an Kurt telegraphiert.“ „Recht so! Und Wichard willst Du doch nicht wieder mitnehmen?“ „Ich fürchte fast, dass er hierbleiben muss. Hast Du noch keine telephonische Verbindung mit Lichterfelde, mein Sohn?“ Der große, blonde Junge schüttelte den Kopf. „War nich zu machen — hier im Hotel wenigstens nicht. Die Fernsprecher sind ja förmlich belagert, und da ich das Frühstück in diesem Hotel unbedingt nicht versäumen wollte, habe ich mir die große Frage an das Schicksal aufgespart.“
„Nu seh’ einer diesen Ausbund an! Jeder andere in Deiner Lage würde Essen und Trinken vergessen!“ „O bitte! Der berühmte Feldherr Julius Caesar hat gesagt, dass die Siege durch den Magen gehen! Und außerdem ist die Antwort, die mir der Feldwebelleutnant geben wird, ziemlich sicher, die lautet natürlich: Sofortige Rückkehr — das Vaterland braucht seine Helden!“
„Na pass’ auf! Ich wünsch’ Dir zwar von ganzem Herzen, dass Du mit unter denjenigen bist, die als Fähnrich eingereiht werden, aber ob Du auch wirklich schon dran kommst und nicht vielleicht bloß als Schildwache irgendwo verwendet wirst, ist noch gar nicht heraus. Wärest Du nicht, dank Deinem ausgeprägten Sitzfleisch, zu Ostern in Sekunda B zurückgeblieben —“
„Hat im Kriegsfalle durchaus nichts zu sagen, lieber Onkel Fritz! Inter arma silent musae, auf gut deutsch: Lebe wohl, Hörsaal der Königlichen Sekunda! Jetzt entscheidet nur das Lebensalter und der Brustumfang und beides ist zufriedenstellend.“
„Meinst Du wirklich, dass Du ein Notexamen machen kannst?“ fragte die Cousine.
Der Kadett warf sich in die Brust. „Ich werde Dir Gelegenheit geben, mich binnen heute und drei Tagen in der feldgrauen Uniform eines Fähnrichs bewundern zu können. Ich nehme Wetten entgegen.“ Da stürmte der Fähnrich z. S. in den Frühstücksraum. Sein Gesicht strahlte. Die Blicke der Gäste an den anderen Tischen wandten sich auf die geschmeidige Gestalt. Jeder schien es zu ahnen, welche Botschaft es war, die die Augen des Jünglings leuchten ließ. Mit drei Schritten war er an der Seite seiner Mutter. „Ich reise heute Nachmittag, Muttchen! Kiel! Schiff ist geheim.“ Er wandte sich um. „Wenigstens für die Allgemeinheit. Meinem guten Muttchen werde ich es noch unter vier Augen anvertrauen.“
In Frau Charlottes Augen schimmerte eine Träne. Sie perlte die Wange hinunter, aber die Lippen versuchten ein Lächeln zu formen. Sie stand auf. Auch in Onkel Fritzens Augen glänzte es. „Mittags? Eine kurze Frist! Wohlan denn! Aber eins möchte ich noch vorschlagen. Im Dom wird ein unglaublicher Andrang sein. Ich höre eben vom Geschäftsführer, dass am Bismarckdenkmal ein Gottesdienst unter freiem Himmel abgehalten wird. Da hätten wir es sogar näher, und wenn wir keine Zeit verlieren, können wir noch einen guten Platz bekommen.“
Der Vorschlag fand den Beifall der Damen. Wenige Minuten später waren alle schon auf dem Wege. Ein stiller entschlossener Ernst lag auf den Gesichtern der Menschen, die ihnen entgegenkamen und an ihnen vorbeidrängten. Eine ununterbrochene Kette von Droschken mit riesenhaften Koffer und Gepäckstücken kam von den Bahnhöfen. Das war kein ungewohntes Bild, gestern hatte man den ungeheuren Rückstrom, der aus den Bädern stattfand, selbstbeteiligt an sich vorbeifluten sehen. Heute war dieser Verkehr noch gewachsen. Wie manches, aus entlegener Sommerfrische herbeigeeilte Ehepaar war in den Droschken zu sehen! Müde und übernächtig, erschöpft von endloser Fahrt, drängten manche Mutter, mancher alte, weißbärtige Vater fiebernd nach Hause, von dem einen Gedanken beseelt, den geliebten Sohn noch einmal zu sehen und zu umarmen. Und daneben junge, wettergebräunte, in den Seebädern oder auf den Feldern wie die Nubier braun“ gebrannte Gestalten, die selbst dem Mobilmachungsbefehl Folge leisteten und zu ihren Regimentern eilen mussten. Reisende mit Bergstöcken dazwischen, Reservisten und Landwehrleute, die mit Köfferchen und Pappkasten zu ihren Truppen“ teilen wollten. Und inmitten der Scharen der Ankommenden und Abreisenden, die von und zu den Bahnhöfen drängten und jede Droschke, jeden Kraftwagen mit Beschlag belegt hatten, den kriegerischen Charakter des flutenden Bildes noch erhöhend, Offiziere aller Waffengattungen und aller Stämme, viele schon feldmarschmäßig, in der grauen oder grünen Einheitstracht, den Stoffbezug über Helm oder Tschako. Und je näher man dem Reichstagsgebäude kam, umso mehr drängten sich die Menschen, die einander wildfremd waren und doch eine selbstverständliche Zusammengehörigkeit hatten. Manche deutsche Frau, manches Mädchen hatte verweinte Augen, aber es war ein stiller, in sich gekehrter, würdiger Schmerz. Die Frauen und Mädchen wussten, wofür ihre Männer und Ernährer, ihre Söhne und Brüder ins Feld ziehen mussten. Niemand unter allen, die hier zusammengeströmt waren, um den allmächtigen Gott um Hilfe für unser braves Heer anzuflehen, der nicht gefasst sich der Bedeutung dieser Stunden für das bedrohte Vaterland bewusst war. Ein einziger, machtvoller Wille und unverrückbarer Glaube beseelte alle diese großen und kleinen, jungen und alten, reichen und armen Menschen, die, welche auf ihren Posten eilten, wie die anderen, deren daheim die ernsten Pflichten harrten: der Wille, den aufgezwungenen großen Kampf aufzunehmen, hinzunehmen und alles einzusetzen für das von hinterhältigen Feinden angegriffene deutsche Vaterland!
Und so traten sie vor ihren Gott. So standen sie vom Reichstagsgebäude bis zur Siegessäule, vom Tiergarten bis zur Roonstraße, Kopf an Kopf, Schulter an Schulter, ein unzählbares Heer von Andächtigen. Die Treppe zum Reichstag, zum Bismarckdenkmal, zur Siegessäule, die Sockel und Mauervorsprünge der stolzen Gebäude und Denkmäler waren dicht besetzt und von vielen mit Mühe erklettert worden. Die große Freitreppe war der Altar, die Regimentskapelle der Garde- Füsiliere ersetzte die Orgel. Als klare, strahlende Kuppel wölbte sich, groß wie das Schicksal, das auf diesen Männern und Frauen lag, der wolkenlose, blaue Himmel.
Fast war kein lautes Wort zu hören. Weihevoll, ehrfurchtsvoll standen die Hunderttausende zu den Füßen des schwarzbronzenen Siegfried, zu Füßen des Schmiedes vom Sachsenwald, der dieses Volk im blutigen Waffentanz vor 43 Jahren zur Einheit zusammengeschweißt hatte. Einig, nie, niemals einiger harrte die unvergleichbare Menschenmenge zu den Füßen ihres unvergleichlichen Nationalhelden.
Dicht bei der Kapelle hatte Fritz Schmellin mit seinen Verwandten Platz gefunden. Nur die Miss fehlte, die es vorgezogen hatte, zu ihrem Konsul zu fahren. Und dann klangen wuchtig anschwellend die Klänge der Regimentsmusik, deren Helmspitzen und messingene Instrumente über den unendlichen Platz mit seinen Riesenchören funkelten. Und diese Riesenchöre, einander zugewandt, sangen es mit, was die Orgel intonierte. Nie wurde in heiligerer Stimmung von Preußen und Deutschen ein Gotteslied gesungen.
„Wir treten zum Beten, vor Gott, den Gerechten,
er waltet und haltet ein strenges Gericht,
er lässt von den Schlechten die Guten nicht knechten;
sein Name sei gelobt, er vergisst unser nicht!“
Auf den oberen Stufen stand ein junger Priester. Der Licentiat und Hofprediger Doehring. Seine Gestalt reckte sich hoch, seine Augen blitzten. Er schien, als er die Hände faltete, seinem Gott inbrünstig dafür zu danken, dass er ihn auserwählt hatte, an solchem Tage zu solcher Gemeinde zu reden.
„Dein Name sei gelobt, o, Herr, mach’ uns frei!
Herr, mach’ uns frei!“
schloss das Niederländische Dankgebet. Gleich darauf begann der Streiter Gottes im schlichten Talar und predigte den Tausenden. Es waren Gottesworte, die nicht den Schmerz schonten und nicht die drohende Trauer umgingen, aber Worte, die jeder verstand, der ein Deutscher war; Worte, die auch der hätte sprechen können, der dort auf granitnem Sockel als Bronzebildnis stand. Der Name des Mannes, in dessen Schatten die Predigt gehalten wurde, schwebte auf aller Lippen. „Fürchte Dich vor keinem, das Du leiden musst“, hieß es in den Offenbarungsworten, die die Rede einleiteten, Treue, Gläubigkeit an Gott, an König und Kaiser und die Führer, Getrostheit vor dem Schicksal, das waren die Grundgedanken, die des Predigers helltönende Stimme behandelte. „Wir Deutschen fürchten Gott, und sonst nichts in der Welt!’ schien es auf den Lippen des Geistes zu stehen, den sein Volk in dieser Stunde heraufbeschwor.
In Andacht versunken lauschten die Menschen. Wohl gab es viele, viele, deren Herzen von herbem Weh zerrissen waren, deren Tränen flossen, Frauen und Männer, Mütter und Väter, die die Schrecken des Krieges schon miterlebt hatten, denen alte Wunden, die sie längst vernarbt geglaubt hatten, wieder zu brennen begannen, aber auch die Jungen und die Jüngsten, die Zurückbleibenden, die die so nahe bevorstehenden bitteren Szenen kaum vom Hörensagen oder nur aus Kriegsschilderungen kannten — keines von allen brauchte sich seiner Tränen edelster Rührung zu schämen. Aber keiner sandte seine Klage laut zum Himmel. Ein Volk, ein Gott, ein Glaube beseelte sie alle, der Glaube an den Sieg — und wenn die Welt voll Teufel wär’! Barhäuptig sprachen, als der Prediger endete, all diese ungezählten Brüder und Schwestern in leisem Chor die Worte des Vater Unsers. Dann sangen sie das alte Luthersche Schlachtlied.
Und als es verbraust war, quoll aus der Mitte die stolze, in diesen Tagen so oft gesungene Nationalhymne zum Himmel empor. Im Nu ergriff sie den ganzen, riesigen Platz. Und Märsche folgten und die alten Lieder, und, während lauter die Füsiliere die Weisen schmetterten, kam Feuer und Leben in die Augen, die eben noch den Worten des Geistlichen nachgeweint hatten. In Begeisterung, Hoffnungsfreudigkeit und Siegeszuversicht klang diese große, erhabene Stunde aus, und diese Stimmung blieb haften.
Fritz v. Schmellin hatte den Arm seiner Schwester genommen. „Nicht bange sein, Lotte! Sieh Deinen Jungen an, steh sie alle an, die hier auseinanderströmen. Da ist keiner, der mit stockendem Fuß in den heiligen Krieg geht. Neben mir stand ein Mütterchen, dass sich an ihren Sohn schmiegte; unter Tränen lachte sie ihm zu, wenn sie in seine stolzen Augen sah. Und bei dem jungen Pärchen rechts von mir, das gerade von der Nottrauung zu kommen schien — denn das nette Weibchen hatte noch die Myrrhe im Haar — war’s nicht viel anders. Herzhafter ist nie ein Volk in den Kampf gezogen, als dieses. Wenn ich’s gestern noch hätte bezweifeln können, die heutige Feier hätte mir’s gezeigt.“
Frau v. Babenberg nickte. „Wie Gott will!“ Weiter sagte sie nichts.
„Geht da nicht“, sagte plötzlich der Sierstädter und blieb stehen, „geht da nicht unser Amtsrichter aus Westerland? Aber natürlich, er ist’s! Den muss ich unbedingt begrüßen, und wenn’s bloß wär’, um wieder sein gemütliches Münchnerisch zu hören! — Hallo, Herr Dr. Sedlmayr!“
Der Angerufene drehte sich um. „Ah so!“ sagte er. „Dös is fei net schlecht! Der Herr Baron!“ Und er arbeitete sich zu Schmellin durch. Er kam nicht allein. „Erlauben’s — ich derf Eahna bekannt machen — Herr Baron v. Schmellin — Herr Hauptmann Hering.“
„Freut mich, freut mich! Also, bitte! Wer hatte nu recht?“
„Ja freili hab’n Sie recht g’habt, lieber Baron. I hab’s net gern glauben wollen, damals, wia wir in den Dünen gelegen sind, und Sie hab’n allweil was dahergeredt von grauslichen Gewitterwolken an politischen Horizont. Nu bin i aa scho Hals über Kopf hier. In zwoa Stund geht’s stracks nach Bamberg!“
„Nach —?“
„Bamberg. Net München. Ja, hab’ i Eahna net verzählt, dass i Königl. Bayerischer Landwehrmann bin? Oberleitnant. Da schaun’s! Ja, des Bäucherls zuwegen, netwahr? — Na — es hat mich g’freit, Herr Baron. I seh’, Sie sind net solo. Empfehlens mich den Damen! Heit. wer wär’ net pressiert!“
Sie schüttelten einander die Hände. „Also Heil! Heil und Sieg, lieber Amtsrichter! Und Heil den wackeren Bajuvaren daheim!“
„Die machen’s! B’hüt Eahna Gott, Herr Baron!“ Noch einmal lüftete er den breitrandigen Hut. Dann trennte ihn und seinen Begleiter die vorüberflutende Menschenwelle.
„War doch mein Amtsrichter“, sagte er. „Wollte in Westerland schlank werden und lachte mich aus, als ich zum Aufbruch drängte. Jetzt ist er selbst schon sozusagen im Dienst, Landwehroffizier. Ja, Herrschaften, allmählich bekomm’ ich’s mit der Angst, dass ich der einzige aus der Verwandtschaft und Bekanntschaft bin, der zu Hause als Drohne zurückbleibt. Grässlich!“
„Beruhige Dich, Onkel Fritz“, sagte der Kadett Wichard, „Heinz ist ja auch noch da!“ „Habt Ihr so was schon erlebt?“ brauste der Onkel auf. Man war jetzt dicht am Brandenburger Tor. „Jetzt tanzen schon die Jüngsten ihrem Erbonkel auf der Nase herum!“ „Ich gehe auch mit in den Krieg“, erklärte der zehnjährige Heinz. „Die Miss hat gesagt, was die andern könnten, könnte ich auch.“
„Dann hat sie Dir was Scheusäliges beigebracht. Du lüttes Nesthäkchen! Ich weiß überhaupt nicht, liebe Lotte, ob es nicht angezeigt und an der Zeit ist, der guten Scoolfield so’n ganzen kleinen Wink mit dem Zaunspfahl zu geben — hm —“ „Ich dachte auch daran, „ sagte Grete, die ihren Arm in den der Majorin gelegt hatte.
„Zumal die allgemeine Lage“, ergänzte der Fähnrich z. S. die Schwester, „darauf hindeutet, dass die lange in der Luft liegende Abrechnung mit der „Musterflotte“ nicht auf sich warten lässt.“
„Schnackste auch schon klug?“ Onkel Fritz lachte. „Nee, im Ernst! Ich trau’ dem verehrten Tom Atkin auch nich über den Weg. Die Leute, Herr Edward Greg an der Spitze, reden sich gern ins Feuer, wenn’s ums liebe Verdienen geht, und sind neidischer als alle, alle anderen zusammen auf unsere Erfolge. Sollte mich Zeit meines Lebens wundern, wenn ausgerechnet sie, die sonst beim kleinsten Anlass ihre schöne Krämerseele entdeckten, sich nun die große Gelegenheit entgehen lassen, mal feste im Trüben zu fischen.“
„Aber die Engländer sind doch Germanen“, warf die Schwägerin ein. „Das wäre doch ein Bruderkrieg!“
„Na, liebe Hertha, darüber streiten sich noch die Gelehrten, ob die Vetternschaft wirklich so echt ist. Nach dem von Freund Wichard zitierten General Caesar saßen in Britannien ausschließlich Kelten. Später sind dann von Skandinavien her ein paar Angeln angeschwommen gekommen, aber die waren doch recht in der Minderzahl. Bleibt für den Kenner nur die Sprachverwandtschaft — ja, und die ist bestimmt nicht dicker als Wasser.“ „Onkel Fritz war nie gut auf die Engländer zu sprechen, „ meinte seine Schwester. „Ich besinne mich noch ganz genau auf Dein entsetztes Gesicht, als Du hörtest, dass Miss Grace in Haus Müncheberg ihren Einzug halten würde.“ „Na, wenn auch! Nachgetragen hab’ ich’s ihr nicht —“ Er brach ab. Ein Hurrabrausen wurde laut. Hupenzeichen klangen fanfarenartig von weitem, und die Menge drängte nach einer bestimmten Richtung, so dass für den Fahrweg Unter den Linden nur eine schmale Rinne blieb. Im Galopp sprengten auch schon berittene Schutzleute herzu. Drei Kaiserliche Autos kamen, stürmisch umjubelt, vom Schlosse und nahmen den Weg nach dem Brandenburger Tor. Schon hatte man den Kaiser erkannt. In Generalsuniform saß er im ersten der offenen Wagen, die Kaiserin, ganz in Weiß, neben ihm. Er sah ernst aus, aber einen Augenblick ging es wie ein sonniges Lächeln über sein gebräuntes Angesicht. Er musste es ja fühlen und froh empfinden, dass die Huldigungen, die ihm sein deutsches Volk darbrachte, nie echter gewesen waren, als gerade heute.
Die Hand am Helm fuhr er durch die ihm zujubelnden Menschenmauern. Und im nächsten offenen Auto saß der Kronprinz in der Uniform seiner Totenkopfhusaren, und auf erhöhtem Sitz, vor dem Elternpaar, „Kronprinzens Ältester“, fröhlich mit dem bloßen Ärmchen in die Menge winkend, die sich bis dicht an den Wagen drängte und ihn fast aufzuhalten drohte. Im Schritt musste auch der nachfolgende Wagen sich seinen Weg bahnen. Er brachte den Herzog Ernst August und die junge Kaisertochter. Das Hüte schwenken und Hurrarufen wollte kein Ende nehmen. Nein, heute war nicht nur der Tag der Erregung und der Tag der Tränen, heute war auch der Tag des klaren, geläuterten Gefühls, der Tag, der den Herzen den Mut gab für die große beginnende Sache, Mut und Vertrauen auf die deutsche Kraft, Einigkeit und Stärke. Und vor allem füllte die Herzen aller, die tausendfältig dahinwogten, das Vertrauen, dass das blanke Schwert nie für eine gerechtere Sache gezogen worden war . . . Immer mehr der feldgrauen Uniformen tauchten auf. Burschen, die mit ihren Leutnants zur Bahn eilten, Reservisten, die schon eingekleidet waren, weinende Bräute, die still sich ihren Soldaten in den Arm hingen, Generale, die im Auto vorüberjagten, kofferbeladene Droschken.
Und auf Schritt und Tritt begegnete man Gerüchten, die sich mit unheimlicher Schnelligkeit verbreiteten. Eine Bewegung kam in die Menschenmenge, als jetzt auch Extrablätter die Nachricht bestätigten, dass die Russen deutsches Gebiet angegriffen hatten. Und Frankreich hatte eine ausweichende Antwort auf die deutsche Anfrage gegeben, die gleichzeitig mit dem Ultimatum an Russland abgesandt war. Und immer wieder schwirrten neue Alarmnachrichten durch die Luft. „In Kochem hat ein Verräter den Tunnel sprengen wollen!“ „Bei Geldern sind 80 französische Offiziere als Spione entdeckt!“
„Ausgeschlossen! Bedenken Sie bloß die Zahl!“
„Doch doch! Sie sind als deutsche Offiziere verkleidet in Automobilen gekommen!“
„Und die Kosaken! Die Kosaken reiten schon auf Insterburg!“
„Ach Unsinn! Kommt nicht ein einziger bei uns ‘rein!“
„Un wenn schon, denn sitzt er in die Mausefalle. ‘raus lass’ ma keenen wieda! Die soll’n in de masurischen Seen schwimmen lern’!“
In der Wilhelmstraße begegnete den Schmellins ein Marineoffizier. Er stutzte und errötete. Dann ging ein frohes Leuchten über sein Gesicht. Er grüßte.
„Ist es die Möglichkeit? Mein lieber Kapitänleutnant?“
„Wir wähnten Sie längst auf hoher See!“ setzte Frau Charlotte hinzu. In jähem Erröten war Grete v. Babenberg stehen geblieben. Kapitänleutnant Hermann drückte den Damen die Hand. „Ich bin ebenfalls aufs freudigste überrascht sagte er, und sein Blick suchte den Gretes. „Ich wurde schnurstracks zum Reichsmarineamt geschickt. Eine Sondermission. Aber Sie dürfen nicht denken, dass ich hier zum Stillsitzen verdammt wäre. In drei Tagen bin ich wieder in Kiel!“
„Gottfried heute schon!“ sagte Frau v. Babenberg.
„Gratuliere! — Die Feuerprobe wird nicht auf sich warten lassen!“
„Also Sie glauben auch, dass uns England den Fehdehandschuh hinwerfen wird?“ forschte der Sierstädter.
„Ich möchte sagen: Wir hoffen es sogar!“ Wieder gingen seine Blicke zu Grete Babenberg hinüber. Sie schlug die Augen nieder, ihr Herz klopfte ungestüm. Der Klang dieser Stimme war ihr Musik, und dieses unverhoffte Wiedersehen schien ihr ein kostbares Geschenk des Himmels.
Der Kapitänleutnant hielt sich an ihrer Seite. „Oder meinen Sie, wir fragten nicht, wo jetzt das Heer nach zwei Fronten seine alte Schlagkraft zeigen will, vor Ungeduld zitternd: Und wir? — Nein, die Frage wird bald wunschgemäß beantwortet werden.“
Er sagte es mit der zuversichtlichen Begeisterung, mit der er schon auf Westerland das Lob der jungen Flotte gesungen hatte. „Wir wollen auch unseren Waffentanz haben und einen ebenbürtigen Gegner dazu!“
„Und doch ist England der mächtigste Gegner zur See, den die Welt kennt!“ Grete hatte es gesagt.
„Eben drum. ‘Ran an den Feind! heißt unsre Losung. Und vielleicht fuhr er fort, „hat, während wir hier steh’n und plaudern, das erste Kapitel schon begonnen.“
„Eine Frage! Haben Sie etwas Eiliges vor? oder darf ich Sie bitten, mit uns zu frühstücken?“ fragte Onkel Fritz. Ein dankbarer Blick aus den Augen der Nichte traf ihn. Sie wusste die Antwort, die der Kapitänleutnant geben würde; eine innere Stimme sagte es ihr. Und sie sollte sich nicht getäuscht haben.
„Sie kommen meiner Bitte zuvor, Baron Schmellin. Ich wollte eben fragen, ob Sie Ihrem „Badebekannten“ erlauben, dass er Ihnen noch seine Aufwartung macht. Mein Aufbruch in Westerland verbot mir ja leider, mich förmlich von Ihnen zu verabschieden, und ich habe mir im Stillen schwere Vorwürfe gemacht. Die gemeinsamen Stunden waren doch so herrlich —“ „Das will ich meinen! Also verleben wir noch ein Stündchen in angenehmen Erinnerungen!“ Onkel Fritz ging voraus. Am Kaiserhof-Hotel stand eine Gruppe von höheren Offizieren mit ihren Damen. In der Halle herrschte ein buntes Durcheinander. Ausländer mit ihren Koffern, Amerikaner, Russen, Engländer und Franzosen drängten zum Aufbruch. Man hatte erfahren, dass der Friedensfahrplan nur noch heute in Kraft sei, darnach war also höchste Eile geboten. Auch hatte es die ungewöhnliche und doch so berechtigte Maßnahme gegeben, dass die politische Polizei ihre Beamten ins Hotel geschickt und die Reisepässe der Fremden geprüft hatte. Überall sah man erregte Gesichter, und eine Amerikanerin erzählte, dass eine Anzahl Verhaftungen vorgekommen seien, es wurden auch Namen von hochstehenden Russen genannt.
In den Empfangsräumen des Hauses aber herrschte die vornehme Ruhe, wie zu jeder anderen Zeit vor. In den roten Ledersesseln um die kleinen Tische saßen ein paar bekannte Herren von Fritz Schmellin, Rittergutsbesitzer und Reichstags- oder Landtagsabgeordnete. Man winkte dem Sierstädter zu. Sie besprachen lebhaft die Rede, die der Kaiser gestern Abend vom Balkon des Schlosses gehalten hatte. „Ich kenne keine Parteien mehr“, hatte es darin geheißen. „Ich kenne nur noch Deutsche!“ Der eine der Herren, ein Graf Kastal, hatte sich erhoben und brachte einen Trinkspruch auf seine Majestät aus, und ein anderer, Landrat Prengel, sprach von der bevorstehenden Einberufung des Reichstages, und als Schmellin mit den Damen in dem hinteren Raum des behaglichen Hallenbaues Platz genommen hatte, hörte man auch diesen Abgeordneten die Stimme zu einem Trinkspruch erheben: — „Zum heiligen Verteidigungskampfe! Wir wollen kämpfen für westliche Kultur, gegen östliches Barbarentum.
Vom Reichstage her soll es bis in die letzte Hütte unseres Landes, in das die Kosaken schon eingebrochen sind, als Echo erklingen zu dem Aufruf des Kaisers; Deutschland ist einig! Die Welt soll es erfahren: Das Volk steht auf, der Sturm bricht los!“ Und ein Hurra erklang auf Kaiser und Reich, auf Volk und Heer . . .
Man hatte kaum Platz genommen, als sich Werner v. Babenberg einstellte. „Das Regiment marschiert erst am 6. Mobilmachungstage. Leider! Ihr ahnt ja nicht, wie unsere Grenadiere darauf brennen, an den Feind zu kommen! Natürlich gleicht unsere Kaserne schon jetzt einem Feldlager —“ Onkel Fritz stellte seinen Neffen dem Kapitänleutnant vor, und die beiden schüttelten einander die Hände wie zwei alte Bekannte und standen einander doch das erste Mal gegenüber. Beide waren groß und blond, farblos blond fast war Werner, und diese Haarfarbe hatten auch die Brüder Gottfried und Heinz. Nur Grete war etwas dunkler, und gerade sie kleidete das. Und beide, der Seeoffizier, wie der Garde-Grenadier, hatten fast etwas unnatürlich tiefblaue Augen, als wären beide von friesischem Stamme. Unwillkürlich fragte die Majorin: „Wo sind Sie doch zu Hause, Herr Hermann?“ Er antwortete, dass er Holste sei. Werner hatte jemanden mit seinen Blicken gesucht, endlich fragte er seinen Bruder Gottfried. „Du, sag’ mal, Friedel, wo steckt denn die Miss?“
Der Jüngere blinzelte dem Älteren zu, als wollte er sagen: „Das ahnte ich schon lange, dass Dir hier etwas fehlte,“ dann meinte er achselzuckend: „Ich weiß es wahrhaftig nicht, ich habe jetzt an andere Dinge zu denken, aber da Du in der glücklichen Lage bist, mehr Zeit zum Abschiednehmen zu haben, wirst Du schon noch Gelegenheit finden. Miss Grace Lebewohl sagen zu können.“
Werner lachte. „Friedel, biste eifersüchtig? Das ist ja kostbar!“ Schon gestern Abend hatte er wiederholt einen der schmachtenden Blicke aufgefangen, mit denen der jüngere Bruder die Engländerin bombardierte. Sollten sie beide denselben Geschmack haben?
Er hatte es leise gesagt. Ebenso antwortete der Fähnrich. „Warum das kostbar sein soll, sehe ich nicht ein. Ich meine nur, was dem einen recht ist, sollte dem andern billig sein, und da ich die Ahnung habe, dass ich Miss Grace nie wiedersehen werde in diesem Leben —„
„I wo! Du gräbst Dir doch nich selbst schon ‘n Wogengrab? Nee, Friedel! Du kommst gefälligst genau so frisch und munter wieder, wie Du heute an Bord gehst!“
„Steht nicht bei mir. Aber wenn auch! Die Miss wird dann nicht mehr hier sein. Es wurde schon davon gesprochen. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie bereits oben ihre Siebensachen packte.“
Onkel Fritz hatte Sekt bestellt. Er füllte die Spitzgläser. Seine Schwester und auch die Schwägerin wehrten ab, aber er meinte, das gehöre zu so ‘nein Tage. Und er stieß mit den Neffen auf glückliche Heimkehr an: „Sorg mir dafür, Werner, dass Ihr die olle Champagne erobert, dann feiern wir den Einzug unserer Helden mit neudeutschem Champagner.“
„Ich wird’s meinen Leuten sagen! Woher weißt Du denn übrigens, dass unser Regiment nach Frankreich geht? Das ist doch tiefstes Geheimnis.“
„Dacht’ ich mir so. Wer am lautesten schreit, kommt zuerst dran, und die guten Franzosen haben sich ja heiser geschrien all’ die Jahre her. Na, und an der Ostgrenze steht ja sowieso ein Grenzschutz, der mit den Herrn Kosaken auch ohne Eure Hilfe fertig wird.“ Er wurde unterbrochen, da ein Hotelpage an den Tisch kam und ein Telegramm an die Majorin brachte.
„Endlich!“ sagte sie. „Die Antwort von meinem Mann!“ Aber kaum hatte sie das Telegramm aufgebrochen, als sie sich verfärbte. „Um des Himmelswillen!“ rief sie. „Er ist schon unterwegs! O meine Ahnungen, meine Ahnungen! Das Telegramm ist in Köln aufgegeben —“
„In Köln?“ — „Aber das geht doch nicht mit rechten Dingen zu! Am ersten Mobilmachungstag rückt doch das Generalkommando Hannover nicht bis Köln!“
Frau von Schmellin war aufgestanden. Die Depesche flatterte zu Boden, Werner v. Babenberg erhaschte sie. „Nahe an der Grenze“, las er halblaut vor, „Gott schütze Dich und Wichard! Brief wird Dir alles erklären. Ebenso Frau v. Emmich. Dein ewig treuer Kurt v. Schmellin —“ . . . „Sapperlot noch eins!“ fuhr es Onkel Fritz heraus. Und die Frau, die bisher so tapfer gewesen war, brach nun doch in Tränen aus, ihre Hand tastete nach einem Halt. „Ohne Abschied!“ hauchte sie. „Ohne ihn noch einmal zu sehen! O, Gott im Himmel!“ Und dann schlang sie ihren Arm um ihren Jungen. Wie lange noch, und auch dieser würde von ihrer Seite gerissen werden! — Auch die anderen hatten sich erhoben. Die Damen hatten den Wunsch, sich zurückzuziehen. Onkel Fritz begleitete sie hinauf. Schließlich blieben Werner Babenberg und Kapitänleutnant Hermann allein. „Ja“, sagte Werner. „Ihnen darf ich’s sagen, wir gehen wirklich nach Frankreich. Kinder, wird das ein Fechten! Steigerungsfähig ist der Mumm nicht mehr, den unsere Kerls in den Knochen haben. Wie Blücher geht alles drauf, wir haben schon Not gehabt, sie in der Kaserne zu bändigen.“
„Wie das?“
„Unsere aktive Mannschaft natürlich. Wie die gestern erfuhr, welch’ infames Doppelspiel Russland mit uns gespielt hat, da flogen die Späne, und alles, was an den jetzigen Zaren erinnerte, sauste in die Ecke. Wir hatten Not, ihre — 42 — begreifliche Erregung einzudämmen, aber Zeit wird’s, dass wir bald marschieren.
Und heute, als ich mir früh um sechse den Schlaf aus den Augen reibe, da steht schon der ganze Kasernenhof vor meiner Wohnung voll — alles Kriegsfreiwillige — Studenten, Arbeiter, Gymnasiasten!
Aber auch ganz alte Sturmgesellen. Einer war darunter, der hat schon die Düppeler Schanzen mitgenommen. Und wo einer von uns Offizieren sich zeigte, sofort hing ihm ein ganzer Schwarm an den Hacken, und jeder fragte ängstlich: „Werd ich genommen? Sie nehmen doch Freiwillige, nicht wahr?’ Wenn’s in andern Regimentern ähnlich ist, wie bei uns, dann wird an die sofortige Einstellung aller gar nicht zu denken sein!“
„Ja, es ist wahrhaft erhebend! An der Waterkant ist es nicht anders. Ich war in Kiel Zeuge, wie Majestät bei der Heimfahrt umjubelt wurde; wer das mit angesehen hat, vergisst es nie. Die Stunde ist da, wo wir’s der Welt von neidischen Gegnern beweisen wollen, dass sich die deutsche Flagge nicht niederholen lässt!“
Da kam Grete zurück. „Mein Onkel lässt um Entschuldigung bitten, Herr Hermann; er versucht mit Sierstädt telefonische Verbindung zu bekommen. Und unsere Miss scheint schlechte Nachrichten auf ihrem Konsulat erhalten zu haben, sie kam verstört die Treppe heraufgeflogen.“
„Ah, Miss Scoolfield! Ich wollte schon nach ihr fragen“, sagte der Kapitänleutnant.
„Will sie etwa abreisen?“ fragte Werner schnell. „Gestern versicherte sie mir das Gegenteil.“
„Allem Anschein nach packt sie. Willst Du ihr vielleicht helfen?“ Der Bruder übersah das spöttische Lächeln. Er stand auf. „Ich werde mich wenigstens erkundigen, ob sie irgendwelcher Hilfe bedarf —“
„Dann wünsche ich Dir, dass Du mehr Glück hast, als ich. Von meiner Hilfe schien sie nicht viel wissen zu wollen.“
Der Bruder ging. In der Halle, wo die Pförtnersloge war, standen Offiziere und Kadetten. Ausländer dazwischen, mit eilig gepackten Koffern, die auf einen Wagen warteten. Es mochte schwer halten, einen zu bekommen.
Nun saß Grete v. Babenberg dem Kapitänleutnant gegenüber. Sie waren ganz allein. „Ich bin so unendlich glücklich“, begann er ohne alle Umschweife, „dass ich Sie hier in Berlin noch fand! Es war auch nicht der reine Zufall, dass ich Ihnen auf der Wilhelmstraße in den Weg lief; ich war schon in allen Hotels, die in Frage kamen, gestern und heute gewesen. Ich hatte Ihre Spur!“ „Unsere Spur!“ Sie war errötet. „Ich wusste nicht, dass Ihnen daran lag —“
Aber er fuhr unbeirrt von ihrem Einwurf fort: „Haben Sie wirklich meinen können, dass ich Westerland verließ, ohne den Versuch gemacht zu haben, Ihnen Lebewohl zu sagen?“
„Ich musste — ich musste es aber doch glauben“, erwiderte sie leise. Dabei fühlte sie, wie ihr Herz klopfte, sie dachte, er müsse es hören, während er ihr in kurzen Worten auseinandersetzte, wie er vergeblich um ihr Häuschen in Westerland geschlichen und nach ihr ausgespäht habe, bis es die äußerste Zeit gewesen war, das Schiff zu erreichen, mit dem er nach Kiel musste. Aber die ganze, ruhelose Fahrt habe er darunter gelitten, schwer gelitten, dass er sie nicht noch einmal gesehen habe. Und ob denn wenigstens ihr Onkel die Grüße bestellt hätte? denn Herr v. Schmellin sei ja der einzige gewesen, den er ganz knapp vor der Abfahrt noch erwischt habe.
Ja, die Grüße hatte Onkel Fritz bestellt. Beiläufig. Sie sagte es fast tonlos. Aber ihr Beklemmung, unter der sie tagelang gelitten hatte, fiel plötzlich von ihr ab und verschwand. Sie sah, wie durch einen Schleier, zwei Augen, die sie anblickten und sich in ihr Inneres zu bohren schienen — dieselben Augen, die sie auf der traumverlorenen Nordsee-Insel angesehen und verwirrt hatten. Nur, dass jetzt ein heißes Feuer in diesen Augen war, und gleichzeitig fühlte und wusste sie, dass das große Sehnen nach diesem Manne auch in ihr lebte, und dass ein anderes Bild in ihrem Herzen verblasste. . .
Und er sprach ihr von seiner Liebe — von der Liebe auf den ersten Blick — von seiner Sehnsucht, mit ihr allein zu sein und ihr sein Herz zu entdecken!
Seine Stimme hatte sie längst überwältigt. Sie war keiner Entgegnung fähig. Sie wollte etwas erwidern, aber zu ihrer eigenen Verwunderung kam kein Ton aus ihrer Kehle. Und eindringlich fuhr er fort. Sie hörte wie aus weiter Ferne, was er sagte von der großen Schicksalszeit, von dem Kampf, in den sie gingen — sie wusste auch später nicht, wie lange er so gesprochen, und was er alles gesagt hatte, sie wusste nur, dass sie ihn liebte, dass er sie liebte, liebte und zu seinem Weibe begehrte! Und deutlich kam die große Frage: „Fräulein Grete! Fräulein Grete — ich bin hier, um mir die Antwort über Leben und Tod zu holen!“
Sie zitterte. Es wollte sich etwas auf ihre Lippen drängen, sie hatte sagen wollen, dass sein Leben in dieser Stunde nicht ihr. dass es nur dem Kaiser gehöre — allein es kam nicht mehr dazu: im nächsten Augenblicke lag sie an seinem Halse. Und während die ganze Welt um sie herum verschwand, fühlte sie nichts, als seine glühenden Küsse. . .
„Walter!“ hauchte sie. „O, Walter! Ich kann es nicht fassen, mich nicht in das Glück finden!“ Sie sah, wie seine Augen glänzten, wie sie lachten. Da gab er sie frei. Über den Teppich her kamen Schritte. Es war Onkel Fritz. Ganz erschrocken blieb er einen Augenblick wie festgewurzelt stehen. Im nächsten Moment lag seine Nichte an seinem Halse.
„Onkel, ach. Onkel!“
Und während er verstand und nach Worten rang, verbeugte sich der andere vor ihm. „Herr v. Schmellin! Ich habe mich mit Ihrer Nichte verlobt!“ Da fand er endlich die Sprache wieder. „Verraten Sie mir, bitte, bloß eins: Is das nu der Abschluss einer langen Belagerung — oder haben Sie mein stolzes Nichtchen im Sturm erobert?“
Und da antworteten beide, glücklich, lächelnd, fast gleichzeitig: „Im Sturm erobert!“ Und Onkel Fritz schüttelte ihnen herzlich und mit Nachdrücklichkeit die Hände. Als er fertig war, erbot er sich dazu, bei Frau Charlotte den Brautwerber zu machen — „damit sie nicht genauso aus den Wolken fällt, wie ich! Ich denke doch nicht anders, als ich habe ‘ne Halluzination!“ — Und ein Wunder war es beinahe. Grete war von jeher die Unnahbarste in der Familie gewesen seit dem unseligen Tage, wo der älteste Sohn des Trebnitzers Hals über Kopf den Dienst quittieren musste; einige kluge Tanten und der nichtsahnende Onkel Theodor auf Trebnitz hatten schon längst prophezeit, für Grete märe überhaupt kein Mensch auf Erden gewachsen, der vor ihren Augen Gnade fände, und wenn ein leibhaftiger Königlicher Prinz käme! Und nun war es doch anders und noch dazu so schnell gekommen, dass man’s kaum glauben konnte! Onkel Fritz bildete sich sonst etwas ein auf seine feine Witterung, wenn ‘ne Verliebtheit oder ‘ne Verlobung in der Luft lag, aber hier hatte dieser Sinn versagt. Wer hatte denn auch an so was nur im Entferntesten gedacht in so ‘ner Stunde, die alle Herzen emporgerissen hatte aus den Banden des Alltags! Als ob es da Herzen gäbe, die nicht im gleichen Takt geschlagen hätten, wie die Hunderttausend um sie herum! Und nun dieses persönliche Erleben zweier Menschenkinder mitten in dem einheitlichen Rhythmus, der die Empfindungen aller trug! Fast schien’s ein Werk dieser Stunde selbst zu sein, was er da geschaut hatte, in dieser Stunde, wo eine gemeinsame Liebe Hunderttausende durchdrungen hatte. Solche Stunden schaffen, was sonst Jahre nicht fertig bringen. Sie schmieden und hämmern zusammen. Und in dieser Stunde hatte sich seine stolze Nichte mit dem bürgerlichen Offizier verlobt, von dem sie wusste, dass er dem Vaterlande gehörte mit seiner ganzen Männlichkeit und seiner ganzen Kraft!
Das ungefähr war’s, was der Sierstädter seiner Schwester Charlotte alles erzählte, die fast erschrocken war. Und zum Schluss fügte er hinzu: „Und alle anderen Bedenken erledigen sich. Für seinen Charakter, für seine ehrliche Gesinnung spricht feine Uniform.“ Da fand sich die Mutter in das Unvorhergesehene. „Wie ist das nur so plötzlich gekommen?“ war alles, was sie fragte, als Grete gleich darauf ihr in den Armen lag.
„Gar nicht plötzlich! Ich wusste es schon in Westerland, dass ich ihn mit der ganzen Leidenschaft meiner Natur lieben könnte. Und von Walter weiß ich auch dies eine: dass er nur mich liebt!“
Da war die Mutter beruhigt. Eine Sekunde lang hatte sie dasselbe gedacht, was ihr Bruder vorhin gedacht hatte. Dann hatte sie aufgeatmet. Also endlich! Endlich hatte Grete vergessen! Sie, die jahrelang darunter gelitten hatte, dass ihre erste Liebe eine unglückliche gewesen war! Walter Hermann brachte dann selber seine Werbung vor. „Ich bin mir meines Glückes selbst noch gar nicht ganz bewusst“, sagte er. „Aber wir Seeleute sind nun einmal Draufgänger!“
„Ihr plant doch nicht am Ende gar ‘ne Not“ oder Kriegstrauung?“ fragte Onkel Fritz. „Prinz Oskar ist ja mit gutem Beispiel vorangegangen.“
„Nein — obwohl wir auch dieses erwogen haben“, antwortete Hermann. „Erst habe ich meine Pflichten zu erfüllen, dann soll sie meine Frau werden.“
Dagegen ließ sich nichts sagen. Am Abend sollte im kleinen Kreise die Verlobung gefeiert werden. Von den Verwandten des Bräutigams lebte ein alter Major in Friedenau, der würde kommen. „Alles weitere bereite ich vor“, erklärte großmütig der Sierstädter. Und dann unterbrach er sich: „Wo stecken denn bloß Deine Jungens, Charlotte?“
Da kamen sie herein. Sie hatten noch von nichts eine Ahnung. Es stellte sich heraus, dass sie beide diensteifrig und ritterlich der Miss beim Packen geholfen hatten. „Miss Scoolfield reist ab!“
„Ja, denkt Euch nur, so plötzlich!“
„Das klingt ja gerade, als ob meine Herren Neffen das bedauerten!“
„Wir liegen ja auch nicht im Kriegszustand mit England!“
„Mindestens nicht mit einer Dame jenes Volkes“, setzte der jüngere Bruder hinzu. Onkel Fritz schüttelte den Kopf. Es war ihm keineswegs entgangen, dass beide Neffen etwas für die Engländerin übrig hatten. Die Miss war hübsch, viel hübscher, als sonst die Töchter Albions zu sein pflegen, die aufs Festland kommen. Hübsch und gefährlich für einen Neuling. Es war wirklich gut, dass sie das Haus verließ. Der englische Konsul schien es geraten zu haben. Das fehlte gerade noch, dass in dieser tiefernsten Zeit eine Engländerin hofiert wurde! Aber er sprach es nicht aus, er sagte nur: „Kriegszustand zunächst nich, das stimmt. Aber bei den treulosen Briten is es geradezu geschichtliche Gewohnheit, andere Völker in den Krieg zu hetzen. Sich selber und ihr Inselreich glauben sie natürlich vor den Schrecken des Krieges sicher. Wir werden sehen! Mich sollte ‘s wundern, wenn sie so neutral bleiben, wie sie jetzt alle Welt glauben machen wollen. Sonst pflegt der „ehrenwerte“ Tommy sich einzustellen, wo es etwas zu holen gibt, und seinen Anteil zu fordern.“
Die Miss kam. Sie war, wie der Sierstädter feststellte, schon „gestiefelt und gespornt“ und trug ein graugrünes Reisekleid. „Also schon feldgrau!“ „Ich wage Ihnen nicht zuzureden, liebes Fräulein Grace“, sagte Frau v. Babenberg, „obwohl Sie in Müncheberg nichts von den kommenden Schlachten gemerkt haben würden —“
„Man kann es nicht wissen, wie es wird kommen. Meine Heimat ist so friedlich, und hier ist der Krieg. Es kann auch ein Aufstand ausbrechen —“
„Was für ein Aufstand?“
„Eine Revolution. Nach dem ersten Misserfolg kommt immer eine Revolution. Alle englischen Familien werden sich flüchten. O, es ist schrecklich!“
„Ich finde es nur schrecklich, dass Sie so etwas glauben können, wo Sie doch selbst sprachlos waren über diese ungeahnte Entschlossenheit und Einigkeit des deutschen Volkes, die sich uns gestern wie ein strahlendes Wunder offenbarte!“
„Ich will Ihnen wünschen, dass Sie recht behalten und dass es so bleibt!“
Das war alles, was die Engländerin mit einem leisen Spottlächeln sagte. Der Oberleutnant ließ es sich aber nicht nehmen, auch diesmal ritterlich zu sein; er begleitete die Miss zur Bahn. Das Reisegeld hatte ihr Frau v. Babenberg in einem Briefumschlag überreicht. Die Verlobung Gretes erfuhr sie erst auf dem Wege zum Lehrter Bahnhof. „Dass diese schnelle Geschichte nur nicht einmal Ihre Schwester gereut“, sagte sie. „Herr Hermann ist nicht standesgemäß.“
„Aber ich bitte Sie, gnädigstes Fräulein!“
„Ich habe sehr lange Zeit die Anschauungen Ihres Hauses studiert. Ich weiß sehr wohl, dass Sie keine Nichtadeligen in Ihrer Familie haben.“
Werner Babenberg biss sich auf die Lippen. „Er ist Offizier. Seeoffizier!“
„Ja freilich!“ Wieder hatte sie das spöttische Lächeln. Nun bedauerte er doch, dass er sie nicht einfach in das Auto, das er mit Mühe aufgetrieben hatte, gesetzt und dann seiner Wege gegangen war. „Wer in Ihrem Deutschland einen bunten Rock trägt, ist ja ein Held, den seit gestern jeder Mensch anjubelt. Man sollte daran denken, die Heldentaten erst abzuwarten.“ Sie kramte in ihrem Gepäck. Es war gut, dass sie am Ziele waren, dem Oberleutnant schwebte eine scharfe Entgegnung auf den Lippen. Er unterdrückte sie. Sie blieb eine Dame, und er war preußischer Offizier. Er löste ihr die Fahrkarte und brachte sie auf den Bahnsteig.
Wie in einem Bienenschwarm schwirrte alles durcheinander. „In diesem Wagen ist noch Platz“, sagte er. „Sie müssen sich beeilen.“ Sie dankte ihm, aber sie war ganz entsetzt, dass sie auf ihre Fahrkarte erster Klasse vierter Klasse fahren sollte. Aber es half nichts. „Es ist eben Kriegszeit!“ Er legte die Hand an den Helm. Sein Dienst war getan . . .
Und ernst schritt er durch die Reihen und Gruppen der Kameraden, die von den Ihrigen Abschied nahmen. Jeder wusste es, es konnte ein Abschied fürs Leben sein, und die Tränen der Frauen flossen. Mancher der feldgrauen Männer, mancher Reservist riss sich mit rascher Bewegung von seinen Liebsten los und stürzte stumm davon, um die Qualen nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Verzweifelt lief ein altes Mütterchen die endlose Wagenreihe entlang; es suchte seinen Sohn, um ihn ein letztes Mal ans Herz zu drücken. Wie gebrochen saßen ein paar einfache Frauen auf einem Gepäckhaufen; sie rührten sich nicht von der Stelle, trotz des tröstenden Zuredens der Beamten. Ein Vater raffte sich zusammen und scherzte noch ein letztes Mal mit dem kleinen, blondlockigen Buben, der ganz verständnislos auf all das Getriebe um sich schaute. Aus der Sperre wankte ganz außer sich ein junges Mädchen; es heulte laut auf. Der lange Zug setzte sich in Bewegung. Stumm schwenkte alles die Tücher und Hüte. Kein Ruf ward laut. Die Kehlen waren allen zugeschnürt. . .
1 Tatsächlich erschien diese Meldung, soweit sie die Kriegseröffnung durch Russland betrifft, erst am 2. August mittags 1 Uhr. Die Mobilisierung Frankreichs wurde 1 Uhr 30 nachts gemeldet und in Morgenausgaben der Tageszeitungen vom 2. August zuerst bekanntgegeben.