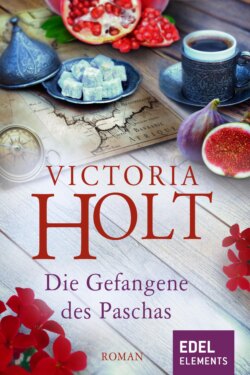Читать книгу Die Gefangene des Paschas - Victoria Holt - Страница 4
Sturm auf See
ОглавлениеAls die Zeit gekommen war, fuhr ich ins Internat. Ich war eine Weile unglücklich, gewöhnte mich aber rasch ein. Das Gemeinschaftsleben gefiel mir. Da ich mich schon immer für andere Menschen interessiert hatte, schloß ich bald Freundschaften und beteiligte mich an Schulveranstaltungen.
Felicity hatte mich hinreichend unterrichtet, und ich war weder übermäßig gescheit noch dumm. Ich war guter Durchschnitt, was vielleicht das beste ist, denn es erleichtert einem das Leben. Niemand beneidete mich um meine Kenntnisse, und niemand verachtete mich, weil es mir daran gemangelt hätte. Ich mischte mich bald unter die anderen und wurde ein ganz normales Schulmädchen. Die Tage vergingen rasch. Schulfreuden, -dramen und -triumphe wurden ein Teil meines Lebens. Dennoch dachte ich oft wehmütig an die Mahlzeiten in der Küche zurück, vor allem an Mr. Dollands »Nummern«. Wir hatten in der Schule Theaterkurse und führten in der Turnhalle Stücke auf. Ich spielte den Bassanio in Der Kaufmann von Venedig und heimste einen bescheidenen Erfolg ein, der sicher dem Umstand zu verdanken war, daß ich viel bei Mr. Dolland abgeschaut hatte.
Dann kamen die Ferien. Nanny Pollock hatte sich endgültig entschieden, nach Somerset zu ziehen, und ich verbrachte eine Woche bei ihr und ihrer Kusine. Nanny hatte sich an das Landleben gewöhnt, und ein Jahr, nachdem sie Bloomsbury verlassen hatte, brachte der Tod einer entfernten Verwandten wieder völlige Zufriedenheit in ihr Leben. Die Verstorbene, eine junge Frau, hinterließ ein zweijähriges Kind, und die Verwandten waren ratlos, wer sich des Waisenkinds annehmen solle. Das war eine gottgesegnete Gelegenheit für Nanny Pollock; ein Kind, das sie umsorgen und zu ihrem eigenen machen konnte und das ihr nicht entrissen werden würde wie die Kinder anderer Leute.
Zu Hause wurde nun von mir erwartet, daß ich die Mahlzeiten mit meinen Eltern einnahm, und wenn sich auch mein Verhältnis zu ihnen erheblich verändert hatte, so dachte ich doch sehnsüchtig an die Mahlzeiten in der Küche zurück. Aber wenn meine Eltern außerhalb Londons Forschungen betrieben oder Vorträge hielten, konnte ich den alten Brauch Wiederaufleben lassen.
Natürlich vermißten wir Felicity und Nanny Pollock, aber Mr. Dolland war wie immer glänzend in Form, und Mrs. Harlows Bemerkungen hatten die Würze der alten Zeiten bewahrt. Und ich besuchte natürlich Felicity, die sich jedesmal freute, mich zu sehen. Sie war sehr glücklich. Sie hatte ein Baby namens James und widmete sich voller Begeisterung der Aufgabe, eine gute Ehefrau und Mutter zu sein. Eine gute Gastgeberin war sie auch. Für einen Mann in James’ Position war es unumgänglich, ab und zu Gäste zu haben, daher hatte sie es lernen müssen. Da ich nun fast erwachsen war, konnte ich an ihren Abendgesellschaften teilnehmen und stellte fest, daß ich sie genoß.
Bei einem solchen Anlaß machte ich die Bekanntschaft von Lucas Lorimer. Felicity hatte mir schon von ihm erzählt. »Übrigens«, sagte sie, »Lucas Lorimer kommt heute abend. Er wird dir gefallen. Die meisten Leute mögen ihn. Er ist charmant, sieht recht gut aus und versteht es, jedem das Gefühl zu geben, ungeheuer interessant zu sein. Du weißt, was ich meine. Laß dich nicht täuschen. So ist er zu allen. Er ist eine ziemlich rastlose Natur, nehme ich an. Er war eine Zeitlang beim Militär, hat aber seinen Abschied genommen. Sein älterer Bruder Carleton hat kürzlich das Gut in Cornwall geerbt. Es ist recht ansehnlich, glaube ich. Der Vater ist erst vor ein paar Monaten gestorben, und Lucas weiß nicht recht, was nun werden soll. Auf dem Gut gibt es viel zu tun, aber er ist ein Charakter, der das Heft lieber selbst in der Hand hätte. Er ist im Moment ein bißchen unsicher, was er anfangen soll. Vor ein paar Jahren fand er im Garten von Trecorn Manor – so heißt das Gut in Cornwall – ein Amulett, eine Art Relikt. Der Fund verursachte einige Aufregung. Es war etwas Ägyptisches, und man steht vor einem Rätsel, wie es dahin gekommen ist. Dein Vater ist damit befaßt.«
»Ich nehme an, es ist mit Hieroglyphen bedeckt.«
»Daran müssen sie seine Herkunft erkannt haben.« Sie lachte. »Lucas hat seinerzeit ein Buch darüber geschrieben. Sein Interesse war geweckt, und er hat ein wenig nachgeforscht. Er fand heraus, daß es ein Orden für militärische Verdienste war, und das führte ihn zu alten ägyptischen Bräuchen. Er stieß auf welche, von denen man noch nie gehört hatte. Ein, zwei Leute wie dein Vater haben sich für das Buch interessiert. Nun, du wirst ihn ja kennenlernen, dann kannst du dir selbst ein Urteil bilden.«
Ich lernte ihn an jenem Abend kennen. Er war groß, schlank und geschmeidig; seine Lebhaftigkeit sprang einem sofort ins Auge. »Das ist Rosetta Cranleigh«, stellte Felicity mich vor.
»Ich bin entzückt, Sie kennenzulernen.« Er nahm meine Hände und sah mich an. Felicity hatte recht. Er gab einem das Gefühl, wichtig zu sein, und man hatte das Empfinden, daß seine Worte keine bloße Förmlichkeit seien. Ich war geneigt, ihm trotz Felicitys Warnung zu glauben.
Felicity fuhr fort: »Professor Cranleighs Tochter und eine ehemalige Schülerin von mir. Tatsächlich die einzige, die ich je hatte.«
»Das ist alles so aufregend«, sagte er. »Ich kenne Ihren Vater. Ein ausgezeichneter Mann.«
Felicity überließ uns unserem Geplauder. Die meiste Zeit führte er das Wort. Er erzählte mir, wie hilfreich mein Vater gewesen und wie dankbar er sei, daß der bedeutende Gelehrte ihm so viel Zeit gewidmet habe. Dann bat er mich, von mir zu erzählen. Ich bekannte, daß ich noch zur Schule ging, daß ich die Ferien hier verbrachte und noch ein gutes Jahr vor mir hatte.
»Und was machen Sie dann?«
Ich hob die Schultern.
»Sie werden über kurz oder lang verheiratet sein, dessen bin ich sicher«, sagte er, womit er andeutete, meine Reize seien dergestalt, daß die heiratsfähigen Männer in Wettstreit treten würden, um mich zu erringen.
»Man weiß nie, was kommt.«
»Wie wahr«, bemerkte er, als habe meine banale Äußerung meine Weisheit bewiesen. Felicity hatte recht. Er war bestrebt zu gefallen. Es war ziemlich offensichtlich, nachdem man gewarnt worden war, und dennoch angenehm, wie ich mir gestehen mußte.
Bei Tisch saß ich neben ihm. Man konnte sich ganz zwanglos mit ihm unterhalten. Er erzählte mir von dem Fund im Garten und daß dieser gewissermaßen sein Leben verändert habe. »Meine Familie war stets dem Militär verbunden, und ich hatte mit der Tradition gebrochen. Mein Onkel war Oberst und Regimentskommandeur. Er hielt sich selten in England auf, stets erfüllte er an irgendeinem entlegenen Posten des Empires seine Pflicht. Ich merkte, daß das kein Leben für mich war, und nahm meinen Abschied.«
»Es muß sehr aufregend gewesen sein, dieses Relikt zu finden.«
»O ja. Während meiner Militärzeit war ich eine Weile in Ägypten. Das machte den Fund besonders interessant. Ich sah es einfach da liegen. Die Erde war feucht, und ein Gärtner war gerade damit beschäftigt, etwas zu pflanzen. Der Fund war mit Hieroglyphen bedeckt.«
»Sie hätten den Stein von Rosette gebraucht.«
Er lachte. »Oh, ganz so unlesbar war es nicht. Ihr Vater hat es entziffert.«
»Das freut mich. Ich heiße nach dem Stein.«
»Ich weiß. Felicity hat es mir erzählt. Sie sind sicher sehr stolz darauf.«
»Das war ich einst. Als ich zum erstenmal im Museum war, habe ich ihn voller Staunen betrachtet.«
Er lachte. »Namen sind bedeutsam. Sie werden es nie erraten, wie mein erster Vorname lautet.«
»Sagen Sie’s mir.«
»Hadrian. Stellen Sie sich vor, mit einem solchen Namen befrachtet zu sein. Die Leute würden einen andauernd fragen, wie man mit dem Grenzwall vorankomme. Hadrian Edward Lucas Lorimer. Hadrian kam aus dem genannten Grund nicht in Frage. Edward – es gibt so viele Edwards auf der Welt. Lucas ist nicht so gebräuchlich, also wurde ich Lucas gerufen. Aber ist Ihnen aufgefallen, was meine Initialen ergeben? Das ist sehr ungewöhnlich: HELL, Hölle.«
»Ich bin sicher, das ist höchst unangemessen«, sagte ich lachend.
»Oh, Sie kennen mich nicht. Haben Sie noch einen anderen Namen?«
»Nein. Bloß Rosetta Cranleigh.«
»R. C., Römisch-Catholisch.«
»Nicht annähernd so amüsant wie Ihrer.«
»Ihrer läßt auf große Frömmigkeit schließen, wogegen ich ein Satanssproß sein könnte. Das ist bedeutungsvoll, finden Sie nicht? Der Hinweis auf Menschen in entgegengesetzten Sphären? Ich bin sicher, es betrifft unsere kommende Freundschaft. Sie werden mich vom Pfad des Bösen abbringen und einen guten Einfluß auf mein Leben ausüben. Ich würde gerne denken, daß es diese Bedeutung hat.« Ich lachte, und wir schwiegen eine Weile, dann sagte er: »Sie interessieren sich bestimmt für die Geheimnisse Ägyptens. Als Tochter Ihrer Eltern müssen Sie sich einfach dafür interessieren.«
»Nun ja, mit Maßen. Im Internat hat man nicht viel Zeit, sich mit Dingen zu befassen, die nichts mit der Schule zu tun haben.«
»Ich wüßte gerne, was die Worte auf meinem Stein wirklich bedeuten.«
»Ich dachte, man hat sie Ihnen entziffert.«
»Das schon, gewissermaßen. Diese Dinge sind alle so rätselhaft. Die Bedeutung ist in Worte gekleidet, die nicht ganz klar sind.«
»Warum müssen die Menschen sich so unklar ausdrücken?«
»Um ein mysteriöses Element hineinzubringen, meinen Sie nicht? Das steigert das Interesse. Mit den Menschen ist es genauso. Wenn Sie etwas Untergründiges in ihrem Charakter entdecken, finden Sie sie interessanter.« Er lächelte mich an, und seine Augen sagten etwas, das ich nicht verstand. »Irgendwann werden Sie merken, daß ich recht habe«, sagte er.
»Sie meinen, wenn ich älter bin?«
»Ich glaube, es ärgert Sie, wenn man auf Ihre Jugend anspielt.«
»Ja. Ich vermute, es soll mich darauf hinweisen, daß ich vieles noch nicht zu begreifen vermag.«
»Sie sollten Ihre Jugend in vollen Zügen genießen. Die Dichter haben gesagt, sie vergeht viel zu schnell. ›Pflücke die Rose, eh sie verblühte‹ Er lächelte mich mit nahezu zärtlichem Wohlwollen an. Das machte mich etwas nachdenklich, und ich nahm an, daß es ihm auffiel.
Nach dem Essen ging ich mit den Damen hinaus, und als die Herren sich zu uns gesellten, sprach ich nicht wieder mit ihm. Später fragte mich Felicity, wie er mir gefallen habe. »Ihr habt euch offenbar sehr gut verstanden«, meinte sie.
»Ich glaube, er gehört zu denen, die sich mit jedermann gut verstehen ... oberflächlich.«
Sie zögerte eine Sekunde, bevor sie sagte: »Ja, du hast recht.«
Später kam es mir bedeutsam vor, daß mir von diesem Besuch die Begegnung mit Hadrian Edward Lucas Lorimer am deutlichsten in Erinnerung geblieben war.
Als ich in den Weihnachtsferien nach Hause kam, erschienen mir meine Eltern lebhafter als sonst, ja geradezu erregt. Ich konnte mir nur eines denken, was eine solche Wirkung auf sie ausübte: eine neue Erkenntnis. Ein Durchbruch im Verständnis ihrer Arbeit? Ein neuer Stein, der den von Rosette ersetzte?
Es war nichts dergleichen. Sie wünschten mich unverzüglich zu sprechen. »Es hat sich etwas sehr Interessantes ergeben«, sagte meine Mutter. Mein Vater lächelte mich nachsichtig an. »Und«, setzte er hinzu, »es betrifft dich.« Ich war verblüfft. »Laß es dir erklären«, sagte meine Mutter. »Wir sind auf eine hochinteressante Vortragsreise eingeladen. Sie führt uns nach Kapstadt und auf dem Rückweg nach Baltimore und New York.«
»So? Dann werdet ihr lange fort sein.«
»Deine Mutter schlug vor, die Arbeit mit Ferien zu verbinden«, sagte mein Vater.
»Er hat in letzter Zeit viel zu schwer gearbeitet. Natürlich wollen wir nicht ganz untätig sein. Er kann an seinem neuen Buch arbeiten ...«
»Natürlich«, murmelte ich.
»Wir planen, mit dem Schiff nach Kapstadt zu fahren ... eine lange Seereise. Wir werden uns dort ein paar Tage aufhalten, wenn dein Vater seinen Vortrag hält. Das Schiff fährt unterdessen weiter nach Durban, und wenn es nach Kapstadt zurückkehrt, gehen wir wieder an Bord. Es legt in Baltimore an, wo wir es abermals verlassen werden – für einen weiteren Vortrag –, danach fahren wir über Land nach New York, wo dein Vater seinen letzten Vortrag halten wird, und dann nehmen wir ein anderes Schiff nach Hause.«
»Das klingt aufregend.«
Es entstand eine kurze Pause. Mein Vater sah meine Mutter an und sagte: »Wir haben beschlossen, dich mitzunehmen.«
Ich war zu verblüfft, um gleich zu antworten. Dann stammelte ich:
»Ist das ... ist das wirklich euer Ernst?«
»Es wird dir guttun, etwas von der Welt zu sehen«, sagte mein Vater gütig.
»Wann, wann?« fragte ich.
»Wir brechen Ende April auf. Es gilt eine Menge Vorbereitungen zu treffen.«
»Da bin ich noch in der Schule.«
»Du würdest am Ende des Sommerhalbjahres sowieso abgehen. Wir finden, daß es dir nicht schadet, wenn du es abkürzt. Schließlich bist du dann fast achtzehn, also reif genug.«
»Ich hoffe, du freust dich«, sagte mein Vater.
»Ich bin bloß ... so überrascht.«
Sie lächelten mich an. Du wirst deine eigenen Vorbereitungen treffen müssen. Du könntest dich mit Felicity Wills – oder vielmehr Mrs. Grafton – beraten. Sie ist seit ihrer Heirat ziemlich erfahren. Sie wird wissen, was du benötigst. Vielleicht zwei, drei Abendkleider für festliche Anlässe, und etliche, hm, zweckmäßige Kleidungsstücke.«
»O ja, ja«, sagte ich. Wenn ich es recht bedachte, war ich nicht sicher, ob ich mich freuen sollte oder nicht. Die Idee, zu reisen und andere Länder kennenzulernen, war verlockend. Andererseits würde ich in Gesellschaft meiner Eltern und vermutlich von lauter Leuten sein, die ihre eigene Gelehrsamkeit so wichtig nahmen, daß sie mich zu einem unwissenden Dummerchen degradieren würden.
Die Aussicht auf neue Kleider stimmte mich froh. Ich konnte es nicht erwarten, mich mit Felicity zu beraten. Ich schrieb ihr und berichtete ihr von dem Vorhaben. Sie antwortete unverzüglich. »Wie aufregend. James muß im März für ein paar Tage in den Norden. Ich habe ein großartiges Kindermädchen. Sie betet Jamie an und er sie auch. Ich kann für ein paar Tage nach London kommen, und wir werden in Einkäufen schwelgen.«
Als die Wochen vergingen, war ich von der Aussicht auf eine Auslandsreise so begeistert, daß ich die damit verbundenen Nachteile vergaß. Bald darauf kam Felicity nach London, und wie ich erwartet hatte, stürzte sie sich voller Begeisterung in das Unternehmen, mir die richtigen Kleider auszusuchen. Ich merkte, daß sie mich jetzt in einem anderen Licht sah; ich war kein Schulmädchen mehr. »Du hast wundervolles Haar«, sagte sie. »Dein größter Vorzug. Das müssen wir berücksichtigen.«
»Mein Haar?« Mir war nie etwas Besonderes daran aufgefallen, außer daß es ungewöhnlich blond war. Es war lang, glatt und dicht.
»Eine Farbe wie Mais«, sagte Felicity. »Das, was man goldfarben nennt. Wirklich äußerst attraktiv. Du kannst alles mögliche damit anstellen. Du kannst es hochstecken, wenn du würdevoll aussehen willst, oder es mit einem Band im Nacken zusammenhalten oder sogar flechten, wenn du sittsam wirken möchtest. Du wirst viel Freude daran haben. Und wir nehmen vornehmlich blaue Stoffe, um deine Augenfarbe zur Geltung zu bringen.«
Meine Eltern waren nach Oxford gefahren, daher ließen wir den alten Brauch Wiederaufleben und aßen in der Küche. Es war wie einst, und wir bewogen Mr. Dolland, im Gedenken an frühere Tage seinen Hamlet oder Heinrich V. und die unheimlichen Stellen aus Die Glocken zu rezitieren. Wir vermißten Nanny Pollock, doch ich schrieb ihr, was sich ereignete. Sie war jetzt sehr glücklich, ganz in Anspruch genommen von der kleinen Evelyn, die ein »Frechdachs« sei und sie an mich erinnere, als ich in ihrem Alter war. Ich stolzierte in meinen neuen Kleidern in der Küche herum, was Meg und Emily zu Ohs und Ahs und Mrs. Harlow, die etwas über die heutige Mode murmelte, zu ein paar spitzen Bemerkungen veranlaßte. Es waren überaus glückliche Tage, und hin und wieder kam mir der Gedanke, daß die Reisevorbereitungen vielleicht vergnüglicher wären als die Reise selbst.
Ich sagte Felicity mit Bedauern Lebewohl, und sie kehrte nach Oxford zurück. Rasch nahte der Tag, an dem wir nach Tilbury fahren würden, um uns auf der Atlantic Star einzuschiffen. In der Küche wurde beständig von der bevorstehenden Reise gesprochen. Keiner von uns war je im Ausland gewesen, nicht einmal Mr. Dolland, der immerhin einmal beinahe nach Irland gefahren wäre; aber das war, wie Mrs. Harlow betonte, ein anderes Paar Stiefel. Ich würde ins richtige Ausland gehen, und das könne gefährlich sein. Man wisse nie, wie man mit Ausländern dran sei, bemerkte sie, und ich würde eine Menge von ihnen zu sehen bekommen. Sie würde nicht in die Fremde wollen, und wenn man ihr hundert Pfund dafür böte.
Meg sagte: »Niemand wird Ihnen hundert Pfund bieten, um ins Ausland zu gehen, Mrs. Harlow. Seien Sie unbesorgt.« Mrs. Harlow warf Meg, die sich ihrer Meinung nach immer zuviel herausnahm, einen mißbilligenden Blick zu.
Und dann wurde das ständige Gerede über das Ausland, seine Reize und seine Nachteile, plötzlich von einem Mord überschattet. Wir hörten es von den Zeitungsjungen, die es auf der Straße ausriefen. »Gräßlicher Mord. Mann mit Kopfschuß in verlassenem Bauernhaus aufgefunden.« Emily wurde hinausgeschickt, um eine Zeitung zu kaufen, und Mr. Dolland nahm am Tisch Platz, setzte seine Brille auf und las den Versammelten vor. Der Mord war zu dieser Zeit die Hauptnachricht, weil sich sonst nichts Wichtiges ereignete. Man nannte ihn den Bindon-Boys-Mord, und die Presse befaßte sich in schauerlicher Manier damit, auf daß die Leute überall von dem Fall läsen und gespannt wären, was als nächstes geschehen würde.
Mr. Dolland hatte seine eigenen Theorien, und Mrs. Harlow meinte, er habe von solchen Dingen genausoviel Ahnung wie die Polizei. Das komme daher, daß er zahlreiche Theaterstücke kenne, die von Mord handelten. »Man sollte ihn hinzuziehen, finde ich«, verkündete sie. »Er würde die Geschichte rasch aufklären.«
Mr. Dolland saß am Tisch, sonnte sich im Glänze solcher Bewunderung und erläuterte seine Ansichten. »Es muß dieser junge Mann sein«, sagte er. »Alles weist auf ihn hin; er hat bei der Familie gelebt, gehörte aber nicht dazu. Das kann heikel sein, o ja.«
»Wieso kam er dorthin?« fragte ich.
»Er war offenbar adoptiert. Ich vermute, er war eifersüchtig auf den anderen jungen Mann. Eifersucht kann die Menschen rasend machen.«
»Ich kann verlassene Häuser nicht ausstehen«, sagte Mrs. Harlow.
»Mir gruselt davor.«
»Die Sache war natürlich so: Er ging in das verlassene Bauernhaus, Bindon Boys, wie sie es nennen, und hat ihn da erschossen«, fuhr Mr. Dolland fort. »Dieser Cosmo war der älteste Sohn, und schon das allein muß den jungen Mann eifersüchtig gemacht haben, da er nun mal der Außenseiter war. Dann war da diese Witwe, Mirabel heißt sie. Er wollte sie für sich, und dieser Cosmo kriegt sie. Da habt ihr das Motiv. Er lockt Cosmo in das verlassene Bauernhaus und erschießt ihn.«
»Er wäre vielleicht davongekommen«, sagte ich, »wenn der jüngere Bruder, Tristan – hieß er nicht so? –, wenn der ihn nicht auf frischer Tat ertappt hätte.« Ich fügte die Geschichte zusammen. Sir Edward Perrivale hatte zwei Söhne, Cosmo und Tristan. Dazu den Adoptivsohn Simon, der mit fünf Jahren ins Haus gekommen war. Simon war als Mitglied der Familie aufgezogen worden, aber man hatte ihn offenbar immer spüren lassen, daß er nicht richtig dazugehörte. Sir Edward, ein kranker Mann, war just zur Zeit des Mordes gestorben, so daß er wohl kaum etwas davon mitbekommen hatte. Bindon Boys war ein baufälliges Bauernhaus auf dem Gut der Perrivales. Die drei jungen Männer waren mit der Verwaltung des großen Gutes an der Küste von Cornwall befaßt. Die Vermutung lag nahe, daß Simon Cosmo in das verlassene Bauernhaus gelockt und kaltblütig erschossen hatte. Er hatte vermutlich geplant, die Leiche beiseite zu schaffen, aber da war Tristan hereingekommen und hatte ihn mit dem Gewehr in der Hand erwischt. Es gab offensichtlich ein hinreichendes Motiv. Der Adoptivsohn muß auf die anderen beiden eifersüchtig gewesen sein; und er liebte anscheinend die Witwe, die mit Cosmo verlobt war.
Der Mord erregte bei den Dienstboten größtes Interesse, und ich muß gestehen, daß er auch mich zu fesseln begann. Vielleicht war mir ein wenig bange vor der bevorstehenden Reise mit meinen Eltern, und ich klammerte mich an etwas, das meine Gedanken ablenkte. Ich war genauso aufgeregt wie die anderen, wenn wir am Küchentisch saßen und Mr. Dolland zuhörten, der seinen Verstand gegen Scotland Yard ausspielte. »So etwas nennt man einen klaren Fall«, verkündete er.
»Das gäbe ein gutes Theaterstück«, meinte Mrs. Harlow.
»Da bin ich nicht so sicher«, erwiderte Mr. Dolland. »Man weiß von Anfang an, wer der Mörder ist. In einem Stück muß es eine Menge Fragen und Hinweise und dergleichen geben, und dann kommt ein überraschender Schluß.«
»Vielleicht ist es nicht so klar, wie es aussieht«, gab ich zu bedenken. »Es scheint, daß Simon es getan hat, aber er sagt, daß er es nicht war.«
»Natürlich sagt er das, wie denn auch nicht?« warf Mrs. Harlow ein. »Das sagen sie alle, um sich zu retten, und schieben die Schuld auf jemand andern.«
Mr. Dolland preßte die Handflächen aneinander und blickte zur Decke. »Haltet euch an die Tatsachen«, sagte er. »Ein Mann bringt einen Fremden ins Haus und behandelt ihn wie seinen Sohn. Die anderen mögen ihn nicht, und der Junge verübelt es ihnen, daß sie ihn nicht als ihresgleichen anerkennen. Das staut sich im Lauf der Jahre auf. Haß herrscht im Haus. Und dann kommt diese Witwe dazu. Cosmo will sie heiraten. Immer war dieser Groll zwischen ihnen. Darum hat Simon Cosmo getötet, und Tristan kommt herein und findet ihn.«
»Die haben so ausgefallene Namen«, meinte Meg mit einem kleinen Kichern. »Ich hatte immer eine Vorliebe für ausgefallene Namen.«
Alle ignorierten die Unterbrechung und warteten darauf, daß Mr. Dolland weiterspräche. »Also, da ist diese Sache mit der Witwe. Das brachte das Faß zum Überlaufen. Cosmo bekommt alles. Und Simon? Er ist kaum etwas Besseres als ein Dienstbote. Empörung flammt auf. Da habt ihr den geplanten Mord. Ah, aber ehe er die Leiche beiseite schaffen kann, kommt Tristan herein und vereitelt seinen Plan. Im Theater gehen Morde immer schief. Das muß so sein, sonst gäbe es keine Stücke darüber, und Theaterstücke fußen auf dem wirklichen Leben.«
Wir hingen alle an seinen Lippen. Emily sagte: »Ich kann nicht anders, dieser Simon tut mir leid.«
»Ein Mörder!« rief Mrs. Harlow. »Du bist nicht bei Sinnen, Mädchen. Wie würde dir das gefallen, wenn er daherkäme und dir eine Kugel durch den Kopf jagte?«
»Warum sollte er das tun? Ich bin nicht Cosmo.«
»Dafür kannst du deinem Schicksal dankbar sein«, sagte Mrs. Harlow. »Und unterbrich Mr. Dolland nicht.«
»Wir können nichts tun«, fuhr er weise fort, »als abwarten.«
Wir brauchten nicht lange zu warten. Die Zeitungsjungen riefen auf der Straße: »Dramatische Wendung im Bindon-Boys-Fall. Lesen Sie alles darüber.«
Und wir lasen es begierig. Offenbar war die Polizei im Begriff gewesen, Simon Perrivale zu verhaften. Was sie zögern ließ, war Mr. Dolland ein Rätsel – und jetzt war Simon verschwunden.
»Wo ist Simon Perrivale?« fragten die Schlagzeilen. »Wer hat den Mann gesehen?« Dann: »Polizei auf der Spur. Mit Verhaftung wird stündlich gerechnet.«
»So«, verkündete Mr. Dolland. »Er ist getürmt. Deutlicher hätte er nicht sagen können: ›Ich bin schuldige Sie werden ihn finden, keine Bange.«
»Na hoffentlich«, sagte Mrs. Harlow. »Man fühlt sich ja seines Lebens nicht mehr sicher, wenn Mörder frei herumlaufen.«
»Er hat keinen Grund, Sie zu ermorden, Mrs. Harlow«, sagte Meg.
»Ich würde ihm nicht über den Weg trauen«, versetzte Mrs. Harlow.
»Die Polizei wird ihn bald finden«, versicherte Mr. Dolland. »Ihre Männer suchen überall.«
Doch die Tage vergingen, und von einer Festnahme war nichts zu hören. Dann verschwand der Fall aus den Schlagzeilen. Das goldene Jubiläum der Königin trat an seine Stelle, und für einen gemeinen Mord, dessen Hauptbeteiligter das Weite gesucht hatte, war kein Platz mehr. Zweifellos würde das Interesse von neuem aufflammen, wenn er verhaftet würde; aber vorerst wurden die Nachrichten von Bindon Boys auf die hinteren Seiten verbannt.
Drei Tage vor unserer Abreise bekamen wir Besuch. Ich war in meinem Zimmer, als meine Eltern mich in den Salon rufen ließen. Dort erwartete mich eine Überraschung. Als ich hereinkam, trat mir Lucas Lorimer entgegen, um mich zu begrüßen.
»Mr. Lorimer sagt, daß ihr euch bei den Graftons kennengelernt habt«, erklärte meine Mutter.
»O ja.« Ganz naiv verriet ich meine Freude.
Er nahm meine Hände und sah mir lächelnd in die Augen. »Es war mir ein großes Vergnügen, die Bekanntschaft von Professor Cranleighs Tochter zu machen«, sagte er, womit er gleichzeitig meinem Vater und mir schmeichelte.
Meine Eltern lächelten mich nachsichtig an. »Wir haben gute Nachrichten«, sagte mein Vater. Alle drei betrachteten mich, als seien sie im Begriff, einem Kind eine Freude zu machen. »Mr. Lorimer fährt auch mit der Atlantic Star«, sagte meine Mutter.
»Na, so was!« rief ich erstaunt.
Lucas Lorimer nickte. »Eine große Überraschung für mich, und eine große Ehre. Man hat mich gebeten, zur gleichen Zeit, wie Professor Cranleigh seinen Vortrag hält, eine Rede über meine Entdeckung zu halten.«
Ich hätte am liebsten losgeprustet. Die feine Unterscheidung zwischen einer Rede und einem Vortrag amüsierte mich. Ich konnte nicht recht glauben, daß er so bescheiden war, wie er sich anhörte. Der Ausdruck in seinen Augen strafte seine Worte Lügen.
»Und deshalb«, fuhr mein Vater fort, »wird Mr. Lorimer mit uns auf der Atlantic Star fahren.«
»Das«, erwiderte ich aufrichtig, »wird sehr vergnüglich sein.«
»Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie froh ich bin, daß ich mitkomme«, erklärte er. »Es war wirklich ein großes Glück, daß ich diesen Fund im Garten gemacht habe.«
Mein Vater bemerkte lächelnd, die Botschaft auf dem Stein sei etwas schwer zu entziffern gewesen; natürlich nicht die Hieroglyphen, sondern die exakte Bedeutung. Das sei bezeichnend für den arabischen Geist, erklärte er weiter. Dieser sei stets mit Unklarheiten behaftet.
»Aber das macht es ja so interessant«, warf Lucas Lorimer ein.
»Es war nett von Ihnen, herzukommen«, fuhr mein Vater fort, »und uns über Ihre Einladung und Ihren Entschluß, sie anzunehmen, zu unterrichten.«
»Mein lieber Herr Professor, wie könnte ich die Ehre ausschlagen, ein Podium mit Ihnen zu teilen – nun ja, nicht direkt zu teilen, aber, wollen wir sagen, Ihnen auf dem Fuße folgen zu dürfen?« Meine Eltern waren sichtlich entzückt, was bewies, daß sie imstande waren, aus der vergeistigten Atmosphäre, in der sie gewöhnlich lebten, aufzutauchen und sich in einer kleinen Schmeichelei zu sonnen. Lucas wurde gebeten, zum Mittagessen zu bleiben; wir unterhielten uns dabei über die Reise, und von meiner Mutter ermuntert, sprach mein Vater über das Thema der Vorträge, die er in Südafrika und Nordamerika halten würde.
Ich hatte nur einen Gedanken: Er wird mit uns auf dem Schiff sein. Er wird mit uns in den fremden Städten sein. Damit hatte das Vorhaben beträchtlich an Reiz gewonnen, und irgendwie wurde meiner bangen Erwartung die Spitze genommen. Lucas Lorimers Gegenwart würde dem Abenteuer Würze verleihen.
Zum erstenmal an Bord eines Schiffes zu gehen war ein spannendes Erlebnis. Ich war mit meinen Eltern nach Tilbury gefahren und hatte auf dem Weg dorthin brav ihrer Unterhaltung gelauscht, bei der es hauptsächlich um die Vorträge meines Vaters ging. Ich war ganz froh darüber, weil es mich der Anstrengung des Redens enthob. Vater erwähnte Lucas Lorimer und war gespannt, wie seine Rede aufgenommen würde.
»Er verfügt freilich nur über eine oberflächliche Kenntnis des Themas, aber ich habe gehört, er hat eine unbeschwerte Art, es darzustellen. Nicht gerade die rechte Einstellung, aber eine gewisse Leichtigkeit mag ab und zu gestattet sein.«
»Er wird hoffentlich vor Leuten sprechen, die etwas davon verstehen«, sagte meine Mutter.
»O ja.« Mein Vater wendete sich lächelnd an mich. »Wenn du Fragen stellen möchtest, darfst du nicht zögern, Rosetta.«
»Ja«, ergänzte meine Mutter, »wenn du ein wenig darüber weißt, erhöht das deine Freude an den Vorträgen.«
Ich dankte ihnen. Offenbar waren sie nicht völlig unzufrieden mit mir.
Ich hatte eine Kabine neben der meiner Eltern, die ich mit einem Mädchen teilen sollte, das zu seinen Eltern nach Südafrika fuhr, wo sie eine Farm betrieben. Sie hatte die Schule beendet und war etwas älter als ich. Mary Kelpin hieß sie und war leidlich sympathisch. Sie hatte diese Reise schon mehrmals gemacht und war erfahrener als ich. Mary wählte die untere der beiden Kojen, was mich nicht im mindesten störte. Ich hätte mich sicher etwas beengt gefühlt, wenn ich unten schliefe. Sie teilte den Kleiderschrank, den wir gemeinsam benutzen mußten, peinlich genau mit mir, und ich dachte, daß wir in der Zeit, die wir auf See waren, einigermaßen miteinander auskommen würden.
Wir liefen am frühen Abend aus, und Lucas Lorimer hatte uns sogleich entdeckt. Ich hörte seine Stimme in der Kabine meiner Eltern. Ich ging nicht zu ihnen, sondern beschloß, das Schiff zu erkunden. Ich begab mich auf dem Niedergang zu den Gemeinschaftsräumen und dann hinauf aufs Deck, um einen letzten Blick auf den Pier zu werfen, bevor wir in See stachen. Ich lehnte an der Reling und beobachtete die Betriebsamkeit unten, als er zu mir trat. »Ich dachte mir, daß ich Sie hier finden würde«, sagte er. »Sie wollen bestimmt das Schiff ablegen sehen.«
»Ja«, erwiderte ich.
»Ist es nicht lustig, daß wir die Reise zusammen machen?«
»Lustig?«
»Das wird es bestimmt. Ein erfreulicher Zufall.«
»Es hat sich ganz selbstverständlich ergeben. Kann man das Zufall nennen?«
»Ich sehe, Sie nehmen es mit der Sprache sehr genau. Sie müssen mir helfen, meine Rede zu konzipieren.«
»Haben Sie sie noch nicht fertig? Mein Vater arbeitet seit einer Ewigkeit an seinem Vortrag.«
»Das ist sein Beruf. Meine Rede wird ganz anders. Ich werde mit den Geheimnissen des Ostens beginnen. Ein bißchen Anklang an Tausendundeine Nacht.«
»Vergessen Sie nicht, daß Sie vor Fachleuten sprechen.«
»Oh, ich hoffe, ein größeres Publikum anzuziehen – die phantasievollen, romantisch veranlagten Leute.«
»Das gelingt Ihnen bestimmt.«
»Ich bin so froh, daß wir zusammen fahren«, sagte er. »Und Sie sind nun kein Schulmädchen mehr, das ist an sich schon aufregend genug, nicht?«
»Ja, ich denke schon.«
»Auf der Schwelle zum Leben und zum Abenteuer.« Das Tuten einer Sirene zerriß die Luft. »Das bedeutet wohl, daß wir jetzt auslaufen. Ja, tatsächlich. Adieu, England. Willkommen, neue Länder, neue Eindrücke, neue Abenteuer.« Er lachte. Mir war beschwingt und froh zumute, weil er mit uns fuhr.
Die gute Stimmung hielt an. Der Kapitän und einige Mitreisende machten viel Aufhebens um meine Eltern. Die Nachricht, daß sie in Kapstadt und Nordamerika Vorträge halten würden, verbreitete sich rasch, und man betrachtete sie mit einer gewissen Ehrfurcht. Lucas war sehr beliebt und allseits begehrt. Er hatte keine Hemmungen; wenn er zu einer Gruppe stieß, gab es sogleich Gelächter und allgemeine Heiterkeit. Er besaß die Gabe, alles amüsant erscheinen zu lassen. Er war reizend zu mir, aber zu allen anderen auch. Das Leben meisterte er unbeschwert und leicht, und ich denke, dank seiner seltenen Begabung erreichte er stets, was er wollte.
Meine Kabinengenossin war mächtig beeindruckt. »Was für ein charmanter Mann!« sagte sie. »Und du hast ihn gekannt, bevor er an Bord kam. Hast du ein Glück!«
»Ich bin ihm auf einer Abendgesellschaft kurz begegnet, und dann besuchte er uns, um uns mitzuteilen, daß er an Bord sein würde.«
»Es ist natürlich wegen deines Vaters.«
»Was meinst du?«
»Daß er so freundlich zu dir ist.«
»Er ist zu allen freundlich.«
»Er ist sehr attraktiv ... zu attraktiv«, fügte sie düster hinzu und musterte mich nachdenklich. Sie betrachtete mich offenbar als Einfaltspinsel, weil ich ihr törichterweise erzählt hatte, daß ich vorzeitig von der Schule abgegangen war, um diese Reise machen zu können. Sie hatte die Schule im Vorjahr beendet, also mußte sie ungefähr ein Jahr älter sein als ich.
Ich hatte das Gefühl, daß sie mich vor Lucas warnen wollte. Das sei nicht nötig, hätte ich ihr am liebsten scharf erwidert, doch dann fürchtete ich, zu grob zu sein. In einem hatte sie recht: Ich hatte keine Ahnung, wie es auf der Welt zuging.
Wie dem auch sei, die Zeit, die ich mit Lucas verbrachte, war auf jeden Fall vergnüglich. An einem der ersten Tage suchten wir uns einen geschützten Platz an Deck, denn die See war zuweilen etwas rauh, und es ging ein starker Wind. Meine Eltern verbrachten die meiste Zeit in ihrer Kabine, und ich war mir selbst überlassen, um Erkundungen anzustellen. Dies tat ich mit großem Eifer, und bald fand ich mich auf dem Schiff zurecht. Die kleine Kabine war beengend, zumal ich sie mit der ziemlich geschwätzigen und etwas gönnerhaften Mary teilen mußte. Ich war froh, so oft wie möglich nach draußen zu kommen. Ich fand meine obere Koje ziemlich stickig. Ich wachte immer früh auf und lag wartend da, bis es Zeit war aufzustehen. Bald aber entdeckte ich, daß ich die Leiter heruntersteigen konnte, ohne Mary aufzuwecken. Ich zog mich an und ging an Deck. Der frühe Morgen war erfrischend. Ich setzte mich an unseren geschützten Platz, sah aufs Meer und beobachtete den Sonnenaufgang. Ich liebte den Anblick des Morgenhimmels; manchmal war er zart perlmutterfarben, ein andermal blutrot. Meine Phantasie sah Bilder in den Wolkenhaufen, die am Himmel trieben, und ich lauschte auf die Wellen, die längsseit klatschten. Zu keiner anderen Zeit war es so schön wie am Morgen.
Ein Mann in blauem Arbeitsanzug pflegte den Teil des Decks zu schrubben, wo ich jeden Morgen saß. Ich hatte mit ihm Bekanntschaft geschlossen, falls man es so nennen konnte. Er kam mit Scheuerlappen und Eimer, kippte das Wasser aus und schrubbte drauflos. Um diese Stunde war das Deck fast verlassen. Als er näher kam, sagte ich: »Guten Morgen. Ich bin herausgekommen, um etwas frische Luft zu schnappen. In der Kabine ist es so stickig.«
»O ja«, sagte er und schrubbte weiter.
»Bin ich Ihnen im Weg? Ich rücke ein Stück.«
»O nein, lassen Sie nur. Ich mache meine Runde und wische diesen Teil später.«
Er sprach kultiviert, ohne jeden Akzent. Ich betrachtete ihn – ziemlich groß, hellbraune Haare und ausgesprochen traurige Augen.
»Um diese Zeit sehen Sie sicher nicht viele Leute draußen sitzen«, sagte ich.
»Nein.«
»Sie halten mich bestimmt für verrückt.«
»Nein, nein. Ich kann verstehen, daß Sie an die Luft wollen. Und dies ist die schönste Zeit des Tages.«
»Oh, da stimme ich Ihnen zu.«
Ich bestand darauf aufzustehen, und er verrückte meinen Stuhl und schrubbte weiter.
Das war am ersten Morgen. Am nächsten Morgen sah ich ihn wieder. Am dritten Morgen hatte ich das Gefühl, daß er nach mir Ausschau hielt. Es war nicht direkt verabredet, aber es gehörte bald zum alltäglichen Ablauf. Wir wechselten ein paar Worte, »Guten Morgen«, »Schöner Tag heute« und so weiter. Er hielt beim Schrubben immer den Kopf gesenkt, als sei er vollkommen in sein Tun vertieft.
»Sie lieben das Meer, nicht wahr?« fragte er am vierten Morgen.
»Ich glaube, ja«, erwiderte ich. Ich sei noch nicht sicher, da ich zum erstenmal auf dem Meer sei.
»Es nimmt einen gefangen. Faszinierend. Es kann sich so rasch verändern.«
»Wie das Leben«, sagte ich, an die Veränderungen in meinem Dasein denkend. Er erwiderte nichts, und ich fuhr fort: »Ich nehme an, Sie haben viel Erfahrung mit dem Meer?«
Er schüttelte den Kopf und ging davon.
Die Mahlzeiten an Bord waren interessant. Lucas Lorimer saß als Freund der Familie mit an unserem Tisch, und Kapitän Graysom pflegte die hübsche Sitte, sich während der Reise immer an einen anderen Tisch zu setzen, so daß er die meisten Passagiere kennenlernte. Er wußte viele Geschichten von seinen Abenteuern auf See zu erzählen, und dieser sympathische Brauch ermöglichte es allen, sie zu hören.
»Er hat es leicht«, sagte Lucas. »Er hat sein Repertoire und muß nichts weiter tun als seine Vorstellung an jedem Tisch wiederholen. Er weiß genau, wo er eine Pause machen muß, damit gelacht werden kann und er die beste dramatische Wirkung erzielt.«
»Darin sind Sie ihm ein bißchen ähnlich«, sagte ich zu ihm. »Oh, ich meine nicht im Wiederholen, aber Sie wissen auch, wann Sie eine Pause machen müssen.«
»Ich sehe, Sie kennen mich zu gut; das beunruhigt mich.«
»Dann lassen Sie sich beruhigen. Ich finde, die Fähigkeit, Menschen zum Lachen zu bringen, ist eine der größten Gaben, die man haben kann.«
Er ergriff meine Hand und küßte sie. Meine Eltern, die während dieses Gesprächs mit am Tisch saßen, waren ein wenig erschrocken. Ich denke, es war ihnen klargeworden, daß ich erwachsen wurde. Bei einem Spaziergang rund ums Deck begegneten Lucas und ich Kapitän Graysom. Er machte täglich einen Rundgang auf dem Schiff, wohl um sich zu vergewissern, daß alles in Ordnung war.
»Na, wie geht’s?« fragte er beim Näherkommen.
»Bestens«, antwortete Lucas.
»Werden Sie schon seefest? Man ist es nicht immer von Anfang an. Aber wir haben einigermaßen Glück mit dem Wetter ... bis jetzt.«
»Wird es nicht anhalten?« fragte ich.
»Um Ihnen das zu sagen, bedarf es eines Klügeren, als ich es bin, Miß Cranleigh. Unsere Vorhersagen sind nie absolut zuverlässig. Das Wetter ist unberechenbar. Alle Anzeichen stehen auf Schön, und dann erscheint etwas Unvorhergesehenes am Horizont, und unsere Vorhersagen werden über den Haufen geworfen.«
»Vorhersagbarkeit kann ein bißchen langweilig sein«, meinte Lucas. »Es liegt immer ein gewisser Reiz im Unerwarteten.«
»Ich bin nicht sicher, ob das auch für das Wetter zutrifft«, sagte der Kapitän. »Wir laufen bald in Madeira ein. Gehen Sie an Land?«
»O ja«, rief ich. »Ich freue mich schon darauf.«
»Schade, daß wir nur einen Tag haben«, sagte Lucas.
»Das reicht, um Vorräte an Bord zu nehmen. Die Insel wird Ihnen gefallen. Sie müssen den Wein dort kosten. Er ist sehr gut.« Damit verließ er uns.
»Welche Pläne haben Sie für Madeira?« fragte Lucas.
»Meine Eltern haben noch nichts gesagt.«
»Ich würde Sie gern durch die Stadt begleiten.«
»Oh, danke. Sind Sie schon mal dortgewesen?«
»Ja«, erwiderte er. »Bei mir sind Sie daher gut aufgehoben.«
Es war ein erhebendes Gefühl, am Morgen aufzuwachen und Land zu sehen. Ich war zeitig an Deck, um die Ansteuerung zu beobachten. Ich sah die üppig grüne Insel aus dem klaren, aquamarinblauen Meer aufsteigen. Die Sonne war warm, und kein Wind bewegte das Wasser.
Mein Vater hatte eine leichte Erkältung und blieb an Bord. Er hatte genug Beschäftigung, und meine Mutter wollte bei ihm bleiben. Sie hielten es für eine ausgezeichnete Idee, daß ich mit Mr. Lorimer an Land ging, der sich freundlicherweise erboten hatte, mich mitzunehmen. Ich war zufrieden und hatte deswegen ein leichtes Schuldgefühl; aber es würde ohne sie viel vergnüglicher sein. Lucas sprach es nicht aus, doch ich war sicher, daß er meine Ansicht teilte.
»Da ich schon einmal hier war, sollte ich mich eigentlich auskennen«, sagte er. »Und wenn es etwas gibt, was ich noch nicht kenne –«
»Was sehr unwahrscheinlich ist ...«
»– werden wir es gemeinsam entdecken«, schloß er.
Und damit machten wir uns auf den Weg. Ich sog die Luft tief ein, die mit Blumenduft gewürzt schien. Und wirklich, Blumen waren überall. Es gab Stände, die überquollen mit Blumen in leuchtenden Farben, ebenso solche mit Körben, bestickten Taschen, Schals, Tischdecken und Zierdeckchen. Der Sonnenschein, die Menschen, die in einer fremden Sprache – Portugiesisch, nahm ich an – ihre Waren feilboten, die Aufregung, in einem fremden Land zu sein, und Lucas Lorimers Gesellschaft – das alles stimmte mich so heiter, wie ich es schon lange nicht mehr gewesen war.
Es war wirklich ein denkwürdiger Tag. Lucas war der vollendete Begleiter. Sein Lächeln bezauberte die Leute, wohin wir auch kamen. Er war einer der nettesten Menschen, denen ich je begegnet war.
Er wußte tatsächlich gut über die Insel Bescheid. »Sie ist sehr klein«, sagte er. »Ich war eine Woche hier, und in dieser Zeit bin ich fast überall gewesen.« Er mietete einen Ochsenkarren, und wir fuhren durch die Stadt, zur Kathedrale, wo wir anhalten ließen, um sie zu besichtigen, dann am Markt vorbei, wo es noch mehr Blumen, Körbe sowie Tische und Sessel aus Weidengeflecht gab. Von der Stadt aus erhaschten wir ab und zu einen Blick auf die Atlantic Star, die vor dem Hafen ankerte, und auf die Barkassen, die die Passagiere zwischen Ufer und Schiff übersetzten.
Lucas meinte, wir müßten den Wein kosten. Wir gingen in einen Weinkeller, wo wir uns an einen der kleinen Tische setzten, die wie Fässer geformt waren. Man brachte uns Gläser mit kleinen Kostproben von Madeirawein, wohl in der Hoffnung, wir möchten ihn für so gut befinden, daß wir ein paar Flaschen kauften.
In dem Keller war es dunkel – ein starker Kontrast zu der strahlenden Helligkeit draußen. Wir saßen auf Schemeln und betrachteten einander. Lucas hob sein Glas. »Auf Sie, auf uns und auf viele Tage wie den heutigen.«
»Der nächste Halt ist Kapstadt, glaube ich.«
»Vielleicht haben wir beide dort Gelegenheit, das Vergnügen zu wiederholen.«
»Sie werden mit Ihrem Vortrag beschäftigt sein.«
»Bitte nennen Sie es nicht Vortrag. Das Wort hat so einen strengen Beigeschmack. Ich wurde sozusagen als leichter Kontrast zu dem Professor hinzugebeten. Ich fühlte mich geehrt, und sehen Sie, es hat uns hierhergeführt. Nennen Sie es also eine Rede. Das ist weniger schwülstig. Und ich muß gestehen, ich habe das Gefühl, daß sie Ihre Eltern schockieren wird. Sie handelt von schauerlichen Dingen wie Flüchen und Grabräubern.«
»Vielleicht hören die Leute so etwas lieber als ...«
»Das soll mich nicht kümmern. Wenn sie ihnen nicht gefällt, dann eben nicht. Drum weigere ich mich, meine Vergnügungen von Vorbereitungen überschatten zu lassen. Es ist ein großes Glück, daß wir zusammen reisen.«
»Für mich ist es jedenfalls erfreulich.«
»Wir werden langsam beduselt. Das macht der Wein. Er ist gut, nicht? Wir müssen eine Flasche kaufen, um uns für die unentgeltliche Kostprobe erkenntlich zu zeigen.«
»Hoffentlich zahlen sich alle unentgeltlichen Kostproben aus.«
»Bestimmt, sonst würde man den Brauch nicht beibehalten, nicht wahr? Es ist ja auch sehr angenehm, hier in dem dämmerigen Raum auf diesen unbequemen Schemeln zu sitzen und den ausgezeichneten Madeirawein zu trinken.«
Einige von unseren Mitreisenden kamen in den Keller. Wir riefen uns Grüße zu. Alle wirkten sehr ausgelassen.
Ein junger Mann kam an unserem Tisch vorbei. »Oh, guten Tag«, sagte Lucas. Der junge Mann blieb stehen. »Ach«, sagte Lucas, »ich glaubte Sie zu kennen.«
Der junge Mann starrte Lucas eisig an, und da erkannte ich ihn. Heute trug er nicht den Arbeitsanzug, in dem ich ihn sonst immer gesehen hatte. Es war der junge Mann, der morgens die Decks schrubbte.
»Nein«, sagte er. »Ich glaube nicht ...«
»Verzeihung. Ich dachte bloß einen Augenblick, ich hätte Sie schon mal irgendwo gesehen.«
Ich lächelte. »Sie müssen sich an Bord begegnet sein.«
Der Decksmann hatte sich straff aufgerichtet und musterte Lucas mit einer Spur Unbehagen im Blick.
»So wird es wohl sein«, sagte Lucas.
Der junge Mann ging weiter und setzte sich in einer dunklen Ecke des Kellers an einen Tisch.
Ich flüsterte Lucas zu: »Er ist ein Decksmann.«
»Sie scheinen ihn zu kennen.«
»Ich bin ihm ein paarmal morgens begegnet. Ich gehe hinauf, um den Sonnenaufgang zu beobachten, und er kommt um die Zeit, um die Decks zu schrubben.«
»Er sieht nicht wie ein Decksschwabberer aus.«
»Weil er seinen Arbeitsanzug nicht anhat.«
»Danke, daß Sie mich aufgeklärt haben. Der arme Kerl wirkte ein bißchen verlegen. Hoffentlich schmeckt ihm der Wein so gut wie uns. Kommen Sie, kaufen wir eine Flasche, um sie mit aufs Schiff zu nehmen. Vielleicht nehmen wir besser zwei. Die trinken wir heute abend beim Essen.« Wir kauften den Wein und traten hinaus in den Sonnenschein. Langsam begaben wir uns zu der Barkasse, die uns zum Schiff zurückbrachte. Am Kai blieben wir an einem Stand stehen, wo Lucas für mich eine mit scharlachroten und blauen Blumen reich bestickte Tasche erstand. »Ein Andenken an einen glücklichen Tag«, sagte er. »Als Dank, weil ich ihn mit Ihnen verbringen durfte.«
Wie reizend er war; mir hatte er ganz bestimmt einen glücklichen Tag beschert. »Ich werde immer daran denken, wenn ich die Tasche sehe«, sagte ich zu ihm. »An die Blumen, die Ochsenkarren, den Wein ...«
»Und sogar an den Decksschwabberer.«
»Ich werde mich an jede Minute erinnern«, versicherte ich ihm.
Auf See schließt man rasch Freundschaft. Nach Madeira hatten wir mildes Wetter mit ruhiger See. Lucas und ich waren seit unserem Landausflug noch engere Freunde geworden. Ohne uns zu verabreden, trafen wir uns regelmäßig an Deck. Er setzte sich zu mir, und wir plauderten zwanglos, während wir über das ruhige Wasser glitten. Lucas erzählte mir viel von sich und berichtete, wie er mit der Familientradition gebrochen hatte, daß ein Sohn die militärische Laufbahn einschlug. Aber die war nichts für ihn. Er wußte noch nicht recht, was er wollte. Er war rastlos und reiste viel, meistens in Gesellschaft von Dick Duvane, seinem Freund und ehemaligen Burschen. Sie hatten dem Militär zur gleichen Zeit den Rücken gekehrt und waren seither unzertrennlich gewesen. Dick war jetzt in Cornwall und machte sich auf dem Gut nützlich, und Lucas nahm an, daß auch er eines Tages dort landen würde. »Bloß, im Augenblick bin ich noch unsicher«, sagte er. »Auf dem Gut gibt es genug zu tun, um meinen Bruder und mich zu beschäftigen. Vermutlich wäre es etwas anderes, wenn ich es geerbt hätte. Mein Bruder Carleton trägt die Verantwortung, und er ist der vollendete Gutsherr, der ich niemals sein werde. Er ist der feinste Kerl auf der Welt, aber ich spiele nicht gerne die zweite Geige. Das widerspricht meiner hochmütigen Natur. Deshalb habe ich mich nach meinem Abschied vom Militär ein wenig treiben lassen; ich war viel unterwegs. Ägypten hat mich immer fasziniert, und als ich den Stein im Garten fand, schien es mir wie ein Wink des Schicksals. Und das war es auch, denn jetzt bin ich hier, auf Reisen mit herausragenden Persönlichkeiten wie Ihren Eltern und natürlich ihrer reizenden Tochter. Und das alles, weil ich einen Stein im Garten fand. Aber ich rede die ganze Zeit von mir. Wie steht es mit Ihnen? Was haben Sie für Pläne?«
»Gar keine. Sie wissen ja, ich habe die Schule abgebrochen, um diese Reise zu machen. Wer weiß, was die Zukunft bringt?«
»Das kann man freilich nie genau wissen, aber manchmal hat man Gelegenheit, sie zu beeinflussen.«
»Haben Sie Ihre beeinflußt?«
»Ich bin gerade dabei.«
»Und das Gut Ihres Bruders liegt in Cornwall?«
»Ja. Es ist übrigens nicht weit von dem Ort, der kürzlich in den Zeitungen erwähnt wurde.«
»Ach ... welcher?«
»Haben Sie von dem jungen Mann gelesen, der kurz vor der Verhaftung verschwunden ist?«
»O ja, ich erinnere mich. Simon Soundso, nicht? Hieß er nicht Perrivale?«
»Richtig. Er trug den Namen des Mannes, der ihn adoptiert hat, Sir Edward Perrivale. Das Gut liegt zehn, zwölf Kilometer von unserem entfernt. Perrivale Court. Eine herrliche alte Villa. Ich bin vor langer Zeit einmal dortgewesen. Mein Vater war mit irgendeiner Angelegenheit in der Nachbarschaft befaßt, und Sir Edward interessierte sich dafür. Ich bin mit meinem Vater hinübergeritten. Als ich in der Zeitung über den Fall las, fiel mir das alles wieder ein. Da waren zwei Brüder und der Adoptivbruder. Wir waren alle erschüttert, als wir es lasen. Man rechnet nie damit, daß solche Dinge Leuten zustoßen, die man kennt, wenn auch nur flüchtig.«
»Das ist ja hochinteressant. Bei uns zu Hause haben sie ausgiebig darüber geredet. Die Dienstboten, nicht meine Eltern.«
Während wir uns unterhielten, kam der Decksschwabberer vorbei; er schob einen mit Bierflaschen beladenen Sackkarren. »Guten Morgen«, rief ich. Er nickte einen Gruß und schob weiter.
»Ein Freund von Ihnen?« fragte Lucas.
»Das ist der, der immer das Deck schrubbt. Erinnern Sie sich, er war in dem Weinkeller.«
»Ach ja, stimmt. Er wirkt ein bißchen griesgrämig, nicht?«
»Er ist vielleicht etwas zurückhaltend. Es könnte sein, daß die Mannschaft nicht mit den Passagieren sprechen soll.«
»Er scheint anders als die anderen.«
»Ja. Er sagt nie viel mehr als guten Morgen und vielleicht noch eine Bemerkung über das Wetter.«
Wir verbannten den Mann aus unseren Gedanken und sprachen von anderen Dingen. Lucas erzählte mir von dem Gut in Cornwall und den exzentrischen Leuten, die dort lebten. Ich erzählte ihm von zu Hause und von Mr. Dollands »Nummern« und brachte ihn mit meinen Schilderungen des Küchenlebens zum Lachen.
»Sie haben es anscheinend sehr genossen.«
»O ja, ich habe Glück gehabt.«
»Wissen Ihre Eltern das?«
»Sie interessieren sich wirklich nicht für irgend etwas, das nach Christi Geburt geschah.« So verliefen unsere Plaudereien.
Als ich mich am nächsten Morgen in aller Frühe aufs Deck setzte, sah ich den Decksschwabberer, aber er kam nicht in meine Nähe.
Wir nahmen Kurs auf Kapstadt, und der Wind hatte den ganzen Tag zugenommen. Ich sah meine Eltern kaum. Sie verbrachten viel Zeit in ihrer Kabine. Mein Vater vervollständigte seinen Vortrag und arbeitete an seinem Buch, und meine Mutter half ihm dabei. Ich sah sie bei den Mahlzeiten, wenn sie mich mit dieser milden Geistesabwesenheit betrachteten, an die ich mich gewöhnt hatte. Mein Vater fragte, ob ich genügend Beschäftigung hätte. Ich möge in seine Kabine kommen, dort würde er mir etwas zum Lesen geben. Ich versicherte ihm, daß ich das Bordleben genösse, daß ich genug zu lesen hätte und daß Mr. Lorimer und ich gute Freunde geworden seien. Darüber schienen sie erleichtert, und sie wandten sich wieder ihrer Arbeit zu.
Der Kapitän, der gelegentlich mit uns speiste, berichtete, zu den schlimmsten Stürmen, die er erlebt habe, hätten die am Kap gehört. Alten Seeleuten sei es als Kap der Stürme bekannt. Wir könnten keinesfalls damit rechnen, daß das schöne Wetter, dessen wir uns bisher erfreut hatten, anhalte. Wir müßten das Unangenehme mit dem Angenehmen in Kauf nehmen. Und Unangenehmes stünde uns gewiß bevor.
Meine Eltern blieben in ihrer Kabine, aber ich hatte das Bedürfnis nach frischer Luft und ging aufs Oberdeck. Auf ein solches Toben war ich nicht gefaßt. Das Schiff wurde heftig geschüttelt; es war, als sei es aus Kork. Es stampfte und rollte dermaßen, daß ich dachte, es würde kentern. Die hohen Wellen erhoben sich wie drohende Berge, bevor sie umschlugen und über das Deck schwappten. Der Wind zerrte an meinen Haaren und meinen Kleidern. Mir war, als wolle die wütende See mich emporheben und über Bord werfen. Es war erschreckend und gleichzeitig belebend. Ich war von Meerwasser durchnäßt, und es war mir fast unmöglich, aufrecht zu stehen. Atemlos klammerte ich mich an die Reling.
Als ich dort stand und mit mir rang, ob es klug sei, das schlüpfrige Deck zu überqueren, um wenigstens der unmittelbaren Wut des Sturmes zu entkommen, sah ich den Decksmann. Er schwankte auf mich zu, seine Kleider waren feucht. Die Gischt hatte sein Haar dunkel gefärbt, so daß es wie eine schwarze Kappe aussah, und Meerwasser glitzerte auf seinem Gesicht.
»Alles in Ordnung mit Ihnen?« rief er mir zu.
»Ja«, rief ich zurück.
»Sie sollten nicht hier oben sein. Gehen Sie lieber runter.«
»Ja«, rief ich.
»Kommen Sie, ich helfe Ihnen.«
Er taumelte zu mir und fiel gegen mich.
»Ist es öfter so schlimm wie heute?« keuchte ich.
»Kann ich nicht sagen. Ist meine erste Reise.« Er hatte meinen Arm genommen, und wir torkelten wie Betrunkene über das Deck. Er öffnete eine Tür und schob mich hinein. »So«, sagte er. »Wagen Sie sich nicht noch einmal hinaus bei so einer See.«
Ehe ich ihm danken konnte, war er verschwunden. Taumelnd begab ich mich in meine Kabine. Mary Kelpin lag auf der unteren Koje. Ihr war regelrecht übel. Ich ging nach meinen Eltern sehen. Sie fühlte sich beide nicht wohl. Wieder in meiner Kabine, nahm ich ein Buch, kletterte auf die obere Koje und versuchte zu lesen. Das war gar nicht so einfach.
Den ganzen Nachmittag warteten wir auf das Nachlassen des Sturms. Das Schiff schaukelte immerzu, es knarrte und ächzte wie im Todeskampf. Am Abend flaute der Wind ein wenig ab. Ich war imstande, in den Speisesaal zu gehen. Die Schlingerleisten an den Tischen waren hochgeklappt, um zu verhindern, daß das Geschirr herunterrutschte. Es waren nur wenige Leute da. Ich sah Lucas sofort. »Ah«, sagte er, »nicht viele von uns sind tapfer genug, sich in den Speisesaal zu wagen.«
»Haben Sie jemals so einen Sturm erlebt?«
»Ja, einmal auf dem Heimweg von Ägypten. Wir passierten Gibraltar und kamen zum Golf. Ich dachte, mein letztes Stündlein hätte geschlagen.«
»Das dachte ich heute nachmittag auch.«
»Das Schiff wird den Sturm überstehen. Morgen ist das Meer vielleicht so glatt wie ein See, und dann fragen wir uns, wozu die ganze Aufregung war. Wo sind Ihre Eltern?«
»In ihrer Kabine. Sie waren nicht in der Verfassung herunterzukommen.«
»Viele andere offenbar auch nicht.«
Ich erzählte ihm, daß ich an Deck gewesen und von dem Decksmann einigermaßen streng gerügt worden war.
»Er hatte ganz recht«, sagte Lucas. »Es muß äußerst gefährlich gewesen sein. Sie hätten leicht über Bord gespült werden können. Ich schätze, wir sind gerade noch an einem Hurrikan vorbeigekommen.«
»Da merkt man erst, wie gefährlich die See sein kann.«
»Allerdings. Mit den Elementen ist nicht zu spaßen. Das Meer ist wie das Feuer, ein guter Freund, aber ein böser Feind.«
»Wie es wohl sein mag, wenn man Schiffbruch erleidet?«
»Entsetzlich.«
»In einem offenen Boot treiben«, murmelte ich.
»Weit unangenehmer, als es sich anhört.«
»Ja, das kann ich mir denken. Aber der Sturm scheint nachzulassen.«
»Darauf würde ich nicht bauen. Wir müssen auf jedes Wetter gefaßt sein. Vielleicht war dies eine heilsame Lektion für uns.«
»Die Menschen lernen ihre Lektionen nicht immer.«
»Ich weiß nicht, warum, wenn sie doch ein gutes Beispiel haben, wie tückisch die See sein kann. Eben noch lächelnd, und im nächsten Moment wütend, boshaft.«
»Hoffentlich erleben wir keinen Hurrikan mehr.«
Es war zehn Uhr vorbei, als ich in meine Kabine kam. Mary Kelpin lag im Bett. Ich ging nach nebenan, um meinen Eltern gute Nacht zu sagen. Mein Vater hatte sich hingelegt, meine Mutter las in irgendwelchen Papieren. Ich erklärte, daß ich mit Lucas Lorimer gegessen hätte und jetzt zu Bett ginge.
»Hoffen wir, daß das Schiff morgen etwas stetiger ist«, sagte meine Mutter. »Diese ewige Bewegung stört Vaters Gedankenfluß, und er hat noch an dem Vortrag zu arbeiten.«
Ich schlief unruhig und wachte in den frühen Morgenstunden auf. Der Wind nahm zu, und das Schiff schaukelte noch stärker als tags zuvor. Ich wurde beinahe aus meiner Koje geworfen. Schlafen war unmöglich. Ich lag still da, lauschte auf das Heulen des Sturms und auf das Geräusch der mächtigen Wellen, die längsseit schlugen.
Plötzlich hörte ich ungestümes Glockenläuten. Ich wußte sofort, was das bedeutete, denn an unserem ersten Tag auf See hatten wir an einer Übung teilgenommen, die uns mehr schlecht als recht auf einen Notfall vorbereitete. Man hatte uns gesagt, wir müßten uns warm anziehen und die Rettungswesten anlegen, die im Kleiderschrank in unseren Kabinen aufbewahrt wurden, und uns zu dem Sammelpunkt begeben, der uns zugewiesen worden war.
Ich sprang von meiner Koje. Mary Kelpin war schon dabei, sich anzuziehen. »Es ist soweit«, sagte sie. »Dieser gräßliche Wind ... und jetzt das.« Ihre Zähne klapperten. In der Enge war es nicht leicht für uns zwei, uns gleichzeitig anzuziehen. Sie war vor mir fertig, und als ich alle Knöpfe geschlossen und meine Rettungsweste übergezogen hatte, eilte ich in die Kabine meiner Eltern.
Die Alarmglocken läuteten unaufhörlich. Meine Eltern machten ängstliche Gesichter, und mein Vater suchte aufgeregt seine Papiere zusammen. Ich sagte: »Dazu ist jetzt keine Zeit. Kommt, zieht eure warmen Sachen an. Wo sind eure Rettungswesten?« In dieser Situation gewann ich die Erkenntnis, daß ein bißchen Ruhe und gesunder Menschenverstand gegenüber Gelehrsamkeit im Vorteil sind. Meine Eltern waren rührend folgsam und überließen sich meiner Obhut; endlich waren sie soweit, daß sie die Kabine verlassen konnten.
Der Laufgang war menschenleer. Mein Vater blieb plötzlich stehen, und etliche Papiere fielen ihm aus der Hand. Ich hob sie hastig auf. »Ach«, sagte er bestürzt, »ich habe die Aufzeichnungen vergessen, die ich gestern gemacht habe.«
»Egal. Unser Leben ist wichtiger als deine Aufzeichnungen.« Er rührte sich nicht von der Stelle. »Ich kann nicht ... ich muß sie holen.«
Meine Mutter sagte: »Vater braucht seine Aufzeichnungen, Rosetta.«
Ich sah den hartnäckigen Ausdruck in ihren Gesichtern und sagte schnell: »Ich hole sie. Geht ihr in den Salon, wo sich alle versammeln sollen. Wo sind die Aufzeichnungen?«
»In der oberen Schublade«, sagte meine Mutter.
Ich schob meine Eltern sanft zu dem Niedergang, der zum Salon führte, und kehrte um. Die Aufzeichnungen waren nicht in der oberen Schublade. Ich kramte herum und fand sie weiter unten. Die Rettungsweste hinderte mich sehr in meinen Bewegungen. Ich schnappte mir die Aufzeichnungen und eilte hinaus.
Die Glocken hatten zu läuten aufgehört. Es war schwierig, aufrecht zu stehen. Das Schiff schlingerte, und ich wäre fast gestürzt, als ich den Niedergang erklomm. Von meinen Eltern war nichts zu sehen. Ich nahm an, sie wären am Treffpunkt zu den anderen gestoßen und eiligst an Deck gebracht worden, wo die Rettungsboote auf sie warteten.
Der Sturm hatte an Heftigkeit zugenommen. Ich stolperte und rutschte, bis ich am Schott zum Stillstand kam. Ich rappelte mich benommen auf und sah mich nach meinen Eltern um. Wo konnten sie in der kurzen Zeit, die ich gebraucht hatte, um die Aufzeichnungen zu holen, nur hingegangen sein? Ich umklammerte die Papiere, während ich mich mühsam zum Deck kämpfte. Dort war die Hölle los. Die Leute drängten zur Reling. Vergebens suchte ich meine Eltern unter ihnen. In der stoßenden, schreienden Menge kam ich mir plötzlich schrecklich allein vor.
Es war entsetzlich. Dem Wind schien es eine tückische Freude zu bereiten, uns zu peinigen. Meine Haare flogen mir wild um den Kopf und wehten mir in die Augen, und ich konnte nichts sehen. Die Aufzeichnungen wurden mir aus der Hand gerissen. Sekundenlang führten sie über meinem Kopf einen wilden Tanz auf, bevor sie von dem heftigen Wind gepackt wurden und in die schäumenden Wassermassen flatterten.
Wir hätten zusammenbleiben sollen, dachte ich. Und dann: Warum? Wir sind nie zusammen gewesen. Aber dies war etwas anderes. Wir waren in Gefahr. Der Tod starrte uns ins Gesicht. Ein paar Aufzeichnungen waren es doch gewiß nicht wert, sich in solch einem Augenblick zu trennen? Die Leute stiegen in die Boote. Ich wußte, daß ich noch lange nicht an der Reihe war ... und als ich sah, wie die zerbrechlichen Boote in die tückische See herabgelassen wurden, da war ich nicht sicher, ob ich mich einem von ihnen anvertrauen wollte.
Das Schiff erzitterte plötzlich und gab ein Ächzen von sich, als könne es mehr nicht ertragen. Wir schienen zu kentern, und ich stand im Wasser. Dann sah ich ein Boot umschlagen, während es herabgelassen wurde. Ich hörte die Schreie der Insassen, als die See sie gierig packte und in die Tiefe zog.
Ich fühlte mich benommen und irgendwie dem Geschehen entrückt. Der Tod schien so gut wie sicher. Ich sollte mein Leben verlieren, fast bevor es richtig begonnen hatte. Ich dachte an die Vergangenheit, wie es Ertrinkende angeblich immer tun. Aber ich ertrank nicht ... noch nicht. Ich war auf diesem lecken, zerbrechlichen Dampfer, der beispiellosen Wut der Elemente ausgeliefert, und wußte, daß ich im nächsten Augenblick von der vergleichsweisen Sicherheit des Decks in die graue See geworfen werden konnte, wo es keine Hoffnung auf Überleben gab. Der Lärm war ohrenbetäubend, die Schreie und Gebete der Menschen, die Gott anflehten, sie aus der Gewalt der See zu erretten, das Tosen des Sturms, das heftige Heulen und die aufgewühlte See ... es war wie eine Szene aus Dantes Inferno.
Wir waren machtlos. Ich nehme an, der erste Gedanke der Menschen, die dem Tod ins Gesicht sehen, gilt ihrer eigenen Rettung.
Wenn man jung ist, scheint einem der Tod vielleicht so fern, daß man ihn nicht ernst nehmen kann. Er holt andere Menschen, alte Menschen zumal. Man kann sich eine Welt ohne einen selbst nicht vorstellen; man hält sich für unsterblich. Ich wußte, daß in dieser Nacht viele Menschen im Wasser ihr Grab finden würden, aber ich konnte nicht glauben, daß ich unter ihnen sein würde.
Benommen stand ich da und wartete; ich versuchte, meine Eltern zu entdecken. Ich dachte an Lucas Lorimer. Wo war er? Ich wünschte, ich könnte ihn sehen. Flüchtig ging mir der Gedanke durch den Kopf, daß er wohl nach wie vor gelassen und ein wenig zynisch sein würde. Ob er über den Tod ebenso unbekümmert plaudern würde wie über das Leben?
Da sah ich das umgekippte Boot. Es wurde im Wasser umhergeworfen. Es kam dicht an die Stelle, wo ich stand. Dann richtete es sich auf und tänzelte unter mir.
Jemand packte mich unsanft am Arm. »Sie werden im nächsten Augenblick über Bord gespült, wenn Sie hier stehenbleiben.«
Ich drehte mich um. Es war der Decksmann. »Es ist aus mit ihr. Sie wird kentern, das ist sicher.« Sein Gesicht war naß von Gischt. Er starrte das Boot an, das von der Gewalt des Windes nahe an die Schiffsseite gedrückt wurde. Eine riesige Welle hob es fast auf unsere Höhe. Der Decksmann schrie: »Das ist unsere Chance. Los, springen!« Zu meiner Verwunderung gehorchte ich. Er hielt meinen Arm noch gepackt. Es kam mir ganz unwirklich vor. Ich segelte durch die Luft und tauchte dann in die schäumende See. Wir waren neben dem Boot. »Festhalten!« schrie er über das Getöse hinweg.
Ich gehorchte instinktiv. Er war dicht bei mir. Es kam mir wie Minuten vor, doch es können nur Sekunden gewesen sein, bis er im Boot war. Ich klammerte mich an der Seite fest. Dann packte er mich und hievte mich neben sich hinein. »Festhalten ... festhalten, um Himmels willen«, schrie er.
Es war ein Wunder. Wir waren noch immer im Boot, völlig außer Atem. »Festhalten, festhalten«, rief der Decksmann immerzu.
Was in den folgenden Minuten geschah, weiß ich nicht genau. Ich merkte nur, daß ich heftig umhergeworfen wurde und die Gewalt des Windes mir den Atem nahm. Ich vernahm ein lautes Krachen, als die Atlantic Star sich aufbäumte und dann umschlug. Das Meerwasser hatte mir die Sicht genommen, mein Mund war voll davon. In einem Augenblick waren wir auf einem Wellenkamm, im nächsten in den Tiefen des Ozeans.
Ich hatte mich von dem sinkenden Schiff in ein kleines Boot gerettet, das einer solchen See bestimmt nicht standhalten konnte. Das mußte das Ende sein.
Die Zeit hatte aufgehört zu existieren. Ich hatte keine Ahnung, wie lange ich mich an die Seiten des Bootes klammerte, während nur eines wichtig schien: nicht aufzugeben. Ich spürte den Mann dicht neben mir. Er schrie gegen den Wind: »Wir treiben noch. Wie lange ...« Seine Stimme verlor sich im Getöse.
Ich konnte die Atlantic Star gerade noch ausmachen. Sie war noch im Wasser, aber in einer ungewöhnlichen Lage. Ihr Bug schien verschwunden. Es gab kaum eine Chance, daß jemand auf ihr überlebte.
Wir schaukelten heftig und waren darauf gefaßt, daß jede Welle unser Leben beenden konnte. Rings um uns tobte und wütete die See, und dieses zerbrechliche kleine Boot wollte dem ungeheuerlichen Meer trotzen. Was wäre wohl aus mir geworden, wenn dieser Mann nicht im rechten Augenblick gekommen wäre und mich aufgefordert hätte, mit ihm zu springen? Es war ein Wunder! Ich konnte es kaum fassen. Aber wo waren meine Eltern? Ob sie sich hatten retten können?
Dann schien der Sturm nicht mehr ganz so grimmig zu sein. War es Einbildung? Vielleicht nur eine vorübergehende Flaute. Immerhin ein kleiner Aufschub. Ein Rettungsboot kam in unsere Nähe. Ich suchte es mit den Augen ab in der Hoffnung, meine Eltern darin zu erspähen. Ich sah angespannte, weiße Gesichter, unkenntlich, fremd. Plötzlich erfaßte eine Welle das Boot. Eine Sekunde hing es in der Luft, dann wurde es von einer anderen Riesenwelle überrollt. Ich hörte die Schreie. Das Boot war noch da. Abermals wurde es emporgehoben. Es schien aufrecht zu stehen. Ich sah Körper ins Meer tauchen. Dann fiel das Boot herab und schlug um. Es war kieloben im Wasser, bevor es wieder hochkam und die See es auf die Seite warf wie ein Kind, das plötzlich eines Spielzeugs überdrüssig ist. Ich sah Köpfe scheinbar endlose Minuten lang im Wasser auf und ab tauchen und dann verschwinden. Ich hörte meinen Retter rufen: »Sehen Sie, da treibt jemand auf uns zu.« Es war ein Mann. Plötzlich erschien sein Kopf dicht neben uns. »Holen wir ihn an Bord, schnell, sonst geht er unter und nimmt uns mit.«
Ich streckte meine Arme aus. Ich war von Bewegung überwältigt, denn der Mann, den wir ins Boot zu hieven suchten, war Lucas Lorimer. Es dauerte eine ganze Weile, bis es uns gelang. Er fiel bäuchlings hin und war ganz still. Ich hätte ihm gern zugerufen: Sie sind in Sicherheit, Lucas. Und ich dachte dabei: Soweit irgend jemand von uns in Sicherheit sein kann.
Wir drehten ihn auf den Rücken. Als mein Retter ihn erkannte, hielt er den Atem an. Er rief mir zu: »Er ist in sehr schlechter Verfassung.«
»Was können wir tun?«
»Er ist halb ertrunken.« Er beugte sich über Lucas und begann das Wasser aus seinen Lungen zu pumpen. Er bemühte sich um Lucas’ Leben, und ich fragte mich, wie lange er durchhalten konnte. Er hatte Erfolg. Lucas sah ein wenig belebter aus. Mir fiel auf, daß mit seinem linken Bein etwas nicht in Ordnung war. Ab und an befühlte er es mit der Hand. Er war nur halb bei Bewußtsein, aber er merkte, daß da etwas nicht stimmte.
»Mehr kann ich nicht tun«, murmelte mein Retter.
»Wird er durchkommen?«
Er zuckte die Achseln.
Nach ungefähr zwei Stunden begann der Wind ein wenig nachzulassen. Die Böen kamen weniger häufig, und wir trieben immer noch auf dem Wasser.
Lucas hatte die Augen nicht geöffnet, er lag reglos auf dem Boden des Bootes. Mein anderer Gefährte war mit dem Boot beschäftigt. Ich wußte nicht, was er da machte, es schien aber wichtig, und der Umstand, daß wir uns über Wasser hielten, verriet mir, daß er damit umzugehen verstand. Er sah auf und merkte, daß ich ihn beobachtete. »Sie sollten lieber schlafen«, meinte er. »Sie sind erschöpft.«
»Sie auch.«
»Ach, es gibt genug zu tun, um mich wach zu halten.«
»Es ist besser geworden, nicht? Haben wir eine Chance?«
»Daß man uns findet? Vielleicht. Wir haben Glück. Unter dem Sitz sind ein Kanister Wasser und eine Dose Biskuits als Notration verstaut. Das wird uns eine Zeitlang am Leben halten. Wasser ist das wichtigste. Damit können wir überleben, jedenfalls eine Weile.«
»Und er?« Ich deutete auf Lucas.
»Er ist übel dran. Aber er atmet. Er war halb ertrunken ... und es sieht so aus, als wäre sein Bein gebrochen.«
»Können wir etwas tun?«
Er schüttelte den Kopf. »Nichts. Wir haben nichts da. Er muß warten. Wir müssen nach einem Schiff Ausschau halten. Sie können nichts tun, also versuchen Sie zu schlafen. Danach werden Sie sich besser fühlen.«
»Und Sie?«
»Vielleicht später. Für ihn können wir nichts mehr tun. Wir müssen die Richtung nehmen, wohin der Wind uns treibt. Wir können nicht steuern. Wenn wir Glück haben, geraten wir auf einen Handelsschiffsweg. Wenn nicht ...« Er zuckte die Achseln. Dann sagte er beinahe zärtlich: »Für Sie ist es das beste, ein bißchen zu schlafen. Das wirkt Wunder.«
Ich befolgte seinen Rat und schloß die Augen.
Als ich erwachte, war die Sonne aufgegangen. Ein neuer Tag war angebrochen. Ich blickte mich um. Der rotgefleckte Himmel warf einen rosa Widerschein aufs Meer. Es ging immer noch ein starker Wind, der weiße Kämme auf die Wellen setzte. Das bedeutete, daß wir flott vorankamen. Wohin, konnte man nur vermuten. Wir waren dem Wind ausgeliefert.
Lucas lag noch auf dem Boden des Bootes. Der andere Mann sah mich eindringlich an. »Haben Sie geschlafen?« fragte er.
»Ja, ziemlich lange, wie es scheint.«
»Sie hatten es nötig. Fühlen Sie sich besser?«
Ich nickte. »Was ist geschehen?«
»Sie sehen, die See ist ruhiger.«
»Es stürmt nicht mehr.«
»Drücken Sie die Daumen. Im Augenblick hat es nachgelassen. Es kann natürlich binnen weniger Minuten wieder losgehen ... aber vorerst haben wir eine kleine Chance.«
»Meinen Sie, es besteht Hoffnung, daß man uns findet?«
»Eine Chance von fünfzig zu fünfzig.«
»Und wenn nicht?«
»Das Wasser wird nicht lange reichen.«
»Sie sagten etwas von Biskuits.«
»Hm. Aber Wasser ist wichtiger. Wir müssen es rationieren.«
»Was ist mit ihm?« Ich deutete auf Lucas.
»Sie kennen ihn.« Das war eine Feststellung, keine Frage.
»Ja. Wir haben uns an Bord angefreundet.«
»Ich sah Sie mit ihm sprechen.«
»Ist er schwer verletzt?«
»Ich weiß nicht. Wir können ohnehin nichts tun.«
»Was ist mit seinem Bein?«
»Muß geschient werden, denke ich. Wir haben nichts da ...«
»Ich wünschte ...«
»Wünschen Sie sich nicht zuviel. Das Schicksal könnte Sie für unersättlich halten. Wir sind gerade erst wie durch ein Wunder davongekommen.«
»Ich weiß. Das ist Ihnen zu verdanken.«
Er lächelte mich schüchtern an. »Wir müssen weiter auf Wunder hoffen«, sagte er.
»Ich wünschte, wir könnten etwas für ihn tun.«
Er schüttelte den Kopf. »Wir müssen vorsichtig sein. Wir könnten binnen einer halben Sekunde kentern. Seine Chancen stehen so gut wie unsere.«
Ich nickte. »Meine Eltern ...« begann ich.
»Vielleicht haben sie ein Rettungsboot erwischt.«
»Ich sah, wie ein Boot heruntergelassen wurde ... und unterging.«
»Viel Hoffnung besteht für keins von ihnen.«
»Es wundert mich, daß dieses winzige Boot sich gehalten hat. Wenn wir hier heil herauskommen, ist das allein Ihnen zu verdanken.«
Wir verfielen in Schweigen. Nach einer Weile holte er den Wasserkanister hervor. Wir tranken jeder einen Schluck. Er schraubte ihn sorgsam zu. »Wir müssen es einteilen«, sagte er. »Es ist unser Lebenssaft, denken Sie daran.«
Ich nickte.
Die Stunden vergingen. Lucas öffnete die Augen und sah zu mir auf.
»Rosetta?« murmelte er.
»Ja, Lucas?«
»Wo ...« Seine Lippen formten das Wort, aber es kam fast kein Laut heraus.
»Wir sind in einem Rettungsboot. Das Schiff ist gesunken, glaube ich. Es ist alles gut. Sie sind hier mit mir und mit ...« Es war absurd, daß ich den Namen nicht wußte. Er mochte einst ein Decksmann gewesen sein, aber jetzt war er unser Retter, der Mann, dem wir unser wunderbares Entkommen zu verdanken hatten.
Doch Lucas hätte es sowieso nicht richtig hören können. Er zeigte keinerlei Verwunderung, sondern schloß die Augen wieder. Er sagte etwas. Ich mußte mich über ihn beugen, um ihn zu verstehen. »Mein Bein ...«
Wir mußten etwas damit anstellen. Aber was? Wir hatten keine Medikamente, nichts, und wir mußten uns im Boot vorsichtig bewegen. Selbst in dieser ruhigen See konnte es beängstigend schaukeln, und dabei hätte leicht einer über Bord gehen können.
Die Sonne stieg höher, und es wurde sehr heiß. Zum Glück wehte ständig eine leichte Brise. Sie blies uns sachte vorwärts, aber niemand von uns hatte eine Ahnung, in welche Richtung. »Es wird einfacher sein, wenn die Sterne herauskommen«, sagte unser Retter. Ich hatte seinen Namen erfahren, John Plaidy. Mir schien, er hatte ihn etwas zögernd genannt.
»Haben Sie etwas dagegen, wenn ich John zu Ihnen sage?« fragte ich ihn, und er antwortete: »Dann sage ich Rosetta zu Ihnen. Wir stehen jetzt auf gleicher Stufe, wir sind nicht mehr Passagier und Decksmann. Die Todesangst ist ein guter Gleichmacher.« Ich erwiderte: »Ich brauche diese Angst nicht, um Sie beim Vornamen zu nennen. Es wäre doch absurd, zu rufen: ›Mr. Plaidy, ich ertrinke, bitte retten Sie mich.‹« – »Äußerst absurd«, pflichtete er mir bei.
»Aber ich hoffe, daß Sie das keinesfalls tun müssen.«
Ich fragte ihn: »Werden Sie den Kurs nach den Sternen bestimmen können, John?«
Er zuckte die Achseln. »Ich bin kein gelernter Navigator, aber ein bißchen bekommt man auf See schon mit. Wenn es eine klare Nacht wird, haben wir wenigstens eine Ahnung, wohin es uns treibt. Letzte Nacht war es zu bewölkt, um etwas zu sehen.«
»Die Richtung könnte wechseln. Sie sagten, sie hinge vom Wind ab.«
»Ja, wir müssen uns von ihm treiben lassen. Dabei fühlt man sich schrecklich hilflos.«
»Wie immer im Leben, wenn man in wesentlichen Dingen auf andere angewiesen ist. Glauben Sie, Mr. Lorimer wird sterben?«
»Er wirkt ziemlich kräftig. Ich glaube, das Ärgste ist sein Bein. Es muß einen Schlag abbekommen haben, als das Rettungsboot umschlug.«
»Ich wünschte, wir könnten etwas tun.«
»Das beste ist, die Augen offenzuhalten. Wenn wir das kleinste Zeichen am Horizont sehen, müssen wir auf uns aufmerksam machen. Eine Flagge hissen ...«
»Wo nehmen wir eine Flagge her?«
»Ihr Unterrock an einem Stock oder dergleichen.«
»Sie sind sehr erfinderisch.«
»Mag sein, aber zuerst brauchen wir noch einmal etwas Glück.«
»Vielleicht wurde uns unser volles Quantum schon zuteil, als wir von dem sinkenden Schiff wegkamen.«
»Aber wir brauchen noch ein bißchen mehr. Tun wir also alles, um es zu finden. Halten Sie die Augen offen. Ein Fleckchen am Horizont, und wir geben ein Signal.«
Der Morgen verging langsam. Es wurde Nachmittag. Wir trieben gemächlich dahin. Lucas schlug ab und zu die Augen auf und sagte etwas, aber es war klar, daß er die Situation nicht ganz erfaßte.
Die Sonne war zum Glück von ein paar Wolken verdeckt, die sie erträglicher machten. Ich wußte nicht, was schlimmer war – Regen, der Sturm bedeuten könnte, oder diese sengende Hitze. John Plaidy war erschöpft eingeschlafen. Im Schlaf sah er sehr jung aus. Ich dachte über ihn nach. Das lenkte mich von der gegenwärtigen verzweifelten Lage ab. Wieso war er Decksmann geworden? Bestimmt gab es in seiner Vergangenheit etwas zu verbergen. Er hatte etwas Geheimnisvolles. Er war verschwiegen, beinahe heimlichtuerisch, immer auf der Hut. Während der letzten Stunden hatte ich diese Eigenschaften allerdings nicht beobachtet, weil er sich nur darauf konzentrierte, unser Leben zu retten. Dies hatte eine gewisse Beziehung zwischen uns entstehen lassen. Das war wohl ganz natürlich.
Meine Eltern gingen mir nicht aus dem Kopf. Ich versuchte mir vorzustellen, wie sie in ihrer kindlichen Verwunderung, mit der sie das Dasein betrachteten, soweit es sich nicht um das Britische Museum drehte, an Deck gekommen waren. Von den praktischen Seiten des Lebens hatten sie keine Ahnung. Sie hatten sich nie damit befassen müssen. Das hatten ihnen andere abgenommen, damit sie sich ungehindert ihren Forschungen widmen konnten.
Wo mochten sie jetzt sein? Ich dachte mit einer Art zärtlicher Verzweiflung an sie. Ich stellte mir vor, wie sie hastig in ein Rettungsboot verfrachtet worden waren, während Vater immer noch den Verlust seiner Aufzeichnungen beklagte, mehr als den seiner Tochter.
Vielleicht tat ich ihnen unrecht. Vielleicht lag ihnen mehr an mir, als mir bewußt war. Hatten sie mich nicht Rosetta genannt, nach dem kostbaren Stein?
Ich suchte den Horizont ab. Ich durfte nicht vergessen, daß ich auf dem Ausguck war. Ich mußte bereit sein, wenn ein Schiff in Sicht kam. Ich hatte meinen Unterrock ausgezogen, der nun an einem Stück Holz befestigt war. Wenn ich irgend etwas erblickte, das nach einem Schiff aussah, würde ich John wecken und keine Zeit verlieren, meine improvisierte Flagge zu schwenken.
Der Tag zog sich hin, und nichts war zu sehen – nur die unendliche Wasserfläche ringsum, überall, bis an den Horizont. Wohin ich auch blickte, war nichts als Leere.
Es war dunkel geworden. John Plaidy wachte auf. Er schämte sich, so lange geschlafen zu haben.
»Sie hatten es nötig«, sagte ich. »Sie waren vollkommen erschöpft.«
»Und Sie haben Wache gehalten?«
»Ich schwöre, von einem Schiff war nichts zu sehen.«
»Irgendwann muß eins auftauchen.«
Wir tranken etwas Wasser und aßen ein Biskuit.
»Wie steht es mit Mr. Lorimer?« fragte ich.
»Wenn er aufwacht, geben wir ihm etwas.«
»Kann er so lange ohne Bewußtsein bleiben?«
»Sollte er vielleicht nicht, ist er aber. Ist vielleicht auch gut so. Das Bein könnte arg schmerzen.«
»Wenn wir doch nur etwas tun könnten.«
Er schüttelte den Kopf. »Wir können nichts machen. Wir haben ihn an Bord gehievt. Das war alles, was wir tun konnten.«
»Und Sie haben ihn künstlich beatmet.«
»So gut es ging. Ich glaube, es hat genutzt. Mehr konnten wir nicht tun.«
»Ich wünschte, es käme ein Schiff.«
»Da stimme ich Ihnen von Herzen zu.«
Die Nacht brach über uns herein. Unsere zweite Nacht. Ich schlummerte ein wenig und träumte, ich sei in der Küche in Bloomsbury.
»Es war eine Nacht wie diese, als der polnische Jude ermordet wurde ...«
Eine Nacht wie diese! Da wachte ich auf. Das Boot bewegte sich kaum. Undeutlich sah ich John Plaidy, der vor sich hin starrte. Ich schloß die Augen. Ich wollte in die Vergangenheit zurückgleiten.
Unser zweiter Tag war angebrochen. Die See war vollkommen glatt, und wieder war ich betroffen von der Leere der unendlichen Wasserfläche. Es schien auf der weiten Welt nur uns und unser Boot zu geben.
Lucas kam im Laufe des Vormittags zu sich. Er sagte: »Was ist mit meinem Bein?«
»Ich nehme an, es ist gebrochen«, sagte ich. »Wir können nichts tun. Bald wird uns ein Schiff aufnehmen, meint John.«
»John?«
»John Plaidy. Er ist großartig. Er hat uns das Leben gerettet.«
Lucas nickte. »Wer ist sonst noch da?«
»Nur wir drei. Wir sind in einem Rettungsboot. Wir haben unwahrscheinliches Glück gehabt.«
»Ich bin so froh, daß Sie hier sind, Rosetta.« Ich lächelte ihn an. Wir gaben ihm etwas Wasser. »Das hat gutgetan«, sagte er. »Ich komme mir so hilflos vor.«
»Das sind wir alle«, erwiderte ich. »Wir sind auf ein Schiff angewiesen.«
Am Nachmittag glaubte John Land zu sichten. Er rief mir aufgeregt zu und deutete auf den Horizont. Ich konnte nur einen dunklen Buckel erkennen. Ich starrte hin. War es ein Wunder? Sehnten wir es so sehr herbei, daß unsere gemarterte Phantasie es heraufbeschworen hatte? Wir trieben erst zwei Tage und Nächte umher, aber es schien eine Ewigkeit. Ich hielt meine Augen fest auf den Horizont gerichtet.
Das Boot schien nicht von der Stelle zu kommen. Wir waren auf ruhiger See, und sollte wirklich Land in der Nähe sein, konnten wir es womöglich nicht erreichen.
Der Nachmittag zog sich hin. Das Land war verschwunden, und uns sank der Mut. »Unsere einzige Hoffnung ist ein Schiff«, sagte John. »Weiß der Himmel, ob die Möglichkeit besteht. Ich habe keine Ahnung, wie weit wir von den Handelsschiffswegen entfernt sind.«
Ein leichter Wind kam auf. Er trieb uns eine Weile voran. Ich war auf dem Ausguck und sah wieder Land. Es war jetzt ganz nahe. Ich rief John. »Sieht wie eine Insel aus«, sagte er. »Wenn nur der Wind in der richtigen Richtung weht ...«
Mehrere Stunden vergingen. Das Land kam näher, dann verschwand es. Der Wind nahm zu, und dunkle Wolken waren am Horizont. Ich merkte John an, daß er besorgt war.
Plötzlich stieß er einen Freudenschrei aus. »Wir kommen näher. O Gott, bitte hilf uns! Der Wind, er sei gepriesen, er treibt uns hin.«
Ich war sehr aufgeregt. Lucas schlug die Augen auf und fragte: »Was gibt’s?«
»Ich glaube, Land ist in der Nähe«, erklärte ich ihm. »Wenn nur ...«
John war an meiner Seite. »Es ist eine Insel«, sagte er. »Sehen Sie, wir treiben darauf ...«
»Ach John«, murmelte ich, »kann es sein, daß unsere Gebete erhört wurden?« Er drehte sich plötzlich zu mir und küßte mich auf die Wange. Ich lächelte, und er faßte meine Hand ganz fest. Wir waren in diesem Augenblick zu bewegt für weitere Worte.
Wir befanden uns in seichtem Wasser, und das Boot lief scharrend auf. John sprang heraus, ich folgte ihm. Während ich dastand und das Wasser meine Füße umspülte, überkam mich ein ungeheures Triumphgefühl.
Es dauerte sehr lange, bis wir das Boot auf trockenes Land gezogen hatten. Die Insel, auf der wir gelandet waren, war sehr klein, kaum mehr als ein steil aus dem Meer ragender Felsen. Wir sahen ein paar verkrüppelte Palmen und spärliche Laubbäume.
Als erstes nahm John eine gründliche Untersuchung des Bootes vor, und zu seiner Freude fand er in einem Fach unter dem Sitz weitere Biskuits und noch einen Kanister Wasser, außerdem einen Erste-Hilfe-Kasten mit Verbandszeug und ein Seil, mit dem wir das Boot an einen Baum binden konnten, was uns ein wunderbares Gefühl der Sicherheit gab. Die Entdeckung des Wassers freute John besonders. »Das wird uns noch ein paar Tage am Leben halten.«
Mein erster Gedanke galt Lucas’ Bein. Mir fiel ein, daß Dot sich einmal den Arm gebrochen und Mr. Dolland ihn geschient hatte; dann war der Arzt gekommen und hatte ihn für sein entschlossenes Handeln gelobt. Es war mir in allen Einzelheiten geschildert worden, und ich versuchte mich nun zu entsinnen, was Mr. Dolland getan hatte.
Mit Johns Hilfe tat ich, was ich konnte. Wir ertasteten den gebrochenen Knochen und versuchten ihn zusammenzufügen. Wir fanden ein Stück Holz, das als Schiene diente. Das Verbandszeug kam uns dabei zustatten. Lucas sagte, es fühle sich jetzt schon besser an, doch ich fürchtete, daß unsere Bemühungen nicht sehr erfolgreich und in jedem Fall viel zu spät gekommen waren.
Es war seltsam, diesen bislang so überlegen spöttischen Mann von Welt dermaßen hilflos und auf uns angewiesen zu sehen. John hatte die Führung übernommen. Er schien dazu geboren. Er sagte, er habe bei Übungen auf der Atlantic Star, an denen alle Mannschaftsangehörigen teilnehmen mußten, gelernt, wie man sich im Notfall zu verhalten habe. Das komme ihm jetzt zustatten. Er wünsche, er hätte besser aufgepaßt, aber er erinnere sich wenigstens an einiges, was man ihm beigebracht hatte.
Wir waren ungeduldig, die Insel zu erkunden. Wir fanden ein paar Kokosnüsse. John schüttelte sie und hörte die Milch gluckern. Er hob die Augen zum Himmel. »Da oben sorgt einer für uns«, sagte er.
Die Tage, die ich auf der Insel verbrachte, werden mir für immer unvergeßlich bleiben. John erwies sich als überaus erfinderisch; er war praktisch veranlagt und sann beständig auf neue Mittel, die uns überleben halfen.
Wir müßten die Zeit festhalten, meinte er. Er wollte zu diesem Zweck Kerben in einen Stock machen. Wir waren drei Nächte auf dem Meer gewesen, damit konnten wir beginnen. Lucas bekam jetzt alles mit, was geschah. Es machte ihn wahnsinnig, daß er sich nicht bewegen konnte, aber ich denke, seine Hauptsorge war, er könne uns behindern. Wir versuchten ihn zu überzeugen, daß dem keineswegs so war und wir jemanden brauchten, der die ganze Zeit Wache hielt. Er konnte im Boot auf dem Ausguck bleiben, während John und ich die Insel nach Nahrung absuchten oder andere notwendige Verrichtungen erledigten. Unsere Rettungswesten waren mit Pfeifen ausgestattet, und wenn er ein Segel oder irgend etwas Ungewöhnliches sichtete, konnte er uns unverzüglich verständigen.
Es ist erstaunlich, wie nahe sich Menschen unter solchen Bedingungen kommen können. So ging es mit John und mir. Mit Lucas war ich ja schon vor dem Schiffbruch befreundet. John war fast ein Fremder gewesen. Jetzt wurden wir gute Freunde. Wenn wir allein waren, sprach er offener mit mir als in Lucas’ Gegenwart. Er hatte ein sehr gütiges Wesen. Er konnte Lucas verstehen, er vergegenwärtigte sich, wie ihm in seiner Lage zumute wäre, und erwähnte vor ihm nie seine Sorge wegen des zu Ende gehenden Wasservorrats. Aber mit mir sprach er darüber. Er hatte ein Rationierungssystem eingeführt. Wir tranken bei Sonnenaufgang, mittags und bei Sonnenuntergang. »Wasser ist unser kostbarster Besitz«, sagte er. »Ohne Wasser sind wir verloren. Wir würden in kürzester Zeit verdursten. Ein gesunder junger Mensch kann vielleicht einen Monat ohne Nahrung auskommen, aber er braucht Wasser. Wir dürfen nur wenig nehmen. Trinken Sie langsam. Behalten Sie es im Mund, rollen Sie es herum, dann haben Sie am meisten davon. Solange wir Wasser haben, können wir überleben. Wir werden etwas sammeln, wenn es regnet. Wir werden es schaffen.«
Es war tröstlich für mich, mit ihm zusammenzusein. Ich hatte großes Vertrauen zu ihm. Er merkte es, und ich glaube, das gab ihm den Mut und die Kraft, schier Unmögliches zu leisten.
Er und ich erkundeten die Insel auf der Suche nach etwas Genießbarem, während Lucas Wache hielt. Manchmal gingen wir schweigend, manchmal sprachen wir.
Wir hatten uns etwa anderthalb Kilometer vom Ufer entfernt und waren auf einen Hang gestiegen. Von dort konnten wir die Insel deutlich sehen und ringsum den Horizont überblicken. Ein Gefühl unendlicher Verlassenheit überkam mich, und ich glaube, er empfand dasselbe. »Setzen Sie sich eine Weile, Rosetta«, sagte er. »Ich glaube, ich nehme Sie zu hart her.«
Ich lachte. »Sie sind es, John, der hart arbeitet. Ohne Sie hätten wir nicht überlebt.«
»Manchmal denke ich, wir kommen nie mehr fort von dieser Insel.«
»Wir sind doch erst ein paar Tage hier. Natürlich kommen wir fort von hier. Bedenken Sie, wie wir Land entdeckt haben. Wer hätte das gedacht? Ein Schiff wird vorbeikommen ... Sie werden sehen.«
»Und wenn es kommt ...« Er hielt inne und blickte finster in die Ferne. Ich wartete, daß er fortführe, aber er sagte nur: »Ich glaube, dies ist nicht die Fahrtroute der Schiffe.«
»Wieso nicht? Warten Sie’s ab.«
»Seien wir ehrlich. Unser Wasser geht zu Ende.«
»Es wird regnen. Wir sammeln Regenwasser.«
»Wir müssen Nahrung suchen. Die Biskuits werden knapp.«
»Warum reden Sie so? Das sieht Ihnen gar nicht ähnlich.«
»Woher wissen Sie das? Sie kennen mich nicht sehr gut, oder?«
»Ich kenne Sie so gut wie Sie mich. In Situationen wie dieser lernt man sich sehr schnell kennen. Man gibt sich nicht mit Konventionen ab und sieht sich nicht nur in großen Abständen wie seine Bekannten zu Hause. Wir sind die ganze Zeit zusammen, Tag und Nacht. Wir haben gemeinsam unglaubliche Gefahren überstanden. Unter solchen Bedingungen lernt man die Menschen rasch kennen.«
»Erzählen Sie mir von sich«, bat er.
»Was möchten Sie wissen? Vielleicht haben Sie meine Eltern an Bord gesehen. Ich frage mich unentwegt, was wohl aus ihnen geworden ist. Ob sie mit einem Rettungsboot mitgekommen sind? Sie sind so weltfremd. Ich glaube nicht, daß ihnen klar war, was geschah. Sie waren mit den Gedanken in der Vergangenheit. Sie schienen mich oft zu vergessen, außer wenn sie mich sahen. Sie hätten sich mehr für mich interessiert, wenn ich eine mit Hieroglyphen bedeckte Tafel gewesen wäre. Wenigstens haben sie mich nach dem Stein von Rosette genannt.«
Er lächelte, und ich erzählte ihm von meiner glücklichen Kindheit, die ich größtenteils im Erdgeschoß verbracht hatte, von den Hausmädchen, die meine Gefährtinnen waren, von den Mahlzeiten in der Küche, von Mrs. Harlow, Nanny Pollock und Mr. Dollands »Nummern«.
»Ich sehe, Sie brauchen mein Mitleid nicht.«
»O nein. Ich frage mich oft, was Mr. Dolland und die anderen jetzt wohl tun. Sie haben bestimmt von dem Schiffbruch gehört. Ach du meine Güte, sie werden sich schreckliche Sorgen machen. Und was wird aus dem Haus? Und aus ihnen? Ich hoffe so sehr, daß meine Eltern gerettet wurden. Wenn nicht, weiß ich nicht, was aus allen werden soll.«
»Vielleicht werden Sie es nie erfahren.«
»Da fangen Sie schon wieder an. Aber nun zu Ihnen. Was haben Sie von sich zu berichten?«
Er schwieg eine Weile, dann sagte er: »Rosetta, es tut mir so leid.«
»Ist schon gut, wenn Sie’s nicht erzählen wollen.«
»Doch, ich will. Es ist mir ein Bedürfnis, es Ihnen zu erzählen. Rosetta, mein Name ist nicht John Plaidy.«
»Nein? Das habe ich mir fast gedacht.«
»Ich heiße Simon Perrivale.«
Ich schwieg. Erinnerungen stürmten auf mich ein. Wie wir am Küchentisch saßen, wie Mr. Dolland seine Brille aufsetzte und uns aus der Zeitung vorlas.
Ich stammelte: »Doch nicht der ...«
Er nickte.
»Oh ...« begann ich.
Er unterbrach mich. »Sie sind erschrocken. Natürlich. Es tut mir leid. Vielleicht hätte ich es Ihnen nicht sagen sollen. Ich bin unschuldig. Ich möchte, daß Sie das wissen. Sie mögen mir vielleicht nicht glauben ...«
»Ich glaube Ihnen«, sagte ich ernst.
»Danke, Rosetta. Sie wissen, ich bin, wie man so sagt, ›auf der Flucht‹.«
»Und warum haben Sie auf einem Schiff angeheuert, als ...«
»Decksmann. Ich hatte Glück. Ich wußte, meine Verhaftung stand unmittelbar bevor. Ich war sicher, daß man mich für schuldig erklären würde. Ich hätte keine Chance gehabt. So vieles sprach gegen mich. Aber ich bin unschuldig, Rosetta, ich schwöre es. Ich mußte auf der Stelle fort, um vielleicht später, wenn möglich, meine Unschuld zu beweisen.«
»Vielleicht wäre es besser gewesen, zu bleiben und es durchzustehen.«
»Vielleicht, vielleicht auch nicht. Er war schon tot, als ich hinkam. Das Gewehr lag neben ihm. Ich hob es auf, und da sah es aus, als ob ich schuldig wäre.«
»Sie hätten Ihre Unschuld beweisen können.«
»Nicht sofort. Alles sprach gegen mich. Die Presse hatte entschieden, daß ich der Mörder war, und alle anderen waren derselben Meinung. Da wußte ich, daß ich gegen sie keine Chance hatte. Ich wollte das Land verlassen und ging nach Tilbury. Dort hatte ich unglaubliches Glück. In einer Schenke sprach ich mit einem Matrosen. Er trank sehr viel, weil er nicht wieder auf See wollte. Seine Frau erwartete ein Kind, und er konnte es nicht ertragen, sie zu verlassen. Er war untröstlich. Ich machte mir seine Trunkenheit zunutze. Das hätte ich nicht tun sollen, aber ich sah keinen anderen Ausweg. Ich mußte das Land verlassen, das war meine einzige Chance. Da kam ich auf die Idee, seine Stelle einzunehmen. Er hieß John Plaidy und war Decksmann auf der Atlantic Star. Das Schiff lief an diesem Tag aus, es war nach Südafrika bestimmt. Ich dachte, ich könnte dort ein neues Leben beginnen, und vielleicht würde eines Tages die Wahrheit ans Licht kommen, und ich könnte wieder nach Hause. Ich war verzweifelt, Rosetta. Es war ein irrwitziger Plan, aber es klappte. Ich war in ständiger Angst, daß es herauskäme, aber nichts dergleichen geschah. Und dann passierte dies.«
»Ich habe gleich gemerkt, daß Sie anders waren. Irgendwie paßten Sie nicht ins Bild.«
»War es so auffällig?«
»Ein bißchen.«
»Ich fürchtete mich vor Lorimer.«
»Oh, ich verstehe. Er sagte, sein Heim sei nicht weit vom Sitz der Perrivales entfernt.«
»Ja. Er war tatsächlich einmal dort. Ich muß damals siebzehn gewesen sein. Es war eine sehr kurze Begegnung, und man verändert sich sehr mit den Jahren. Er hätte mich nicht wiedererkennen können, trotzdem hatte ich Angst.«
»Und jetzt? Was soll nun werden?« fragte ich.
»Es sieht so aus, als wäre dies das Ende der Geschichte.«
»Was ist an jenem Tag geschehen? Können Sie darüber sprechen?«
»Ich denke, Ihnen kann ich es erzählen. Sie und ich, wir sind ... nun ja, wir sind Freunde geworden, richtige Freunde. Wir vertrauen einander, und selbst wenn ich befürchten müßte, daß Sie mich verraten, hier können Sie mir nicht schaden, nicht? An wen könnten Sie mich hier verraten?«
»Es würde mir nicht im Traum einfallen, Sie zu verraten! Außerdem haben Sie mir gesagt, daß Sie unschuldig sind.«
»Ich hatte nie das Gefühl, nach Perrivale zu gehören. Das ist sehr traurig für ein Kind. Ich habe verschwommene Erinnerungen an das, was ich das ›Vorher‹ nannte. Damals war das Leben behaglich und unbeschwert. Ich war fünf, als es sich änderte und das wurde, was ich als das ›Jetzt‹ bezeichnete. Damals gab es eine Frau namens Angel. Sie war mollig und rosig und roch nach Lavendel; sie war immer da, um mich zu trösten. Dann war da noch eine Frau, Tante Ada. Sie lebte nicht mit uns in dem Häuschen, aber sie kam oft zu uns. An solchen Tagen versteckte ich mich unter einem Tisch mit einer roten Decke, samtig und weich. Ich spüre den Stoff noch heute, den leichten Geruch nach Mottenkugeln, und ich höre die schneidende Stimme sagen: ›Warum tust du das nicht, Alice?‹ Es klang vorwurfsvoll. Alice war die gemütvolle, nach Lavendel duftende Angel. Einmal bin ich mit Angel im Zug gefahren. Wir fuhren zu Tante Ada nach Witches’ Home, Hexenheim. Ich glaubte damals, Tante Ada sei eine Hexe. Sie mußte eine sein, wenn sie in Hexenheim wohnte. Ich klammerte mich an Angels Hand, als wir eintraten. Es war ein kleines Haus mit bleigefaßten Fenstern, die es dunkel wirken ließen, aber alles darin glänzte. Die ganze Zeit über sagte Tante Ada Angel, was sie tun sollte. Ich wurde in den Garten geschickt. Am Ende des Gartens war ein Gewässer. Ich fürchtete mich, weil ich von Angel getrennt war, und ich dachte, Tante Ada würde ihr sagen, sie solle mich hierlassen. Wie groß war meine Freude, als ich wieder neben Angel im Zug saß. Ich sagte: ›Angel, laß uns nie wieder nach Hexenheim fahren.‹ Wir fuhren nicht mehr hin, aber Tante Ada kam zu uns. Ich hörte sie sagen, du solltest dies tun, du solltest das nicht tun, und Angel sagte: ›Ach weißt du, Ada, das ist nämlich so ...‹ Sie sprachen über den Jungen, und ich wußte, damit war ich gemeint. Tante Ada war überzeugt, daß ein Verbrecher aus mir würde, wenn man nicht auf etwas mehr Disziplin halte. Heute würden manche Leute sagen, daß sie recht hatte. Aber so ist es nicht, Rosetta. Ich bin unschuldig.«
»Ich glaube Ihnen«, versicherte ich ihm.
Er schwieg eine Weile, und seine Augen blickten verträumt in die Vergangenheit. Dann fuhr er fort: »Manchmal bekamen wir Besuch von einem Herrn. Ich fand bald heraus, daß es sich um Sir Edward Perrivale handelte. Er brachte Angel und mir Geschenke mit. Sie freute sich immer, wenn er kam, und ich mich auch. Er setzte mich auf sein Knie und sah mich an, und ab und zu gab er ein kleines Kichern von sich. Dann sagte er: ›Braver Junge. Guter Junge.‹ Das war alles. Aber mir gefiel’s, es war eine angenehme Abwechslung zu Tante Ada. Eines Tages hatte ich im Garten gespielt, und als ich hereinkam, sah ich Angel auf einem Stuhl am Tisch sitzen. Sie griff sich an die Brust; sie war bleich und keuchte. Ich rief: ›Angel, Angel, ich bin da.‹ Mir war bange, weil sie mich nicht ansah. Und plötzlich schloß sie die Augen und war gar nicht mehr wie Angel. Ich hatte Angst und rief andauernd ihren Namen, aber sie fiel nach vorn, mit dem Kopf nach unten. Ich fing an zu schreien. Leute kamen herein. Sie brachten mich fort, und da wußte ich, daß etwas Schreckliches geschehen war. Tante Ada kam, und es war zwecklos, sich unter der Tischdecke zu verstecken. Sie hatte mich rasch gefunden und sagte mir, ich sei ein böser Junge. Es war mir egal, was sie zu mir sagte, ich wünschte nur, Angel wäre da.
Sie war tot. Es war eine seltsame verwirrende Zeit. Ich kann mich nicht an viel erinnern, außer daß ein ständiger Strom von Leuten ins Häuschen kam und es darin ganz anders aussah. Sie lag in einem Sarg im Wohnzimmer, und die Jalousien waren heruntergelassen. Tante Ada brachte mich herein, um ›Abschied von ihr zu nehmen‹. Sie befahl mir, ihr kaltes Gesicht zu küssen. Ich schrie und wollte weglaufen. Das war nicht meine Angel, die da lag, gleichgültig gegen mich und mein Verlangen nach ihr.
Warum erzähle ich Ihnen das alles ... und noch dazu aus der Sicht eines Kindes? Warum sage ich nicht einfach, sie ist gestorben, und lasse es dabei bewenden?«
»Sie erzählen es, wie es erzählt werden muß«, sagte ich. »Sie lassen es mich sehen, wie es war, wie Sie es erlebt haben, und genau so will ich es sehen.«
Er fuhr fort: »Ich höre noch das Läuten der Totenglocke. Ich sehe die schwarzgekleideten Gestalten vor mir, und Tante Ada wie eine schauerliche Unheilsprophetin, die mich ständig beobachtete, mich bedrohte.
Sir Edward kam zur Beerdigung. Es wurde sehr viel geredet, und es betraf den ›Jungen‹. Meine Zukunft war ungewiß, und ich hatte große Angst.
Ich fragte Mrs. Stubbs, die immer ins Häuschen kam, um die Fußböden zu schrubben, wo Angel sei, und sie sagte: ›Zerbrich dir darüber nicht dein kleines Köpfchen. Sie hat es gut. Sie ist bei den Engeln im Himmel.‹ Dann hörte ich jemanden sagen: ›Er kommt natürlich zu Ada.‹
Ein schlimmeres Schicksal konnte ich mir nicht vorstellen. Halb hatte ich es erwartet. Ada war Angels Schwester, und da Angel im Himmel war, mußte sich jemand um den ›Jungen‹ kümmern. Ich wußte, was ich zu tun hatte. Ich mußte Angel finden, also machte ich mich auf zum Himmel, wo ich sie sehen und ihr sagen würde, daß sie zurückkommen müsse, sonst bliebe ich bei ihr.
Ich war nicht sehr weit gekommen, als ich einen Landarbeiter traf, der einen Heuwagen fuhr. Er hielt an und rief zu mir herunter: ›Wohin des Wegs, Freundchen?‹ Und ich erwiderte: ›Ich geh’ in den Himmel.‹ – ›Das ist ein weiter Weg‹, sagte er. ›Gehst du ganz allein?‹ – ›Ja‹, erklärte ich, ›Angel ist dort. Ich geh’ zu ihr.‹ Er sagte: ›Du bist der kleine Simon, nicht wahr? Ich kenn’ dich. Komm, spring auf, ich nehm’ dich mit.‹ – ›Fährst du denn in den Himmel ?‹ – ›Noch nicht, will ich hoffen‹, sagte er. ›Aber ich weiß den Weg, den du nehmen mußt.‹ Er hob mich zu sich hinauf. Und dann brachte er mich zum Häuschen zurück. Sir Edward sah mich als erster. Der Mann, der mich verraten hatte, tippte an die Stirn und sagte: ›Verzeihung, Sir, der Kleine gehört hierher. Hab’ ihn auf der Straße aufgelesen. Auf dem Weg zum Himmel, sagt er. Dachte, ich bring’ ihn lieber zurück, Sir.‹ Sir Edward hatte einen merkwürdigen Gesichtsausdruck. Er gab dem Mann Geld und dankte ihm, dann sagte er zu mir: ›Wir wollen uns ein bißchen unterhalten, ja?‹ Wir gingen ins Wohnzimmer, das nach Lilien roch, aber der Sarg war nicht mehr da, und da wußte ich, Angel würde nie wiederkommen, und ich fühlte mich entsetzlich verlassen. Sir Edward setzte mich auf sein Knie. Ich dachte, er würde sagen: ›Braver Junges aber nein, er sagte: ›Du wolltest also den Weg zum Himmel finden, mein Junge?‹ Ich nickte. ›Das ist ein Ort, den man nicht erreichen kann.‹ Ich beobachtete, wie sein Mund sich beim Sprechen bewegte. Er hatte ein Haarbüschel auf der Oberlippe und einen Spitzbart. Genaugenommen einen Knebelbart. ›Warum bist du fortgelaufen?‹ fragte er. Ich war nicht imstande, mich klar auszudrücken. ›Tante Ada‹, sagte ich. Er schien zu verstehen. ›Du willst nicht mit ihr gehen. Aber sie ist deine Tante.‹ Ich schüttelte den Kopf. ›Nein, nein, nein‹, sagte ich. ›Du kannst sie nicht leiden, wie?‹ Ich nickte. ›Schön, schön‹, sagte er. ›Mal sehen, was wir tun können.‹ Er wurde sehr nachdenklich. Ich glaube, daß er sich in diesem Augenblick entschieden hat, denn keine zwei Tage später erfuhr ich, daß ich in ein großes Haus kommen sollte. Sir Edward würde mich in seine Familie aufnehmen.«
Simon lächelte mich an. »Sie werden Ihre Schlüsse gezogen haben. Ich bin sicher, es sind die richtigen. Ich war sein Sohn, sein unehelicher Sohn, obwohl es kaum zu glauben war, so, wie ich ihn später als Menschen kennenlernte. Ich war überzeugt, daß er meine Mutter, Angel, geliebt hat. Alle mußten sie lieben. Ich spürte es, wenn sie zusammen waren, aber er konnte sie natürlich nicht heiraten. Sie war nicht von seinem Stand. Er hatte sich wohl in sie verliebt und sie in dem Häuschen untergebracht, wo er sie von Zeit zu Zeit besuchte. Das hat mir weder Sir Edward noch sonst jemand erzählt. Es war eine Vermutung, aber sie war so plausibel, daß alle sie teilten. Warum hätte er mich sonst in sein Haus aufgenommen und mit seinen Söhnen erzogen?«
»Und so kamen Sie nach Perrivale Court.«
»Ja. Ich war eineinhalb Jahre älter als Cosmo und drei Jahre älter als Tristan. Das war mein Glück, sonst wäre es mir schlecht ergangen, nehme ich an. Diese zwei Jahre verschafften mir einen Vorteil. Den hatte ich nötig, denn kaum hatte Sir Edward mich in seiner Kinderstube untergebracht, schien er das Interesse an mir zu verlieren, wenngleich ich merkte, daß er mich zuweilen verstohlen betrachtete. Das Personal war mir übel gesinnt. Ohne das Kindermädchen wäre ich wohl genauso schlimm dran gewesen wie bei Tante Ada. Aber das Mädchen hatte Mitleid mit mir. Sie liebte und beschützte mich. Ich werde nie vergessen, was ich der guten Frau zu verdanken habe. Als ich etwa sieben Jahre alt war, bekamen wir einen Hauslehrer, Mr. Welling, mit dem ich mich gut verstand. Er mußte die Gerüchte gehört haben, aber sie berührten ihn nicht. Ich war ernster als Cosmo und Tristan, außerdem hatte ich den Vorteil dieser paar Jahre Altersunterschied.
Und da war natürlich Lady Perrivale, eine furchteinflößende Person. Ich war froh, daß sie meine Existenz kaum wahrzunehmen schien. Sie sprach sehr selten mit mir, und ich hatte den Eindruck, daß sie mich gar nicht sah. Sie war eine hochgewachsene Frau, und alle – ausgenommen Sir Edward – fürchteten sich vor ihr. Jeder im Haus wußte, daß sie Perrivale Court mit ihrem Geld gerettet hatte und daß sie die Tochter eines millionenschweren Kohlenbergwerksbesitzers oder Eisenfabrikanten war; was von beidem, darüber gingen die Meinungen auseinander. Sie war die einzige Tochter, und er wollte einen Adelstitel für sie. Er war bereit, dafür zu bezahlen, und ein beträchtlicher Teil des mit Eisen oder Kohle verdienten Geldes wurde dazu verwendet, das Dach und die Mauern von Perrivale Court zu sanieren. Für Sir Edward muß es eine gute Übereinkunft gewesen sein, denn seine Gattin erhielt ihm nicht nur das Dach über dem Kopf, sondern schenkte ihm auch zwei Söhne. Ich hatte nur den einen Wunsch, ihr aus dem Weg zu gehen. So, nun haben Sie ein Bild von der Familie, in der ich lebte.«
»Ja. Und dann sind Sie in die Schule gekommen?«
»Das war entschieden besser für mich. Dort war ich unter meinesgleichen. Ich war ein guter Schüler und leidlich im Sport. Ich verlor ein wenig von der Aggressivität, die ich in früheren Jahren entwickelt hatte, stets bereit, mich zu verteidigen, bevor überhaupt Anlaß dazu bestand. Ich sah Kränkungen und Beleidigungen, wo gar keine waren. Die Schule tat mir gut. Sie ging nur viel zu schnell vorbei. Wir waren keine Jungen mehr. Auf dem Gut gab es genug Arbeit, um uns alle zu beschäftigen, und wir arbeiteten ziemlich gut zusammen. Wir waren ja jetzt vernünftige Erwachsene.
Ich war vierundzwanzig, als Major Durrell in unsere Gegend zog. Seine Tochter kam mit ihm. Sie war eine Witwe mit einem kleinen Mädchen. Die Witwe war auffallend schön, rote Haare, grüne Augen. Höchst ungewöhnlich. Wir waren alle von ihr gefesselt. Cosmo und Tristan besonders; sie entschied sich aber für Cosmo, und die Verlobung wurde bekanntgegeben.«
Ich sah ihn forschend an. Hatte er die Witwe geliebt, wie vermutet wurde? Hatte die Aussicht, daß sie einen anderen heiraten würde, bei ihm Wut, Verzweiflung, Eifersucht hervorgerufen? Hatte er geplant, die Witwe für sich zu gewinnen? Nein. Ich glaubte ihm. Er hatte mit solcher Aufrichtigkeit gesprochen.
»Ja«, fuhr er fort. »Sie hatte sich für Cosmo entschieden. Lady Perrivale war hoch erfreut. Sie war sehr darauf bedacht, daß ihre Söhne heirateten und ihr Enkelkinder schenkten, und es freute sie, daß Mirabel Cosmos Braut wurde. Mirabels Mutter soll eine Schulfreundin von ihr gewesen sein – ihre beste Freundin, hieß es. Sie hatte den Major geheiratet, und obwohl sie nun tot war, hieß Lady Perrivale den Witwer und seine Tochter wärmstens willkommen. Sie hatte den Major kennengelernt, als ihre Freundin ihn heiratete, und er hatte ihr geschrieben, daß er seinen Abschied vom Militär genommen habe und gedenke, sich irgendwo zur Ruhe zu setzen. Vielleicht in Cornwall? Lady Perrivale war entzückt und fand Seashell Cottage für sie. So sind sie dorthin gekommen. Und ziemlich bald darauf folgte die Verlobung mit Cosmo. Sie sehen, wie sich alles fügte.«
»Ja, ich sehe es allmählich ganz klar«, sagte ich.
»Auf dem Gut gab es dieses Bauernhaus, Bindon Boys. Der Bauer, der es bewohnt und den Hof bewirtschaftet hatte, war ungefähr drei Jahre zuvor gestorben. Das Land war an einen anderen Bauern verpachtet worden, aber das Haus hat keiner übernommen. Es war in schlechtem Zustand und mußte renoviert werden.«
»In den Zeitungen stand eine Menge über Bindon Boys.«
»Wir hatten gemeinsam das Haus besichtigt und beschlossen, was repariert werden sollte.«
Ich nickte. Ich sah die dicken schwarzen Schlagzeilen vor mir: »Der Fall Bindon Boys. Polizei rechnet in Kürze mit Verhaftung.« Ich sah alles jetzt ganz anders als damals, als Mr. Dolland am Küchentisch saß und wir versucht hatten, die Geschichte zusammenzufügen.
»Wir waren mehrmals dort gewesen. Es gab eine Menge Arbeit. Ich erinnere mich deutlich an den Tag. Cosmo und ich wollten uns bei dem Bauernhaus treffen, um die Pläne an Ort und Stelle zu besprechen. Ich ging hin, und dort fand ich ihn – tot, das Gewehr lag neben ihm. Ich konnte es nicht glauben. Ich kniete mich neben ihm hin. An meiner Jacke war Blut. Sein Blut. Ich hob das Gewehr auf, und da kam Tristan herein. Ich erinnere mich an seine Worte: ›Großer Gott, Simon! Du hast ihn getötet!‹ Ich sagte ihm, daß ich eben erst hereingekommen war und Cosmo so vorgefunden hatte. Er starrte auf das Gewehr in meiner Hand, und ich sah, was er dachte.« Er hielt inne und schloß die Augen, als suche er die Erinnerung auszuschalten. Ich legte ihm meine Hand auf die Schulter. »Ich weiß, daß Sie unschuldig sind, Simon«, sagte ich. »Eines Tages werden Sie es beweisen.«
»Wenn wir nie von dieser Insel fortkommen, wird niemand je die Wahrheit erfahren.«
»Wir werden fortkommen«, sagte ich. »Ich fühle es.«
»Das ist nur die Hoffnung.«
»Hoffnung ist etwas Gutes.«
»Es ist zum Verzweifeln, wenn sie sich als unbegründet erweist.«
»Aber das ist nicht der Fall. Es wird ein Schiff kommen. Ich weiß es. Und dann ...«
»Ja, was dann? Ich muß mich verstecken. Ich darf nie zurückkehren. Ich wage es nicht. Wenn ich es täte, würde man mich verhaften und sagen, durch meine Flucht hätte ich meine Schuld eingestanden.«
»Was ist wirklich passiert? Haben Sie eine Ahnung?«
»Ich halte es für möglich, daß es der alte Harry Tench war. Er hat Cosmo gehaßt. Er hatte vor einigen Jahren einen Hof gepachtet. Er trank zuviel und hat den Hof heruntergewirtschaftet. Cosmo warf ihn hinaus und setzte einen anderen Pächter auf den Hof. Tench ging fort, aber er kam zurück. Er vagabundierte herum. Er wurde so eine Art wandernder Kesselflicker. Die Leute sagten, er hätte den Perrivales und besonders Cosmo Rache geschworen. Er war seit einigen Wochen nicht in der Gegend gesehen worden, aber wenn er vorhatte, Cosmo zu töten, hätte er sich natürlich gehütet, sich in der Nähe blicken zu lassen. Sein Name fiel während der Ermittlungen, aber man ließ den Verdacht rasch wieder fallen. Ich galt als der Verdächtige. Man machte ein großes Theater um die Feindschaft zwischen Cosmo und mir. Überall schienen sich die Leute an Anzeichen zu erinnern, von denen ich nichts bemerkt hatte. Sie machten viel Aufhebens um Mirabel und ihre Verlobung mit Cosmo.«
»Ich weiß. Verbrechen aus Leidenschaft. Haben Sie sie geliebt?«
»O nein. Wir waren alle ein bißchen von ihr geblendet, aber geliebt ... nein.«
»Und als ihre Verlobung mit Cosmo bekanntgegeben wurde, haben Sie sich da enttäuscht gezeigt?«
»Tristan und ich haben wohl gesagt, was für ein Glückspilz Cosmo sei und wie wir ihn beneideten oder etwas dergleichen. Wir haben es aber nicht weiter ernst gemeint.«
Wir schwiegen eine Weile, dann fuhr er fort: »Jetzt wissen Sie es. Ich bin froh. Es ist, als wäre mir eine Last von den Schultern genommen. Sagen Sie, sind Sie erschüttert, weil Sie mit einem mutmaßlichen Mörder zusammen sind?«
»Ich kann nur daran denken, daß er mir und Lucas das Leben gerettet hat.«
»Und mein eigenes natürlich.«
»Wenn Sie das nicht getan hätten, wäre keiner von uns hier. Ich bin froh, daß Sie es mir gesagt haben. Ich wünschte, man könnte etwas tun, um die Sache zu bereinigen, damit Sie zurückkehren könnten. Eines Tages können Sie es vielleicht.«
»Sie sind eine Optimistin. Sie meinen, daß wir von dieser gottverlassenen Insel fortkommen. Sie glauben wohl an Wunder.«
»Ich habe in den letzten Tagen einige gesehen.«
Wieder nahm er meine Hand und drückte sie. »Sie haben recht, und ich bin undankbar. Man wird uns rechtzeitig finden, und eines Tages kehre ich vielleicht nach Perrivale Court zurück, und man wird die Wahrheit erfahren.«
»Ganz bestimmt«, sagte ich. Ich stand auf. »Wir haben lange geredet. Lucas wird sich wundern, wo wir bleiben.«
Noch zwei Tage vergingen. Der Wasservorrat war fast erschöpft, und auch die Kokosnüsse gingen zu Ende. Simon hatte einen stabilen Stock gefunden, den Lucas als Krücke benutzte. Sein Bein tue nicht mehr ganz so weh, sagte er, aber ich hatte wenig Vertrauen in unsere Bemühungen, den Bruch einzurichten. Immerhin konnte er ein paar Schritte humpeln, und das heiterte ihn beträchtlich auf.
Wenn wir allein waren, erzählte mir Simon weitere Vorfälle aus seinem Leben, und ich gewann ein klareres Bild, wie alles gewesen war. Ich war wie gebannt davon. Ich hätte so gern geholfen, die Wahrheit aufzudecken und Simons Unschuld zu beweisen. Ich wollte mehr über Harry Tench hören. Für mich stand fest, daß er der Mörder war. Simon meinte, Cosmo hätte den Mann nicht so hart behandeln sollen. Sicher, Harry Tench war ein schlechter Bauer, und wenn das Gut gedeihen sollte, mußte es anständig geführt werden, aber er hätte Harry Tench vielleicht in einer anderen Stellung behalten können. Cosmo hatte befunden, daß er als Arbeiter untauglich sei; mehr noch, er war unverschämt gewesen, und das konnte Cosmo nicht dulden.
Wir erörterten, wie es Harry Tench möglich gewesen sein könnte, Cosmo zu töten. Er hatte keinen festen Wohnsitz. Oft schlief er in Scheunen; er hatte zugegeben, in Bindon Boys geschlafen zu haben. Vielleicht war er dort gewesen, als Cosmo kurz vor Simon ins Haus gekommen war. Vielleicht hatte er die Gelegenheit ergriffen. Und das Gewehr? Dafür mußte es eine Erklärung geben. Man hatte festgestellt, daß es aus der Waffenkammer von Perrivale Court stammte. Wie hatte Harry Tench es sich verschaffen können?
Und so weiter ... Sicher war es für Simon eine große Erleichterung, darüber sprechen zu können.
Es war an unserem fünften Tag auf der Insel, am späten Nachmittag. Simon und ich waren den ganzen Morgen umhergewandert. Wir hatten ein paar Beeren gefunden, die vielleicht eßbar waren, und erwogen das Risiko, sie zu versuchen, als wir einen Ruf hörten, gefolgt von einem Pfiff. Es war Lucas. Wir eilten zu ihm. Er deutete auf den Horizont. Es war nur ein Fleck. Bildeten wir es uns ein, oder beschworen wir in Gedanken etwas herauf, was wir so verzweifelt zu sehen wünschten?
Wir beobachteten den Fleck in atemlosem Schweigen. Er nahm langsam Gestalt an.
»Ein Schiff! Es ist ein Schiff!« rief Simon.