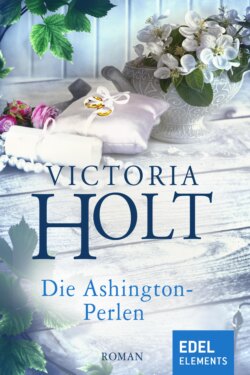Читать книгу Die Ashington-Perlen - Victoria Holt - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Skandal
ОглавлениеZwei Wochen später reiste Toby ab. Er kam nicht, um mir Lebewohl zu sagen. Er hatte erklärt, daß Abschiedsszenen unerträglich seien und daß alte Freunde wie wir es nicht nötig hätten, sich ewiger Freundschaft zu versichern.
Ich fühlte mich entsetzlich einsam.
Meg versuchte, mich zu trösten. »Es mußte so kommen. Ein junger Mann wie er kann nicht sein Leben lang nur spielen, weißt du. Es war für ihn wie ein Urlaub ... ein langer Urlaub ... aber es gibt ernsthaftere Dinge im Leben. Er hat ja nur gespielt, daß er Lehrer war. Jetzt fängt der Ernst des Lebens an. Du brauchst einen richtigen Lehrer.«
Janet sagte: »Ich halte nichts von diesen hochnäsigen Gouvernanten, das kann ich dir sagen. Die speisen auf ihrem Zimmer ... sind zu hoch und erhaben, um mit unsereins zu essen. Dieser Haushalt ist für so was nicht geeignet. In so ’nem kleinen Haus ist kein Platz für eine Gouvernante.«
»Das einzig Wahre wäre eine Schule«, meinte Meg, »aber das würde unserer kleinen Sarah nicht gefallen und ihr auch nicht.«
»Ich sage dir, das Haus ist nicht groß genug, und in Null Komma nix wäre ich weg. Ich hab’ heute morgen einen langen Brief von Ethel bekommen ...«
Meg lauschte dem Loblied auf die Freuden des Landlebens, nickte weise – und war nach wie vor fest entschlossen, bei meiner Mutter zu bleiben.
»Ach Meg«, jammerte ich, »ich könnte es nicht ertragen, auch dich noch zu verlieren.« Das freute Meg natürlich, wenn sie auch murrte: »Je nun, du mußt dich eben zusammennehmen, kapiert?«
Janet verdrehte die Augen zur Decke, als stünde sie mit dem Allerhöchsten in Verbindung, und murmelte dann in den Teig, den sie gerade anrührte, daß gewisse Leute – womit, vermute ich, meine Mutter, aber auch ich und Meg gemeint waren – ihr unbegreiflich seien.
Dann brach der Sturm los.
Everards Frau wollte sich scheiden lassen. Ein zu diesem Zweck angestellter Detektiv hatte Everards Kommen und Gehen bei uns beobachtet Infolgedessen sollte meine Mutter vorgeladen werden, und aufgrund der Berühmtheit meiner Mutter und Everards Stellung im Parlament stand ein Skandal bevor.
Everard war mir immer als ein Mann erschienen, der keine Gefühlsregungen zeigte, gleichgültig, in welcher Situation er sich befand. Toby und ich hatten uns darüber lustig gemacht. Ich sagte, wenn Everard erführe, daß sein Haus in Flammen stehe, würde er lediglich ein wenig überrascht dreinblicken und äußern: »Du bliebe Güte, wie unangenehm.« Wir stellten uns Everard in dramatischen Lebenslagen vor und malten uns aus, wie er reagieren werde. Das war sicherlich recht kindisch, aber es bereitete ungeheures Vergnügen. Meg hörte uns zu, und ihre Lippen verzogen sich zu einem schwachen Lächeln. »Ihr zwei!« sagte sie. »Ich sollte euch vielleicht ’n paar Bauklötze zum Spielen besorgen.« Doch ich weiß, daß sie uns gern lachen hörte, und auch sie amüsierte sich über Everards Gleichmut. Eines Tages meinte sie: »Es ist mir unbegreiflich, wie so ein Mann da hineingeraten konnte.« Dann fügte sie düster hinzu: »Männer! Es gibt nicht viel, das ich nicht über sie wüßte. Persönlich hatte ich nicht viel mit ihnen zu schaffen. Aber ich hab’ ’ne Menge zu sehen gekriegt jawohl ... und es heißt doch, der Zuschauer sieht das Beste vom Spiel, oder?«
Everard war also in diese schreckliche Situation geraten. Bloßgestellt! Die Welt der Politik würde von der Liaison mit einer berühmten Schauspielerin erfahren, und solches Treiben (Megs Worte) war nicht das, was die Leute von ihrem zukünftigen Premierminister erwarteten. »Ich wette ein Pfund gegen einen Penny«, prophezeite Janet, »daß dies sein Ende im Unterhaus bedeutet.«
Ich wünschte, Toby wäre hier gewesen, um mit mir darüber zu diskutieren und mir zu erklären, welche Folgen die Sache haben würde.
Ich erfuhr, daß es Beweise gab ... unwiderlegbare Beweise, beigebracht von einem Detektiv, der Everard das Haus um halb eins betreten und um sechs verlassen sah ... nicht einmal, sondern mehrmals.
Meine Mutter reagierte, wie zu erwarten war, dramatisch. Sie schritt in ihrem Schlafzimmer auf und ab – diesmal eine Tragödin. »Und wie wird sich das auf den Theaterbesuch auswirken?« wollte sie wissen. »Ich schätze, es treibt die Massen nur so herein«, meinte Meg. »Die wollen doch alle ’nen Blick auf die anstößige Person werfen.«
Meine Mutter war wütend. Es gehe nicht um ihren Ruf, sagte sie. Oh, wie sie die Frau haßte, die das alles angezettelt hatte. Jemand mußte sie dazu angestiftet haben. Darauf konnte man Gift nehmen. Die war nicht selbst auf die Idee gekommen, dazu war sie nicht schlau genug.
Everard tat mir wirklich leid. Ich konnte mir vorstellen, was ein Skandal für ihn bedeutete. Erst kurz zuvor war Sir Charles Dilke zum Ergötzen seiner Feinde und zum Schrecken seiner Freunde in einen anrüchigen Scheidungsfall verwickelt gewesen, und auch für ihn hatte der Sessel des Premierministers auf dem Spiel gestanden. Der Fall hatte seine Karriere ruiniert.
Everard kam nicht mehr zum Denton Square. Meine Mutter war verdrießlich, reizbar und nervös.
Eines Abends kam sie allein vom Theater nach Hause. Das war, bevor die Geschichte erst richtig losging. Meg war im Theater, und Janet nörgelte die ganze Zeit nicht ohne eine gewisse Befriedigung und deutete an, daß unser Haushalt nun wohl aufgelöst werde. Meine Mutter müsse ein normaleres Leben führen, rieb sie mir hin, ein bißchen zur Ruhe kommen. Vielleicht sollte sie zu ihrem Gatten zurückkehren. Da gehöre sie schließlich hin. Das würde natürlich bedeuten, daß Janet mit Meg an ihrer Seite jenen Hafen erreichte, den man als Mekka, Walhalla oder die elysischen Gefilde bezeichnen konnte, je nachdem, wie man sich den Idealzustand vorstellte.
Meine Mutter begab sich geradewegs in ihr Zimmer im ersten Stock, und bald darauf kam sie zu mir. Noch nie hatte ich sie so erregt gesehen.
Ich lag bereits im Bett. Sie setzte sich in einen Sessel und sah zu mir herüber. Sie musterte mich eine Weile, und schließlich sagte sie: »Wir sind in einen bösen Schlamassel geraten, Siddons.«
Ich nickte.
»Das wird ziemlich ekelhaft. Die Leute können so gemein sein. Gut, daß du nicht zur Schule gehst. Kinder sind manchmal schrecklich grausam untereinander. Aber du hast nichts zu befürchten. Nur diejenigen, die in der Öffentlichkeit stehen, trifft das ganze Ausmaß der Gehässigkeit.«
Ich wartete.
»Es wird sich alles anders anhören, als es in Wirklichkeit ist. Ich liebe Everard, mußt du wissen.«
Ich glaube, sie liebte ihn wirklich. Er war nicht so wie die anderen Verehrer. Er bildete den ruhigen Pol in ihrem Dasein, den sie, wie sie in ernsteren Momenten eingestand, brauchte.
»Natürlich«, fuhr sie fort, »war er immer besorgt wegen dieser Situation. Er legte so großen Wert darauf, ein geregeltes und konventionelles Leben zu führen. Er ist konventionell. Es war ihm zuwider, daß unsere Beziehung so sein mußte. Aber siehst du, wir liebten uns. Ich weiß, wie verschieden wir waren – im Charakter und so –, aber wir paßten zusammen. Versteht du?«
»Ja, natürlich.«
»Man wird scheußliche Sachen sagen. Ich weiß nicht, wie sich das im einzelnen auswirkt. Es ist das Ende seiner Karriere. Was glaubst du wohl, wie mir zumute ist ... Ich bin dafür verantwortlich!«
»Jeder ist für alles, was er tut, selbst verantwortlich, niemand anderes«, sagte ich, Toby zitierend.
Sie blickte mich nachdenklich an. »Little Siddons«, meinte sie versonnen, »so klein bist du gar nicht mehr ... wirst schnell erwachsen. Lernst das Leben kennen. Wer hat dir das gesagt? Toby vermutlich.«
»Ich habe so viel von ihm gelernt«, gab ich zu.
Sie ballte zornig ihre Hand zur Faust. »Er hätte nicht fortgehen sollen. Hätte er nur den Mumm gehabt, sich gegen seinen Vater aufzulehnen. Er besaß eine gewisse Courage, aber die hat nie ganz gereicht.«
»Wie kannst du so etwas sagen!« rief ich empört. »Vielleicht brauchte er mehr Mut zum Weggehen als zum Bleiben. Er konnte schließlich nicht ewig seine Zeit vertrödeln. Außerdem hat er seinen Vater sehr gern. Niemand sollte über die Handlungen anderer urteilen, wenn er nicht alle Beweggründe kennt.«
Sie sah mich erstaunt an, dann lächelte sie schwach. »Du sprichst ein wahres Wort, mein liebes Kind. Du wirst in den kommenden Wochen noch daran denken. Ich möchte dir alles erklären. Wir reden nicht gerade viel miteinander, nicht wahr?« Darin konnte ich ihr widerspruchslos zustimmen.
»Everard war der einzige Mann, aus dem ich mir wirklich etwas machte«, sagte sie.
Ich mußte an meinen Vater denken, und sie spürte es.
»Das«, fuhr sie fort, »war nur eine momentane Verwirrung. Was weiß ein siebzehnjähriges Mädchen schon von Liebe? Ich gebe zu, daß ich Liebhaber hatte, aber Everard war anders. Wir haben uns immer wieder ausgemalt, wie es wäre, wenn sie stirbt. Wir wollten heiraten und uns auf seinem Landsitz niederlassen, und in Westminster hätten wir ein Stadthaus gehabt. Ich hätte eine gute Parlamentariergattin abgeben. Du guckst so skeptisch. Es war jedenfalls schön, darüber zu reden, und Everard glaubte, daß es in Erfüllung gehen würde ... irgendwann. Sie war schließlich da ... Sie war immer da. Er war an sie gefesselt.«
»Er hat sie geheiratet. Er muß sie irgendwann geliebt haben.«
»Es war mehr oder weniger eine abgesprochene Partie. Zwei Familien aus der Politik ... reicher Landadel. Du weißt, wie das vor sich geht. Er war damals sehr jung und wußte nichts von dieser Veranlagung zum Wahnsinn in ihrer Familie. Die machte sich kurz nach den Flitterwochen bemerkbar. Sie brauchte oft eine Pflegerin, und zeitweise mußte man sie in eine Anstalt bringen. Stell dir vor, ein Mann wie Everard ... zu Höherem berufen, parlamentarischer Ehren sicher, und dann an so eine Frau gefesselt.«
»Armer Everard. Ich fand oft, daß er traurig aussah.«
»Seine Traurigkeit war es, die mich anfangs so anzog. Merkwürdig. Bei deinem Vater war es auch die Traurigkeit, die mich auf ihn aufmerksam machte. Vielleicht zieht mich Traurigkeit an. Ja, tatsächlich. Ich wollte die Ärmsten zum Lachen bringen und fröhlich machen. Und dann erkannte ich, was für ein vortrefflicher Mensch Everard war. Intelligent, anders als die anderen. Vielleicht lag es daran, daß Gegensätze sich anziehen ... Jedenfalls war es da ... ein starkes eisernes Band, das uns zusammenhielt Wir lieben uns so sehr, Siddons, daß wir trotz dieser Bedrohung nichts bereuen.«
»Und was wird nun passieren?«
»Sie werden es mächtig aufbauschen, mit Schlagzeilen in den Zeitungen. Neulich war da die Sache mit Sir Charles Dilke. Du weißt nichts davon.«
»Doch.«
»Nun, dann weißt du auch, daß er danach erledigt war. Und das hier wird Everard erledigen. Er hat Feinde im Parlament Das ist doch klar. Ein angesehener Mann hat immer Feinde. Seine politischen Gegner werden eine Verfolgungsjagd in Gang setzen. Und weißt du, auch ich habe Feinde. Unseren Feinden steht ein Festtag bevor.«
Ich versuchte, sie zu trösten, und meinte, mit der Zeit werde alles wieder gut. »Nein«, widersprach sie. »Es wird sich einiges ändern. Irgend jemand steckt dahinter ... der treibt sie dazu. Sie hätte es nie aus eigener Kraft tun können. Sie ist bloß ein Werkzeug. Das macht alles noch schlimmer, glaub’ mir.«
Ich bemerkte, es sei ihr gar nicht ähnlich, so schwarz zu sehen. Vielleicht komme es am Ende gar nicht soweit. Vielleicht ließe sich alles rückgängig machen. Das kam doch bei solchen Dingen zuweilen vor, nicht wahr?
Ich brachte sie zu Bett und deckte sie zu. Ich gab ihr heiße Milch mit einem Schlafmittel von Meg, die sich auf dergleichen verstand, und wartete, bis sie eingeschlummert war.
Als ich wieder ins Bett ging, fragte ich mich, wohin das alles führen mochte. Eines wußte ich sicher: Es würde eine Wende eintreten.
Am Anfang waren es nur eine oder zwei Zeilen in den Zeitungen – ziemlich zurückhaltend. Die Gattin eines bekannten Politikers wollte sich scheiden lassen. »Man munkelt, daß eine berühmte Schauspielerin beteiligt ist.«
Nach ein paar Tagen aber brach es dann über die Welt herein. Ich hörte die Zeitungsjungen auf den Straßen rufen: »Irene Rushton in Scheidungsfall verwickelt. Prominenter Politiker beteiligt.«
Meine Mutter schloß sich in ihrem Zimmer ein und las die Zeitungen. Janet triumphierte. »So! Da siehst du, was dabei herauskommt, wenn man für eine Schauspielerin arbeitet«, hielt sie ihrer Schwester vor. Meg kniff die Lippen zusammen. Ihre anderen Damen hatten alle wohlanständig geheiratet, und keine hatte sich mit weniger als einem Ritter abgefunden. Und nun das! »Eine schöne Bescherung«, bemerkte sie.
Zeitungsreporter lauerten meiner Mutter auf. Sie warteten vor dem Haus, bis sie heimkam. Sie stürmten das Theater. Wie Meg gesagt hatte: Es war gut für das Stück. Die Leute strömten ins Theater, um sie zu sehen.
Sie machte weiter, als sei nichts geschehen. Sie war eben die geborene Schauspielerin und fand sogar eine gewisse Befriedigung in der Rolle, die sie nun verkörperte. An einem Tag war sie die verworfene Hure, am nächsten die gekränkte Unschuld, dann wieder die von den Umständen überwältigte tapfere Frau. Sie fand durchaus Genuß daran. Ich war der Meinung, sie hätte in jeder Rolle, in die sie sich hineinversetzte, eine gewisse Befriedigung gefunden.
Sie sprach viel mehr mit mir als früher. Ich weiß nicht, ob sie meinte, da ich nun erwachsen wurde, sollte ich auch erfahren, was vorging, oder ob sie einfach Everards Gesellschaft vermißte und jemanden brauchte, dem sie sich anvertrauen konnte.
Everard hatte ihr geschrieben. Wenn dieser Alptraum vorüber und er frei sei, würden sie zusammen fortgehen, teilte er ihr mit. Natürlich könnten sie, meines Vaters wegen, nicht heiraten, aber er frage sich, ob man mit ihm nicht zu einer Übereinkunft kommen könne.
»Armer Everard«, seufzte sie. »Er ist die Anständigkeit in Person. Stell dir vor, was das hier für ihn bedeutet Es beweist, wie sehr er mich liebt, sonst hätte er sich nie auf eine solche Beziehung eingelassen. Lieber, lieber Everard! Vielleicht wird eines Tages alles gut Aber zunächst steht uns diese schreckliche Prüfung bevor. Wir müssen uns darauf gefaßt machen, daß man in unserer Vergangenheit herumwühlt, und zwar auf ganz gehässige Weise. Ach Siddons, das wird für uns alle eine schlimme Prüfung.«
»Am schlimmsten wird’s für Everard«, bemerkte ich. »Mit seiner Karriere ist es vorbei.«
Sie nickte heftig. »Er muß zurücktreten, das ist klar. Er hatte sein Leben lang mit Politik zu tun. Das hier ist sein Ende.«
Ich dachte: Ein Weltuntergang aus Liebe! Und ich fragte mich, wie ihm wohl jetzt zumute war. Daß er meine Mutter von Herzen liebte, daran zweifelte ich nicht; doch solange die Liebesaffäre geheimgehalten wurde, konnte er seiner Karriere nachstreben – er hatte zwar gefährlich gelebt, aber nun hatte die Gefahr ihn eingeholt.
Eine schwermütige Stimmung hatte sich über das Haus gesenkt. Alles war so anders geworden. Nur Janet war zufrieden, gewahrte sie doch eine günstige Chance, daß Megs Dienste nicht mehr benötigt würden, und dann könnten sie auf schnellstem Wege zu Ethels ländlichem Paradies aufbrechen.
Meine Mutter spielte vor überfüllten Häusern, doch als sie eines Abends das Theater verließ, erhoben sich etliche feindselige Stimmen gegen sie, und man bezeichnete sie mit unmißverständlichen Ausdrücken als sittenloses Weibsbild. Sie, so sehr an Bewunderung gewöhnt, war ganz außer sich.
Sie weinte, als sie heimkam; Meg braute einen Schlaftrunk, und ich bürstete ihr Haar und band es mit rosa Bändern hoch, ehe ich sie zu Bett brachte.
Sie fügte sich in die unterschiedlichen Rollen, die im Augenblick von ihr verlangt wurden: die Frau, die sich gegen die Gesellschaft versündigt hatte, die Maria Magdalena mit einem Herzen aus Gold, die Unschuld, die ins grelle Licht der Öffentlichkeit. geraten war und sich wunderte, was das alles sollte; die Büßerin, die fortan ein Leben in Frömmigkeit führen wollte ... Sie probierte sie alle. Doch nun waren die nüchternen Tatsachen nicht mehr zu übersehen, und als sie sich mit der Realität konfrontiert sah, befiel sie eine tiefe Niedergeschlagenheit. Sie tat mir leid, denn ich erkannte, daß dieses von der Natur verwöhnte Kind nicht begriff, warum das Leben so grausam sein und sich völlig verändern konnte.
»Der Ärger geht erst richtig los, wenn die Verhandlung kommt«, prophezeite Meg.
Janet hob die Augen zur Decke. »Die Zeitungsleute werden nicht zu halten sein. Alles kommt ans Licht. Die machen einen richtigen Pfingstmontag daraus, das kann ich euch flüstern. Wie nett für uns alle ... in einem Haus zu leben, wo so was passiert ist.«
»Solche Reden bringen uns auch nicht weiter«, gab Meg zurück.
»Unsere Gnädige kommt ungeschoren davon, du wirst es sehen.«
»Vielleicht nimmt sie Reißaus«, vermutete Janet. »Das hat sie ja schon mal gemacht.«
»Gar keine schlechte Idee«, bemerkte Meg.
Die Zeit verging. In einer Woche sollte die Verhandlung eröffnet werden. Meine Mutter büßte ein wenig von ihrer Ruhe ein. Ihr wurde bange bei dem Gedanken, was bei Gericht alles herauskommen mochte. Ich hörte Janet mit Meg darüber reden.
»Sie werden alles ans Licht zerren«, sagte Janet. »Ihre Ehe. Warum sie ihren Mann verließ. Es sollte mich nicht wundern, wenn vor der Öffentlichkeit ein Berg schmutziger Wäsche gewaschen würde.«
»Meine Güte! Was da alles rauskommt! Diese Leute halten’s mit der Wahrheit nicht immer so genau.«
»Oh, die geben sich schon mit der Wahrheit zufrieden. Ist ja auch kein Wunder«, erwiderte Janet mit einem grimmigen Lachen.
Meine Mutter bekam nun wirklich Angst. Seit einer Woche fühlte sie sich nicht wohl, so daß sie nicht auftreten konnte. Das Stück mußte abgesetzt werden. Die Spannung im Haus war unerträglich. Wir versuchten alle, uns für das, was auf uns zukam, zu wappnen.
Dann kam der Schlag. Ich hörte, wie die Zeitungsjungen es ausriefen, und als ich eine Zeitung kaufte, tanzte mir die schwarze Schlagzeile vor den Augen. Mir wurde übel. Die Szenerie hatte sich dramatisch gewandelt Ein böser Traum war zum Alpdruck geworden.
Sir Everard Herringford war tot.
Er hatte sich im Arbeitszimmer seines Hauses in Westminster erschossen.
In den ersten Tagen herrschte eine gewisse morbide Erregung. Meg kaufte sämtliche Zeitungen, und wir sahen sie durch, bevor wir sie meiner Mutter brachten.
Zunächst waren die Titelseiten voll mit Meldungen und Bildern von Everard. Die Zeitungen berichteten über seine Zukunftsaussichten, wobei ich mich des Gefühls nicht erwehren konnte, daß diese durch seinen Tod verklärt und glänzender dargestellt wurden, als sie es im Leben waren. Die Möglichkeit, Premierminister zu werden, wurde zur Gewißheit; man zitierte seine witzigen und spitzen Zwischenrufe bei den Debatten. »Alles verloren durch die Liebe zu einer Frau«, lautete eine Schlagzeile; und als feststand, daß diese Frau Irene Rushton war, verfügte man über um so schärfere Munition, um beim Leser Abscheu oder Mitleid zu erwecken, je nachdem, was gerade angemessener schien. In einer Zeitung wurde Everard gar fast wie ein Märtyrer hingestellt: » ... im Fieber der Leidenschaft gefangen, der Ehemann, der jahrelang eine kränkelnde Frau umsorgte und sich sodann in eine verliebte, deren Ausstrahlung hinlänglich bekannt ist.« Am gleichen Tag war er aber auch der schurkische Verführer, der seinen Kollegen vorgetäuscht hatte, ein Ehrenmann zu sein.
Ich glaube, damals schlich sich ein gewisser Zynismus in mein Naturell, den ich nie mehr ganz verlor. Ich war erst vierzehn, doch war ich nicht so unerfahren, um daran zu glauben, daß jene Kollegen, die sich nun durch die Enthüllungen so erschüttert zeigten, von dem Verhältnis zwischen Everard und meiner Mutter die ganze Zeit nichts gewußt hatten. Sie war viel zu bekannt, als daß dergleichen unbemerkt geblieben wäre. Zudem war er so oft im Theater gewesen. Schockierend wurde das erst, als seine Frau sich entschloß, die Scheidung einzureichen.
Es galt eine Lektion daraus zu lernen: Es ist zwar in den Augen der Welt bedauerlich, wenn einer sündigt; doch unverzeihlich wird die Sünde erst, wenn sie ans Licht gelangt. Mit anderen Worten, die Sünde selbst ist nicht tadelnswert; daß sie der Öffentlichkeit preisgegeben wird, das erst macht sie so schockierend.
Everard hatte wohl angenommen, es sei für alle das beste, wenn er aus dem Leben scheide. Meine Mutter weinte und sagte, er habe es getan, um sie zu retten. Ich vernahm etwas von ein paar pikanten Briefen, die sie ihm geschrieben und die er aufbewahrt hatte, und die nun den Anwälten in die Hände gefallen waren. So wie ich ihn kannte, war es für ihn wohl Ehrensache gewesen, sich das Leben zu nehmen.
Man brachte Bilder von Herringford Manor, Everard Landsitz in Mittelengland, bei trübem Licht aufgenommen; es sah aus, als würde es jeden Augenblick zu regnen anfangen. Der Wohnsitz, auf dem die kränkelnde Frau lebte, mußte eben düster wirken – und darum wurde er so fotografiert – ein großes, graues steinernes Gebäude, unheimlich und bedrohlich. Ich aber konnte mir blühende Sträucher auf den Rasenflächen und Sonnenschein auf dem grauen Stein vorstellen – ein gänzlich anderes Bild. Doch dies war das Haus der Tragödie, und so hatte es auch auszusehen.
Solche Geschichten sind freilich Eintagsfliegen. Der Lauf der Welt wird kurz unterbrochen, und die Menschen müssen mit den Folgen leben; doch das öffentliche Interesse daran schwindet glücklicherweise schnell dahin.
Nach ungefähr einer Woche wurde die sogenannte Herringford-Rushton-Affäre in den Zeitungen nicht mehr erwähnt Everard war tot; er konnte die Unterhausabgeordneten nicht mehr mit seinem beißenden Witz ergötzen oder verärgern; er würde nicht mehr ins Theater gehen und mit meiner Mutter heimkommen, würde sie nicht mehr in finanziellen Angelegenheiten beraten oder sie ganz allgemein von seiner Klugheit profitieren lassen. Dessen war sie nun beraubt. Dank Everard war sie nicht ganz mittellos. Er hatte ihr weniges Geld klug angelegt, doch es reichte nicht, um ohne Gage gut leben zu können.
Sie müsse sehr bald wieder arbeiten, sagte sie; und ihr wurde unbehaglich bei dem Gedanken, wie die Leute sie wohl aufnehmen würden. Sie ertrug es nicht, wenn man sie nicht anhimmelte. Ich wußte, daß sie bei einem feindlich gesinnten Publikum die Nerven verlieren würde. Die Zuschauer bei ihrem Auftritt seufzen zu hören, ehe der Applaus losbrach, und den glücklichen Ausdruck auf ihrem Gesicht dabei zu beobachten – das hatte mich jedesmal gerührt, wenn ich meine Mutter auf der Bühne sah. Ich fragte mich, was geschehen würde, wenn diese Anerkennung ausblieb – oder, schlimmer noch, wenn ihr Feindseligkeit entgegenschlug. Ich glaube, das war es, wovor sie sich fürchtete.
Sie hatte eine lange Unterredung mit Tom Mellor. Ich fand, daß er, als Janet ihn hereinführte, nicht sein gewöhnliches Selbstvertrauen an den Tag legte. Er rief nicht wie sonst: »Ich hab’s, Reeny. Das ist das Stück!« Toby und ich hatten darüber gelacht, und der Satz war für uns zu einer stehenden Redensart geworden. Diesmal war Tom ganz ernst. Er blieb lange bei meiner Mutter im Wohnzimmer. Daß es keine sehr erfolgreiche Besprechung war, erfuhr ich, als er fort war.
Meine Mutter schimpfte, als ich zu ihr hineinkam: »Die Provinz! Kannst du dir das vorstellen, ich in der Provinz! Das hat dieser Idiot vorgeschlagen. ›Laß sie sich erst mal beruhigen, Reeny‹, sagt er. ›Sie brauchen ein bißchen ... Erholung.‹ Erholung von mir . Hat man je so einen Unsinn gehört?«
Ein paar Tage lang wetterte sie gegen Tom. Was war der bloß für ein Agent? Er wollte sie daran hindern, im Westend aufzutreten.
Wir – Meg und ich – beruhigten sie, so gut wir konnten. Mir wurde klar, daß dies für Meg ein fast ebensolcher Schlag war wie für meine Mutter. Wenn Meg an jene Damen dachte, die sie betreut hatte und die nun stolz ihre Diademe und Herzoginnenkronen zur Schau trugen, so war sie entsetzt über die Vorstellung, daß sie die besten Jahre ihres Lebens einer Schauspielerin gewidmet hatte, deren Agent die Provinz vorschlug.
Wie dem auch sei, für meine Mutter war nichts anderes in Aussicht, und die Düsternis hing so drückend über dem Haus am Denton Square wie ein Erbsensuppennebel.
Dann traten die Tanten in Erscheinung.
Der Brief war an meine Mutter gerichtet, und ich brachte ihn ihr mit dem Frühstückstablett. Die Adresse war mit einer steifen und großen Handschrift geschrieben, und ich hoffte, man biete ihr ein neues Stück an, und zwar genau das, das sie sich wünschte.
Ich sortierte die Rechnungen aus, die mit der gleichen Post gekommen waren, und ging zu meiner Mutter hinein.
Sie schlief; sie war in den letzten Wochen ein wenig gealtert, doch im Schlaf glich sie noch immer einem Kind. Ich stellte das Tablett hin und küßte sie flüchtig. Sie öffnete die Augen und lächelte matt. Ich stopfte Kissen um sie herum und stellte das Tablett, den Brief obenauf plaziert, vor sie hin. Sie griff sogleich nach ihm.
»Wer um alles in der Welt ...« Sie schlitzte den Umschlag auf, und während sie las, umspielte ein grimmiges Lächeln ihre Lippen. Plötzlich brach sie in Lachen aus. »Hier, hör dir das an:
Liebe Irene, wir haben natürlich von den erschütternden Ereignissen gehört, und haben wir uns auch lange nicht gesehen, so vergessen wir doch nicht, daß Du zur Familie gehörst. Wir würden Dich gern am dreiundzwanzigsten um vier Uhr aufsuchen ...«
Sie zog eine Grimasse und sagte: »Du lieber Himmel, das ist ja heute!«
»... Wir wohnen für ein paar Tage im Hotel Brown und können uns vorstellen, daß Du angesichts dessen, was geschehen ist, Rat und Hilfe brauchst. Man muß ja auch an das Kind denken.«
Meine Mutter sah mich an und nickte. »An dich!« sagte sie. »Der Brief ist von Martha Ashington unterschrieben. Das ist deine Tante. Das ›Wir‹ ist nicht majestätisch gemeint. Sie sind zu zweit: Martha und Mabel, und Mabel lebt in Marthas Schatten.«
Sie wandte sich wieder dem Brief zu. »Da steht noch ein Postskript:
Wir haben Dir einen Vorschlag zu unterbreiten und werden darüber reden, wenn wir Dich besuchen.«
Ich war erregt über die Aussicht, meine Verwandten kennenzulernen, doch meine Mutter seufzte resigniert.
»Das sieht denen ähnlich«, sagte sie. »Ziemlich anmaßend, findest du nicht? ›Wir würden Dich gern um vier Uhr aufsuchen.‹ Woher wissen die denn, daß ich darin zu Hause bin? Ich hätte große Lust, einfach nicht da zu sein. Das wäre doch spaßig. Stell dir vor, Meg würde zu ihnen sagen: ›Sie hätten sich eher anmelden müssen, um Miss Rushton anzutreffen.‹«
»Aber willst du dir ihren Vorschlag denn nicht anhören?«
»Ich bin sicher, nichts, was von denen kommt, würde mir zusagen.«
»Es muß Jahre her sein, seit du sie gesehen hast. "Vielleicht haben sie sich verändert.«
»Die nicht. Die Damen Ashington auf dieser Welt bleiben Säulen der Tugend von neun bis neunzig.«
»Sie sind immerhin die Schwestern meines Vaters.«
Sie blickte mich sinnend an. »Vielleicht ist es doch besser, wenn ich hier bin. Ich sollte dein Haar flechten, dann sieht es ordentlicher aus. Ich weiß nicht, was die von dir halten werden.« Der Gedanke erheiterte sie, und ich war froh, sie lachen zu sehen wie schon lange nicht mehr.
Wir bereiteten uns den halben Tag auf den Empfang der Tanten vor. Janet buk Teegebäck und Kuchen. Meg kleidete gutgelaunt meine Mutter wieder einmal für eine Rolle an, denn es war klar, daß sie die bevorstehende Begegnung wie eine Szene aus einem Stück empfand, Sie erzählte an diesem Morgen eine ganze Menge von den Tanten und beschrieb sie: Martha, die dominierende, sei wie ein Kriegsschiff, das in die Schlacht zieht, und Mabel sei zwar nicht ganz so furchterregend, doch nichtsdestoweniger eine Macht, mit der man rechnen mußte. »Die Wochen, die ich auf dem Gut der Ashingtons verbrachte, bevor wir nach Ceylon gingen, kamen mir wie Jahre vor«, sagte sie. »Du lieber Himmel, waren die etepetete. Alles, was sie taten, entsprach irgendwelchen Regeln. Es war ein Witz Gottes, ihnen Ralph als Bruder zu geben. Ralph tat immer genau das Gegenteil von dem, was die Regeln verlangen. Aus Rebellion gegen seine Schwestern und diesen gräßlichen alten Landsitz.«
Ich konnte es kaum erwarten, die Tanten zu sehen. Ich trug ein dunkelblaues Sergekleid mit Kragen und Manschetten aus weißem Piqué, und mein Haar war, so gut es ging, in zwei Zöpfen mit marineblauen Schleifen gebändigt.
Punkt vier Uhr fuhr die Droschke vor dem Haus vor, und die beiden Tanten stiegen aus. Sie waren schwarz gekleidet (wie zwei schwarze Krähen, sagte meine Mutter später), groß und hielten sich sehr aufrecht Sie kamen mir uralt vor, doch das lag vermutlich an meiner Jugend. Sie mußten damals um die fünfzig gewesen sein. Martha war zwei Jahre älter als Mabel.
Martha – ich erkannte sie sofort – marschierte (anders läßt sich ihr militärisches Auftreten nicht beschreiben) auf die Haustür zu, Mabel folgte ihr dicht auf den Fersen. Selbst das Klopfen an der Tür war wie ein herrisches Kommando. Sie wurden von Meg ins Wohnzimmer geführt, und ich harrte auf den Befehl, zu erscheinen, der, wie ich wußte, bald erfolgen würde. Und so war es auch.
Als ich eintrat, war mir sogleich klar, daß dies der Augenblick war, auf den sie gewartet hatten. Ich spürte, wie zwei Paar lebhafte dunkle Augen mich musterten – und dabei gewahrte ich ihren pompösen schwarzen Schmuck. Perlen hoben und senkten sich über ihren beachtlichen Busen und baumelten an ihren Ohren, und große Kameen prangten an ihrem Hals. Die langen schwarzen Röcke schleiften über den Boden. »Das ist also das Kind ... Sarah, glaube ich.«
Tapfer begegnete ich dem kritischen Blick aus den durchdringenden dunkelbraunen Augen.
»Ja«, erwiderte ich, »und Sie sind meine Tante Martha, nehme ich an.« Ich wandte mich der anderen zu. »Und Sie sind meine Tante Mabel.« Tante Martha schien mit meiner prompten Antwort leidlich zufrieden und fuhr fort: »Es ist höchst bedauerlich, daß die Umstände eine frühere Begegnung verhindert haben.« Mit den »Umständen« war natürlich meine Mutter gemeint, die auf dem Sofa saß und hinreißend aussah – für die Rolle herausstaffiert in einem lavendelfarbenen Nachmittagskleid, das sie in irgendeinem Stück getragen hatte. Die Kostüme, die sie mochte, behielt sie, und ich glaube, wenn sie eines anzog, so nahm sie auch die Rolle an, die sie früher darin gespielt hatte. Dies hier, erinnere ich mich, gehörte zu einem schönen Mädchen einfacher Herkunft, das einen wohlhabenden Mann ehelicht und seiner Familie vorgestellt werden soll. Ich hatte das Stück mehrmals gesehen und wußte, wie sie sich verhalten würde: charmant, verträumt, unverdorben und ein wenig schelmisch gegenüber unsympathischen Verwandten.
Diese ignorierten sie, und Martha sagte zu mir: »Nun, wir dachten, das Kriegsbeil sollte begraben werden. Wir wissen, was hier vorgefallen ist« – Mabel schüttelte ganz leicht den Kopf, eine Geste, die unschwer als Ausdruck von Abscheu und Mißbilligung zu erkennen war –, »und wir hielten es für unsere Pflicht, vorbeizukommen. Wir haben einen Vorschlag zu machen.«
»Meine Mutter und ich werden ihn mit Interesse vernehmen«, sagte ich. »Und es ist nett von Ihnen, daß Sie gekommen sind.«
Tante Martha sah tatsächlich aus, als trage sie einen Heiligenschein, für meine Augen unsichtbar, weil ich eben so und nicht anders aufgewachsen war. »Es war unsere Pflicht«, sagte sie leise.
Janet brachte den Tee ziemlich mißmutig herein.
»Bediene du unsere Gäste, liebes Kind«, sagte meine Mutter.
Die Augen der Tanten ruhten auf mir, und ich verspürte den Drang, ihnen zu zeigen, daß wir uns trotz unseres Theaterhaushalts und trotz der Tatsache, daß wir jüngst in einen großen Skandal verwickelt waren, zu benehmen wußten. Auch ich spielte eine Rolle. Das half mir in einer Situation, die sich als unangenehm erweisen konnte.
»Sahne? Zucker?« fragte ich – zuerst Tante Martha, dann Tante Mabel, zuletzt meine Mutter.
Meine Mutter schnitt eine Grimasse, als ich ihr die Tasse reichte. »Du hast dich kaum verändert, Irene«, bemerkte Tante Martha.
»Vielen Dank, Miss Ashington. Sie auch nicht.«
»Wir waren sehr betrübt«, warf Mabel ein. »Wir haben die Zeitungen von den Dienstboten ferngehalten ... ein Segen, daß der Name Ashington kaum erwähnt wurde.«
»Das ist einer der Vorteile meines Berufes«, sagte meine Mutter leichthin.
»Eigentlich sind wir gekommen«, ergriff Tante Martha rasch wieder das Wort, »um festzustellen, wie du situiert bist.«
»Situiert?« fragte meine Mutter.
»Ich vermute, du kannst deinen ... hm ... Beruf nun nicht mehr ausüben.«
»Wie kommen Sie auf diese Idee?«
»Die Leute müssen doch empört sein, und deine Geschichte mit diesem ... hm ... Politiker ...«
»Die Leute sind ausgesprochen gern empört, Miss Ashington.«
»Ich bin sicher, das ist bei den wenigsten der Fall. Du bist die Gattin unseres Bruders.« Es hörte sich an, als sei dies eine furchtbare Katastrophe. »Und Sarah ist unsere Nichte. Wir sind gekommen, um ihr ein Heim zu bieten. Wir werden dafür sorgen, daß sie eine Bildung erhält, wie sie der Tochter unseres Bruders zukommt, und daß sie so erzogen wird, wie es sich für sie schickt.«
Ich wollte lauthals protestieren. Ich blickte meine Mutter flehend an. »Meine Tochter und ich sind immer zusammen gewesen«, sagte sie, »und so soll es auch bleiben ... bis daß der Tod uns scheidet«
Nicht ganz der richtige Text für diese Rolle, dachte ich und unterdrückte ein Kichern. Ich stellte mir vor, wie sie aus jenem düsteren Haus im dumpfigen Dschungel schritt und mich in den Armen hielt Ich konnte Megs Stimme hören: »Es war bestimmt nicht gut für ihre Karriere, aber sie hatte dich dabei.«
»Was kannst du dem Kind hier schon bieten?« fragte Tante Martha.
»Mutterliebe«, erwiderte meine Mutter gefühlvoll.
»Schade, daß du nicht daran gedacht hast, bevor ... bevor ...«, begann Tante Mabel, doch ein Blick von Tante Martha brachte sie zum Schweigen.
»Du solltest es dir überlegen«, sagte sie. »Sie ist Ralphs Tochter. Wir haben eine gewisse Verantwortung.«
»Ich hätte gedacht, die haben er und ich wohl eher als Sie.«
»Es könnte sein, daß du nicht in der Lage bist, deiner Verantwortung nachzukommen«, sagte die respektable Martha. »Und Ralph neigte von jeher zur Leichtfertigkeit Außerdem ist er weit weg. Seine Tochter sollte auf jeden Fall in England erzogen werden. Wie steht es mit ihrer Bildung? Sie sollte eine Schule besuchen. Hat sie eine Gouvernante? Wenn ja, würden wir sie gern sprechen.«
»Sie wurde von einem ... Hauslehrer unterrichtet.«
»Einem Hauslehrer! Einem Mann! Nicht gerade schicklich für ein junges Mädchen, aber vielleicht ... in einem Haushalt, wo ...« Mabel hatte anscheinend die Gewohnheit, ihre Sätze unvollendet zu lassen, sobald Marthas Blick sie traf.
»Wir sind soeben dabei, eine Gouvernante zu engagieren«, sagte meine Mutter, mehr schuldbewußt als wahrheitsgemäß.
»Gouvernanten sind in einigen Familien durchaus am Platze, aber in einer Situation wie dieser würde ich eine Schule empfehlen. Das heißt, falls Sarah hier bleibt.«
»Falls sie hier bleibt? Dies ist ihr Zuhause!«
»Ja, ja, aber unter diesen Umständen ...«, begann Mabel.
»Eine Gouvernante dürfte in Ashington Grange durchaus ihren Zweck erfüllen«, fiel ihr Martha ins Wort. »Ein junges Mädchen gehört in einen ordentlichen Haushalt und in anständige Gesellschaft.«
»Wir führen einen ordentlichen Haushalt«, warf meine Mutter ein.
Tante Martha seufzte. »Es stand so viel in den Zeitungen. Ich versichere dir, Irene, es tut dem Kind nicht gut, wenn es hier bleibt.«
»Ich bleibe bei meiner Mutter«, sagte ich.
Beide Tanten sahen mich an. Tante Martha nickte. »Lobenswert«, meinte sie, »aber unklug. Wir sind gekommen, um unsere Pflicht zu tun. Ich kenne deine finanziellen Verhältnisse nicht, Irene, aber ich nehme an, es steht nicht allzugut damit. Ralph kann dir nicht helfen. Er ist ständig in Geldnot. Ich denke, daß du augenblicklich pausierst ... falls man es so nennen will …, und selbst ein Haushalt wie dieser kann kostspielig sein. Du hast diese beiden Frauen ... deine ganze Dienerschaft, vermute ich. Sehr einfach und unzureichend, aber trotzdem kostspielig, wenn das Einkommen nicht groß ist.«
»Ich werde bald wieder arbeiten«, sagte meine Mutter. Ich fand, sie sah ein wenig traurig aus, als sie aus ihrer Rolle in die Wirklichkeit schlüpfte. Sie wandte sich an mich. »Sarah, komm her, mein Kind.« Ich ging zu ihr, und sie ergriff meine Hand.
»Deine Tanten bieten dir ein Heim in Ashington Grange – ein schönes altes Anwesen mitten im Wald. Dort könntest du leben, wie es der Tochter deines Vaters zukommt.« Wir befanden uns wieder im Spiel. Ich sah es deutlich. Dies war die Entsagungsszene, in der das Kind um seines Wohles willen den reichen Verwandten übergeben wird und die schöne Mutter das große Opfer ihres Lebens bringt. »Ja, mein Liebling. Es ist besser für dich. Du wirst ein respektables Leben führen; du wirst erzogen, wie es sich für ein Mitglied der Familie Ashington gehört. Du brauchst mir nur noch Lebewohl zu sagen.«
Sie erwartete, daß ich meine Arme um ihren Hals schlang und jammerte: »Mutter, liebste Mutter, ich werde dich nie verlassen.« Sie hatte sich bereits in Positur gesetzt. Die Tanten blickten mich an, und ich schaute über das Rampenlicht ins Publikum. Fast konnte ich das Wort »Vorhang!« hören.
Ich sagte mit kühler, sachlicher Stimme:»Es ist lieb von Ihnen, Tante Martha und Tante Mabel, mir ein Heim zu bieten, aber ich könnte meine Mutter nie verlassen.«
Meine Mutter machte eine leicht ungeduldige Geste, und die Tanten tranken ihren Tee.
»Du solltest es dir überlegen«, sagte Tante Martha. »Wir sind bis Ende der Woche im Hotel Brown zu erreichen.«
Als sie fort waren, unterhielten wir uns lange miteinander. Meine Mutter sagte: »Ich war ja so stolz auf dich. Wie du sie in ihre Schranken verwiesen hast, das war großartig.«
»Selbstverständlich würde ich dich nie verlassen«, erwiderte ich.
Sie tätschelte meine Hand. »Die waren wie zwei alte Krähen ...«
»Und du warst ein Paradiesvogel«, ergänzte ich, »und da wir schon mal im Vogelkäfig sind – was war ich? Vielleicht eine kleine Pfauhenne? Ganz bescheidene Vögel sind das, die ihrem prachtvollen Männchen immer auf dem Fuße folgen. Aber das ist vielleicht nicht ganz passend. Eher ein Zaunkönig.«
»Sie würden dir schon einen Ehemann verschaffen, dessen bin ich sicher. Irgendeinen Adelssprößling, vielleicht eine Säule der Kirche. Oh, ihre Lebensart wäre dir zuwider, Siddons, und doch ... und doch ...«Ihre Leichtfertigkeit schien einen Augenblick lang von ihr abzufallen. »Es wäre vielleicht das beste.«
»Wie meinst du das?«
»Ich meine, du würdest wirklich die Erziehung genießen, die der Tochter deines Vaters angemessen ist. Du bekämst einen erstklassigen Unterricht, würdest auf den Eintritt in die Gesellschaft vorbereitet und könntest diesen Pfuhl hinter dir lassen.« Ich starrte sie an. Sie meinte es wirklich ernst.
»Ich denke nur an dich«, fuhr sie fort. »An dein Bestes.« Plötzlich umklammerte sie meine Hand ganz fest »Tom«, sprach sie weiter, »sieht nicht gerade optimistisch in die Zukunft«
Kälte beschlich mein Herz. Deutete sie an, daß es kein Engagement für sie gab, daß das Publikum, das ihr neulich noch tosenden Beifall spendete, ihr den Rücken kehrte?
Sie sagte langsam: »Ich könnte ein paar Rollen haben ... aber das sind nicht die richtigen. Weißt du, was vorgefallen ist, das war alles nicht gut für meinen ... Leumund.«
»Schauspielerinnen sollten ihren Leumund einfach vergessen und spielen«, sagte ich.
»Ach, welch weise Worte«, gab sie zurück. Sie schien eine andere geworden. Ja, da waren Falten um ihre Mundwinkel. Die hatte ich vorher nie bemerkt Everards Tod war ihr doch sehr nahegegangen. Er hatte seinen Preis gezahlt und sie glaubte, daß sie nun ihren zahlen müsse. Sie fuhr fort: »Vielleicht bin ich verschwenderisch. Ich habe sehr wenig gespart Everard hat mir ab und an etwas geschenkt, und das wurde vernünftig angelegt Immerhin etwas. Ich brauche Kleider ... gute Kleider. Ich muß dieses Haus unterhalten. Die Kosten sind hoch, und dann noch Janet und Meg. Weißt du, wenn man nichts verdient ...« Mir schwindelte. Ich hatte bis dahin wenig über Geld nachgedacht. »Du siehst also«, sagte sie langsam, »man darf die Tanten nicht vor den Kopf stoßen.«
Ich nahm sie in die Arme und drückte sie fest an mich. Das schien sie einigermaßen zu trösten. »Als ob ich dich verlassen könnte!« sagte ich.
Damals waren wir uns sehr nahe.
Am nächsten Tag suchte sie Tom auf und ging zu Fuß zurück. Ich glaube, die Unterredung war niederschmetternd, und sie wollte über die Zukunft nachdenken. Sie wurde von einem Regenschauer überrascht und kam durchnäßt nach Hause. Nach ein paar Tagen hatte sie die erste jener starken Erkältungen, die sie von da an häufig befielen. Ihr Gesundheitszustand war angegriffen, denn Everards Tod war ihr weit nähergegangen, als wir anfangs angenommen hatten.
Die Tanten besuchten uns abermals, und da meine Mutter das Bett hütete und ziemlich krank war, redeten sie mit mir allein im Wohnzimmer und gaben mir zu verstehen, daß sie zwar meine Zuneigung und meine Anhänglichkeit gegenüber meiner Mutter würdigten, es jedoch für töricht hielten, wenn ich es ablehnte, zu ihnen zu ziehen.
Ich dankte ihnen, beharrte jedoch darauf, daß mein Platz bei meiner Mutter sei.
»Wir haben deinem Vater geschrieben und ihn über die Vorfälle hier unterrichtet«, sagte Tante Martha. »Er wird sich zweifellos dazu äußern und gewiß wünschen, daß du zu uns kommst.«
»Ich weiß so wenig von meinem Vater«, erwiderte ich. »Ich kann mich überhaupt nicht an ihn erinnern.«
»Wie betrüblich und schandbar ist das doch alles, wenn man bedenkt, wie ...«, begann Tante Mabel.
»Wenn dergleichen geschieht«, unterbrach sie Tante Martha, »ist es immer das beste, diese Ereignisse hinter sich zu lassen und durch beispielhaftes Betragen zu beweisen, daß man sich bemühen will, die angerichtete Verwüstung wiedergutzumachen.«
Da ich mich in keiner Weise dafür verantwortlich fühlte, daß meine Mutter meinen Vater verlassen hatte, noch für das, was zwischen ihr und Everard vorgefallen war, verspürte ich einen leichten Groll; doch ich war sehr besorgt, denn was vor ein paar Tagen noch ganz undenkbar erschien, das rückte nun in den Bereich des Möglichen.
Tante Martha sagte: »Wir reisen Ende der Woche ab. Wenn du uns brauchst, kannst du uns in Ashington Grange erreichen. Mabel, gib ihr unsere Karte.« Mabel reichte mir eine Visitenkarte, die sie ihrer Handtasche entnahm. »Außerdem«, fuhr Tante Martha fort, »kommen wir in ein oder zwei Monaten wieder nach London. Vielleicht kannst du uns bis dahin eine Antwort geben. Wir wohnen dann wieder im Hotel Brown. Doch falls du dich früher mit uns in Verbindung setzen möchtest, erreichst du uns in Ashington Grange.«
Als sie wiederkamen, hatte sich die Lage nicht sehr verändert, außer daß es hieß, meine Mutter solle in einem Ausstattungsstück auftreten – in einer ihrer alten Rollen. Sie war natürlich hocherfreut, und wenn es auch nicht mehr ganz so wie früher sein konnte, so sah es doch so aus, als würden wir jenen entsetzlichen Depressionen entkommen, die uns beschlichen hatten, als sich das Schicksal gegen uns zu wenden schien.
Ich versicherte den Tanten abermals, daß ich meine Mutter niemals verlassen würde. Sie mißbilligten dies und verlangten zu wissen, was für meine Bildung getan werde. Meine Mutter antwortete ausweichend, und Tante Martha sagte, es gehe sie durchaus etwas an, denn es sei undenkbar, daß eine Ashington nicht gebildet sei. Meine Mutter wies daraufhin, daß ich mir im Alter von vier Jahren selbst das Lesen beigebracht hätte und seither mit meiner Nase ständig in einem Buch stecke. Sie glaube, es lasse sich schwerlich ein Mädchen in meinem Alter finden, daß in englischer Literatur so bewandert sei wie ich.
»Es gibt noch andere Fächer«, murmelte Tante Mabel, und Tante Martha stimmte ihr zu. Sie verließen mich ziemlich bekümmert, fand ich.
»Ich glaube, sie möchten mich wirklich gern bei sich haben«, sagte ich.
»Sie wollen dich nach dem Vorbild formen, das sie für richtig halten«, erwiderte meine Mutter. »Sie wollen eine kleine Ashington aus dir machen, das heißt, eine wie sie. Sie haben Ralph immer gesagt, daß er dies und das tun solle. Das war einer der Gründe, warum er froh war, ihnen zu entkommen.«
Ein paar Wochen später sagte sie zu mir: »Weißt du, wegen deiner Bildung haben sie eigentlich recht Du solltest in eine Schule.«
Ich war verblüfft.
»Ja«, sagte sie, »es muß sein. Es gibt eine sehr gute Schule in der Nähe von York. Die Ashington-Mädchen waren alle dort.
Das ist eine Art Familientradition.«
»Du willst mich auf den Arm nehmen.«
»Du gehst im September.«
»Aber das Geld. Ist das nicht furchtbar teuer?«
»Notgroschen«, murmelte sie. »Und das neue Stück. Das wird ein Bombenerfolg. Ich bin wieder da, Siddons. Jetzt brauchen wir uns keine Sorgen mehr zu machen.«
Ich fand mich allmählich mit dem Gedanken an die Schule ab, und als ich schließlich tatsächlich dort war, zog sie mich ganz in ihren Bann. War ich in einigen Fächern auch zurück, so war ich in anderen weit voraus, und zur Freude meiner Lehrer lernte ich mit Begeisterung. Daneben war ich stets für aufregende Abenteuer und Spaße zu haben, und das machte mich bei meinen Mitschülerinnen nicht gerade unbeliebt. Es war neu für mich, mit Gleichaltrigen zusammenzusein, und ich war von meinem neuen Leben entzückt Die Flucht vor den tragischen Ereignissen, die auf dem Haus am Denton Square lasteten, war mir vollkommen geglückt. Die Schule nahm mich so sehr gefangen, daß ich tagelang nicht an den Denton Square dachte. Das Drama, welche Note ich für meinen Aufsatz bekam und wie es mir in dem bevorstehenden Hockeyspiel ergehen würde, war mir entschieden wichtiger.
Eine ganz alte Lehrerin erinnerte sich an meine Tanten und war erfreut, wieder eine Ashington in der Schule zu haben. »Sie waren sehr gewissenhafte, strebsame Mädchen, und sie haben ein ehrbares Leben geführt«, bemerkte sie. »Laß uns hoffen und beten, Sarah, daß du wie sie wirst!« Das war das letzte, das mir für die Zukunft vorschwebte. In den Weihnachtsferien kam ich nach Hause. Es wurde kein glücklicher Aufenthalt Das Stück war nur einen Monat gelaufen – ein finanzieller Reinfall für die Geldgeber.
Ich erfuhr es von Meg. »Sie haben deiner Mutter die Schuld gegeben. Sie brauchen ja immer ’nen Sündenbock. Das Stück war schlecht Das hätte ich denen von Anfang an sagen können. Dann war da noch dieser gemeine Kerl ... Kritiker nennt er sich. Der Star der Herringford-Affäre sei wohl nicht ganz die richtige Besetzung für die Unschuldige in diesem Stück, hat er gesagt. So ein Biest! Du siehst, die sind durchaus nicht bereit, die Sache zu vergessen.«
»Und wie hat sie’s aufgenommen?«
»Schlecht. Es hat sich auf ihr Spiel ausgewirkt, denke ich. Jemand hat ein Ei auf sie geworfen, als sie zum Bühneneingang herauskam; es hat ihren Samtumhang verdorben. Das Zeug bringe ich nie wieder raus. Das bleibt für immer drin. Ich muß den Umhang wegschmeißen, wenn ich den Eierfleck loswerden will. Und ’ne schöne Stange Geld hat er gekostet der Umhang.«
»Meg«, sagte ich ernst, »und was wird nun?«
»Das kann ich dir ebensowenig sagen wie du mir.«
Meine Mutter wollte von nun an klüger sein. Das nächste Mal würde sie sich ihre Stücke bestimmt sorgfältiger aussuchen, das gelobte sie sich.
Ich blieb einen Monat lang zu Hause. Wir schmückten das Wohnzimmer, wie wir es immer getan hatten. Früher waren die Leute in Scharen ein- und ausgegangen. An den Weihnachtstagen kamen ein paar Freunde, unter ihnen Tom Mellor, doch die Beziehung zwischen ihm und meiner Mutter hatte sich merklich abgekühlt Sie machten sich gegenseitig für den Mißerfolg verantwortlich.
Ich war froh, wieder zur Schule zu kommen, und das Leben dort nahm mich abermals so gefangen, daß ich mich damit zufrieden gab, nur gelegentlich einen Brief von meiner Mutter zu bekommen. Ich dagegen mußte ihr freilich jede Woche schreiben. Das gehörte zu den Gepflogenheiten der Schule. Später fragte ich mich oft, was meine Mutter sich wohl bei den Berichten über die Hockeymannschaft, über Tennis, Korbball und über meine guten Englischnoten gedacht hat.
Im Sommer stellte ich fest, daß sich zu Hause viel verändert hatte. Meine Mutter war gealtert. Ich erfuhr, daß sie ein paar kleine Rollen bekommen hatte. Die eine sei ein ziemlicher Erfolg gewesen, erzählte sie mir. Janet war verschlossener denn je, und doch konnte sie gleichzeitig eine innere Genugtuung nicht verbergen. Meg und meine Mutter stritten sich unentwegt. Ich war auch diesmal froh, als die Ferien vorüber waren und ich wieder zur Schule konnte.
In der darauffolgenden Weihnachtszeit wurde mir klar, daß etwas nicht stimmte. Meine Mutter sollte die gute Fee in einer Pantomime spielen.
»Pantomime!« sagte Janet mit verächtlichem Grinsen.
Meg sprach wenig.
Es wurde ein stilles Weihnachtsfest denn meine Mutter mußte am zweiten Feiertag mit der Arbeit beginnen. Sie war erkältet und fühlte sich schlaff. Ich brachte ihr das Frühstück, wie ich es früher des öfteren getan hatte.
Sie gab sich fröhlich, doch nach so langer Abwesenheit konnte mir ihre Veränderung nicht verborgen bleiben. Sie sah zehn Jahre älter aus; sie hatte tiefe Falten der Verbitterung um den Mund. Während sie in der Pantomime auftrat, flackerte der Skandal wieder auf. Lady Herringford, Everards Gattin, war auf Gut Herringford tot aufgefunden worden, mit dem Gesicht nach unten in einem seichten Fluß. Sie war lange krank gewesen, und es bestand kein Verdacht, daß etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sein könnte. »Ihr Tod ruft uns den unglücklichen Sir Everard in Erinnerung, der seiner Karriere und seinem Leben ein Ende setzte, als er in einen Skandal mit einer Schauspielerin verwickelt war ...«
Meine Mutter las den Artikel – er stand nicht auf der Titelseite -und regte sich auf, weil von ihr lediglich als von »einer Schauspielerin« die Rede war.
»Nun, es wäre dir doch nicht recht, wenn man deinen Namen erwähnt hätte«, besänftigte ich sie.
Sie geriet plötzlich ganz außer sich. »Siehst du nicht, was das bedeutet? Sie erwähnen mich nicht, weil ich nicht mehr wichtig bin! ›Eine Schauspielerin!‹ Als würde ich in einem Repertoiretheater auftreten oder ... oder ...«, sie lachte hysterisch, » ... in einer Pantomime!«
Es waren auch diesmal unerfreuliche Ferien, und ich war abermals froh, als ich wieder in der Schule war; doch es dauerte über eine Woche, bis ich die Erinnerungen verdrängt hatte.
Der Sommer kam. Mein sechzehnter Geburtstag war vorüber, und noch ehe das Jahr endete, stand mein siebzehnter bevor. Ich war kaum länger als eine Stunde zu Hause, als mir klar wurde, daß das Leben, das ich auf dem Blessington-Lyzeum für junge Damen genoß, vorbei war.
Meine Mutter hatte sich noch mehr verändert. Unter ihren Augen lagen dunkle Schatten.
Meg eröffnete es mir als erste: »Ich gehe. Ich habe bloß abgewartet, bis du nach Hause kommst. Mir reicht’s. Ich halte ihre schlechte Laune nicht mehr aus.«
Janet war obenauf. »In zwei Wochen fahren wir zu Ethel«, triumphierte sie. »Sie«, dabei wies sie auf ihre Schwester, »wollte dir Zeit lassen, um irgendwas in die Wege zu leiten.«
»Und meine Mutter?« fragte ich. »Sie sieht nicht gut aus.«
»Sie hat’s auf der Brust. Sie kriegt eine Erkältung nach der anderen, aber sie nimmt sie nicht ernst.«
»Die kriegt sie immer, wenn sie mies gelaunt ist«, bemerkte Janet.
»Ja«, bestätigte Meg. »Wenn sie bloß eine richtige Chance bekäme, ich wette, dann wäre ihr ein Comeback sicher.«
Das war an Janet gerichtet, die über den Mißerfolg meiner Mutter frohlockte. Als wir allein waren, sagte Meg zu mir: »Schauspielerinnen wie sie sind oft nur kurze Zeit erfolgreich. Das weiß ich. Ich hab’s gesehen. Sie haben einen besonderen Charme. Sie sind jung und hübsch wie Schmetterlinge. Sie flattern über die Bühne, und die Leute lieben sie ... Aber das vergeht. Jugend vergeht, verstehst du? Eine glänzende Partie, das wäre das beste für diese Sorte. Sie verlassen die Bühnenbretter und werden Ehefrauen und Mütter. Aber bei ihr ist es von Anfang an schiefgelaufen. Sie hätte nicht heiraten und nach Ceylon gehen sollen. Sie ist aus der Reihe getanzt, wie man so sagt, und dafür muß sie eben büßen.«
»Und deshalb verläßt du sie, Meg«, sagte ich vorwurfsvoll.
»Da ist nichts zu machen. Sie kann uns unseren Lohn nicht zahlen ... mir und Janet Sie kriegt immer weniger Angebote. Bald wird sie dankbar für ’ne Statistenrolle sein.«
»Alles wegen dieser Affäre ...«
»Nein, nein, das ist es nicht. Wäre sie eine große Schauspielerin gewesen, so hätte sie den Sturm kinderleicht überstanden. Aber sie ist keine große Schauspielerin. Ihr Erfolg hätte ihre Jugend nicht überdauert. Sie ist durch die Geschichte bloß früher gealtert Ich hab’ ihr damals gesagt es sei dumm von ihr, daß sie heiratet ... aber sie wollte nicht hören. O nein! Sie wußte alles besser. Nun, sie hat sich verrechnet, basta. Ich ziehe zu Ethel. Dann gibt Janet endlich Ruhe. Ich hab’ die Nase voll vom Theater, nach allem, was passiert ist.«
Ich führte ein ernstes Gespräch mit meiner Mutter. Sie lag zu Bett. Ich hatte darauf bestanden, weil sie so blaß aussah.
»Ich weiß nicht, was jetzt werden soll«, sagte sie. »Ich konnte Meg und Janet nicht mehr entlohnen. Wir müssen das Haus aufgeben.«
»Mein Schulgeld muß eine ungeheure Belastung gewesen sein!« rief ich aus.
Sie lachte leise. »Nicht für mich. Das haben deine Tanten bezahlt.« Ich starrte sie an. Dann verdankte ich also ihnen diese zwei Jahre, in denen ich neben meiner Ausbildung ein sorgenfreies Leben genoß! Ich fühlte mich tief in ihrer Schuld und ein wenig beschämt. Ich sagte: »Ich gehe nicht zurück. Wie könnte ich? Wir müssen etwas unternehmen.«
»Was?« fragte meine Mutter.
Was sollte ein Mädchen in meiner Lage tun? War sie allein, wurde sie gewöhnlich Gouvernante oder Gesellschafterin – beides ziemlich unerfreuliche Aussichten, denn gewöhnlich waren die Kinder widerspenstig und die alten Damen unleidlich.
Aber ich war nicht allein. Ich mußte meine Mutter unterstützen. Ich sagte: »Als erstes muß ich Tante Martha und Tante Mabel schreiben, daß ich die Schule aufgebe. Ich werde ihnen die Lage erklären.«
»Ich kann mir ihre Genugtuung lebhaft vorstellen«, grollte meine Mutter.
Ich schrieb ihnen noch am gleichen Tag.
Es war nicht nötig, daß mich die Tanten auf unsere schwierige Lage hinwiesen. Ich kannte sie zur Genüge, und nach einer mehrstündigen Unterredung in ihrer Suite im Hotel Brown stimmten meine Mutter und ich der einzigen Lösung unserer Probleme zu.
»Es sei, wie es wolle«, sagte Tante Martha, »Irene ist Mistress Ashington, und du, Sarah, bist die Tochter unseres Bruders.« Ashington Grange war der Wohnsitz der Familie, und dort hätte mein Vater gelebt, wenn er die Teeplantage nicht gehabt hätte. Das Haus, erklärten sie, gehöre zwar ihnen, dafür habe ihr Vater gesorgt, doch wenn Ralph einen Sohn hätte, so würde es natürlich diesem zufallen.
Irene müsse nach Ashington Grange kommen, wo sie gut versorgt würde, und ich solle wieder zur Schule gehen.
Meine Mutter sah schließlich ein, daß ihr keine andere Wahl blieb. Sie litt unter heftigen Depressionen. Es war schwer für sie, ohne die Verehrung und Bewunderung zu leben, die sie stets als rechtmäßigen Anspruch betrachtet hatte. Davon würde auf Ashington Grange sicher wenig zu spüren sein. Sie sagte, ohne mich wäre sie nicht imstande, das auszuhalten, und das glaubte ich gern. Die Tanten verachteten sie, und sie konnte die Tanten nicht leiden. Von deren Mildtätigkeit zu leben war ihr zuwider – aber nicht so wie die Aussicht, in einer Dachstube zu verhungern. Außerdem, sagte sie, müsse sie an mich denken. Die Vorstellung, daß ich arbeitete, war mehr, als sie ertragen konnte. Überdies gab es auch gar keine Arbeit, die ich hätte verrichten können. Wie wir es auch betrachteten. Es gab nur einen Ausweg, nämlich den, nach Ashington Grange zu ziehen. Ich entdeckte bald, daß ich es war, der die Sorge der Tanten galt Ich glaube, sie fanden die Aussicht, eine junge Verwandte im Haus zu haben, höchst aufregend. Sie schmiedeten Pläne für mich, denn Pläneschmieden war etwas, das Tante Martha leidenschaftlich gern tat. Ich merkte ihnen an, daß sie die Zukunft einer Nichte weit interessanter fanden als den Wohltätigkeitsbasar der Kirche oder das Gartenfest, das alljährlich zugunsten des Kirchturmbaus veranstaltet wurde.
Ich bestand darauf, nicht zur Schule zurückkehren zu müssen.
»Lächerlich!« rief Tante Martha. »Die Töchter der Ashingtons haben stets bis zum achtzehnten Lebensjahr die Schule besucht.«
»Ich muß bei meiner Mutter bleiben«, beharrte ich. »Es geht ihr nicht gut.«
»Papperlapapp! Trübsinnig ist sie, weiter nichts.«
»Sie hat ein schweres Unglück erlitten«, gab ich zu bedenken. »Das ist die Strafe«, murmelte Tante Mabel, »nach allem, was ...«
»Sie müssen wissen«, entgegnete ich, »daß ich nur nach Ashington Grange kommen kann, wenn auch meine Mutter dort gern gesehen ist.«
Ich staunte über mich selbst, daß ich diesen beiden respektheischenden Damen Bedingungen stellte, und ich verspürte eine leise Zärtlichkeit für sie, weil sie so sehr wünschten, mich bei sich zu haben, daß sie sogar auf meine Forderungen eingingen. »Dann ist es allerdings vonnöten«, meinte Tante Martha, »eine Gouvernante zu engagieren.«
»Dafür bin ich zu alt«, protestierte ich.
»Deine Ausbildung wurde abgebrochen wegen einer ... Marotte!« sagte Tante Martha. »Eine Gouvernante muß sein. Unsere Schwester Margaret war zu zart für die Schule und hatte auch eine Gouvernante ... genauer gesagt, eine ganze Menge. Sie ist gestorben.«
»Hoffentlich nicht aus Überdruß an Gouvernanten«, bemerkte ich kichernd, denn ich verspürte ein unbezähmbares Verlangen, diese Tanten zu necken, was ich aber, wie mir klar wurde, unterdrücken mußte.
»Du bist allzu übermütig, Sarah, und das hier ist eine ernste Angelegenheit.«
Niemand wußte das besser als ich. Immerhin gaben sie nach. Wir wurden uns einig. Meine Mutter kündigte das Mietshaus am Denton Square, und wir zogen nach Ashington Grange.