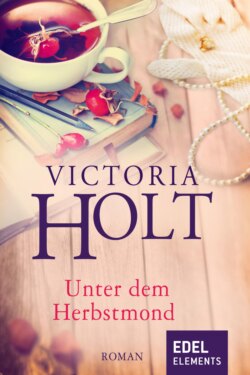Читать книгу Unter dem Herbstmond - Victoria Holt - Страница 4
Die Erscheinung im Wald
ОглавлениеIch war neunzehn, als ich das Erlebnis mit »der Erscheinung im Wald« hatte. Rückblickend mutet es fast mystisch an, wie etwas, das in einem Traum geschah. Tatsächlich war mir oftmals, als hätte sich alles nur in meiner Phantasie abgespielt, obwohl ich schon immer nüchtern veranlagt und keineswegs verträumt war; allerdings war ich recht unerfahren, ich ging damals noch zur Schule und war gerade dabei, meine Kinderschuhe abzustreifen.
Es geschah Ende Oktober an einem Nachmittag in einem Wald in der Schweiz, nicht weit von der deutschen Grenze, im letzten Jahr meines Aufenthalts in einer der vornehmsten Schulen Europas. Tante Patty hatte darauf bestanden, daß ich dort »den letzten Schliff« erhielt.
»Zwei Jahre dürften genügen«, sagte sie. »Es kommt nicht so sehr darauf an, was du dort lernst, sondern was man dir nach Meinung der Leute dort beigebracht hat. Wenn die Eltern hören, daß eine von uns in Schaffenbrucken ausgebildet wurde, werden sie ihre Töchter unbedingt auf unsere Schule schicken wollen.«
Tante Patty war Vorsteherin einer Mädchenschule, und nach Beendigung meiner Ausbildung sollte ich ihr dort zur Hand gehen. Für diese Aufgabe mußte ich die besten Voraussetzungen mitbringen, und durch den »letzten Schliff« sollte ich zum unwiderstehlichen Köder für Eltern werden, die den Wunsch hegten, daß etwas vom Glanz Schaffenbruckens auf ihre Töchter abfärbte.
»Snobismus«, murrte Tante Patty, »schierer Snobismus. Aber was sollen wir anderes machen, wenn nur dadurch Patience Grants exklusivem Institut für junge Damen zu einem ansehnlichen Profit verholfen wird?«
Tante Patty war wie eine Tonne anzuschauen; sie war klein und ausgesprochen mollig. »Ich ess’ nun mal gern«, pflegte sie zu sagen, »warum soll ich’s mir da nicht schmecken lassen? Ich halte es für die Pflicht und Schuldigkeit eines jeden Erdenbürgers, die guten Dinge zu genießen, die uns der Herr beschert hat, und Roastbeef und Schokoladenpudding wurden erfunden, um gegessen zu werden.«
Die Verpflegung in Patience Grants Institut für junge Damen war vorzüglich – sie unterschied sich deutlich von der Kost, die in vielen ähnlichen Etablissements aufgetischt wurde. Tante Patty war nicht verheiratet, »aus dem einfachen Grund«, wie sie sagte, »weil niemand um mich angehalten hat. Ob ich ja gesagt hätte, das steht auf einem anderen Blatt, aber da sich mir das Problem nie gestellt hat, braucht weder meine Wenigkeit noch sonst wer sich darüber den Kopf zu zerbrechen.«
Sie ließ sich ausführlich über das Thema aus. »Ich war die geborene Sitzenbleiberin«, erzählte sie, »das ewige Mauerblümchen. Denk nur, damals, bevor ich durch mein Übergewicht so unbeweglich war, konnte ich auf Bäume klettern, und wenn ein Junge es wagte, mich an den Zöpfen zu ziehen, dann mußte er schleunigst verschwinden, wenn er einen Kampf vermeiden wollte, aus dem ich, meine liebe Cordelia, unweigerlich als Siegerin hervorgegangen wäre.«
Das glaubte ich gern, und oft dachte ich, wie dumm die Männer doch seien, da keiner von ihnen genügend Verstand besaß, um Tante Pattys Hand anzuhalten. Sie wäre eine vorbildliche Ehefrau geworden; so aber war sie mir eine vorbildliche Mutter. Meine Eltern hatten sich der Missionarsarbeit in Afrika gewidmet. Man bezeichnete sie als Heilige, aber wie viele Heilige waren sie so sehr damit beschäftigt, die Welt im großen zu bekehren, daß sie sich kaum um die Probleme ihrer kleinen Tochter kümmerten. Ich kann mich nur undeutlich erinnern – ich war erst sieben Jahre alt, als ich heim nach England geschickt wurde –, wie sie mich manchmal mit vor Eifer und Hingabe glühenden Gesichtern betrachteten, als seien sie nicht ganz sicher, wer ich war. Später habe ich mich gefragt, wie sie in ihrem Leben voll guter Werke überhaupt die Zeit und die Lust gefunden hatten, mich zu zeugen.
Jedenfalls – und wohl zu ihrer ungeheuren Erleichterung – stand fest, daß ein Leben im afrikanischen Dschungel nicht das Rechte sei für ein Kind. Ich sollte nach Hause geschickt werden, und wohin konnte man mich schicken außer zu Patience, der Schwester meines Vaters?
Jemand von der Mission, der vorübergehend nach Hause fuhr, nahm mich mit. An die lange Reise kann ich mich nur verschwommen erinnern, aber die rundliche Gestalt von Tante Patty, die mich erwartete, als ich von Bord ging, wird mir unvergeßlich bleiben. Als allererstes fiel mir ihr Hut auf, ein Prachtstück mit einem Vogel obenauf. Tante Patty hatte eine Schwäche für Hüte, die derjenigen fürs Essen beinahe gleichkam. Oftmals behielt sie sie sogar im Haus auf. Da stand sie also – die Augen durch eine Brille vergrößert; ihr Vollmondgesicht glänzte von Wasser und Seife und joi de vivre unter dem prachtvollen Hut mit dem wippenden Vogel, als sie mich an ihren gewaltigen, nach Lavendel duftenden Busen drückte.
»Da bist du also«, lächelte sie. »Alans Tochter ... heimgekehrt.«
Und in diesem Augenblick hatte ich das Gefühl, tatsächlich heimgekehrt zu sein.
Ungefähr zwei Jahre später starb mein Vater an der Ruhr, und wenige Wochen darauf erlag meine Mutter derselben Krankheit.
Tante Patty zeigte mir die Artikel in den frommen Blättern. »Sie opferten ihr Leben im Dienste Gottes«, hieß es da.
Ich fürchte, ich trauerte nicht sehr. Ich hatte meine Eltern fast vergessen und erinnerte mich höchst selten an sie. Das Leben in Grantley Manor, der alten elisabethanischen Villa, die Tante Patty zwei Jahre vor meiner Geburt von ihrem väterlichen Erbe gekauft hatte, nahm mich gänzlich gefangen.
Wir führten ausführliche Gespräche, Tante Patty und ich. Sie nahm kein Blatt vor den Mund. Später machte ich die Erfahrung, daß die meisten Menschen Geheimnisse haben. Nicht so Tante Patty. Sie ließ ihren Worten freien Lauf.
»Als ich noch zur Schule ging«, berichtete sie, »machte mir das Leben großen Spaß, aber ich hatte nie genug zu essen. Sie haben die Suppe verwässert. Montags nannten sie es Brühe. Die war nicht schlecht. Dienstags war sie ein bißchen dünner, und am Mittwoch war sie so schwach, daß ich mich fragte, wie lange das so weitergehen könnte, bis es sich nur noch um reines H2O handelte. Das Brot war stets altbacken. Ich glaube, durch die Schule bin ich zur Feinschmeckerin geworden; denn ich schwor mir, wenn ich sie hinter mir hätte, würde ich schlemmen und schlemmen. Wenn ich eine Schule leiten würde, sagte ich mir, sollte alles ganz anders sein. Und als ich dann zu Geld kam, fragte ich mich, warum nicht? ›Es ist ein Hasardspiel‹, meinte der alte Lucas. Das war der Anwalt. ›Na und?‹ sagte ich, ›ich mag Hasardspielen Und je mehr er dagegen war, um so mehr war ich dafür. So bin ich eben. Wenn mir einer erklärt, ›Nein, das geht nicht‹, sage ich, so wahr ich hier sitze, ›Doch, das geht.‹ Ich fand die Villa ... sie war gar nicht so teuer, auch wenn einiges renoviert werden mußte. Genau das Richtige für eine Schule. Ich taufte sie Grantley Manor. Grant, wie mein Name. Da hat sich ein bißchen von dem dummen Snobismus eingeschlichen. Miss Grant auf Grantley. Da denkt man doch, die leben hier seit Jahrhunderten, findest du nicht? Da stellt man keine Fragen; man denkt es einfach. Das ist gut für die Mädchen. Ich wollte Grantleys Institut zum vornehmsten Internat des Landes machen, wie dieses Schaffenbrucken in der Schweiz.«
Das war das erste Mal, daß ich von Schaffenbrucken hörte. Sie erklärte es mir. »Alles ist da genau bedacht. Schaffenbrucken wählt seine Schülerinnen sorgfältig aus, und es ist nicht einfach, dort unterzukommen. ›Ich fürchte, wir haben keinen Platz für Ihre Amelia, Madame Smith. Versuchen Sie es im nächsten Schuljahr wieder. Wer weiß, vielleicht haben Sie Glück. Wir sind besetzt und haben eine Warteliste.‹ Eine Warteliste! Das ist eine magische Vokabel im Wortschatz einer Schulvorsteherin. Das hoffen wir alle zu erreichen ... daß die Leute darum kämpfen, ihre Töchter in unserer Schule unterzubringen, statt daß wir sie, wie es gewöhnlich der Fall ist, umwerben müssen.«
»Schaffenbrucken ist teuer«, gab sie ein andermal zu, »aber ich glaube, es ist jeden Pfennig wert. Man lernt Französisch und Deutsch bei Leuten, die es richtig aussprechen, weil es ihre Muttersprache ist; man bekommt Anstandsunterricht, kann tanzen lernen, und gehen übt man, indem man ein Buch auf dem Kopf balanciert. Ja, sagst du, das wird einem in tausend Schulen beigebracht. Gewiß, aber man sieht dich mit ganz anderen Augen an, wenn der Glanz von Schaffenbrucken dich verklärt.«
Ihre Rede war stets vom eigenen Gelächter unterbrochen.
»Du brauchst ein wenig Schaffenbruckener Flair, meine Liebe«, konstatierte sie. »Dann kommst du zurück, und wenn sich herumspricht, wo du gewesen bist, werden die Mütter ihre Töchter nur noch zu uns schicken. ›Was Benehmen betrifft, da ist Miss Cordelia Grant führend. Sie war in Schaffenbrucken, wissen Sie.‹ O ja, meine Liebe, wir werden ihnen einflüstern, daß wir eine Warteliste haben mit jungen Damen, die danach lechzen, von Miss Cordelia Grant, behaftet mit dem Glorienschein von Schaffenbrucken, in den gesellschaftlichen Feinheiten unterwiesen zu werden.«
Es war von vornherein ausgemacht, daß ich, wenn ich »fertig« wäre, an Tante Pattys Schule unterrichten würde.
»Eines Tages«, erklärte sie, »wird sie dir gehören, Cordelia.«
Ich wußte, sie meinte, wenn sie tot sei; doch – ich konnte mir eine Welt ohne sie nicht vorstellen. Mit ihrem glänzenden Gesicht, ihren Lachanfällen, ihren geistreichen Reden, ihrem maßlosen Appetit und ihren übertriebenen Hüten war sie der Mittelpunkt meines Lebens.
Als ich siebzehn war, behauptete sie, es sei nun Zeit für mich, nach Schaffenbrucken zu gehen.
Wieder wurde ich Reisenden anvertraut – diesmal waren es drei Damen, die in die Schweiz fuhren. In Basel sollte ich von einer von der Schule abgeholt werden, die mich den Rest des Weges begleiten würde. Die Fahrt war interessant, und ich erinnerte mich an die lange Heimreise von Afrika. Diesmal war alles ganz anders. Ich war älter; ich wußte, wo es hinging, und stand nicht unter der ängstlichen Spannung, die ein kleines Mädchen auf einer Reise ins Unbekannte befällt.
Die Damen, die mich durch Europa begleiteten, nahmen mich gewissenhaft unter ihre Fittiche und waren sichtlich erleichtert, als sie mich Fräulein Mainz übergaben, die in Schaffenbrucken Deutsch unterrichtete. Sie war eine ziemlich unscheinbare Person mittleren Alters. Sie freute sich, daß ich ein wenig Deutsch gelernt hatte. Meine Aussprache fand sie zwar grauenhaft, meinte aber, das würde sich bessern, und weigerte sich während der Fahrt, sich in einer anderen als ihrer Muttersprache zu unterhalten. Sie erging sich in Lobeshymnen auf Schaffenbrucken und hielt es für mein Glück, daß ich auserkoren sei, mich dieser erlauchten Gruppe junger Damen zuzugesellen. Es war das alte Schaffenbruckener Lied, und Fräulein Mainz dünkte mich die humorloseste Person, der ich je begegnet war. Ich verglich sie im stillen mit Tante Patty.
Schaffenbrucken selbst machte keinen großen Eindruck auf mich, die Umgebung dafür um so mehr. Das Internat lag ungefähr eine Meile von der Stadt entfernt und war von Wäldern und Bergen umgeben. Madame de Guérin, eine Französisch-Schweizerin von stiller Autorität, kann ich nur als ›eindrucksvolle Erscheinung‹ bezeichnen. Ich merkte, wie stark sie den Mythos von Schaffenbrucken beeinflußte. Mit uns Mädchen hatte sie nicht viel zu schaffen. Wir waren der Obhut der Lehrerinnen überlassen. Sie unterrichteten Tanz, Theaterspiel, Französisch, Deutsch sowie das sogenannte gesellschaftliche Comment. Wenn wir Schaffenbrucken verließen, sollten wir zum Eintritt in die höchsten gesellschaftlichen Kreise gerüstet sein.
Ich gewöhnte mich bald an das neue Leben. Die Mädchen fand ich interessant. Sie kamen aus ganz Europa, und ich freundete mich natürlich mit den Engländerinnen an. Je zwei Mädchen verschiedener Nationalität teilten sich ein Zimmer. In meinem ersten Jahr war ich mit einer Deutschen zusammen, im zweiten mit einer Französin. Das war sehr vorteilhaft, denn es half uns, unsere Sprachkenntnisse zu vervollkommnen.
Es herrschte keine sonderlich strenge Disziplin; schließlich waren wir keine Kinder mehr. Die Mädchen kamen meistens mit sechzehn oder siebzehn und blieben, bis sie neunzehn oder zwanzig Jahre waren. Wir waren nicht da, um eine Allgemeinbildung zu erhalten, sondern eine jede mußte, wie Madame de Guérin es ausdrückte, zu einer femme comme il faut geformt werden. Gut zu tanzen und anmutig Konversation zu machen, war wichtiger als Literatur oder Mathematik. Die meisten Mädchen würden geradewegs von Schaffenbrucken aus ihr Debüt in der Gesellschaft geben. Eine oder zwei waren, wie ich, zu etwas anderem bestimmt. Die meisten waren recht vergnügt und betrachteten ihren Aufenthalt in Schaffenbrucken als wesentlichen Bestandteil ihrer Erziehung – er war ohnehin von kurzer Dauer, und man tat gut daran, ihn zu genießen.
Beim Unterricht in den verschiedenen Fächern ging es zwar recht leger zu, dennoch behielt man uns im Auge. Sollte ein Mädchen in einen Skandal verwickelt werden, so würde sie sicher unverzüglich ihre Sachen packen müssen, denn es gab immer ehrgeizige Eltern, die ihre Tochter mit Freuden auf den freigewordenen Platz setzten.
Weihnachten und in den Sommerferien fuhr ich nach Hause, und Tante Patty und ich unterhielten uns amüsiert über Schaffenbrucken.
»Wir müssen es genauso machen«, meinte Tante Patty dann. »Ich sage dir, wenn du aus Schaffenbrucken zurückkommst, wird unser Mädchenpensionat das vornehmste im ganzen Land. Daisy Hetherington wird grün vor Neid werden.«
Das war das erstemal, daß ich den Namen Daisy Hetherington hörte. Beiläufig fragte ich, wer sie sei, und erfuhr, daß sie eine Schule in Devonshire leitete, die beinahe so gut war, wie Daisy selbst glaubte, und das sagte eine ganze Menge.
Später wünschte ich, ich hätte mich genauer erkundigt. Aber damals konnte ich natürlich nicht ahnen, daß es einmal wichtig sein könnte.
Mein letztes Halbjahr in Schaffenbrucken war gekommen. Es war Ende Oktober – das Wetter war herrlich für die Jahreszeit. Wir hatten viel Sonne in Schaffenbrucken, wodurch uns der Sommer sehr lang vorkam. Tagsüber war es heiß, doch sobald die Sonne verschwand, wurde einem die Jahreszeit bewußt. Dann drängten wir uns im Aufenthaltsraum um den Kamin und schwatzten.
Meine besten Freundinnen waren damals Monique Delorme, mit der ich das Zimmer teilte, ein englisches Mädchen namens Lydia Markham sowie ihre Zimmergenossin Frieda Schmidt. Wir vier waren stets zusammen, hatten uns unentwegt etwas zu erzählen und unternahmen gemeinsame Ausflüge in die Stadt. Manchmal gingen wir zu Fuß, und wenn der Kutschwagen in die Stadt fuhr, nahm er einige von uns mit. Wir gingen im Wald spazieren, was uns in Sechsergruppen – oder mindestens zu viert – gestattet war. Ein gewisses Maß an Freiheit wurde uns zugestanden, und wir fühlten uns nicht im mindesten eingeschränkt.
Lydia verglich den Aufenthalt in Schaffenbrucken mit dem Warten auf den Zug, der einen an den Ort brächte, wo man zu einem richtig erwachsenen Menschen würde. Ich verstand, wie sie das meinte. Dies hier war lediglich eine Haltestelle in unserem Leben – ein Meilenstein auf unserem Lebensweg. Wir erzählten von uns. Monique kam aus einem adligen Elternhaus und würde demnächst angemessen vermählt werden. Friedas Vater hatte sein Vermögen mit Keramikarbeiten gemacht und war ein vielseitiger Geschäftsmann; Lydia stammte aus einer Bankiersfamilie. Ich war ein wenig älter, und da ich Schaffenbrucken Weihnachten verlassen würde, kam ich mir überaus reif vor.
Elsa fiel uns sogleich auf, als sie ihre Stellung im Internat antrat. Sie war klein, hübsch und lebhaft, hatte blonde lockige Haare und schelmisch blickende blaue Augen. Sie war anders als die anderen Stubenmädchen und war kurzfristig eingestellt worden, weil ein Mädchen mit einem Mann aus der Stadt durchgebrannt war. Madame de Guérin wollte es bis zum Ende des Schuljahres mit Elsa versuchen.
Hätte Madame de Guérin Elsa wirklich gekannt, so hätte sie sie gewiß nicht bis zum Ende des Schuljahres behalten. Sie war in keiner Weise respektvoll und hatte nicht die geringste Ehrfurcht vor Schaffenbrucken oder seinen Insassen. Sie gab sich so kameradschaftlich, als sei sie eine von uns. Manche Mädchen fanden das abstoßend; unser Quartett dagegen amüsierte sich darüber. Vielleicht hielt sie sich deshalb so oft in unseren Zimmern auf.
Manchmal kam sie, wenn wir vier zusammen waren, und mischte sich in unsere Gespräche.
Sie hörte gern, wenn wir von zu Hause erzählten, und stellte eine Menge Fragen. »Oh, ich würde gern nach England gehen«, sagte sie dann. »Oder nach Frankreich ... oder Deutschland ...« Sie entlockte uns Schilderungen über unsere Herkunft und hörte mit gespannter Miene zu, so daß wir gar nicht anders konnten, als ihr viel zu erzählen.
Sie selbst sei verarmt, sagte sie. Sie sei eigentlich kein Dienstmädchen, o nein! Sie glaubte, eine sorgenfreie Zukunft vor sich zu haben. Ihr Vater war, nun ja, nicht eben reich, aber es hatte ihm an nichts gefehlt. Sie hatte in die Gesellschaft eingeführt werden sollen. »Freilich nicht so wie ihr, meine jungen Damen, sondern bescheidener. Dann starb mein Vater. Simsalabim!« Sie fuchtelte mit den Armen und hob die Augen zur Decke. »Das war das Ende von Klein-Elsas Glanz und Glorie. Kein Geld. Elsa auf sich selbst gestellt. Mir blieb nichts anderes übrig, als zu arbeiten. Und was konnte ich tun? Zu was war ich ausgebildet?«
»Nicht zum Stubenmädchen«, meinte Monique mit ihrer französischen Logik, worauf wir alle lachten, Elsa eingeschlossen.
Wir mußten sie einfach gernhaben und ermunterten sie, sich zu uns zu gesellen und mit uns zu plaudern. Sie war amüsant und kannte sich bestens aus in den Sagen von den deutschen Wäldern. Dort hatte sie ihre frühe Kindheit verbracht, dann war ihr Vater mit ihr nach England gezogen, wo sie eine Weile gelebt hatte, ehe sie in die Schweiz kam.
»Gern stelle ich mir alle die Dämonen in ihren unterirdischen Behausungen vor«, sagte sie. »Da kriege ich immer eine Gänsehaut. Es gibt aber auch schöne Geschichten von Rittern in Rüstungen, die Jungfrauen nach Walhalla trugen ... oder sonstwohin.«
»Nach Walhalla kamen die Toten«, gab ich ihr zu verstehen. »Dann eben an einen schönen Ort, wo gefeiert und geschmaust wurde.«
Sie leistete uns fast jeden Nachmittag Gesellschaft. »Was würde Madame de Guérin sagen, wenn sie das wüßte?« fragte Lydia.
»Wir würden vermutlich an die Luft gesetzt«, meinte Monique.
»Welch ein Glück für die auf der Warteliste. Vier auf einen Streich.«
Elsa saß auf einer Stuhlkante und lachte. »Erzähl mir vom Château deines Vaters«, bat sie Monique. Und Monique berichtete, wie förmlich es bei ihr daheim zuging, und daß sie so gut wie verlobt war. Mit Henri de la Creseuse, der den Landsitz besaß, der an die Güter ihres Vaters angrenzte.
Und Frieda erzählte von ihrem strengen Vater, der ihr bestimmt mindestens einen Baron zum Ehemann aussuchen würde. Lydia sprach von ihren beiden Brüdern, die Bankiers werden würden wie ihr Vater.
»Und Cordelia?«, fragte Elsa.
»Cordelia hat es am besten von uns allen«, rief Lydia aus. »Sie hat eine ganz wunderbare Tante, bei der darf sie tun und lassen, was sie will. Ich höre schrecklich gern von Tante Patty. Die läßt Cordelia ganz bestimmt keinen Baron oder alten Knacker heiraten, nur weil er einen Titel und Geld hat. Cordelia heiratet den, der ihr gefällt.«
»Und sie wird trotzdem reich sein. Sie erbt die schöne alte Villa. Eines Tages wird alles dir gehören, Cordelia, und du mußt nicht erst heiraten, um es zu bekommen.«
»Ich will’s aber nicht, weil Tante Patty vorher sterben müßte.«
»Aber eines Tages wird es dir gehören. Du wirst reich und unabhängig sein.«
Elsa erkundigte sich nach Grantley Manor, und ich beschrieb es in glühenden Farben. Mit der Pracht von Grantley hatte ich wohl ein wenig übertrieben, aber gewiß nicht bei der Schilderung von Tante Pattys ungewöhnlichem Charme. Ihr konnte niemand ganz gerecht werden. Ich erzählte gern von ihr. Wie die anderen mich beneideten, bei denen es daheim strenger und förmlicher zuging!
»Ich wette«, sagte Elsa eines Tages, »daß ihr alle bald verheiratet seid.«
»Gott bewahre«, empörte sich Lydia. »Zuerst will ich mich amüsieren.«
»Wart ihr schon mal am Pilcherberg?« fragte Elsa.
»Ich hab’ davon gehört«, erwiderte Frieda.
»Ist nur zwei Meilen von hier.«
»Ist er sehenswert?« wollte ich wissen.
»O ja. Er liegt im Wald, es ist ein bizarrer Felsen. Es gibt auch eine Geschichte darüber. Solche Geschichten hatte ich schon immer gern.«
»Was für eine Geschichte?«
»Wenn man zu bestimmten Zeiten dorthin geht, kann man seinen zukünftigen Liebhaber ... oder Ehemann sehen.«
Wir lachten.
Monique meinte: »Ich hab’ keine große Lust, Henri de la Creseuse ausgerechnet jetzt zu sehen. Dazu ist noch Zeit genug, wenn ich von hier fortgehe.«
»Ah«, sagte Elsa, »aber es kann doch durchaus sein, daß das Schicksal ihn gar nicht für dich bestimmt hat.«
»Und der Mann, der für mich bestimmt ist, wird an diesem Ort erscheinen? Was hat es mit dem Pilcherberg auf sich?«
»Ich erzähl’ euch die Geschichte: Vor vielen, vielen Jahren wurden Liebende, die beim Ehebruch überrascht wurden, zum Pilcher gebracht. Sie mußten auf den Berg steigen und wurden dann hinabgeworfen – immer nachts bei Vollmond. Das Blut der vielen Toten hat die Erde dort fruchtbar gemacht, so daß rund um den Berg Bäume wuchsen, und so ist der Wald entstanden.«
»Und da sollen wir hingehen?«
»Cordelia ist das letzte Halbjahr hier. Sie wird nicht mehr oft Gelegenheit dazu haben, und sie sollte ihn unbedingt sehen, solange es noch geht. Morgen abend wird Vollmond sein, und dazu noch Herbstmond. Das ist eine günstige Zeit.«
»Herbstmond?« echote Monique.
»Ja, der folgt auf den Erntemond. Der ist am besten geeignet.«
»Haben wir wirklich schon Oktober?« fragte Frieda.
»Es ist noch so warm.«
»Gestern abend war es kalt«, bemerkte Lydia, und die Erinnerung machte sie frösteln.
»Tagsüber ist es noch schön«, sagte ich. »Das sollten wir ausnutzen. Ein seltsamer Gedanke, daß ich nicht zurückkommen werde.«
»Bist du traurig deswegen?« fragte Monique.
»Ihr werdet mir alle fehlen.«
»Aber du wirst bei deiner wunderbaren Tante sein«, meinte Frieda neidvoll.
»Und reich wirst du sein«, fügte Elsa hinzu, »und unabhängig. Du wirst die Schule besitzen und die wundervolle alte Villa.«
»Nein, nein. Bis dahin sind es noch viele Jahre hin. Ich erbe das Haus, wenn Tante Patty stirbt, und das wünsche ich mir niemals.«
Elsa nickte. »Naja«, meinte sie, »wenn ihr nicht zum Pilcher wollt, dann frag’ ich die anderen.«
»Warum eigentlich nicht?« fragte Lydia. »Ist morgen ... Vollmond?«
»Wir könnten den Kutschwagen nehmen.«
»Wir könnten sagen, wir wollten die Wildblumen im Wald sehen.«
»Glaubt ihr, das wird man uns erlauben? Wildblumen sind für die Salons der Oberschicht kaum geeignet. Und was für Wildblumen gibt es in dieser Jahreszeit?«
»Dann denken wir uns eben was anderes aus«, schlug Lydia vor.
Es fiel jedoch keiner etwas ein, und je angestrengter wir überlegten, um so verlockender schien uns ein Ausflug zum Pilcher.
»Ich hab’s«, sagte Elsa schließlich, »ihr fahrt in die Stadt, um ein Paar Handschuhe für Cordelias Tante auszusuchen. Sie war so begeistert von denen, mit denen Cordelia nach Hause kam, und natürlich gibt es nirgends so schicke Handschuhe wie in der Schweiz. Das wird Madame einleuchten. Und, statt in die Stadt zu fahren, biegt die Kutsche ab in den Wald. Es sind nur zwei Meilen. Ihr könnt bitten, länger ausbleiben zu dürfen, weil ihr noch in die Konditorei wollt, auf eine Tasse Kaffee und ein Stück von dieser Sahnetorte, die es nur in der Schweiz gibt. Ich bin sicher, daß ihr die Erlaubnis kriegt, und damit habt ihr genug Zeit, um in den Wald zu fahren und euch unter die Liebeseiche zu setzen.«
»So etwas Hinterlistiges!« rief ich aus. »Wenn Madame de Guérin wüßte, daß du uns zu so etwas verleitest, was dann? Du würdest entlassen und müßtest einsam in den Schneebergen umherirren.«
Elsa faltete die Hände wie zum Gebet. »Bitte, verratet mich nicht. Ist ja nur ein Scherz. Ich möchte bloß ein bißchen Romantik in euer Leben bringen.«
Ich lachte mit den anderen. »Warum sollen wir eigentlich nicht hingehen? Sag, was müssen wir tun, Elsa?«
»Ihr setzt euch unter die Eiche. Die könnt ihr nicht verfehlen. Sie steht am Fuß des Berges. Setzt euch dorthin und unterhaltet euch ... ganz natürlich. Und wenn ihr Glück habt, erscheint euer zukünftiger Ehemann.«
»Einer für uns vier?« rief Monique.
»Vielleicht auch mehr ... wer weiß? Aber auch wenn nur einer kommt, ist das Beweis genug, daß an der Sage was dran ist, oder?«
»So was Lächerliches«, erklärte Frieda.
»Es wäre immerhin einen Ausflug wert«, meinte Monique.
»Unser letzter, vor dem Winter«, ergänzte Lydia.
»Wer weiß? Vielleicht ist es morgen schon kalt.«
»Dann ist es zu spät für Cordelia«, gab Lydia zu bedenken. »Ach, Cordelia, überrede deine Tante doch, daß sie dich noch ein Jahr bleiben läßt.«
»Zwei Jahre sind genug für unseren Schliff. Man sieht mir den Glanz bestimmt schon an.«
Wir lachten ein Weilchen und beschlossen, uns am folgenden Nachmittag zum Pilcherberg zu begeben.
Es war heller Nachmittag, als wir aufbrachen. Die Sonne schien warm wie im Frühling. Wir waren guter Laune, als der Kutschwagen von der Straße zur Stadt abbog und uns in den Wald brachte. Die Luft war klar und frisch, und Schnee glitzerte auf den fernen Berggipfeln. Ich gewahrte den würzigen Duft der Tannen des Waldes. Aber zwischen den immergrünen Bäumen standen auch ein paar Eichen, und nach einer davon sollten wir Ausschau halten.
Wir fragten den Kutscher nach dem Pilcherberg, und er sagte, den könnten wir nicht verfehlen. Er werde ihn uns zeigen, wenn wir um die Kurve bögen. Dann würden wir ihn sich hoch über die Schlucht erheben sehen.
Die Szenerie war großartig. In der Ferne sahen wir Berghänge, einige in der Nähe der Täler bewaldet; weiter oben wurde die Vegetation spärlicher.
»Wer von uns ihn wohl sehen wird?« flüsterte Lydia.
»Keine«, gab Frieda zurück.
Monique lachte. »Ich bestimmt nicht, weil ich ja schon vergeben bin.«
Darauf lachten wir alle.
»Ich glaube, was Elsa erzählt, ist halb geschwindelt«, meinte ich.
»Ob sie wirklich verarmt ist?«
»Ich weiß nicht«, sagte ich nachdenklich. »Elsa hat etwas Besonderes an sich. Es könnte stimmen. Andererseits kann sie’s auch erfunden haben.«
»Wie die Visionen vom Pilcherberg«, ergänzte Frieda. »Sie lacht uns bestimmt aus, wenn wir zurückkommen.«
Das Geräusch der Pferdehufe wirkte beruhigend, als wir munter daherrumpelten. Ich würde diese Ausflüge vermissen. Aber es würde natürlich wunderbar zu Hause bei Tante Patty sein.
»Da ist der Berg«, sagte der Fuhrmann und deutete mit seiner Peitsche hinauf.
Wir schauten hin. Von dieser Stelle aus wirkte er sehr eindrucksvoll. Er sah aus wie ein runzliges altes Gesicht ... braun, zerklüftet und feindselig.
»Ob das der Pilcher sein soll?« meinte Monique.
»Wer war dieser Pilcher überhaupt?«
»Da müssen wir Elsa fragen«, sagte ich. »In derlei Dingen scheint sie bestens bewandert.«
Wir waren jetzt im Wald. Der Wagen hielt an, und unser Kutscher sagte: »Ich warte hier. Gehen Sie diesen Weg entlang. Er führt geradewegs zum Fuß des Felsens. Dort steht eine große Eiche, die sogenannte Pilchereiche.«
»Zu der wollen wir«, bestätigte Monique.
»Keine halbe Meile.« Er sah auf seine Uhr. »Ich bringe Sie in, sagen wir, eineinhalb Stunden zurück.
Sie dürfen sich nicht verspäten.«
»Vielen Dank«, sagten wir und begaben uns auf den unebenen Pfad zu dem großen Felsen.
»Hier muß eine gewaltige vulkanische Eruption stattgefunden haben«, bemerkte ich. »Daraus ist der Pilcher entstanden, und viel später wuchs hier die Eiche. Samenkörner, die ein Vogel fallenließ, nehme ich an. Die meisten Bäume hier sind Tannen. Duften sie nicht köstlich?«
Wir waren fast bei der Eiche angelangt, die dicht beim Felsen wuchs. »Das muß sie sein«, sagte Lydia. Sie ließ sich fallen und streckte sich im Gras aus.
»Der Duft macht mich schläfrig.«
»Oh, dieser köstliche Wohlgeruch«, seufzte ich, kräftig schnuppernd. »Ja, er hat etwas Einschläferndes.«
»Und was machen wir jetzt?« fragte Frieda.
»Hinsetzen ... und abwarten.«
»Ich finde es albern«, meinte Frieda.
»Immerhin, es ist ein Ausflug. Tun wir so, als kauften wir Handschuhe für meine Tante Patty. Ich möchte ihr noch welche besorgen, bevor ich fortgehe.«
»Sprich nicht immer von fortgehen«, sagte Lydia.
»Das mag ich nicht.«
Frieda gähnte. »Ach ja,« gestand ich, »mir ist auch zum Gähnen.«
Ich streckte mich im Gras aus, und die anderen taten es mir nach. So lagen wir da, die Hände unter den Köpfen verschränkt, und blickten durch die Äste der Eiche nach oben.
»Ich wüßte gern, wie das war, als sie die Leute heruntergestoßen haben«, überlegte ich laut. »Stellt euch nur mal vor, ihr werdet auf den Gipfel gebracht und wißt, daß ihr heruntergeworfen werdet ... oder vielleicht sagt man euch, ihr sollt springen. Womöglich ist jemand gerade hier an dieser Stelle heruntergestürzt.«
»Du machst mir eine Gänsehaut.« Lydia schüttelte sich.
»Ich schlage vor«, meinte Frieda, »daß wir zum Wagen zurückgehen und doch noch in die Stadt fahren.«
»Diese petits fours sind zu köstlich«, sagte Monique.
»Haben wir denn noch Zeit?« fragte Frieda.
»Nein«, sagte Lydia.
»Still«, gebot ich. »Lassen wir’s auf einen Versuch ankommen.«
Wir verstummten, und just in dem Augenblick trat er durch die Bäume.
Er war groß und sehr blond. Seine stechenden blauen Augen fielen mir sogleich auf. Sie schienen jenseits von uns in Regionen zu blicken, die wir nicht sehen konnten. Vielleicht bildete ich mir das aber auch erst hinterher ein. Er war dunkel gekleidet, was seine Blondheit noch unterstrich. Sein Anzug war elegant geschnitten, aber nicht gerade nach der neuesten Mode. Sein Rock hatte einen Samtkragen und Silberknöpfe, und er trug einen schwarzen, hohen, glänzenden Hut.
Wir waren still, als er näherkam – vor Überraschung sprachlos, nehme ich an, und im Augenblick von jeglichem Schaffenbruckener Schliff verlassen.
»Guten Tag«, sagte er auf Englisch. Er verbeugte sich. Dann fuhr er fort: »Ich habe Ihr Lachen gehört und verspürte einen unwiderstehlichen Drang, Sie zu sehen.«
Wir schwiegen noch immer, und er fuhr fort: »Sie sind von der Schule, nicht wahr?«
»Ja«, antwortete ich.
»Auf einem Ausflug zum Pilcher?«
»Wir haben Rast gemacht, bevor wir zurückkehren«, erklärte ich, da es den anderen anscheinend die Sprache verschlagen hatte.
»Ein interessanter Recken«, fuhr er fort. »Haben Sie etwas dagegen, wenn ich mich ein wenig mit Ihnen unterhalte?«
»Natürlich nicht«, erwiderten wir wie aus einem Mund. Die anderen hatten sich also von ihrem Schrecken erholt.
Er ließ sich ein wenig entfernt von uns nieder und betrachtete seine langen Beine.
»Sie sind Engländerin?« fragte er mit einem Blick auf mich.
»Ja ... ich und Miss Markham. Dies hier sind Mademoiselle Delorme und Fräulein Schmidt.«
»Eine kosmopolitische Gruppe«, bemerkte er. »Ihre Schule wird von jungen Damen aus ganz Europa besucht, habe ich recht?«
»Ja, das stimmt.«
»Warum haben Sie ausgerechnet heute diesen Ausflug zum Pilcher gemacht? Sollte man das nicht lieber im Sommer tun?«
»Wir wollten ihn gern sehen«, erwiderte ich, »und ich werde sonst vermutlich keine Gelegenheit mehr dazu haben. Ich gehe Ende des Jahres von der Schule ab.«
Er hob die Augenbrauen. »So? Und die anderen jungen Damen?«
»Wir bleiben noch ein Jahr«, sagte Monique.
»Und dann kehren Sie nach Frankreich zurück?«
»Ja.«
»Sie sind alle so jung ... so vergnügt«, stellte er fest.
»Es war hübsch, Ihr Lachen zu hören. Ich fühlte mich davon angezogen und mußte mich einfach zu Ihnen gesellen. Ich wollte an Ihrer Ungezwungenheit teilhaben.«
»Wir wußten gar nicht, daß wir so anziehend sind«, sagte ich, und alle lachten.
Er blickte um sich. »Was für ein schöner Nachmittag! Fühlen Sie die Stille in der Luft?«
»Ja, ich glaube schon«, antwortete Lydia.
Er blickte zum Himmel empor. »Nachsommer«, sagte er leise. »Weihnachten fahren Sie wohl alle nach Hause?«
»Ja, Weihnachten fahren wir immer alle. Und im Sommer. Ostern, Pfingsten und so, na ja ...«
»Die Reise ist zu weit«, endete er an meiner Stelle. »Und Ihre Angehörigen werden Sie gebührend empfangen«, fuhr er fort. »Man wird für Sie Bälle und Bankette geben, und Sie werden alle heiraten und glücklich leben immerdar, ein Schicksal, wie es allen schönen jungen Damen beschieden sein sollte.«
»Was es aber nicht immer ist ... oder nicht oft«, warf Monique ein.
»Da haben wir ja eine Zynikerin. Sagen Sie«, seine Augen ruhten auf mir, »glauben Sie an das Schicksal?«
»Ich glaube, das Leben ist das, was man daraus macht«, zitierte ich Tante Patty. »Was den einen unerträglich, ist den anderen ein Trost. Es kommt darauf an, wie man es betrachtet.«
»Man bringt Ihnen in dieser Schule wahrhaftig etwas bei.«
»Das stammt aber von meiner Tante.«
»Sie haben keine Eltern.« Es war mehr eine Feststellung als eine Frage.
»Nein. Sie sind in Afrika gestorben. Meine Tante hat sich um mich gekümmert.«
»Das ist eine fabelhafte Person«, sagte Monique. »Sie leitet eine Schule. Sie ist das genaue Gegenteil von Madame Guérin. Cordelia hat es gut. Sie wird in der Schule ihrer Tante arbeiten, und eines Tages wird ihr das Institut gehören. Kann man sich Cordelia als Schulvorsteherin vorstellen?«
Er lächelte mich offen an. »Ich kann mir Cordelia als alles vorstellen, was sie zu sein wünscht. Sie ist also eine vermögende Dame?«
»Wenn Sie mich fragen, so hat sie’s von uns allen am glücklichsten getroffen«, bemerkte Monique.
Er blickte mich unverwandt an. »Ja«, sagte er, »ich glaube, Cordelia kann wahrhaftig glücklich sein.«
»Warum sagen Sie, ›sie kann‹?« fragte Frieda.
»Weil es von ihr selbst abhängt. Ist sie vorsichtig? Zögert sie, oder ergreift sie die Gelegenheiten, die sich ihr bieten?«
Die Mädchen sahen sich gegenseitig an, dann blickten sie zu mir.
»Ich würde sagen, ja«, meinte Monique.
»Die Zeit wird es an den Tag bringen«, entgegnete er.
Er hatte eine eigenartige, etwas altväterliche Art. Vielleicht lag es an seinem Englisch, das wohl nicht seine Muttersprache war, wenngleich er es fließend sprach. Ich glaubte, eine Spur von einem deutschen Akzent herauszuhören.
»Immer müssen wir warten, bis die Zeit etwas an den Tag bringt«, sagte Frieda verdrießlich.
»Was wünschen Sie denn, meine junge Dame? Einen Blick in die Zukunft zu tun?«
»Das wäre spaßig«, lachte Monique. »In der Stadt war eine Wahrsagerin. Madame de Guérin hatte es zwar verboten, aber ich glaube, ein paar sind doch hingegangen.«
»Es kann sehr aufschlußreich sein«, sagte er.
»Sie meinen ... in die Zukunft zu blicken?« kam es von Monique. Er beugte sich vor und ergriff ihre Hand. Sie stieß einen leisen Schrei aus. »Oh ... können Sie etwa die Zukunft voraussagen?«
»Die Zukunft voraussagen? Wer kann das schon? Allerdings gibt es manchmal Visionen ...«
Wir waren wie gebannt. Mein Herz klopfte wild. Diese Begegnung war überaus ungewöhnlich.
»Sie, Mademoiselle«, er sah Monique an, »werden Ihr Leben lang lachen. Sie werden in das Château Ihrer Väter zurückkehren.« Er ließ ihre Hand los und schloß die Augen. »Es liegt mitten im Land. Es ist von Weinbergen umgeben. Die Türme mit den Pechnasen reichen bis an den Himmel. Ihr Vater trifft Arrangements, die seiner Familie würdig sind. Er ist ein stolzer Mann. Werden Sie seinem Wunsch gemäß heiraten, Mademoiselle?«
Monique machte ein verblüfftes Gesicht. »Ich nehme an, ich werde Henri heiraten ... eigentlich habe ich ihn ganz gern.«
»Und etwas anderes würde Ihr Vater auch nicht zulassen. Und Sie, Fräulein, sind Sie ebenso fügsam wie Ihre Freundin?«
»Das ist schwer zu sagen«, erwiderte Frieda auf ihre nüchterne Art. »Manchmal denke ich, ich tu, was mir gefällt, und wenn ich dann zu Hause bin, ist alles ganz anders.«
Er lächelte sie an. »Sie machen sich nichts vor, und das ist im Leben ein großer Vorzug. Sie werden stets wissen, welchen Weg Sie gehen und warum – auch wenn es nicht immer der Weg Ihrer Wahl ist.«
Darauf wandte er sich an Lydia. »Ah, Miss«, fuhr er fort, »Welches ist Ihr Schicksal?«
»Das weiß der Himmel«, erwiderte Lydia. »Ich schätze, mein Vater kümmert sich mehr um meine Brüder. Die sind um einiges älter als ich und glauben immer, Knaben seien wichtiger.«
»Sie werden ein schönes Leben haben«, erklärte er ihr.
Lydia lachte. »Es ist fast, als sagten Sie uns unser Schicksal voraus.«
»Ihr Schicksal bestimmen Sie selbst«, erwiderte er.
»Ich habe lediglich ein gewisses ... wie soll ich sagen ... Feingefühl.«
»Jetzt ist Cordelia an der Reihe«, rief Monique.
»Cordelia?«
»Sie haben ihr noch nichts gesagt ... was aus ihr wird.«
»Ich habe gesagt«, entgegnete er freundlich, »daß das von Cordelia selbst abhängt.«
»Aber haben Sie ihr denn nichts zu sagen?«
»Nein. Cordelia wird Bescheid wissen ... wenn die Zeit reif ist.«
Wir verstummten. Das Schweigen des Waldes hüllte uns ein. Über uns ragte der grotesk geformte Felsen auf, der mit einiger Phantasie durchaus bedrohliche Züge annehmen konnte.
Dann ergriff Monique das Wort. »Es ist ziemlich unheimlich hier«, sagte sie schaudernd.
Plötzlich durchbrach ein Laut die Stille. Es war der Ruf des Fuhrmanns.
Seine Stimme schien auf dem Berg aufzutreffen und hallte durch den Wald wider.
»Wir hätten schon vor zehn Minuten aufbrechen müssen«, stellte Frieda fest. »Wir müssen uns sputen.«
Wir sprangen auf. »Auf Wiedersehen«, sagten wir zu dem Fremden.
Dann machten wir uns auf den Weg. Nach ein paar Sekunden blickte ich zurück. Der Fremde war verschwunden.
Wir kamen zu spät zurück, aber keiner sagte etwas, und niemand verlangte die Handschuhe zu sehen, die wir angeblich in der Stadt gekauft hatten.
Nach dem Abendessen kam Elsa in unser Zimmer. Es war die halbe Stunde vor dem Gebet, wonach wir uns für die Nacht zurückzogen.
»Na«, fragte Elsa, »habt ihr etwas gesehen?« Ihre Augen glitzerten vor Neugier.
»Da war etwas«, gab Frieda zu.
»Etwas?«
»Ja doch, ein Mann«, ergänzte Monique.
»Je mehr ich darüber nachdenke«, fügte Lydia hinzu, »um so merkwürdiger kommt er mir vor.«
»Erzählt schon«, rief Elsa, »erzählt doch.«
»Also, wir saßen dort ...«
»Lagen«, sagte Frieda, die Wert auf genaue Details legte.
»Unter dem Baum ausgestreckt«, fuhr Lydia ungeduldig fort, »als er plötzlich da war.«
»Du meinst, er ist erschienen?«
»So könnte man es nennen.«
»Wie sah er aus?«
»Gut. Eigentümlich ...«
»Weiter, weiter ...«
Wir schwiegen alle, während wir uns bemühten, uns zu erinnern, wie er ausgesehen hatte.
»Was ist denn mit euch los?« wollte Elsa wissen.
»Nun ja, es ist schon ziemlich merkwürdig, wenn man es recht bedenkt«, sagte Monique. »Ist euch aufgefallen, daß er von uns allen was wußte? Er hat das Château mitsamt Weinbergen und Türmen genau beschrieben.«
Frieda bemerkte trocken: »Viele Châteaux in Frankreich haben eigene Weinberge und Türme mit Pechnasen.«
»Ja«, gab Monique zu, »und doch ...«
»Ich glaube, am meisten hat ihn Cordelia interessiert«, verkündete Lydia.
»Wie kommst du darauf?« wollte ich wissen. »Er hat mir nichts gesagt.«
»Na ja, so wie er dich angeguckt hat ...«
»Ihr erzählt mir ja gar nichts«, beklagte sich Elsa.
»Ich hab’ euch dahin geschickt, vergeßt das nicht. Ich hab’ ein Recht zu erfahren, was los war.«
»Ich sag’ dir, was geschehen ist«, ließ sich Frieda vernehmen. »Wir waren so dumm, in den Wald zu gehen, statt uns in der Stadt an den köstlichen petits fours gütlich zu tun ... und weil wir so dumm waren, wollten wir unbedingt, daß etwas geschah. Es passierte aber nichts weiter, als daß ein Mann auftauchte, der sagte, er habe uns lachen hören und wolle sich ein Weilchen mit uns unterhalten.«
»Das sieht Frieda ähnlich, alles fein säuberlich zu erklären«, stellte Lydia fest. »Ich für mein Teil bin überzeugt, daß mehr dahintersteckt.«
»Ich wette, er ist der zukünftige Ehemann von einer von euch«, sagte Elsa. »So lautet die Sage.«
»Wenn du daran glaubst, warum bist du dann nicht mitgekommen, um deinen Zukünftigen zu sehen?« fragte ich.
»Ich konnte doch nicht weg. Ich werde beobachtet. Sie haben mich im Verdacht, daß ich mich vor der Arbeit drücke.«
»Sei beruhigt«, spottete Frieda, »dieser Verdacht wird sich bald bestätigen.«
Elsa lachte mit uns. Wenigstens sie war mit dem Ausflug zufrieden.
Den ganzen November schmiedeten wir Pläne für die Heimreise. Mir war sonderlich zumute. Einesteils widerstrebte es mir, allen Lebewohl sagen zu müssen, doch andererseits freute ich mich auf zu Hause. Monique, Frieda und Lydia sagten, wir müßten in Verbindung bleiben. Lydia wohnte in London, aber ihre Familie besaß ein Landhaus in Essex. Dort verbrachte sie meistens ihre Ferien, so daß wir nicht allzuweit voneinander entfernt sein würden.
Noch Tage nach jener Begegnung im Wald sprachen wir viel über unser Abenteuer am Pilcherberg. Wir hatten es rasch in ein unheimliches Erlebnis verwandelt und den Fremden mit allen möglichen Absonderlichkeiten ausgestattet. Laut Monique hatte er stechende Augen mit dem Widerschein eines unirdischen Lichtes. Sie bauschte auf, was er ihr erzählt hatte, und glaubte allmählich, daß er ihr eine akkurate, minuziöse Beschreibung vom Château ihres Vaters geliefert habe. Lydia behauptete, ihr seien Schauder über den Rücken gelaufen, und sie sei überzeugt, daß er kein menschliches Wesen gewesen sei.
»Unsinn«, meinte Frieda, »er machte einen Spaziergang im Wald, als er auf uns traf und dann eine kleine Unterhaltung mit uns kichernden Mädchen führte.«
Ich wußte nicht recht, was ich denken sollte, und wenn mir auch klar war, daß diese Begegnung beträchtlich ausgeschmückt worden war, so hatte sie dennoch einen tiefen Eindruck auf mich gemacht.
Die Schulferien begannen Ende der ersten Dezemberwoche. Da die meisten von uns eine weite Reise vor sich hatten, sorgte Madame de Guérin stets dafür, daß wir abreisten, bevor dichter Schnee die Straßen unpassierbar machte.
Sieben Mädchen aus England reisten zusammen. Fräulein Mainz brachte uns zum Zug, und es war so arrangiert, daß uns in Calais jemand von einer Reiseagentur auf die Fähre begleitete. In Dover würden wir dann von unseren Angehörigen abgeholt werden.
Ich hatte die Reise schon mehrmals gemacht, aber da dies das letzte Mal war, kam uns alles ganz anders vor.
Wir hatten ein Abteil für uns allein. Die Jüngeren brachen, wie wir auf früheren Reisen, angesichts der Großartigkeit der Bergwelt in Ahs und Ohs aus und blieben am Fenster, während wir durch die majestätische Schweizer Landschaft fuhren. Auf die älteren – darunter auch Lydia und ich – machte das keinen Eindruck mehr.
Die Fahrt erschien endlos; wir redeten, wir lasen, machten Spiele, nickten ein.
Die meisten waren eingeschlummert. Als ich zufällig in den Gang hinausblickte, sah ich einen Mann vorbeigehen. Er warf einen Blick in unser Abteil. Mir stockte der Atem. Er schien mich anzusehen, aber ich war nicht sicher, ob er mich erkannte. Binnen Sekunden war er vorüber.
Ich drehte mich zu Lydia um, die schlafend neben mir saß, sprang auf und trat in den Gang. Von dem Mann war nichts zu sehen.
Ich kehrte auf meinen Platz zurück und stieß Lydia an. »Ich ... ich hab’ ihn gesehen«, flüsterte ich.
»Was hast du gesehen?«
»Den Mann ... den Mann im Wald ...«
»Du träumst«, sagte Lydia.
»Nein. Ich bin ganz sicher. Er war wie der Blitz verschwunden.«
»Warum hast du ihn nicht angesprochen?«
»Er war zu schnell vorüber. Ich bin hinterhergegangen, aber er war verschwunden.«
»Du hast geträumt«, murmelte Lydia und schloß die Augen wieder.
Ich war aufgewühlt. Konnte es sich um eine Erscheinung gehandelt haben? Es war so schnell vorüber. Er war dagewesen ... und dann war er weg. Er muß sich sehr geschwind den Gang entlang bewegt haben. War es wirklich der Mann gewesen, oder hatte ich geträumt? Vielleicht hatte Lydia recht.
Ich hielt während der Weiterfahrt nach Calais nach ihm Ausschau, aber er war nicht da.
Der Zug kam wegen Schneetreibens mit acht Stunden Verspätung in Calais an. Das bedeutete, daß wir die Nachtfähre nehmen mußten. Es war gegen zwei Uhr morgens, als wir an Bord gingen.
Lydia fühlte sich nicht wohl; ihr war kalt und ein wenig übel. Sie hatte unten ein Plätzchen gefunden, wo sie sich in eine Decke hüllen und hinlegen konnte. Ich hatte das Bedürfnis nach frischer Luft und sagte ihr, ich werde an Deck gehen. Ich ließ mir eine Decke geben und nahm mir einen Stuhl. Sicher, eswar kalt, aber unter meiner Decke war mir recht behaglich. Lydia hätte gewiß klüger daran getan, mit mir nach oben zu kommen, statt sich im unbelüfteten Teil des Schiffes aufzuhalten.
Ein blasser Halbmond schien, und an dem klaren Nachthimmel waren Myriaden von Sternen zu sehen. Nicht weit entfernt hörte ich die Stimmen der Mannschaft, und ich genoß das sanfte Schaukeln des Schiffes. Es ging kein Wind, und ich rechnete nicht mit einer rauhen Überfahrt.
Ich dachte an die Zukunft. Mit Tante Patty würde es stets Spaß geben. Ich stellte mir lange gemütliche Abende am Kaminfeuer im Wohnzimmer vor, während sie heiße Schokolade trank und Makronen knabberte, für die sie eine besondere Vorliebe hegte. Wir würden über die Geschehnisse des Tages lachen, denn mit ihr würde es immer etwas zum Lachen geben. O ja, ich freute mich darauf.
Schläfrig schloß ich die Augen. Die Reise war ermüdend gewesen, und beim Einschiffen hatte es viel Wirbel gegeben. Ich durfte jedoch nicht fest einschlafen, weil ich zurück zu Lydia mußte, bevor das Schiff anlegte.
Ich nahm eine schwache Bewegung an meiner Seite wahr und öffnete die Augen. Ein Stuhl war leise verrückt worden und stand nun mitsamt seinem Insassen neben mir.
»Haben Sie etwas dagegen, wenn ich mich zu Ihnen setze?«
Mein Herz begann wild zu hämmern. Dieselbe Stimme. Dasselbe Flair, als sei er nicht ganz von dieser Welt. Es war der Mann aus dem Wald.
Einen Augenblick war ich so erschrocken, daß ich nicht sprechen konnte.
Der Mann sagte: »Ich werde still sein, wenn Sie schlafen möchten.«
»O nein ... nein ... Sie sind ... Sie sind es doch?«
»Wir sind uns schon einmal begegnet«, begann er.
»Waren ... waren Sie im Zug?«
»Ja.«
»Ich sah Sie am Fenster vorbeigehen.«
»Ja.«
»Wollen Sie nach England?«
Eine alberne Frage. Wo hätte er auf der Kanalfähre denn sonst hinwollen?
»Ja«, erwiderte er. »Ich bin sicher, daß wir uns während meines Aufenthaltes dort sehen werden.«
»O ja. Es wäre mir ein Vergnügen. Sie müssen uns besuchen. Grantley Manor, Canterton, Sussex. Nicht weit von Lewes. Es ist ganz leicht zu finden.«
»Ich werde es nicht vergessen«, sagte er. »Wir werden uns wiedersehen.«
»Sind Sie auf dem Weg nach Hause?«
»Ja.«
Ich wartete, aber er sagte mir nicht, wohin. Er hatte etwas Zurückhaltendes, etwas, das mich warnte, Fragen zu stellen.
»Sie freuen sich gewiß auf Ihre Frau Tante.«
»O ja.«
»Sie ist anscheinend eine recht großzügige Dame.«
»Großzügig? Ja, das ist sie wohl. Sie ist warmherzig und liebenswert, und ich glaube nicht, daß sie jemals jemandem etwas Böses gewünscht hat. Sie hat Witz und Humor, dabei ist sie aber nie verletzend ... es sei denn, jemand verletzt sie oder die, die ihr nahestehen. Dem würde sie es genüßlich heimzahlen. Sie ist ein wunderbarer Mensch.«
»Sie hängen offenbar sehr an ihr.«
»Sie war mir eine Mutter, als ich sie nötig hatte.«
»Sichtlich eine einzigartige Persönlichkeit.« Nach kurzem Schweigen fuhr er fort: »Erzählen Sie mir von sich.«
»Sie möchten wohl nicht gern über sich reden«, gab ich zurück.
»Später. Jetzt sind Sie an der Reihe.«
Das war wie ein Befehl, und im Nu sprach ich von meiner Kindheit, und mir fielen Dinge ein, die ich bis zu diesem Augenblick vergessen wähnte. Ich erinnerte mich an Geschehnisse in Afrika, an die scheinbar endlosen Stunden in der Halle des Missionsgebäudes, an Hymnengesang, Gebete, kleineschwarze Kinder, die im Staub spielten, an die bunten Perlen, die ihnen um Hals und Taille baumelten, an fremdartige Insekten, die wie Stäbe aussahen und ebenso bösartig waren wie die Schlangen, die durch das Gras glitten, und vor denen man sich in acht nehmen mußte. Vor allem aber sprach ich von Tante Patty und der Villa und der Schule, und wie ich mich darauf freute, dort zu unterrichten.
»Sie sind bestens dazu geeignet«, meinte der Mann.
»O ja, dafür hat Tante Patty gesorgt. Ich wurde in zahlreichen Fächern ausgebildet, und dann ging ich nach Schaffenbrucken, um den letzten Schliff zu erhalten, wie Tante Patty es ausdrückt.«
»Eine sehr kostspielige Schule. Tante Patty muß eine vermögende Dame sein, wenn sie sich leisten kann, ihre Nichte dorthin zu schicken.«
»Ich glaube, sie betrachtet es eher als lohnende Anlage.«
»Erzählen Sie mir von der Villa«, bat er.
Ich beschrieb ihm Zimmer für Zimmer und die Umgebung. Das Grundstück war zwanzig Morgen groß. »Wir haben eine Pferdekoppel, Ställe und Sportplätze.«
»Es scheint sehr weitläufig zu sein.«
»Die Schule hat einen guten Ruf. Tante Patty ist stets bemüht, ihn noch zu verbessern.«
»Ihre Tante Patty gefällt mir.«
»Man kann gar nicht anders.«
»Anhängliche Miss Cordelia.«
Er lehnte sich zurück und schloß die Augen. Ich hielt dies für ein Anzeichen, daß er eine Weile nicht sprechen wolle. Daher schwieg ich auch.
Das Schaukeln des Schiffes war beruhigend, und da ich sehr müde und es mitten in der Nacht war, verfiel ich in einen leichten Schlummer. Plötzlich wurde ich von geschäftigen Geräuschen geweckt. Vor mir konnte ich die Küste erkennen. Ich wandte mich zu meinem Begleiter um. Es war niemand da. Sein Stuhl und seine Decke waren verschwunden. Ich stand auf und sah mich um. Es waren nicht viele Leute an Deck, und von dem Mann war nichts zu sehen. Ich ging zu Lydia hinunter.
Tante Patty erwartete mich am Kai. Sie sah noch rundlicher aus, als ich sie in Erinnerung hatte. Ihr Hut war ein Gedicht – mit Rüschen aus blauen Bändern und einer Schleife, so breit wie sie selbst.
Sie drückte mich liebevoll an sich. Ich stellte ihr Lydia vor, die sich nicht enthalten konnte zu sagen: »Sie sieht genau so aus, wie du sie beschrieben hast.«
»Hast wohl in der Schule Klatschgeschichten über mich verbreitet, was?« argwöhnte Tante Patty.
»Sie hat nur Gutes über Sie erzählt«, erklärte Lydia. »Sie hat in uns allen den Wunsch geweckt, auf ihre Schule zu gehen.«
Ich wurde flüchtig der Frau vorgestellt, die Lydia abholen gekommen war. Sie war wohl eine Art Haushälterin, und ich war glücklich, daß Tante Patty mich persönlich abgeholt hatte.
Tante Patty und ich setzten uns in den Zug. Wir plauderten ohne Unterlaß.
Ich sah mich nach dem Fremden um, aber er war nirgends zu sehen. Es wimmelte von Menschen, und es hätte schon wundersam zugehen müssen, wenn ich ihn hätte entdecken können; doch ich hätte zu gern gewußt, wohin er wollte.
In Canterton – der Bahnhof war kaum mehr als eine Haltestelle – nahmen wir eine Droschke und waren in kürzester Zeit zu Hause. Ich war wie immer nach längerer Abwesenheit vom Anblick von Grantley Manor gerührt. Der rote Backsteinbau mit den Gitterfenstern wirkte eher anmutig denn herrschaftlich, vor allem aber wirkte er anheimelnd.
»Liebes altes Haus«, sagte ich.
»Du hast es gern, nicht wahr?«
»Natürlich. Ich weiß noch, wie ich es zum erstenmal sah ... damals wußte ich gleich, daß alles gut werden würde, weil ich dich hatte.«
»Gott segne dich, mein Kind. Aber glaube mir, Backstein und Mörtel ergeben noch kein Heim. Das findest du nur dort, wo du die Menschen findest, die dir ein Heim schaffen.«
»Wie du, Tante Patty. Die Mädchen hören ausgesprochen gern von dir ... von den Makronen, den Hüten und allem. Sie nennen dich Tante Patty, als wärest du auch ihre Tante. Am liebsten würde ich dann sagen, ›Nun hört aber auf. Sie ist meine Tante.‹«
Wie schön es war, in die Diele zu treten, das Bienenwachs und das Terpentin zu riechen, das immer an den Möbeln haftete und sich mit den Küchengerüchen jenseits der Trennwand mischte.
»Eine komische Zeit zum Ankommen ist das. Es ist kurz nach Mittag. Bist du müde?«
»Eigentlich nicht. Bloß aufgeregt, weil ich wieder zu Hause bin.«
»Später wirst du bestimmt müde. Am besten, du ruhst dich heute nachmittag aus. Danach möchte ich mit dir reden.«
»Natürlich. Dies ist der große Augenblick. Ich habe Schaffenbrucken Lebewohl gesagt.«
»Ich bin froh, daß du dort warst, Cordelia. Es wird sich als ein Segen erweisen.«
»Und die Schülerinnen werden nur so herbeiströmen.«
Tante Patty hüstelte leise und sagte: »Du wirst die Mädchen bestimmt vermissen, und die Berge und alles.«
»Am meisten hab’ ich dich vermißt, Tante Patty.«
»Ach, Unsinn«, sagte sie, doch sie war zutiefst gerührt.
Wäre ich nicht wegen des Fremden ein wenig verwirrt gewesen, wäre mir vielleicht aufgefallen, daß Tante Patty anders war als sonst. Es war fast unmerklich, aber ich kannte meine Tante ja so gut. Dann hätte ich mich womöglich gefragt, ob sie nicht eine Spur weniger überschwenglich als üblich sei.
Ich erhielt allerdings einen Hinweis von Violet Barker, Tante Pattys Haushälterin, Gesellschafterin und ergebener Freundin, die schon bei ihr gewesen war, als ich vor vielen Jahren zu ihr kam. Violet war ziemlich knochig und hager – das genaue Gegenteil von Tante Patty. Sie paßten fabelhaft zusammen. Violet hatte mit der Unterrichtung der Schülerinnen nichts zu schaffen, sondern sie führte fachkundig den Haushalt und war ein wichtiger Bestandteil des Anwesens.
Violet betrachtete mich dermaßen eindringlich, daß ich dachte, Tante Patty müsse so ernsthaft vom Schaffenbruckener Schliff gesprochen haben, daß Violet versuchte, ihn wahrzunehmen. Dann sagte sie unvermittelt: »Es ist das Dach. Sie sagen, es muß innerhalb der nächsten zwei Jahre gerichtet werden. Und das ist noch nicht alles. Die Westwand muß abgestützt werden. Bis jetzt hatten wir einen feuchten Winter. Das macht deiner Tante Sorgen. Hat sie etwas gesagt?«
»Nein. Ich bin ja auch eben erst nach Hause gekommen.«
Violet nickte und preßte die Lippen fest zusammen. Ich hätte ahnen können, daß etwas nicht stimmte.
Als Tante Patty, Violet und ich abends nach dem Essen gegen halb neun im Wohnzimmer saßen, erzählte sie es mir. Mir stockte der Atem, und ich glaubte, ich hätte nicht richtig gehört, als sie sagte:
»Cordelia, ich habe das Haus verkauft.«
»Tante Patty! Was soll das heißen?«
»Ich hätte dich darauf vorbereiten sollen. Die Umstände waren in den letzten drei Jahren nicht gerade günstig.«
»Ach, Tante Patty.«
»Mein liebes Kind, mach nicht so ein betrübtes Gesicht. Alles wird sich zum Besten wenden, dessen bin ich sicher. Es tut mir leid, daß ich dich vor vollendete Tatsachen stellen muß. Aber es ging nicht anders, nicht wahr, Vi? Wir haben hin und her überlegt, und dann bekamen wir dieses Angebot. Sieh dir nur mal das Dach und die Westwand an. Man muß ein Vermögen in das Haus stecken. Die Zeiten waren nicht gut in den letzten Jahren. Ich habe viele Schulden gemacht.«
Das hatte ich geahnt. Ich wußte, daß die Eltern von wenigstens drei ihrer Schülerinnen das Schulgeld kaum aufbringen konnten. »Alles gescheite Mädchen«, pflegte Tante Patty zu sagen. »Gereichen der Schule zur Ehre.« Es waren harte Zeiten. Verwässerte Suppe kam für Grantley nicht in Frage. Ich hatte mich oft gefragt, wie sie mit dem Schulgeld, das sie verlangte, zurechtkäme, aber da sie die Angelegenheit nie erwähnte, nahm ich an, alles sei in Ordnung.
»Was machen wir jetzt?« fragte ich.
Tante Patty brach in Lachen aus. »Wir schieben unsere Sorgen beiseite und genießen das Leben, nicht wahr, Violet?«
»Wie du meinst, Patty.«
»Ja«, sagte Tante Patty, »Tatsache ist, daß ich seit einiger Zeit daran gedacht habe, mich zur Ruhe zu setzen. Ich hätte es schon längst getan, wenn ...«
Sie sah mich an, und ich ergänzte: »Wenn ich nicht gewesen wäre. Du wolltest alles für mich bewahren.«
»Ich sah deine Zukunft darin. Ich gedachte mich zurückzuziehen und nur noch als Ratgeberin oder dergleichen tätig zu sein, falls ich gewünscht würde. Deshalb habe ich dich nach Schaffenbrucken geschickt.«
»Du hast mich auf diese teure Schule geschickt, obwohl du bereits in finanziellen Schwierigkeiten warst.«
»Das habe ich für unsere Zukunft getan. Leider haben sich die Dinge anders entwickelt. Es wären enorme Aufwendungen für Reparaturen erforderlich gewesen. Das hätte mich ruiniert. Na ja, nicht ganz, aber es hätte einen Ausweg unmöglich gemacht. So aber ergab sich die Gelegenheit, und ich beschloß zu verkaufen.«
»Bleibt es eine Schule?«
»Nein. Irgendein Millionär möchte das Haus restaurieren und sich als Gutsherr niederlassen.«
»Tante Patty, und was wird aus uns?«
»Es ist alles arrangiert, Liebes. Höchst zufriedenstellend. Wir haben ein bezauberndes Haus in Moldenbury ... in der Nähe von Nottingham. Das ist ein hübsches Dorf mitten auf dem Land. Das Haus ist freilich nicht so groß wie Grantley, und ich kann nur Mary Ann mitnehmen. Ich hoffe, das übrige Personal kann von den neuen Eigentümern von Grantley übernommen werden. Die Eltern haben alle Bescheid bekommen. Wir schließen im Frühjahr. Das ist beschlossene Sache.«
»Und das Haus – wo ist das? In Moldenbury?«
»Wir verhandeln noch deswegen. Es wird binnen kurzem in unsere Hände übergehen. Alles ist zur gegenseitigen Zufriedenheit geregelt. Wir werden genug zum Leben haben, bescheiden vielleicht, aber ausreichend für unsere Bedürfnisse. Wir werden uns dem Landleben hingeben und allen möglichen Beschäftigungen nachgehen, für die wir bisher nie Zeit hatten. Wir werden uns mit heiterem Gemüt anpassen, wie ich immer zu Violet sage.«
Ich sah Violet an. Sie war nicht so optimistisch wie meine Tante, allerdings gehörte Optimismus nicht gerade zu Violets hervorstechenden Eigenschaften.
»Liebe Tante Patty«, sagte ich. »Du hättest es mir sagen sollen. Du hättest mich nicht weiter auf diese Schule gehen lassen dürfen. Das muß sündhaft teuer gewesen sein.«
»Ich pflege Nägel mit Köpfen zu machen und werfe nicht wegen einer Lappalie die Flinte ins Korn, und wenn etwas die Mühe wert ist, dann ist es auch wert, anständig zu Ende geführt zu werden. Ich habe es mit dir ganz richtig gemacht, Cordelia. Schaffenbrucken war gewiß keine Verschwendung. Später erzähle ich dir mehr. Ich zeige dir die Bücher, dann siehst du selbst, wie die Dinge stehen. Ich muß mit dir auch über unser neues Heim sprechen. Wir werden es besichtigen, bevor das nächste Halbjahr beginnt. Es wird dir gefallen. Das kleine Dorf macht einen netten Eindruck. Ich habe schon Bekanntschaft mit dem Pfarrer gemacht. Das scheint ein bezaubernder Herr zu sein. Und seine Frau heißt uns wärmstens willkommen. Ich glaube, wir werden uns recht wohl fühlen.«
»Eher anders«, murrte Violet.
»Veränderung hat immer ihren Reiz«, sagte Tante Patty. »Ich finde, wir bewegen uns schon viel zu lange auf demselben Gleis. Ein neues Leben, Cordelia. Eine Herausforderung. Wir werden zum Wohle unseres neuen Dorfes wirken ... Festlichkeiten, Basare, Veranstaltungen. Es wird bestimmt ein interessantes Leben.«
Sie glaubte daran. Das war das Großartige an Tante Patty. Sie betrachtete alles als amüsant, aufregend und herausfordernd, und sie hatte mich stets überzeugen können, was ihr bei Violet nicht gelang. Tante Patty und ich sagten immer, daß Violet sich am Mißgeschick weidete.
Ich ging sehr verwirrt zu Bett. Hunderte von Fragen gingen mir durch den Kopf. Die Zukunft wirkte im Augenblick recht verschwommen.
Am nächsten Tag erfuhr ich mehr von Tante Patty. Mit der Schule sei es seit einiger Zeit bergab gegangen, erklärte sie mir. Vielleicht verlangte sie nicht genug Schulgeld; sie hatte, wie ihre Vermögensberater ihr vorhielten, zuviel für Essen und Heizmaterial ausgegeben, und der Betrag für diese kostspieligen Posten stand in keinem Verhältnis zu den Einnahmen.
»Ich wollte keine armselige Schule. Meine Schule sollte eben genauso sein, wie ich sie haben wollte, und wenn das nicht möglich ist, dann verzichte ich lieber ganz. Und soweit ist es nun gekommen, Cordelia. Ich kann nicht behaupten, daß es mir leid tut. Ich wollte dir die Schule vererben, aber es ist sinnlos, ein Unternehmen zu vererben, das auf den Bankrott zusteuert. Nein, man muß die Verluste so gering wie möglich halten, sagte ich mir. Und genau das tue ich jetzt. In unserem neuen Heim werden wir uns eine Weile ausruhen und überlegen, was wir als nächstes anfangen.«
Bei ihr hörte sich alles wie der Aufbruch in ein neues aufregendes Abenteuer an, und ich ließ mich von ihrer Begeisterung anstecken.
Am Nachmittag, als der Unterricht in vollem Gange war, machte ich einen Spaziergang. Ich brach gegen zwei Uhr auf und beabsichtigte kurz nach vier, vor dem Dunkelwerden, zurück zu sein. Die Schule ging nächste Woche zu Ende, und danach würde es nur noch ein einziges Halbjahr geben. Es würde Aufbruchsstimmung und Getriebe herrschen; die Lehrerinnen würden Reisen für die Schülerinnen arrangieren und sie zum Bahnhof begleiten, genau wie in Schaffenbrucken. Viele Lehrerinnen fragten sich bestimmt besorgt, wie ihre nächste Stellung sein würde. Nicht viele würden eine Vorgesetzte finden, die so heiter war wie Tante Patty. Eine melancholische Stimmung lag über dem Haus. Schülerinnen wie Lehrerinnen hatten sich in der Atmosphäre von Grantley Manor wohl gefühlt.
Ohne Tante Pattys Beteuerungen, wie herrlich alles werden würde, kam auch in mir Melancholie auf. Ich versuchte mir meine Zukunft vorzustellen. Ich konnte nicht mein ganzes Leben in einem Dorf zubringen, auch nicht, wenn Tante Patty bei mir war. Irgendwie hatte ich den Eindruck, daß auch Tante Patty überzeugt war, daß mir das nicht lag. Ich hatte bemerkt, wie ihr Blick grübelnd auf mir ruhte, recht geheimnisvoll, als habe sie noch etwas in petto, das sie zu unser aller Verwunderung aus dem Ärmel schütteln würde.
Meinen ersten Spaziergang nach meiner Rückkehr genoß ich jedesmal. Meistens ging ich in das Städtchen Canterton, blickte in die Geschäfte und schwatzte mit den Leuten, die ich kannte. Das war jedesmal ein Vergnügen. Heute war es anders. Ich verspürte kein Bedürfnis, mit den Leuten zu reden, denn ich hatte keine Ahnung, wieviel ihnen von Tante Pattys Umzug bekannt war, und mochte mich nicht über etwas unterhalten, von dem ich selbst nichts Näheres wußte.
Ich gelangte an den Waldrand. Dieses Jahr wuchsen eine Menge Beeren an den Stechpalmen. Die Mädchen würden sie bald pflücken, denn die letzte Woche vor den Ferien war dem Weihnachtsfest gewidmet. Sie hatten bereits den Weihnachtsbaum im Aufenthaltsraum geschmückt und die Geschenke darunter gelegt. In der Kapelle würde dann ein Konzert mit Weihnachtsliedern stattfinden. Zum letzten Mal ... Eine traurige Redewendung.
Die blasse Wintersonne wurde vorübergehend zwischen den Wolken sichtbar. Frost lag in der Luft, dennoch war es mild für diese Jahreszeit. Es waren nicht viele Menschen unterwegs. Niemandem war ich begegnet, seit ich die Villa verlassen hatte. Beim Anblick des Waldes fragte ich mich, ob die Mädchen dieses Jahr viele Mistelzweige finden würden. Gewöhnlich mußten sie eifrig danach suchen, was sie um so kostbarer erscheinen ließ. Sie machten ein großes Aufhebens darum, die Zweige an den Stellen anzubringen, wo die Mädchen ergriffen und geküßt werden konnten – sofern ein männliches Wesen in die Nähe kam, das Lust dazu verspürte.
Am Waldrand zögerte ich. Gerade als ich mich entschlossen hatte, den Rückweg anzutreten, hörte ich Schritte hinter mir, und ehe ich mich umdrehte, wußte ich, wer es war.
»Wie?« rief ich. »Sie hier?«
»Ja«, lächelte er. »Sie sagten mir, daß Sie in Canterton wohnen, deshalb wollte ich es mir mal ansehen.« »Sind Sie ... hier abgestiegen?«
»Vorübergehend«, erwiderte er.
»Auf dem Weg nach ...«
»Anderswo. Ich gedachte Sie aufzusuchen, aber ich hoffte Sie vorher zu treffen, damit ich fragen konnte, ob mein Besuch genehm sei. Ich bin an der Villa vorbeigekommen. Ein hübsches altes Haus.«
»Sie hätten hereinkommen sollen.«
»Vorher wollte ich mich vergewissern, daß Ihre Frau Tante mich empfangen möchte.«
»Aber das hätte sie mit dem größten Vergnügen getan.«
»Immerhin«, fuhr er fort, »sind wir uns nicht offiziell vorgestellt worden.«
»Wir sind uns viermal begegnet, wenn man das eine Mal im Zug mitzählt.«
»Ja«, sagte er langsam, »ich habe das Gefühl, als wären wir alte Freunde. Gewiß wurden Sie daheim wärmstens willkommen geheißen?«
»Tante Patty ist ein Schatz.«
»Sie hängt offenbar sehr an Ihnen.«
»Ja.«
»Es war also eine überglückliche Heimkehr?«
Ich zögerte.
»Nicht?« fragte er.
Ich schwieg ein paar Sekunden, und er sah mich ein wenig besorgt an. Dann meinte er: »Wollen wir durch den Wald wandern? Ich finde ihn in dieser Jahreszeit besonders schön. Die Bäume sind so hübsch ohne Blätter, finden Sie nicht? Schauen Sie nur, was für ein Muster so ein Baum gegen den Himmel bildet.«
»Ja, wahrhaftig. Im Winter ist es hier noch schöner als im Sommer. Eigentlich ist dies gar kein richtiger Wald. Eher ein Hain mit Baumgruppen, höchstens eine Viertelmeile tief.«
»Lassen Sie uns trotzdem zwischen den schönen Bäumen wandern. Dabei können Sie mir erzählen, wieso Ihre Heimkehr nicht so war wie sonst.«
Ich zögerte immer noch, und er sah mich mit leicht vorwurfsvoller Miene an. »Mir können Sie vertrauen«, sagte er. »Bei mir sind Ihre Geheimnisse gut aufgehoben. Kommen Sie, sagen Sie mir, was Sie bedrückt.«
»Alles war ganz anders, als ich erwartet hatte. Tante Patty hatte mir überhaupt keine Andeutung gemacht.«
»Keine Andeutung?«
»Daß nicht alles so war, wie es hätte sein sollen. Sie ... Sie hat Grantley Manor verkauft.«
»Das schöne Haus? Und was ist mit dem florierenden Unternehmen?«
»Offenbar hat es nicht floriert. Ich war wie erschlagen. Man nimmt diese Dinge so selbstverständlich hin, und Tante Patty hat niemals eine Andeutung gemacht, daß wir ärmer würden.«
Plötzlich schien ein kalter Luftzug durch den Wald zu wehen. Der Mann war stehengeblieben und sah mich zärtlich an. »Mein armes Kind«, sagte er.
»Ach, so schlimm ist es wieder auch nicht. Wir werden nicht verhungern. Tante Patty meint, es wendet sich alles zum Guten. Aber so ist sie ja immer.« »Erzählen sie ... wenn Sie möchten.«
»Ich weiß nicht, warum ich mit Ihnen darüber spreche – es ist wohl, weil Sie so teilnahmsvoll wirken. Sie erscheinen einfach, zuerst im Wald, dann auf dem Schiff und jetzt ... Sie kommen mir ziemlich mysteriös vor.«
Er lachte. »Das macht es Ihnen um so leichter, sich mir anzuvertrauen.«
»Ja, schon möglich. Ich hatte gar keine rechte Lust, in die Stadt zu gehen, weil ich nicht mit den Leuten dort reden wollte, die uns seit Jahren kennen.«
»Fein, reden Sie lieber mit mir.«
Ich erzählte ihm, daß Tante Patty die Villa verkaufen mußte, weil der Unterhalt zu kostspielig war, und daß wir in ein kleines Haus in einer anderen Gegend ziehen würden.
»Was werden Sie tun?«
»Ich weiß es nicht. Wir haben dieses Häuschen gemietet, irgendwo in Mittelengland, glaube ich. Ich weiß noch nicht viel darüber. Tante Patty findet es anscheinend nicht übel, aber ich merke, daß Violet – das ist ihre Freundin, die bei uns lebt – schon sehr verstört ist.«
»Das kann ich verstehen. Welch furchtbarer Schlag für Sie! Ich versichere Sie meines tiefsten Mitgefühls. Sie schienen so fröhlich, als ich Sie mit Ihren Freundinnen im Wald sah, und ich hatte den Eindruck, daß die anderen Sie ein wenig beneideten.«
Wir wanderten über das verfärbte Gras, und die Wintersonne blinkte durch die kahlen Zweige der Bäume. Die Luft war erfüllt vom Geruch feuchter Erde und Laubwerks, und ich hatte unwillkürlich das Gefühl, daß sich etwas Bedeutendes ereignen würde, weil dieser Mann bei mir war. Ich sagte: »Wir haben genug über mich gesprochen. Jetzt erzählen Sie mir von sich.«
»Das würden Sie nicht sehr interessant finden.«
»O doch, ganz gewiß. Sie haben so eine Art zu ... erscheinen. Das ist wirklich sehr faszinierend. Wie Sie im Wald plötzlich bei uns waren ...«
»Ich machte einen Spaziergang.«
»Es war so seltsam, daß Sie dort waren, und dann im Zug und auf der Fähre ... und jetzt hier.«
»Ich bin hier, weil es auf meinem Weg lag, und da dachte ich, ich schaue mal bei Ihnen herein.«
»Auf Ihrem Weg wohin?«
»Nach Hause.«
»Dann leben Sie also in England.«
»Ich habe ein Haus in der Schweiz. Aber ich würde sagen, England ist mein Zuhause.«
»Und nun sind Sie auf dem Weg dorthin. Und ich weiß nicht einmal Ihren Namen.«
»Habe ich ihn nie erwähnt?«
»Nein. Im Wald neulich ...«
»Da war ich nur ein Vorübergehender, nicht wahr? Es wäre nicht comme il faut gewesen, Visitenkarten auszutauschen.«
»Und dann auf der Fähre ... Sie waren ganz einfach da.«
»Sie schienen mir ziemlich schläfrig zu sein.«
»Lüften wir das Geheimnis. Wie heißen Sie?«
Er zögerte, und ich hatte den Eindruck, daß er es mir nicht sagen wollte. Dafür mußte es einen Grund geben. Er war wahrhaftig ein Rätsel. Dann sagte er plötzlich: »Mein Name ist Edward Compton.«
»Oh ... Sie sind also doch Engländer. Ich war mir nicht ganz sicher. Wo wohnen Sie?«
»In Compton Manor.«
»Ist das weit von hier?«
»Ja. In Suffolk. In einem kleinen Dorf, von dem Sie bestimmt noch nie gehört haben.«
»Wie heißt es?«
»Croston.«
»Nein. Davon habe ich noch nie gehört. Ist es weit von Bury St. Edmunds?«
»Das ist die nächste Stadt.«
»Und Sie sind jetzt auf dem Weg dorthin?«
»Ja.«
»Bleiben Sie länger in Canterton?«
»Ich denke schon.«
»Wie lange?«
Er sah mich eindringlich an und sagte: »Das hängt von ...«
Ich spürte, wie ich leicht errötete. Es hing von mir ab, gab er mir zu verstehen. Die Mädchen hatten gesagt, daß er nur an mir interessiert sei, und ich hatte es schon bei unserer ersten Begegnung im Wald gespült.
»Sie sind gewiß im Three Feathers abgestiegen. Es ist klein, aber es steht im Ruf, sehr behaglich zu sein. Hoffentlich haben Sie es dort bequem.«
»Ich bin gut untergebracht«, bestätigte er.
»Sie müssen Tante Patty kennenlernen.«
»Das wäre mir ein Vergnügen.«
»Ich muß jetzt umkehren. Es wird schon so früh dunkel.«
»Ich begleite Sie nach Hause.«
Wir traten aus dem Wald auf die Straße. Vor uns lag die Villa. Sie sah schön aus in dem bereits verblassenden Licht.
»Wie ich sehe, bewundern Sie das Haus«, sagte ich. »Traurig, daß Sie es aufgeben müssen«, erwiderte er.
»Ich habe mich noch nicht an den Gedanken gewöhnt, aber wie Tante Patty sagt, Backsteine und Mörtel machen noch kein Heim. Wir wären hier nicht glücklich, wenn wir uns die ganze Zeit sorgen müßten, ob wir es uns überhaupt leisten können. Außerdem wären bald Instandsetzungsarbeiten fällig, sonst würde das Haus über unseren Köpfen zusammenstürzen.«
»Wie betrüblich.«
Ich blieb stehen und lächelte ihn an. »Ich verlasse Sie jetzt, es sei denn, Sie möchten mit hereinkommen.«
»N ... nein. Lieber nicht. Vielleicht nächstes Mal.«
»Morgen. Kommen Sie zum Tee. Um vier Uhr. Tante Patty macht ein ziemliches Zeremoniell aus der Teestunde. Wie bei allen Mahlzeiten. Kommen Sie kurz vor vier.«
»Danke«, sagte er.
Dann ergriff er meine Hand und verbeugte sich.
Voll innerer Erregung lief ich ohne einen Blick zurück ins Haus. Dieser Mann hatte etwas äußerst Faszinierendes an sich. Wenigstens kannte ich jetzt seinen Namen. Edward Compton von Compton Manor. Ich stellte mir das Haus vor ... roter Backstein in reinstem Tudorstil, ähnlich wie unsere Villa. Kein Wunder, daß er sich an Grantley interessiert zeigte und ehrlich erschüttert war, weil wir es verkaufen mußten. Er würde es verstehen, was es bedeutete, sich von einem alten Haus zu trennen, das einem so lange ein Heim gewesen war.
Morgen würde ich ihn wiedersehen. Ich wollte allen Mädchen schreiben und ihnen von dieser aufregenden Begegnung berichten. Auf der Fähre war keine Zeit gewesen, um Lydia zu erzählen, daß ich ihn dort wiedergesehen hatte. Das Ausschiffen und dann das Wiedersehen mit denen, die uns abholen gekommen waren, hatten uns zu sehr in Anspruch genommen.
Vielleicht würde ich ihr mit der Zeit mehr zu berichten haben. Ich war von dem geheimnisvollen Fremden sehr angetan.
Als ich nach Hause kam, befand sich Tante Patty in heller Aufregung. »Ich habe soeben eine Bestätigung von Daisy Hetherington erhalten. Sie kommt uns besuchen. Ende der Woche, auf dem Weg zu ihrem Bruder, bei dem sie das Weihnachtsfest verbringt. Sie macht ein paar Tage bei uns Station.«
Ich hatte sie häufig von Daisy Hetherington sprechen hören, und jedesmal voller Hochachtung. Daisy Hetherington besaß eine der exklusivsten Schulen von England. Tante Patty sprach ohne Unterlaß von ihr, bis ich sie unterbrach: »Tante Patty, es ist etwas Merkwürdiges geschehen. In Schaffenbrucken bin ich einem Mann begegnet, und jetzt ist er zufällig in Canterton. Ich habe ihn für morgen zum Tee eingeladen. Das ist dir doch recht?«
»Aber natürlich, Liebes. Ein Mann, sagst du?« Ihre Gedanken weilten bei Daisy Hetherington. »Wie nett«, fuhr sie geistesabwesend fort. »Ich habe angeordnet, das Tapetenzimmer für Daisy herzurichten. Ich finde, es ist das schönste Zimmer im Haus.«
»Es hat eine schöne Aussicht ... aber das haben sie eigentlich alle.«
»Sie möchte gewiß alles über den Umzug hören. Sie möchte stets informiert sein über das, was sich in der Welt der Schulen tut. Vielleicht ist sie deswegen so erfolgreich.«
»Tante Patty, das hört sich ja ein kleines bißchen neidisch an. Das sieht dir gar nicht ähnlich.«
»Aber nein, mein Liebes. Ich würde nicht mit Daisy Hetherington tauschen, auch nicht um ihres Instituts Colby Abbey willen. Nein, ich bin zufrieden. Froh, daß ich aufhöre. Es war höchste Zeit. Bedauerlich ist es nur deinetwegen. Ich hätte dir gern ein blühendes Unternehmen hinterlassen ...« Ihre Augen glitzerten. »Aber man weiß nie, was einen erwartet. Cordelia, ich glaube, in unserem kleinen Dorf auf dem Land wird es ein bißchen still für dich sein. Du warst in Schaffenbrucken und bist bestens ausgebildet. Daisy Hetheringtons Colby-Abbey-Institut für junge Damen – so lautet der vollständige Name ihrer Schule – hat einen Ruf, den wir nie hatten. Colby kommt Schaffenbrucken gleich ... jedenfalls fast. Ich habe mich gefragt ...«
»Tante Patty, hast du Daisy Hetherington eingeladen, oder hat sie darum gebeten, bei uns zu wohnen?«
»Ach weißt du, ich wußte, wie ungern sie in Gasthäusern absteigt. Ich habe ihr erklärt, daß es für sie kaum ein Umweg sei, und daß sie ebensogut ein paar Tage bei uns wohnen könne. Ich habe ein paar Stücke, die sie vielleicht gebrauchen kann. Den Rollschreibtisch zum Beispiel und ein paar Schulpulte und Bücher. Sie war sehr interessiert, außerdem möchte sie dich gern kennenlernen. Ich habe ihr soviel von dir erzählt.«
Ich kannte Tante Patty nur zu gut. Ihre Augen hatten diesen verschmitzten Ausdruck, der mir verriet, daß sie etwas im Schilde führte.
»Wirst du sie etwa bitten, daß sie mir einen Posten in ihrer Schule gibt?«
»Ich werde sie nicht direkt bitten. Und die Entscheidung liegt in jedem Fall bei dir. Das mußt du dir sorgfältig überlegen, Cordelia. Wird dir das Leben auf dem Land zusagen? Ich meine, das Dorfleben, das sich rund um die Kirche abspielt. Das ist eher etwas für alte Tanten, wie Violet und mich, aber für ein junges Mädchen, das ausgebildet wurde im Hinblick darauf, diese Ausbildung auch zu nutzen ... Nun, die Entscheidung liegt, wie gesagt, bei dir. Wenn du Daisy gefällst ... Ich weiß, sie wird deine Kenntnisse schätzen. Daisy ist ein guter Mensch ... ein bißchen streng ... ein bißchen reserviert und sehr, sehr würdevoll ... ganz das Gegenteil von deiner alten Tante Patty, dazu noch eine geschickte Geschäftsfrau, die genau weiß, was sie tut. Du wirst es ja selbst sehen. Wenn sie dich einstellte, würdest du dort nach einer Weile vielleicht in eine gute Position aufsteigen. Ich dachte an eine Teilhaberschaft. Geld? Nun, ich bin nicht völlig mittellos, und mit dem, was ich besitze sowie dem, was ich für Grantley bekomme – ein sehr guter Preis –, werde ich mein Auskommen haben. Die Weihnachtsferien beginnen in Colby Abbey eine Woche früher als bei uns, deshalb habe ich Daisy zu uns eingeladen. Gar keine schlechte Idee, daß sie kommt, wenn die Mädchen in die Ferien gehen. Dann kann sie wenigstens unsere Unterrichtsmethoden nicht kritisieren, was sie sonst bestimmt tun würde. Du wirst sie bewundern. Sie besitzt alle die Eigenschaften, die mir fehlen.«
»Das werde ich sie bestimmt nicht.«
»O doch. Ich war nicht zum Führen einer Schule geeignet, Cordelia. Sehen wir den Tatsachen doch ins Gesicht. Keines der Mädchen hat auch nur die geringste Ehrfurcht vor mir.«
»Aber sie lieben dich!«
»Manchmal ist Respekt wichtiger. Im Rückblick erkenne ich meine Fehler. Das ist wohl nicht weiter schwierig. Aber sie zuzugeben zeugt immerhin von einer gewissen Klugheit. Und dies ist mein Plan, Cordelia. Dir eröffnet sich eine neue Möglichkeit, das heißt, wenn Daisy mitmacht, worauf ich hinzuwirken gedenke. Wenn sie dir einen Posten in ihrer Schule anbietet, und wenn du in fünf oder sechs Jahren ihr Vertrauen gewonnen hast ... die arme Daisy wird ja auch nicht jünger ... und ich habe ein kleines Kapital auf die Seite gelegt ... siehst du, worauf ich hinaus will? Deshalb ist Daisys Besuch so wichtig. Du kommst soeben aus Schaffenbrucken, und ich weiß zufällig, daß sie niemanden mit dieser Ausbildung in ihrer Schule hat. Wenn du ihr gefällst – und ich wüßte nicht, warum du ihr nicht gefallen solltest –, besteht eine Chance. Cordelia, Liebes, ich möchte, daß du gründlich darüber nachdenkst. Dieser Gedanke allein hat mir dies alles erträglich gemacht, und wenn es so kommt, wie ich es mir vorstelle, dann wird sich alles, was geschehen ist, als Glück im Unglück erweisen.«
»Tante Patty, immer mußt du Pläne schmieden! Angenommen, ich gefalle ihr, und sie ist bereit, mich aufzunehmen ... dann könnte ich nicht mehr bei dir sein.«
»Mein Liebes, das Häuschen wartet immer auf dich. Die Schulferien werden unsere Glückstage sein. Die gute alte Vi wird das Messing besonders blank polieren – sie hat ein Faible für ihr Messing –, und ich werde mich in einem Freudentaumel befinden. Stell dir nur den Jubel im Haus vor, wenn es heißt ›Cordelia kommt nach Hause‹. Ich sehe es schon deutlich vor mir, wie es nächstes Jahr um diese Zeit sein wird. Wir gehen alle zum Weihnachtssingen in die Kirche. Der Pfarrer ist ein besonders netter Mann, und die Leute im Dorf sind überaus freundlich.«
»Ach, Tante Patty«, seufzte ich. »Ich hatte mich so darauf gefreut, bei dir zu sein. In den letzten drei Jahren habe ich ja nicht viel von dir gehabt.«
»Wenn du in Devon bist, werden wir uns öfter sehen, nicht bloß Weihnachten und im Sommer. Ungefähr drei Meilen von unserem Häuschen ist ein Bahnhof, und wir behalten den kleinen Einspänner. Dann hole ich dich ab. Oh, wie ich mich schon darauf freue! Und auf einer Schule wie Colby Abbey, wohin, das kannst du mir glauben, der Hochadel seine Töchter schickt, kommst du mit dem richtigen Genre in Berührung ... falls du weißt, was ich meine. Wir hatten mal eine Ritterstochter oder auch zwei, aber ich sage dir, Daisy Hetherington hat Töchter von Grafen und die Mädchen von dem komischen Gutsherrn.«
Wir lachten so unbeschwert wie immer, wenn man mit Tante Patty zusammen war. Sie besaß die einzigartige Gabe, jede Situation amüsant und erträglich zu machen.
Meine Gefühle waren total durcheinander. Ich hatte unterrichten wollen; ich glaubte tatsächlich, eine besondere Begabung dafür zu besitzen: Dazu war ich jahrelang ausgebildet worden, aber die augenblickliche Lage war zuviel für mich. Ich konnte nicht alles auf einmal erfassen: den Fortzug von Grantley, die Aussicht auf ein neues Heim mit Tante Patty und Violet, und schließlich die Möglichkeit einer Laufbahn in meinem erwählten Beruf, mit der Hoffnung, am Ende meine eigene Schule zu haben! Doch im Vordergrund meiner Gedanken war Edward Compton, der Mann, der auf mysteriöse Weise in meinem Leben erschien und verschwand und allmählich eine natürliche Gestalt annahm. Vorher war er ein namenloses Hirngespinst gewesen, und ich vermochte ihn mit nichts in Zusammenhang zu bringen. Jetzt aber wußte ich, daß er Edward Compton von Compton Manor war. Und wenn er morgen nachmittag zu uns zum Tee kommen würde, würden Tante Patty und Violet ihm schon auf den Zahn fühlen.
Er erregte mich. Er hatte ein so interessantes Gesicht und wirkte wie aus einer anderen Zeit. Doch als er, ein wenig zögernd, als ob es ihm widerstrebte, seinen Namen nannte, war er gleichsam ein menschliches Wesen geworden. Ich hätte gern gewußt, warum er gezögert hatte, ihn mir zu sagen. Vielleicht wußte er, daß er durch sein Erscheinen im Wald und danach an Deck sich eine Aura des Geheimnisvollen geschaffen hatte, die er beizubehalten wünschte.
Ich lachte und freute mich mehr auf ihn, als ich vor Tante Patty zugeben mochte. Er bestimmte meine Gedanken stärker als die Ankunft von Daisy Hetherington und die Auswirkung, welche diese auf meine Zukunft haben konnte.
Als Edward Compton am nächsten Tag nicht erschien, war ich bitter enttäuscht. Da wurde mir bewußt, wie stark ich mich bereits gedanklich mit ihm befaßt hatte.
Tante Patty und Violet erwarteten ihn. Ich hatte kurz vor vier Uhr, der Stunde, zu der der Tee serviert wurde, mit seinem Kommen gerechnet, aber als er um halb fünf noch nicht da war, bestimmte Tante Patty, daß wir ohne ihn anfangen sollten.
Ich horchte die ganze Zeit auf seine Ankunft und gab Tante Patty und Violet, die ständig von Daisy Hetheringtons Besuch sprachen, abwesende Antworten.
»Vielleicht«, meinte Tante Patty, »wurde er plötzlich abberufen.«
»Er hätte eine Nachricht schicken können«, sagte Violet.
»Vielleicht hat er es getan, und sie ist ins falsche Haus geraten.«
»Wer könnte Grantley Manor verfehlen?«
»Es kann alles mögliche passiert sein«, meinte Tante Patty. »Vielleicht hatte er auf dem Weg hierher einen Unfall.«
»Davon hätten wir gewiß gehört«, gab ich zu bedenken.
»Nicht unbedingt«, widersprach Tante Patty.
»Vielleicht hat er es sich anders überlegt«, mutmaßte Violet.
»Er hat doch um die Einladung gebeten«, sagte ich.
»Und zwar erst gestern.«
»Männer!« stöhnte Violet, ohne recht zu wissen, wovon sie sprach. »Die benehmen sich zuweilen äußerst komisch. Da kann alles mögliche passiert sein ... bei Männern kann man nie wissen.«
»Es wird sich bestimmt aufklären«, meinte Tante Patty, während sie ihr Baiser mit Erdbeermarmelade bestrich. Sie gab sich ganz dem Genuß hin. »Ich mache dir einen Vorschlag«, sagte sie, als sie es verzehrt hatte, »wir schicken Jim zum Three Feathers. Dort müßten sie etwas davon wissen, wenn es einen Unfall gegeben hat.«
Jim war der Stallbursche, der sich um die Kutsche und unsere Pferde kümmerte.
»Meinst du nicht, daß das so aussieht, als ob wir allzu interessiert wären?« fragte Violet.
»Meine liebe Vi, wir sind interessiert.«
»Ja schon, aber er ist schließlich ein Mann ...«
»Männern kann genausogut etwas passieren wie Frauen, Violet, und ich finde es komisch, daß er nicht gekommen ist, obwohl er es gesagt hat.«
Sie redeten ein Weilchen über Edward Compton, und ich erzählte, wie wir Mädchen ihn im Wald getroffen hatten und er hinterher durch ein merkwürdiges Zusammentreffen auf der Kanalfähre war.
»Und dann war er zufällig hier.«
»Ach, ich schätze, er wurde plötzlich abberufen«, folgerte Tante Patty. »Sicher hat er eine Nachricht hinterlassen, die uns überbracht werden sollte, aber du kennst ja die Leute im Three Feathers. Nett, aber nicht unbedingt zuverlässig. Weißt du noch, Vi, als die Mutter einer Schülerin einmal dort übernachten wollte, und wir haben ein Zimmer für sie bestellt, aber Mrs. White vergaß sie vorzumerken. Wir mußten sie damals in der Schule unterbringen.«
»Und ob ich das noch weiß«, sagte Violet. »Und dann hat es ihr so gut gefallen, daß sie noch eine Nacht länger geblieben ist und gesagt hat, sie wollte wiederkommen.«
»Da siehst du, wie das ist«, sagte Tante Patty, und damit wandte sich das Gespräch wieder den Vorbereitungen für Daisy Hetheringtons Besuch zu.
Eine Stunde später kehrte Jim vom Three Feathers zurück. Ein Mr. Compton war dort nicht abgestiegen. Im Augenblick hatten sie lediglich zwei ältere Damen zu Gast.
Ich fand das Ganze höchst seltsam. Hatte er nicht gesagt, er sei im Three Feathers abgestiegen? Oder hatte ich mir eingebildet, er müsse dort wohnen? Ich war mir nicht sicher. Als er mir seinen Namen nannte, war dieses mysteriöse Flair ein wenig von ihm gewichen. Nun war es wieder da.
Er hatte schon etwas Sonderbares an sich, dieser Fremde vom Wald.
Von Edward Compton kam keine Nachricht, und ich ging verwirrt und enttäuscht zu Bett.
Immerhin hatte er den Wunsch geäußert, uns besuchen zu dürfen. Ihm war bestimmt etwas dazwischengekommen.
Ich hatte eine unruhige Nacht mit wirren Träumen, von ihm und von Daisy Hetherington. In einem regelrechten Alptraum befand ich mich in Colby Abbey, einer gewaltigen finsteren Burg, und suchte Edward Compton. Als ich ihn fand, war er ein Ungeheuer – halb Mann, halb Frau, halb er selbst, halb Daisy Hetherington –, und ich versuchte zu fliehen. Schweißgebadet erwachte ich und setzte mich atemlos im Bett auf. Ich glaubte, im Schlaf geschrien zu haben. Dann legte ich mich wieder hin und versuchte, mich zu beruhigen.
Binnen kurzer Zeit hatte sich so viel ereignet, da war es kein Wunder, daß ich unruhige Träume hatte. Falls Edward Compton es sich anders überlegt hatte und es ihm an der Höflichkeit gebrach, uns Bescheid zu geben, nun gut. Aber ich glaubte nicht, daß dies der Fall war. Das Bestechende an ihm war ja gerade dieses Flair von nahezu altväterlicher Ritterlichkeit gewesen.
Das alles war ziemlich mysteriös. Vermutlich würde ich des Rätsels Lösung bald finden. Vielleicht war bereits eine Nachricht zu mir unterwegs.
Als ich am nächsten Morgen hinunterkam, hatten alle schon gefrühstückt, und die Mädchen begaben sich in ihre Klassenzimmer. Der Unterricht wurde kurz vor den Weihnachtsferien immer etwas lockerer betrieben.
Am Vormittag begab ich mich in die Stadt. Mrs. Stoker, die Inhaberin des kleinen Wäschegeschäftes, stand auf der Straße und begutachtete ihre Auslage. Deckchen und Tischtücher waren hier und da mit Stechpalmenzweigen dekoriert, um die Weihnachtseinkäufer anzulocken.
Mrs. Stoker begrüßte mich erfreut und meinte, es sei traurig, daß wir fortzögen. »Ohne die Schule wird die Stadt nicht mehr dieselbe sein«, klagte sie. »Wir hatten uns so daran gewöhnt. Denken Sie nur, als wir vor vielen Jahren hörten, daß eine Schule hierherkommen sollte, da waren einige von uns gar nicht begeistert. Aber dann ... Miss Grant war sehr behebt ... und die Mädchen auch. Es war eine Freude, wenn sie in die Stadt kamen. Ich sag’ Ihnen, es wird etwas fehlen.«
»Wir werden Sie alle vermissen«, sagte ich.
»Die Zeiten ändern sich, wie ich immer sage. Nichts steht lange still.«
»Im Augenblick sind nicht viele Leute in der Stadt«, bemerkte ich.
»Nein. Wer kommt schon um diese Jahreszeit hierher?«
»Fremde würden Ihnen doch auffallen, nicht wahr?«
Ich blickte sie erwartungsvoll an. Mrs. Stoker stand in dem Ruf, alles zu wissen, was in der Stadt vorging. »Die Damen Brewer sind wieder im Feathers. Voriges Jahr waren sie auch hier. Sie unterbrechen die Reise zu ihren Cousinen, die sie jedes Jahr Weihnachten besuchen. Sie wissen, daß sie sich aufs Feathers verlassen können. Und dort sind sie froh, daß sie bei ihnen wohnen. Im Winter haben sie nicht viele Gäste. Tom Carew hat mir gesagt, im Frühling, Sommer und Herbst haben sie alle Hände voll zu tun, aber im Winter ist’s totenstill.«
»Da sind also die Damen Brewer jetzt die einzigen Gäste.«
»Ja ... und sie können von Glück sagen, daß sie sie haben.«
Jetzt hatte ich eine doppelte Bestätigung. Wenn noch jemand anders dort wohnte, würde Mrs. Stoker es wissen. Dennoch ging ich, sobald ich ihr entwischen konnte, zum Three Feathers und wünschte den Carews ein frohes Fest. Sie luden mich zu einem Glas Apfelmost ein.
»Wir waren wie vom Donner gerührt, als wir hörten, daß Miss Grant das Haus verkauft hat«, sagte Mrs. Carew. »Das war ein rechter Schock, nicht wahr, Tom?«
Tom sagte: »Meiner Treu, jawohl. Wir waren völlig sprachlos.«
»Es mußte sein«, erwiderte ich, worauf sie seufzten. Ich erkundigte mich, wie die Geschäfte gingen.
»Das schleppt sich so dahin«, sagte Tom. »Wir haben zwei Gäste ... die Damen Brewer. Die waren schon mal hier.«
»Ja, das habe ich von Mrs. Stoker gehört. Und das sind die einzigen?«
»Ja.«
Damit hatte ich endgültig Gewißheit.
»Ihr Jim meinte wohl, wir hätten einen Freund von Ihnen hier ...«
»Wir dachten, er würde vielleicht herkommen. Ein Mr. Compton.«
»Vielleicht kommt er noch. Wir könnten ihm ein sehr schönes Zimmer geben.«
Niedergeschlagen verließ ich das Three Feathers. Ich wanderte durch die Stadt, und dabei fiel mir das Nag’s Head ein. Das war kein richtiges Hotel, eher eine kleine Herberge, ein oder zwei Zimmer, die sie hin und wieder vermieteten.
Ich ging ins Nag’s Head und traf dort auf Joe Brackett, den ich flüchtig kannte. Er begrüßte mich und meinte, es sei bedauerlich, daß ich fortzöge. Ich kam geradewegs zum Thema und fragte ihn, ob ein Mr. Compton bei ihm ein Zimmer genommen habe. Joe Brackett schüttelte den Kopf. »Hier nicht, Miss Grant. Vielleicht im Feathers ...«
»Nein«, sagte ich, »dort ist er auch nicht abgestiegen.«
»Sind Sie sicher, daß er hier in der Stadt ist? Ich kann mir nicht vorstellen, wo er sonst wohnen könnte, außer vielleicht bei Mrs. Shovell. Sie vermietet hin und wieder ein Zimmer mit Frühstück. Aber sie war die ganze letzte Woche bettlägerig ... hatte mal wieder einen Anfall.«
Ich verabschiedete mich und ging nach Hause. Vielleicht ist eine Nachricht eingetroffen, dachte ich.
Aber es war keine Nachricht da.
Nachmittags half ich den Mädchen, den Aufenthaltsraum zu schmücken, und am späten Nachmittag traf Daisy Hetherington ein.
Ich war von Daisy Hetherington ungeheuer beeindruckt. Sie war eine magere, knochige Frau, sehr groß gewachsen. Sie maß bestimmt ihre 1,80 Meter. Ich war selbst groß, aber neben ihr kam ich mir beinahe zwergenhaft vor. Sie hatte sehr helle, eisblaue Augen und elegant frisiertes weißes Haar, und mit ihrer blassen Haut und den klassischen Zügen wirkte sie wie aus Stein gemeißelt. Kühle Vornehmheit strahlte von ihr aus, und ich erkannte sogleich, daß sie eine vorbildliche Schulvorsteherin war, denn sie flößte einem auf Anhieb Ehrfurcht und Respekt ein. Sie verlangte allen das Beste ab, und sie bekam es auch, weil alle wußten, daß sie sich mit nichts Geringerem zufriedengeben würde. Sie verlangte Vollkommenheit – von sich wie von anderen.
Das einzige, was nicht zu ihr paßte, war ihr Name. Daisy gemahnte an ein Gänseblümchen, das sich bescheiden im Gras versteckt. Ihr hätte eher ein königlicher Name angestanden: Elisabeth, Alexandra, Eleonore oder Viktoria.
Niemand hätte Tante Patty unähnlicher sein können; in Daisy Hetheringtons Gegenwart wirkte sie noch rundlicher, gemächlicher und liebenswerter.
Tante Patty hatte ein Mädchen zu mir geschickt und mir sagen lassen, daß Miss Hetherington angekommen sei. Sie hielten sich vor dem Essen im Wohnzimmer auf. Ob ich ihnen dort Gesellschaft leisten wolle?
Ich ging hinunter. Ich trug ein blaues Samtkleid mit weißem Jabot. Mein glattes kastanienbraunes Haar hatte ich hoch auf dem Kopf aufgetürmt, um größer und, wie ich hoffte, würdiger zu erscheinen. Ich hatte das Gefühl, daß ich in der Gegenwart von Miss Hetherington meine ganze Selbstachtung brauchen würde. Interessiert betrachtete ich mich im Spiegel. Ich war beileibe keine Schönheit. Meine hellbraunen Augen standen etwas zu weit auseinander, mein Mund war zu breit, meine Stirn zu hoch. Meine Nase war, wie Monique zu sagen pflegte, »vorwitzig«, das heißt, sie hatte eine leicht aufwärts gebogene Spitze, die meinem ansonsten recht ernsten Gesicht einen Anflug von Lustigkeit verlieh. Ich war verwundert gewesen, wieso Edward Compton an mir mehr interessiert schien, da Monique doch ausgesprochen hübsch und Lydia überaus attraktiv war. Frieda war ein wenig ernst, aber von einer Offenheit, die sie anziehend machte. Zwar hatte ich den Schmelz der Jugend mit ihnen gemein, aber ich war bestimmt nicht die Attraktivste von uns vieren. Es kam mir eigenartig vor, daß Edward Compton sich für mich entschieden haben sollte. Es sei denn, unsere Begegnungen seien Zufälle gewesen. Die erste im Wald war es gewiß, und ebenso die auf der Fähre, aber den Abstecher nach Canterton hatte er doch wohl meinetwegen gemacht. Warum hatte er sich dann aber zum Tee angesagt und war nicht gekommen?
Es gab nur eine Erklärung. Er hatte die Begegnung im Wald völlig vergessen, bis er mich auf der Fähre wiedersah. Er war auf der Durchreise und hatte in Canterton Station gemacht. Dabei fiel ihm ein, daß ich dort wohnte. Wir trafen uns zufällig, und vielleicht hatte ich ihn so sehr zur Annahme der Einladung gedrängt, daß eine Absage unhöflich gewesen wäre. Jedenfalls hielt er es für besser, nicht zu kommen und hatte sich still davongemacht.
Ich durfte nicht mehr an ihn denken. Es war viel wichtiger, auf Daisy Hetherington einen guten Eindruck zu machen.
Tante Pattys Gesicht leuchtete auf, als ich hinunterkam. Sie sprang auf und hakte mich unter. »Da bist du ja, Cordelia. Daisy, das ist meine Nichte Cordelia Grant. Cordelia, das ist Miss Hetherington, die eine der vornehmsten Schulen des Landes besitzt.«
Daisy Hetherington ergriff meine Hand. Die ihre war erstaunlich warm. Ich hatte erwartet, daß sie kalt sein würde ... kalt wie Stein. »Ich freue mich, Sie kennenzulernen«, versicherte ich.
»Es ist mir eine Freude, Ihre Bekanntschaft zu machen«, erwiderte sie. »Ihre Tante hat mir so viel von Ihnen erzählt.«
»Komm, setz dich«, sagte Tante Patty. »Das Essen wird in zehn Minuten serviert. Welch ein Spaß, daß Miss Hetherington bei uns ist!«
Sie lächelte mich, fast unmerklich zwinkernd, an. ›Spaß‹ schien mir ein seltsames Wort in Verbindung mit Miss Hetherington, aber für Tante Patty war ja das ganze Leben ein Spaß.
Ich setzte mich. Die stechenden blauen Augen musterten mich eindringlich. Ich wußte, daß jede Einzelheit meiner Erscheinung erfaßt und daß alles, was ich sagte, bewertet und für oder gegen mich verwendet wurde.
»Wie du weißt, ist Cordelia soeben aus Schaffenbrucken zurückgekehrt«, plauderte Tante Patty drauflos.
»Ja, das ist mir bekannt.«
»Sie war zwei Jahre dort. Länger bleibt kaum jemand.«
»Zwei bis drei Jahre sind das Übliche«, sagte Daisy. »Es war gewiß eine überaus anregende Erfahrung.« Das bestätigte ich.
»Du mußt Miss Hetherington davon erzählen«, drängte Tante Patty. Sie saß lächelnd und nickend in ihrem Sessel. Ihr Stolz auf mich machte mich ein wenig verlegen, und ich mußte mein Bestes tun, um ihn zu verdienen. So erzählte ich denn von Schaffenbrucken, schilderte den Tagesablauf, den Unterricht, die Geselligkeiten ... Ich sprach von allem, was mir von der Schule einfiel, bis Violet schüchtern hüstelnd verkündete, daß das Abendessen angerichtet sei.
Beim Fisch kam Daisy Hetherington auf das Thema zu sprechen, das sie bis dahin umgangen hatte. »Meine liebe Patience«, sagte sie, »ich hoffe, es war eine kluge Entscheidung von dir, alles aufzugeben.«
»Ohne Zweifel«, erwiderte Tante Patty heiter. »Meine Anwälte und die Bank finden es richtig ... und die irren sich selten.«
»So schlimm steht es also!«
»So gut«, gab Tante Patty zurück. »Man will sich ja irgendwann einmal zur Ruhe setzen. Für mich ist es nun an der Zeit. Wir wünschen uns ein geruhsames Leben, wir alle. Und das wird uns von nun an beschieden sein. Violet hat viel zu hart gearbeitet. Sie wird Bienen halten, nicht wahr, Violet?«
»Ich hatte schon immer eine Schwäche für Bienen«, erwiderte Violet, »seit mein Cousin Jeremy beinahe zu Tode gestochen wurde, weil er der Bienenkönigin zu nahe kam.«
Tante Patty brach in Lachen aus. »Sie konnte ihren Cousin Jeremy nämlich nicht ausstehen.«
»Ach was, Patty. Aber es geschah ihm ganz recht. In alles hat er sich eingemischt. Meine Mutter hat immer gesagt, ›laß die Bienen in Frieden, dann tun sie dir nichts‹.«
»Imkerei mag ja ein interessantes Steckenpferd sein«, warf Daisy ein, »aber wenn man auf Profit aus ist ...«
»Wir sind lediglich auf ein bißchen leckeren Honig aus«, gestand Tante Patty. »Er ist so köstlich, direkt aus der Wabe.«
Ich kannte Tante Patty. Sie sorgte absichtlich dafür, daß die Unterhaltung oberflächlich blieb; sie wollte auf keinen Fall, daß Daisy Hetherington etwas von ihrem ernsten Anliegen ahnte. »Wir freuen uns alle auf das einfache Leben«, fuhr sie fort, »Violet, Cordelia und ich.«
Daisy Hetheringtons Augen ruhten auf mir. Mir war fast, als erforschten sie meine Gedanken. »Wird es Ihnen nicht ziemlich eintönig vorkommen, Miss Grant? In Ihrem Alter, bei Ihrer Ausbildung und nach Ihrem Aufenthalt in Schaffenbrucken ... das dünkt mich eine ziemliche Verschwendung.«
»Schaffenbrucken ist niemals eine Verschwendung«, warf Tante Patty ein. »Das bleibt einem ein Leben lang erhalten. Ich bedaure immer, daß ich nicht dort war, du nicht, Daisy?«
»Ich halte es für den idealen Abschluß einer Erziehung«, sagte Daisy. »Schaffenbrucken ... oder ein ähnliches Institut.«
»Zum Beispiel das Colby-Abbey-Institut für junge Damen«, meinte Tante Patty vielsagend. »Ein großer Name! Aber im Grunde unseres Herzens wissen wir, daß nichts, einfach nichts an Schaffenbrucken heranreicht.«
»Um so mehr ein Grund, daß deine Nichte nicht auf dem Land verdummt.«
»Cordelia muß selbst entscheiden, was sie anfangen will. Sie ist ja eigentlich zum Unterrichten ausgebildet, nicht wahr, Cordelia?«
Ich bejahte.
Daisy wandte sich an mich. »Ich nehme an, Sie besitzen eine Begabung dafür.«
»Mir gefällt der Gedanke, mit jungen Menschen zusammen zu sein. So hatte ich es mir eigentlich vorgestellt.«
»Natürlich, natürlich«, sagte Daisy. »Ich würde mich hier gern einmal ein wenig umsehen, Patience.«
»Aber selbstverständlich. Es ist die letzte Woche. Alle sind schon in Weihnachtsstimmung. Vor lauter Weihnachtsfeiern haben wir kaum noch Unterricht, und da es das letzte Weihnachten ist ...«
»Was machen deine Mädchen, wenn du zumachst ... Ende des nächsten Halbjahres, nicht wahr?«
»Ich nehme an, einige Eltern werden Colby Abbey in Betracht ziehen, wenn ich durchblicken lasse, daß du eine Freundin von mir bist. Viele haben mit Interesse vernommen, daß Cordelia in Schaffenbrucken war. Sie dachten natürlich, sie würde hier unterrichten.«
»Ja, ja«, sagte Daisy. Sie vermochte die Berechnung in ihren Augen nicht zu verbergen. Sie dachte über mich nach, und ich war seltsamerweise davon angetan. Auf eine gewisse Art gefiel mir Daisy Hetherington. Sie nötigte mir Bewunderung ab. Freilich war sie streng; ich konnte mir nicht vorstellen, daß sie sich jemals von Gefühlen leiten ließ, aber sie war gewiß auch gerecht und erkannte gute Arbeit an – und etwas anderes ließ sie ganz bestimmt nicht gelten.
Ich malte mir die langen Tage auf dem Land aus ... wie ich nichts Besonderes tat, außer Violet zuzuhören, die von der Imkerei sprach, oder an dörflichen Festen teilzunehmen und einen Stand auf dem Basar zu betreiben, wie ich mit Tante Patty scherzte ... und was noch? So würde es weitergehen, bis ich schließlich heiratete. Und wen würde ich heiraten? Den Sohn des Pfarrers, sofern er einen hatte. Aber Pfarrer schienen fast immer Töchter zu haben. Den Sohn des Arztes? Nein. Ich wollte mehr als ein gemeinsames Heim mit Tante Patty. Tante Patty verstand dies nur zu gut. Wir wollten unsere kostbare Beziehung nicht durch Langeweile verderben. Tante Patty war der Ansicht, ich müsse in die Welt hinaus, und sie hatte mir deutlich gezeigt, daß sie in Daisy Hetherington einen Weg dazu sah.
Daisy erzählte uns vom Colby-Abbey-Institut für junge Damen, und dabei verlor sich ihre harte Miene. Ihre Wangen nahmen einen Hauch von Farbe an, ihre blauen Augen wurden sanft. Die Schule war eindeutig der Mittelpunkt ihres Lebens.
»Wir haben eine höchst ungewöhnliche Umgebung. Die Schule gehört zu einer alten Abtei. Das verleiht uns eine eigene Atmosphäre. Ich finde, die Umgebung ist sehr wichtig. Die Eltern sind immer sehr beeindruckt, wenn sie die Schule zum erstenmal sehen.«
»Ich fand es ein wenig gespenstisch« warf Tante Patty ein. »Violet hatte Alpträume in dem Zimmer, wo du sie einquartiert hattest.«
»Das kam von dem Käse, den ich zum Abendbrot gegessen hatte«, sagte Violet. »Käse wirkt immer so bei mir.«
»Der Mensch kann sich überall alles mögliche einbilden«, erklärte Daisy, um das Thema abzuschließen. Sie wandte sich an mich. »Wie gesagt, eine äußerst interessante Umgebung. Ein großer Teil der Abtei ist verfallen, aber es ist noch ziemlich viel erhalten ... die Refektoriumsgebäude und das Stiftshaus. Das Haus, das wir jetzt zur Verfügung haben, wurde im sechzehnten Jahrhundert von einem Verringer restauriert, und gleichzeitig wurde unter Verwendung von Steinen aus der Abtei das Herrenhaus gebaut. Das ist das Heim der Verringers. Ihnen gehören die Abtei und im Umkreis mehrerer Meilen die meisten Ländereien. Sie sind sehr wohlhabende und einflußreiche Gutsbesitzer. Zwei Mädchen von ihnen sind bei mir ... für sie ist es bequem, und außerdem ist es gut für die Schule. Jason Verringer würde sie bestimmt nicht woanders hinschicken. Ja, eine höchst ungewöhnliche Umgebung.«
»Das hört sich sehr interessant an«, sagte ich. »Da sind Sie wohl überall von den Ruinen der Abtei umgeben.«
»Ja. Die Leute kommen sie besichtigen, es wurde darüber geschrieben, und dadurch wird die Schule bekannt. Ich würde das Haus gern kaufen, aber Jason Verringer ist dagegen. Das ist wohl verständlich. Die Ländereien der Abtei sind im Familienbesitz, seit Heinrich der Achte sie ihnen schenkte, nachdem die Abtei teilweise zerstört war.«
»Ich bin froh, daß Grantley Manor mein Eigentum war«, unterbrach sie Tante Patty.
»Ein Glück für dich!« gab Daisy kurz angebunden zurück. »Das kam dir gut zustatten, als die Schule versagte.«
»Ach, versagt würde ich nicht sagen«, meinte Tante Patty. »Wir haben einfach beschlossen, uns davon zu trennen.«
»O ja, ich weiß ... auf Anraten deines Anwalts und deines Bankiers. Sehr klug, dessen bin ich sicher. Betrüblich ist es trotzdem. Aber vielleicht hat das stille Landleben ja für dich seinen besonderen Reiz.« »Davon bin ich überzeugt«, sagte Tante Patty. »Das sind wir alle, nicht wahr, Cordelia ... Violet! Liebe Vi, du träumst ja. Du hörst bestimmt schon die Bienen summen. Ich sehe dich schon mit so einem Dings über dem Kopf, das man aufsetzt, damit man nicht gestochen wird, und du erzählst den Bienen den ganzen Dorfklatsch. Hast du gewußt, Daisy, daß man mit den Bienen reden muß? Wenn man es nicht tut, kann das üble Folgen haben. Sie fliegen wütend davon, und sie können so erzürnt sein, daß sie zuvor ein paar Stiche anbringen. Hast du gewußt, daß sie ihren Stachel im Fleisch zurücklassen und daran sterben? Welch eine Lehre für uns. Man soll seinem Zorn nie freien Lauf lassen.«
Daisy sprach mich jetzt direkt an: »Gewiß möchten Sie nach Ihrer Ausbildung und Ihrem Aufenthalt in Schaffenbrucken Ihre Fähigkeiten gern ausnutzen.« »Ja«, erwiderte ich, »das möchte ich wohl.«
Darauf erzählte sie, fast nur an mich gewandt, weiter vom Colby-Abbey-Institut, von der Anzahl Lehrerinnen, die sie hatte, von den Fächern, die unterrichtet wurden, und wie sie sich mit älteren Mädchen zu befassen gedachte. »Bei uns gehen die meisten mit siebzehn ab. Manche sind anschließend nach Schaffenbrucken oder woandershin aufs Festland gegangen. Warum meinen die Leute immer, sie müßten ins Ausland gehen, um feine Lebensart zu lernen? Dabei haben wir in unserem Land dafür die besten Repräsentanten der Welt. Ich möchte, daß die Leute das einsehen. Ich gedenke, Sonderkurse für ältere Mädchen einzurichten ... sagen wir, für achtzehn- oder neunzehnjährige ... Tanz, Konversation, Diskussion.«
»O ja, dergleichen hatten wir in Schaffenbrucken auch.«
Daisy nickte. »Wir haben bereits einen Tanz- und einen Gesangslehrer. Einige von den Mädchen haben vortreffliche Stimmen. Mademoiselle Dupont und Fräulein Kutscher unterrichten Französisch und Deutsch, wozu sie bestens geeignet sind. Man muß immer Einheimische aus den entsprechenden Ländern haben.«
Ich hörte aufmerksam zu. Sie hatte in mir den Wunsch geweckt, ihre Schule kennenzulernen.
Es mochte gegenüber Tante Patty treulos erscheinen, daß ich von zu Hause fort wollte, aber ich konnte mir wirklich nicht vorstellen, daß ich mich dort die ganze Zeit wohl fühlen würde. Es würde wunderschön sein, in den Ferien nach Hause zu kommen. Ich konnte beinahe das Summen von Violets Bienen hören, und ich sah Tante Patty schon vor mir, wie sie mit einem riesigen Hut unter einem Baum an einem weißgedeckten Tisch mit Kuchen, Baisers und Erdbeermarmelade saß. Vergnüglich, anheimelnd, gemütlich; mir aber ging diese Abtei-Schule mit den gespenstischen Ruinen in der Nähe und dem drei Meilen entfernten Herrenhaus, dem Wohnsitz der mächtigen Verringers, nicht aus dem Sinn.
Immer noch daran denkend, zog ich mich zurück, aber kaum war ich fünf Minuten in meinem Zimmer, da kam Tante Patty herein. Sie warf sich, vor Anstrengung und Heiterkeit schnaufend, in den Sessel.
»Ich glaube, sie hat angebissen«, jubelte sie. »Ich denke, sie wird dir ein Angebot machen. Sie faßt stets rasche Entschlüsse. Darauf ist sie stolz. Schaffenbrucken hat den Ausschlag gegeben.«
»Ich bin sehr angetan.«
»Das hab’ ich gemerkt. Sie wird dir ein Angebot machen. Ich finde, du solltest es annehmen. Wenn’s dir nicht gefällt und sie dich grob behandeln sollte, kannst du jederzeit wieder gehen. Aber das wird sie nicht tun. Wenn du dein Tagewerk anständig verrichtest, werdet ihr gut miteinander auskommen. Ich kenne sie. Aber wie gesagt, sollte etwas schiefgehen, dann sind Vi und ich immer für dich da, das weißt du.«
»Du hast mir immer alles sehr leicht gemacht.« Ich war bewegt. »Nie werde ich vergessen, wie ich am Kai ankam und dich mit dem Hut mit der blauen Feder dort stehen sah.«
Tante Patty wischte sich die Augen, in denen Tränen der Rührung, aber auch Lachtränen standen. »Ach, der Hut. Den hab’ ich noch irgendwo. Die Feder dürfte etwas schäbig geworden sein. Ich könnte eine neue Feder dranstecken. Warum eigentlich nicht?«
»Ach Tante Patty«, sagte ich, »wenn Daisy Hetherington mir einen Posten anbietet, und ich nehme an, dann ist es nicht, weil ich nicht bei dir sein mag.«
»Natürlich nicht. Du mußt dein eigenes Leben leben. Die Jugend darf sich nicht bei den Alten verkriechen. Vi und ich haben unsere eigenen Interessen. Dein Leben fängt eben erst an. Es ist ganz richtig, daß du in die Welt hinausgehst, und wie gesagt, wenn du es richtig anstellst, eines Tages ... wer weiß? Das Haus ist nicht ihr Eigentum, weißt du. Sie hat es nur gemietet. Von diesen Verringers, von denen sie dauernd spricht. Sie fühlt sich dort wohl; und mir wäre es sehr recht, wenn du zu Daisy gingst. Ich habe wirklich großen Respekt vor ihr. Wenn es gutgeht, kann sich etwas Großes daraus entwickeln, und wenn nicht, dann war es wenigstens eine nützliche Erfahrung.«
Wir umarmten uns. Mit fröhlich verschwörerischer Miene ging sie auf Zehenspitzen hinaus. Ich legte mich hin und schlief gut nach der letzten Nacht mit den wirren Träumen.
Am nächsten Tag hatte ich eine lange Unterredung mit Daisy Hetherington. Das Ergebnis war, wenn ich zu Beginn des Frühjahrshalbjahres in ihre Schule kommen möchte, so würde sie mich gern nehmen. Ich sollte einen Stundenplan ausarbeiten ähnlich dem in Schaffenbrucken, und neben den Diskussions- und Konversationsstunden sollten die Mädchen bei mir Benehmen und Englisch lernen.
Das Vorhaben schien interessant, und da Daisy mit den Schilderungen der Schule, die zu einer Abtei gehörte, meine Neugier angestachelt hatte, war ich sehr geneigt, anzunehmen.
Ich zögerte jedoch aus Sorge um Tante Patty, die mich drängte, weil ihr mein Wohlergehen wichtiger war als ihr eigenes.
»Ich muß Ihre Antwort gleich nach Weihnachten in Händen haben«, sagte Daisy, und dabei ließen wir es bewenden.
Tante Patty war hocherfreut. »Wir haben es richtig angepackt«, frohlockte sie. »Nicht allzu eifrig. Daisy wird unmittelbar nach dem Weihnachtskonzert abreisen. Sie bleibt ja nur so lange da, um sich stolz zu brüsten, daß die Weihnachtssängerinnen des Colby-Abbey-Instituts für junge Damen viel begabter sind.«
Bei ihrer Abreise bedankte sich Daisy für unsere Gastfreundschaft und ermahnte mich, daß meine Antwort vor dem ersten Januar bei ihr eintreffen müsse.
Dann reisten die Mädchen ab. Wir sagten ihnen betrübt Lebewohl. Viele waren traurig, weil es das letzte Weihnachten in Grantley Manor war.
Das Weihnachtsfest war fast genauso wie immer. Es gab den traditionellen Gänsebraten und Plumpudding, und viele Nachbarn leisteten uns an den zwei Tagen Gesellschaft. Der Fiedler vom Dorf spielte uns auf, und wir tanzten in der Diele. Aber jedermann dachte daran, daß es das letzte Mal war, und dadurch kam unwillkürlich eine gewisse Traurigkeit auf.
Ich war richtig froh, als alles vorüber war. Jetzt mußte ich meine Entscheidung treffen. Eigentlich stand sie schon fest. Ich schrieb an Daisy Hetherington, daß ich ihr Angebot annähme und bereit sei, mit Beginn des Frühjahrshalbjahres bei ihr anzufangen. Wir besichtigten das neue Haus. Es war hübsch, wirklich bezaubernd, aber freilich recht unbedeutend im Vergleich mit der Villa.
Von Edward Compton hatte ich nichts mehr gehört. Ich war verwundert und verletzt, denn ich hatte mit einer Erklärung gerechnet. Es war wirklich ungewöhnlich. Manchmal dachte ich, ich hätte mir das Ganze nur eingebildet. Im Rückblick wurde mir klar, daß abgesehen von der Begegnung mit den anderen drei Mädchen, ich jedesmal mit ihm allein gewesen war – im Zug, auf der Fähre und im Hain. Manchmal glaubte ich, daß ich mir diese Begegnungen nur eingebildet hatte. Immerhin hatte er etwas an sich, das ihn von anderen Menschen unterschied.
Ich wußte wenig von Männern. Die meisten Mädchen hatten bestimmt schon mehr Erfahrung. Das lag wohl daran, daß ich so lange zur Schule gegangen war. Junge Männer waren in meinem Leben einfach nicht vorgekommen. Monique hatte ihren Henri und würde ihn heiraten. Frieda war vielleicht nicht mehr Männern begegnet als ich. Lydia hatte Brüder, und die brachten manchmal Freunde mit nach Hause. Sie hatte von ihnen erzählt, wenn sie aus den Ferien zurückkam. Aber ich hatte seit Kindertagen nur von Frauen umgeben gelebt. Sicher, es gab den Hilfspfarrer, einen schüchternen Mann um die zwanzig, und der Arzt hatte einen Sohn, der in Cambridge studierte. Keiner von ihnen war sehr romantisch. Edward Compton dagegen war ausgesprochen romantisch. Er hatte neue Interessen in mir geweckt. Vielleicht, weil er mir sehr deutlich gezeigt hatte, daß ich ihm gefiel ... daß er mich vorzog. Es schmeichelte einem, wenn man vor drei bei weitem nicht unattraktiven Mädchen dermaßen bevorzugt wurde. O ja, ich war bitter enttäuscht. Es hatte so romantisch begonnen ... und dann war es einfach im Sande verlaufen!
Vielleicht war dies mit ein Grund, warum ich auf Abenteuer aus war. Ich suchte die Herausforderung, wollte Neues sehen und erleben. Das würde mir gewiß geboten, wenn ich ans Colby-Abbey-Institut ging.
Als Tante Patty mir das neue Haus in Moldenbury gezeigt hatte, hatte ich mehr Begeisterung bekundet, als ich wirklich empfand, nur um ihr eine Freude zu machen. Wir hatten uns in dem ziemlich großen Garten umgesehen, hatten bestimmt, wo Tante Patty ihr Gartenhäuschen und Violet ihre Bienen haben würden, wir hatten mein Zimmer ausgesucht und besprochen, wie wir es einrichten würden.
Auf dem Heimweg mußten wir in London auf den Zug nach Canterton warten. Dort bemerkte ich einen Anschlag, auf dem die Züge nach Bury St. Edmunds verzeichnet waren, und in diesem Augenblick begann der Gedanke in mir zu reifen ...
Ich wußte, daß ich jetzt handeln mußte, allerdings war mir nicht ganz klar, wie ich mich verhalten sollte, wenn ich dort wäre.
Eigentlich wollte ich mich nicht auf die Suche nach ihm begeben, wollte mich lediglich vergewissern, daß er tatsächlich existierte und daß ich nicht geträumt und mir das Ganze nur eingebildet hatte.
Je mehr Abstand ich von der Angelegenheit hatte, um so geheimnisvoller erschien sie mir. Er war anders als alle, die ich bis dahin gekannt hatte. Er sah sehr gut aus mit seinen wie gemeißelten Zügen – ähnlich denen von Daisy Hetherington, nur daß ich bei ihr nicht zweifelte, daß sie ein lebendiger Mensch war! Als ich ihn mit meinen drei Freundinnen im Wald gesehen hatte, war er sehr wirklich gewesen, oder hatte ich mir vielleicht danach gewisse Dinge, die ihn betrafen, eingebildet? Es war wohl Elsas Geschwätz von den mystischen Sagen zuzuschreiben, daß ich in Gedanken den Mann zuweilen als Teil dieser Sagen sah. Konnte ich es mir eingebildet haben, daß ich ihn im Zug, auf der Fähre und hier in Canterton gesehen hatte? War alles Einbildung? Nein. Lächerlich. Ich war keine Träumerin. Ich war eine ausgesprochen nüchterne Frau. Es wäre ein erschreckender Gedanke, daß man sich gewisse Geschehnisse dermaßen einbilden konnte, daß man nicht ganz sicher war, ob sie sich tatsächlich abgespielt hatten.
Ich wollte Gewißheit. Deswegen kam mir beim Anblick des Anschlags mit den Zügen nach Bury St. Edmunds der Gedanke an eine Entdeckungsreise. Ich hatte Bury St. Edmunds erwähnt – es war die einzige Stadt, die ich in Suffolk kannte –, und er hatte gesagt, er sei dort in der Nähe zu Hause.
Croston. Das war der Name, den er genannt hatte. Die Kleinstadt in der Nähe von Bury St. Edmunds. Angenommen, ich führe dorthin und fände Compton Manor. Natürlich konnte ich dort keinen Besuch machen. Aber ich konnte mich überzeugen, daß er ein ziemlich ungehobelter junger Mann und daß ich eine vernünftige junge Frau war, die sich keinen Phantasien hingab und sich dann verwundert fragte, ob sie Wirklichkeit seien oder nicht.
Und dann bot sich die Gelegenheit. Es war mitten im Schulhalbjahr. Die Verhandlungen wegen des Hauses waren abgeschlossen. Anfang April wollte Tante Patty Grantley verlassen, und ich sollte mich dann zur Colby-Abbey-Schule begeben. Es herrschte eine rege Geschäftigkeit. Tante Patty hatte ihre Freude daran. Viele Möbel und andere Gegenstände mußten veräußert werden, und Tante Patty ließ an dem neuen Haus etliche Veränderungen vornehmen. Es war ein ständiges Kommen und Gehen. Violet wirkte abgespannt und sagte, sie wisse nicht, wo ihr der Kopf stehe. Tante Patty aber blühte auf.
Sie mußte den Architekten in Moldenbury aufsuchen, und da sie über Londen fahren mußte, beschloß sie, sich dort ein paar Tage aufzuhalten, um Einkäufe zu tätigen und sich um den Verkauf der in Grantley verbleibenden Schuleinrichtung zu kümmern; danach wollte sie nach Moldenbury weiterfahren. Ich sollte sie begleiten.
In London sagte ich, ich würde gern ein wenig länger bleiben, da ich noch einiges einkaufen wollte. Also blieb ich denn, während Tante Patty nach Moldenbury fuhr, im Smiths, dem kleinen behaglichen Familienhotel, wo Tante Patty immer abstieg, wenn sie nach London kam, und wo man sie gut kannte. Wenn sie nach London zurückkäme, wollten wir gemeinsam wieder nach Grantley fahren.
Wenn ich meine Forschungsreise jemals antreten wollte, so war jetzt die Zeit.
Früh am Morgen brach ich auf, und als der Zug mich nach Bury St. Edmunds trug, fragte ich mich, ob ich nicht etwas vorschnell handelte. Was, wenn ich ihm von Angesicht zu Angesicht begegnete? Welche Entschuldigung konnte ich dafür vorbringen, daß ich auf der Suche nach ihm war? Er war ja schließlich auch nach Canterton gekommen, oder? Ja, aber das hier war etwas anderes. Er hatte sehr deutlich gezeigt, daß er die Bekanntschaft ... oder Freundschaft ... oder was immer es sein mochte, nicht fortzusetzen wünschte. Daher war es nicht gerade schicklich, ihn ausfindig zu machen.
Nein, aber ich hatte ja auch nicht die Absicht, in Compton Manor vorzusprechen, falls ich es fände. Ich wollte in ein nahegelegenes Gasthaus gehen und diskrete Fragen stellen. Wenn die Leute von Suffolk so versessen auf Klatschgeschichten waren wie die Leute von Sussex, würde ich auf alle Fälle erfahren, was ich wissen wollte. Ich wollte ja, wie ich mir versicherte, lediglich herausfinden, ob es einen Mann namens Edward Compton überhaupt gab, damit ich mich von dieser absurden Vorstellung befreien konnte, daß ich an Halluzinationen litt.
Es war ein klarer kalter Morgen – recht belebend –, und während der Fahrt wurde ich immer aufgeregter. Pünktlich traf der Zug ein, und ich erkundigte mich sogleich, wie ich nach Croston käme. Man sagte mir, daß alle drei Stunden eine Nebenlinie nach Croston verkehrte, und wenn ich mich beeilte, würde ich den nächsten Zug gerade noch erreichen. Ich war voller Erwartung, als wir durch die schöne flache Landschaft ratterten. Am Bahnhof von Croston ging ich zu einem Mann, der ein Bahnbeamter zu sein schien. Es war ein älterer Herr mit grauem Bart und wäßrigen Augen. Er sah mich neugierig an. Offenbar bekam er nicht viele Fremde zu sehen.
»Ist Compton Manor hier in der Nähe?« fragte ich.
Er blickte mich merkwürdig an, dann nickte er. Das gab meiner Stimmung neuen Auftrieb.
»Was wollen Sie dort?« fragte er.
»Ich ... hm ... ich wollte bloß in die Richtung.«
»Ach so.« Er kratzte sich am Kopf. »Nehmen Sie den Fußpfad.
Der führt nach Croston. Dann die Straße entlang und nach rechts halten.«
Das ließ sich ja recht einfach an.
Croston bestand aus einer kurzen Straße mit ein paar strohgedeckten Hütten, einem Dorfladen, einer Kirche und einem Gasthaus. Ich bog rechts ab und ging weiter.
Ich war noch nicht weit gegangen, als ich einen alten Wegweiser sah. Die Hälfte war abgebrochen. Ich betrachtete ihn mir genauer. »Compton Manor«, las ich.
Aber welche Richtung? Es mußte den Feldweg entlanggehen, denn die einzige andere Richtung war die, aus der ich gekommen war. Ich lief also den Feldweg entlang, und als ich um eine Kurve bog, sah ich ein großes Haus.
Und dann stockte mir vor Entsetzen der Atem. Hier konnte ich nicht richtig sein. Und doch, der Wegweiser ...
Ich ging näher heran. Es war nur mehr ein Gemäuer. Die steinernen Mauern waren geschwärzt. Durch eine Öffnung in den versengten Wänden stieg ich in das Innere. Wo einst Zimmer gewesen waren, wuchsen Unkraut und Gras. Der Brand mußte also schon länger zurückliegen.
Das konnte nicht Compton Manor sein. Es mußte noch weiter entfernt liegen.
Ich ließ die geschwärzte Ruine hinter mir und kam zur Straße. Vor mir erstreckte sich freies Feld, und weil das Land so flach war, konnte ich meilenweit blicken. Ein Haus war nirgends zu sehen.
Erschöpft setzte ich mich am Straßenrand ins Gras. Ich stand vor einem Rätsel. Auf der Suche nach der Lösung des Geheimnisses war ich nur noch tiefer hineingeraten.
Es blieb mir nichts anderes übrig, als wieder zum Bahnhof zurückzukehren. Es waren etwa zwei Stunden Wartezeit bis zum nächsten Zug nach Bury St. Edmunds.
Langsam ging ich in die Stadt. Meine Reise war umsonst gewesen. Ich kam zur Kirche. Sie war sehr alt – normannisch, nahm ich an –, und nur wenig Leute waren zu sehen. Es war ziemlich dumm von mir gewesen, hierherzukommen.
Ich trat in die Kirche. Sie hatte ein schönes farbiges Glasfenster – ziemlich eindrucksvoll für so eine kleine Kirche – und ging zum Altar. Dann betrachtete ich eine Messingtafel, in welche die Worte »Zum Gedenken an Sir Gervaise Compton, Baronet von Compton Manor« eingraviert waren. Ich sah mich um und entdeckte noch mehr Gedenkstätten an die Familie Compton.
Während ich dort stand, vernahm ich Schritte hinter mir. Ein Mann kam mit einem Stapel Betkissen in die Kirche.
»Guten Morgen«, grüßte er, »oder besser, guten Tag.«
»Guten Tag«, erwiderte ich.
»Schauen Sie sich unsere Kirche an?«
»Ja. Sie ist sehr interessant.«
»Kommen nicht viele Besucher her. Dabei ist es eine der ältesten Kirchen im Land.«
»Das dachte ich mir.«
»Interessieren Sie sich für Architektur, Madam?«
»Ich verstehe nur wenig davon.«
Er machte ein enttäuschtes Gesicht. Er hätte mir wohl gern einen Vortrag über den normannischen Baustil im Vergleich zur Gotik gehalten. Wahrscheinlich war er der Kirchenvorsteher oder der Küster.
»Ich habe mir das abgebrannte Haus an der Straße angesehen«, sagte ich. »War das Compton Manor?«
»O ja, Madam. Das war Compton.«
»Wann ist es abgebrannt?«
»Oh, das muß so an die zwanzig Jahre her sein.«
»Zwanzig Jahre?«
»Eine furchtbare Tragödie. Es brach im Küchentrakt aus. Das Gemäuer steht noch. Ich frag’ mich, warum es nicht wieder aufgebaut wird. Die Mauern sind stabil. So wie die gebaut sind, halten sie tausend Jahre. Es wird immer wieder davon geredet, aber getan wird nichts.«
»Und die Familie Compton?«
»Ausgerottet ... in den Flammen umgekommen. Ein Knabe und ein Mädchen. Tragisch war das. Die Leute reden heute noch davon. Und Sir Edward und Lady Compton, die sind auch umgekommen. Die ganze Familie wurde ausgelöscht. Es war eine große Tragödie für die Ortschaft, denn die Comptons waren damals Croston. Seither gibt’s keine große Familie mehr, die unsere Mädchen in Dienst nimmt und sich um die Belange des Dorfes kümmert ...«
Ich hörte kaum noch zu. Ich fragte mich: Wie kann er Edward Compton von Compton Manor gewesen sein? Sie sind doch alle tot.
»Die meisten Leichen haben sie rausgeholt. Sie sind alle hier auf dem Friedhof begraben. Die Comptons haben eine eigene Ecke. Mein Vater hat oft von dem Begräbnis gesprochen. ›Crostons Trauertag‹ hat er’s genannt. Interessieren Sie sich für die Familie, Madam?«
»Hm, ich habe das Haus gesehen ... es ist eine furchtbar traurige Geschichte.«
»Ja. Die Comptons und Croston waren eins. Schauen Sie sich hier in der Kirche um. Überall finden Sie Spuren von ihnen. Hier vorne ist ihre Bank. Die hat seitdem niemand mehr benutzt. Ich zeige Ihnen die Gräber, wenn Sie mit hinauskommen wollen.«
Ich folgte ihm zu den Gräbern. Ich fröstelte leicht.
»Ein kühler Wind kommt auf«, stellte der Mann fest. »Wir haben ganz schön rauhe Winde hier. Bei Ostwind kann es schneidend kalt werden.«
Er ging zwischen den Grabsteinen hindurch, und wir kamen zu einer abgeteilten Ecke. Es war ein überaus gepflegter Teil des Friedhofs, mit Rosensträuchern und Lorbeer. Im Sommer mußte es hier sehr hübsch aussehen.
Der Mann erklärte: »Das ist Sir Edward. Sehen Sie, das Datum. Ah, es ist mehr als zwanzig Jahre her. Vierundzwanzig, um genau zu sein. All die Gräber hier ... Brandopfer. Das hier ist Lady Compton, und das da sind der kleine Edward und seine Schwester Edwina. Die armen Würmchen. Haben gar nicht richtig gelebt. Das gibt einem zu denken, nicht wahr. Er war zwei Jahre alt, und Edwina war fünf. Kommen in die Welt und werden wieder fortgeholt. Gibt einem zu denken ...«
»Es ist sehr liebenswürdig von Ihnen, mir das alles zu zeigen«, sagte ich.
»Mach’ ich doch gern. Kommen nicht viele her, die sich dafür interessieren. Aber Ihnen hab’ ich’s gleich angesehen.«
»Ja«, erwiderte ich, »und haben Sie vielen Dank.«
Ich wollte allein sein, wollte nachdenken. Hiermit hatte ich am allerwenigsten gerechnet.
Ich war froh, daß die Fahrt so lange dauerte. Dabei konnte ich nachsinnen über das, was ich gesehen hatte, und zu begreifen versuchen, was das bedeuten konnte; aber als ich in London ankam, war ich der Lösung des Rätsels nicht nähergekommen.
Konnte der Mann, den ich gesehen hatte, tatsächlich eine Erscheinung gewesen sein, ein Geist aus der Vergangenheit? Eine solche Annahme würde vieles erklären. Aber ich konnte mich nicht damit abfinden. Eines war gewiß – es gab keinen Edward Compton von Compton Manor, und zwar seit über zwanzig Jahren nicht mehr!
Wer aber war der Fremde, der einen solchen Eindruck auf mich gemacht hatte, der mich – ja, jetzt gestand ich es mir ein – voll Bewunderung angesehen und dessen Blick mir angedeutet hatte, daß er auf eine engere Beziehung hoffte?
Wie konnte ich mir das Ganze nur eingebildet haben? War er wirklich im Wald gewesen? War es möglich, daß in diesem Wald, der laut Lydia immer ein wenig gespenstisch war – dasselbe Wort, das Tante Patty in bezug auf die Abtei-Schule gebraucht hatte –, sich merkwürdige Dinge begaben?
Ich mußte den Vorfall vergessen und durfte meine Gedanken nicht weiter daran verschwenden. Es war eines von den merkwürdigen Erlebnissen, wie sie im Leben zuweilen vorkamen. Ich hatte davon gelesen. Es gab keine Erklärung dafür.
Das Klügste wäre, den ganzen Vorfall aus meinen Gedanken zu verbannen. Das aber war unmöglich. Wenn ich die Augen schloß, sah ich den Grabstein vor mir. Sir Edward Compton ... und den des kleinen Knaben, der ebenfalls Edward hieß.
Es war mysteriös ... und ziemlich beängstigend.