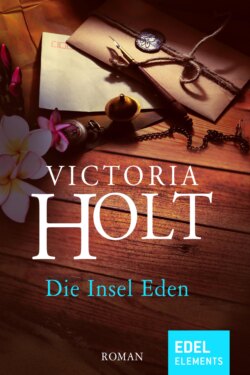Читать книгу Die Insel Eden - Victoria Holt - Страница 3
Die Gewitternacht
ОглавлениеIn der Nacht, als das heftige Gewitter niederging, wurde unser Haus wie viele andere im Dorf beschädigt. Ich war damals achtzehn Jahre alt, mein Bruder Philip dreiundzwanzig, und in den folgenden Jahren fragte ich mich oft, wie wohl alles ohne dieses folgenschwere Gewitter verlaufen wäre.
Es war eine der heißesten Perioden seit Menschengedenken. Die Temperatur kletterte auf über 30°, und es gab kaum ein Gesprächsthema, das sich nicht ums Wetter drehte. Zwei alte Leute und ein Baby starben infolge der Hitze; sogar in den Kirchen wurde um Regen gebetet. Die greise Mrs. Terry, die neunzig Jahre alt war und sich nach einer frivolen Jugend und einem nicht gerade tugendhaften mittleren Alter mit siebzig der Religion zugewandt hatte, erklärte, daß Gott England im allgemeinen und Klein- sowie Groß-Stanton im besonderen strafe, indem er das Vieh verhungern, die Flüsse austrocknen und der Ernte nicht genügend Feuchtigkeit zukommen ließ. Der Tag des Jüngsten Gerichts sei nicht mehr fern, und in der Gewitternacht waren selbst die Skeptischsten unter uns geneigt, Mrs. Terry recht zu geben.
Ich hatte mein ganzes Leben unter Granny M.s Aufsicht in der alten Tudorvilla am Anger verbracht. Das »M« bedeutete Mallory, das war unser Familienname; die eine Großmutter wurde nämlich Granny M. genannt, um sie von Granny C. zu unterscheiden – Granny Cresset; denn mit dem Tod meiner Mutter, die bei meiner Geburt starb, war der Krieg der Großmütter entbrannt.
»Beide wollten uns haben«, hatte Philip erklärt, als ich vier war und er schon neun und sehr klug. Wir kamen uns sehr wichtig vor, weil wir so begehrt waren.
Philip erzählte mir auch, Granny C. habe vorgeschlagen, daß sie eins von uns Kindern und Granny M. das andere nehmen solle – sie wollte uns teilen wie zwei Landstriche, um die sich zwei Generäle zankten. Danach dauerte es lange Zeit, bis ich Granny C. wieder trauen konnte; denn der Mensch, der mir im Leben am meisten bedeutete, war Philip. Er war immer dagewesen, mein großer Bruder, mein Beschützer, der Kluge, der mir fünf Jahre Erfahrung voraus hatte. Gelegentlich stritten wir uns, aber bei solchen Meinungsverschiedenheiten wurde mir erst recht bewußt, wie sehr ich ihn liebte; denn wenn er mir grollte, war mir schrecklich elend zumute.
Der Vorschlag, uns zu teilen, hatte zu unserem Glück bei Granny M. größte Entrüstung hervorgerufen.
»Sie trennen! Niemals!« lautete ihr Schlachtruf, und sie behauptete mit einem Nachdruck, der keinen Widerspruch duldete, daß sie als die Großmutter väterlicherseits den größeren Anspruch besitze. Granny C. unterlag auf der ganzen Linie und war gezwungen, dem Kompromiß zuzustimmen: kurze Sommerferien einmal jährlich in ihrem Haus in Ceshire, gelegentliche Tagesvisiten, Geschenke in Form von Kleidern für mich und Matrosenanzügen für Philip, Strümpfe und Fäustlinge für uns beide zu Weihnachten und Geburtstagen.
Als ich zehn Jahre alt war, erlitt Granny C. einen Schlaganfall und starb.
»Die hätte uns was Schönes eingebrockt, wenn sie die Kinder gekriegt hätte«, hörte ich Granny M. zu Benjamin Darkin sagen. Der alte Benjamin gehörte zu den wenigen, die Granny M. ab und zu widersprachen; er konnte es sich leisten, weil er seit seinem zwölften Lebensjahr im »Geschäft« war und mehr von der Herstellung von Landkarten verstand als sonst ein Mensch auf der Welt, so sagte Granny M.
»Man kann die Dame kaum für Gottes Handeln zur Rechenschaft ziehen, Mrs. Mallory«, erwiderte er mit mildem Vorwurf, und weil er Benjamin Darkin war, ließ Granny M. es dabei bewenden.
Granny M. trat in Klein-Stanton stets als große Dame auf. Wenn sie, wie damals täglich, nach Groß-Stanton mußte, fuhr sie in ihrer Kutsche mit dem Kutscher John Barton und dem kleinen Tom Terry, einem Nachkommen jener Unheilsprophetin, der zur Tugend bekehrten, über neunzigjährigen Mrs. Terry, hinten drauf.
Als Philip achtzehn und für mich der klügste Mensch der Christenheit war, erklärte er mir, daß Leute, die »in etwas einheirateten«, oftmals inniger daran hingen als jene, die hineingeboren waren. Womit er andeuten wollte, daß Granny M. keine geborene Herrin war. Sie hatte Großvater M. geheiratet und war so eine der Mallorys geworden, die in der Villa lebten, seit sie anno 1573 errichtet wurde. Dies wußten wir, weil die Zahl in die Front des Hauses eingemeißelt war. Aber eine stolzere Mallory als Granny M. konnte es nicht geben.
Großvater M. habe ich nie gekannt. Er starb, bevor die große Schlacht der Großmütter begann.
Granny M. regierte das Dorf ebenso tüchtig und selbstherrlich wie ihren eigenen Haushalt. Sie organisierte Feste und Basare und hatte ein wachsames Auge auf unseren gütigen Vikar und seine »wirrköpfige« Frau. Granny M. sorgte dafür, daß die Morgen-und Abendandachten gut besucht waren, und alle Dienstboten hatten sich jeden Sonntag in der Kirche einzufinden – und wenn bestimmte Pflichten dies verhinderten, mußte ein Schichtdienst eingerichtet werden, so daß, wer einen Sonntag ausließ, zumindest am nächsten anwesend war. Philip und ich mußten selbstverständlich immer dabeisein. Sittsam, wie es sich sonntags gehörte, gingen wir neben Granny M. über den Anger von der Villa zur Kirche und nahmen unsere Plätze in der Bank der Mallorys ein, neben der sich das Buntglasfenster mit der Darstellung Christi in Gethsemane befand, das ein Vorfahre 1632 gestiftet hatte.
Granny M.s größte Liebe aber gehörte wohl dem »Geschäft«. Es war ungewöhnlich, daß hohe Herrschaften sich mit geschäftlichen Unternehmungen befaßten und sich dermaßen um einen »Laden« kümmerten. Aber es war ja auch kein gewöhnlicher Laden. Es handelte sich eigentlich mehr um einen Kult zum Gedenken an lange verblichene Mallorys, denn die Mallorys waren große Erdumsegler. Seit Königin Elisabeths Zeiten hatten sie ihrem Vaterland gedient, und Granny M. war überzeugt, daß das Land den Mallorys ein gut Teil seiner Vorherrschaft zur See verdankte.
Ein Mallory war mit Drake gesegelt. Im 17. Jahrhundert hatten sie auch selbständig Abenteuerreisen unternommen, nur die eine Leidenschaft unterschied sie von anderen Abenteurern: Ihnen ging es nicht darum, die Schiffe der feindlichen Spanier und Holländer zu kapern, sondern sie beseelte der heiße Wunsch, die Welt zu kartieren.
Sie, sagte Granny M., hatten ihren Namen nicht nur in die Geschichte Englands, sondern auch in die Geschichte der Welt eingegraben. Sie hatten Hunderten, nein Tausenden von großen Abenteurern auf der ganzen Welt die Navigation erleichtert. Was diese unerschrockenen Segler – und nicht nur sie, sondern auch diejenigen, die das Land erforschten – den Karten der Mallorys verdankten, war unermeßlich.
Das »Geschäft«, ein altes dreistöckiges Gebäude, lag an der Hauptstraße von Groß-Stanton. Im Erdgeschoß befand sich zu jeder Seite der Steintreppe, die zum Haupteingang führte, ein Bogenfenster.
Hinter dem Laden ging es über einen Hof zu einem weiteren Gebäude, in welchem drei dampfgetriebene Maschinen aufgestellt waren. Dies war verbotenes Terrain, es sei denn, wir wurden von einem Erwachsenen begleitet. Mich interessierten die Maschinen nicht besonders, aber Philip dafür um so mehr.
In einem der Bogenfenster war ein in herrlichen Blau-, Rosa- und Grüntönen gemalter Globus ausgestellt, der mich als Kind ungeheuer faszinierte. Wenn ich in Begleitung von Granny M. den Laden besuchte, zeigte Benjamin Darkin mir einen ähnlichen Globus, der in dem zur Straße gelegenen Raum stand. Er drehte ihn rundherum und wies mir die großen blauen Meere, die Länder und ihre Grenzen, und nie unterließ er es, mich auf die rosafarbenen Teile auf dem Globus aufmerksam zu machen – die Gebiete, die zu England gehörten und die, wie ich annahm, nur dank der berühmten Mallorykarten erforscht wurden.
Philip fand die Besuche im Laden genauso aufregend, und wir unterhielten uns oft darüber. Wenn Granny M. in unser Schulzimmer kam, fragte sie uns meist über Geographie aus. Das Fach hatte Vorrang vor allen anderen, und Granny M. war von unserem Interesse entzückt.
In dem anderen Bogenfenster des Ladens war eine riesige Weltkarte aufgehängt. Es war prächtig anzuschauen, wie sich vor uns die Kontinente Afrika auf der einen und Nord- und Südamerika auf der anderen Seite erstreckten. Das Meer war leuchtend blau, das Land meistens dunkelbraun und grün. Unsere Inseln sahen links neben dem komischen Tiger, der Skandinavien bildete, ziemlich unbedeutend aus. Aber das Prächtigste von allem war der in Gold in die rechte Ecke geschriebene Name unseres Vorfahren: Jethro Mallory 1698.
»Wenn ich groß bin«, sagte Philip, »dann hab’ ich ein Schiff, und ich fahre hinaus und vermesse die Meere. Dann steht mein Name unten auf einer Karte.«
Granny M. hörte das mit glücklich strahlendem Gesicht, denn das war genau ihre Absicht; ich nahm an, sie gratulierte sich selbst, daß sie ihren Enkel aus den Klauen von Granny C. gerettet hatte, die vermutlich einen Architekten oder gar einen Politiker aus ihm hätte machen wollen, denn in ihrer Familie gab es mehrere, die diese Berufe ausübten.
Im Laufe der Jahre lernte ich etliches über unsere Familiengeschichte. Granny M. hatte sich nie mit der Ehe ihres Sohnes mit Flora Cresset abgefunden. Nach ihrem Porträt zu urteilen, das auf der Galerie hing, war Flora sehr hübsch, aber zart gewesen, was sich durch ihren Tod bei meiner Geburt bestätigt hatte; allerdings starben so viele Menschen im Kindbett – Und auch Babys –, daß es schon ein kleiner Triumph war, wenn man überlebte. Ich sagte zu Philip, es sei ein Zeichen für die Zähigkeit der Frauen, daß die Menschheit noch nicht ausgestorben sei, worauf er erwiderte: »Manchmal redest du wirklich Unsinn.«
Philip war nüchterner als ich. Ich war eine romantische Träumerin. Er interessierte sich für die praktische Seite der Kartographie (Kartenherstellung), für Berechnungen und Messungen, und es juckte ihn in den Fingern, Kompasse und andere wissenschaftliche Instrumente in die Hand zu nehmen. Ich dagegen fragte mich, wer in diesen fernen Ländern wohl leben mochte, und wenn ich die Inseln inmitten der blauen tropischen Meere betrachtete, spann ich mir alle möglichen Geschichten zusammen, so zum Beispiel, daß ich dorthin ging, unter den Menschen lebte und ihre Sitten und Gebräuche kennenlernte.
Philip und ich hatten ganz verschiedene Auffassungen. Vielleicht verstanden wir uns deswegen so gut. Jeder hatte etwas, was dem anderen fehlte, und wir hingen sehr aneinander, auch weil wir mutterlos waren – und in gewisser Weise sogar vaterlos, obgleich unser Vater nicht tot war.
Als mein Vater seine Braut in die Villa brachte, hatte er im Geschäft der Familie gearbeitet. Er war natürlich, so wie jetzt Philip, dazu erzogen worden. Wenn unsere Mutter nicht gestorben wäre, wäre er wahrscheinlich dageblieben und hätte mehr oder weniger getan, was Granny M. wünschte. Doch als Mutter starb, konnte er das Leben in der Villa nicht mehr ertragen. Es gab wohl zu viele Erinnerungen. Vielleicht hatte er auch eine Abneigung gegen das Kind, das ihn seine geliebte Frau gekostet hatte. Wie dem auch sei, er beschloß, für eine Weile fortzugehen und in Holland bei einer anderen Firma zu arbeiten, die ebenfalls Landkarten herstellte – nur für kurze Zeit, bis er sich von dem Verlust seiner Frau erholt hätte. In Holland lebten etliche führende Kartographen, und Granny M. hielt es damals für eine gute Idee, ihm so über seine Trauer hinwegzuhelfen, wobei er gleichzeitig neue Erfahrungen sammeln konnte.
Mein Vater aber blieb in Holland. Er heiratete eine Holländerin namens Margareta, deren Vater ein wohlhabender Exportkaufmann war, und zu Granny M.s Leidwesen trat mein Vater in dessen Geschäft ein und gab die Kartographie für einen Beruf auf, den Granny M. verächtlich als »Kommerz« abtat. Ich hatte Halbbrüder und eine Halbschwester, die ich nie gesehen hatte.
Damals wurde erwogen, daß Philip zu seinem Vater gehen sollte, aber das wußte Granny M. zu verhindern. Ich glaube, sie fürchtete, Philip könnte der Faszination des Exportgeschäftes erliegen. So richtete sich denn mein Vater mit seiner neuen Familie in Holland ein und schien es zufrieden, seine Kinder aus erster Ehe der Obhut von Granny M. zu überlassen.
An meinem 18. Geburtstag, etwa drei Monate vordem schlimmen Gewitter, verließ uns die Gouvernante, die ich sieben Jahre hatte. Da ich solcher Dienste nun nicht mehr bedurfte, wußte ich, daß Granny M. sich auf die Suche nach einem Ehemann für mich machte. Aber von den jungen Männern, die zu uns nach Hause eingeladen wurden, gefiel mir bis jetzt keiner. Auch konnte ich an so einer prosaischen Zurschaustellung von Ehekandidaten nichts Romantisches finden. Ich war gern mit den jungen Männern zusammen, aber der Gedanke, mein Leben mit einem von ihnen zu verbringen, war alles andere als aufregend.
Granny M. meinte: »Du mußt mehr gesellschaftlichen Schliff lernen, mein Liebes. Früher oder später muß eine junge Frau ihre Wahl treffen unter denen, die verfügbar sind. Wer die Wahl zu lange hinausschiebt, stellt oft fest, daß keine mehr da sind, unter denen man wählen könnte.«
Diese schreckliche Warnung traf bei einer Achtzehnjährigen auf taube Ohren. Das Leben war doch schön, warum es also ändern?
Granny M.s größere Umsicht galt jedoch Philip. Seine Ehefrau würde eines Tages in die Villa ziehen. Sie würde eine Mallory werden, ich hingegen würde bei meiner Heirat diesen berühmten Namen ablegen. Granny M. hatte Flora Cresset zweifellos mit Mißbilligung ins Haus kommen sehen. Sicher, sie hatte Granny M. zwei Enkelkinder geschenkt, aber Floras Zartheit hatte Granny ihren Sohn gekostet, der nun, wie Granny M. es ausdrückte, »von dieser Holländerin gekapert« worden war.
Nach der Heirat hatte sie für die Holländer nichts mehr übrig.
»Aber Granny«, erinnerte ich sie, »du hast doch selbst gesagt, daß einige der besten Kartographen aus jener Gegend stammen. Etliche der frühesten Forscher ... und Mercator selbst war Flame. Bedenke doch, was wir ihnen verdanken.«
Granny M. war hin und hergerissen zwischen der Freude, die sie immer befiel, wenn ich Interesse am Geschäft zeigte, und dem Unmut, wenn man ihr widersprach.
»Das ist lange her. Außerdem war es ein Holländer, der damit anfing, alte Schwarzweißkarten zu kaufen und zu kolorieren, um sie dann für viel Geld wieder zu verkaufen.«
»Das hat doch den anderen viel genützt!« sagte ich.
»Du bist ein eigensinniges Ding.« Aber Granny M. war nicht böse, und wie immer, wenn sie nicht sicher war, daß sie die Oberhand behalten würde, wechselte sie das Thema.
Sie freute sich, daß es für mich jedesmal ein Fest war, wenn ich das Geschäft besuchen durfte, und manchmal gingen meine Gouvernante und ich nachmittags nach Groß-Stanton, wo ich einige sehr angenehme Stunden im Geschäft verbrachte.
Ich unterhielt mich stets angeregt mit Benjamin. Landkarten waren sein Leben. Manchmal nahm er Philip und mich mit in das Gebäude, wo die Karten gedruckt wurden, und er berichtete von modernen Verbesserungen und daß man früher Holzblöcke benutzt und von Reliefdrucken gesprochen hatte, weil Teile des Holzes geschwärzt wurden, was sich beim Übertragen auf Papier reliefartig hervorhob.
»Heute«, sagte er stolz, »nehmen wir Kupfer.«
Die Technik langweilte mich, aber Philip stellte unzählige Fragen über die verschiedenen Arbeitsprozesse, während ich dabeistand, ohne richtig zuzuhören, und die Karten an den Wänden betrachtete. Die meisten waren Kopien derjenigen, die im 16., 15. und sogar 14. Jahrhundert angefertigt worden waren, und ich mußte an die unerschrockenen Forscher denken, die zum erstenmal in diese Gegenden kamen und neue Länder entdeckten.
Philip verbrachte viel Zeit im Geschäft, und als er 21 und mit seiner Ausbildung fertig war, arbeitete er dort den ganzen Tag mit Benjamin und lernte immer mehr. Granny M. war entzückt.
Es verdroß mich, übergangen zu werden, und Benjamin spürte das. Wie Philip, schien auch er mich zu bedauern, weil ich als Mädchen an diesem höchst faszinierenden Geschäft nicht teilnehmen konnte.
Eines Tages sprach Benjamin über das Kolorieren von Landkarten.
Er meinte, daß es sehr bald eine Neuerung geben würde und wir farbige Lithographien auf den Markt bringen könnten.
Er zeigte mir einen Druck – keine Karte, sondern ein rührseliges Familienbild. Es war farbig.
»Das hat ein Mann namens George Baxter gemacht«, erklärte Benjamin. »Sieh dir diese Farben an. Wenn wir die in unsere Karten bringen könnten ...«
»Warum geht das nicht?« fragte ich.
»Er hält seine Methode streng geheim. Aber ich habe eine Ahnung, wie es gemacht wird. Ich glaube, er benutzt eine Reihe Druckstöcke in verschiedenen Farben, aber dazu braucht er ein korrektes Raster. Bei Landkarten ist es allerdings schwieriger, da darf man keinen Millimeter verschieben. Sonst würde man ein Land um Kilometer größer oder kleiner machen, als es wirklich ist.«
»Also werden sie weiterhin von Hand koloriert?«
»Vorläufig ja. Bis wir uns eine andere Technik angeeignet haben.«
»Benjamin, könnte ich nicht auch kolorieren?«
»Du, Annalice? Aber das ist keine leichte Arbeit.«
»Wieso denken Sie, bloß weil sie schwer ist, kann ich sie nicht machen?«
»Nun, weil du ein Mädchen bist.«
»Mädchen sind nicht ganz blöd, Mr. Darkin.«
»Das habe ich nicht behauptet, Annalice.«
»Dann lassen Sie es mich versuchen.«
Man ließ mich einen Versuch machen, und ich machte es gut. Nach einiger Zeit durfte ich eine richtige Karte kolorieren. Welch ein Vergnügen! Das schöne Blau des Meeres ... wie liebte ich diese Farbe! Während der Arbeit glaubte ich, die Wellen an Korallenstränden plätschern zu hören. Ich sah dunkelhäutige Mädchen mit Blumen um Hals und Fußknöchel, ich sah kleine braune Kinder nackt ins Meer laufen und lange Kanus durch die Wellen pflügen. Ich war im Geiste dort.
Das waren abenteuerliche Nachmittage. Ich kletterte auf Berge und überquerte Flüsse, und die ganze Zeit überlegte ich, welche Länder es noch zu entdecken gäbe.
Benjamin Darkin meinte, daß ich der Arbeit bald überdrüssig würde, aber da irrte er sich. Je mehr ich schaffte, um so aufregender fand ich es. Und ich machte meine Arbeit gut. Schließlich konnten sie es sich nicht leisten, diese Karten durch unsorgfältiges Kolorieren zu verderben. Meine wurden von Benjamin persönlich geprüft und für ausgezeichnet befunden.
Allmählich lernte ich einiges über die Kunst der Kartographie. Ich studierte die alten Karten und begann mich für die Männer zu interessieren, die sie gemacht hatten. Benjamin zeigte mir eine Kopie von Ptolemäus’ etwa 150 n. Chr. entstandener Weltkarte und erzählte mir, auch der große Ptolemäus habe von Hipparchos gelernt. Ich vertiefte mich immer mehr in diese Arbeit und verbrachte lange Nachmittage mit Träumen von fernen Ländern und den Männern, die dort vor Jahren ihre Karten fertigten, damit andere den Weg leicht finden könnten.
Manchmal kam Granny M. und sah mir gedankenvoll bei der Arbeit zu. Ihre Enkelkinder machten ihr Ehre, beide waren von der Welt der Landkarten fasziniert. Mehr konnte sie nicht verlangen. Als die geborene Planerin tat sie nichts lieber, als anderer Leute Leben zu gängeln, denn sie war überzeugt, sie könne alles viel besser als die Betreffenden selbst.
Nun hatte sie sich in den Kopf gesetzt, daß Philip ein vernünftiges Mädchen heiraten sollte, die in die Villa ziehen und neue Mallorys zur Welt bringen würde. Die sollten das Geschäft in Groß-Stanton fortführen und gleichzeitig garantieren, daß der Gutsherrenstatus in Klein-Stanton beibehalten würde. Was mich betraf, wollte Granny M. warten, bis sie einen Mann für mich fand, der ihren Vorstellungen entsprach.
Bis dahin konnte ich weiter meine Ersatzabenteuer im Geschäft und das Leben in der Villa genießen.
Unsere Villa war ein höchst interessantes Haus. Es hieß, daß es hier spuke. Im zweiten Stockwerk gab es nämlich einen dunklen Winkel, dessen Bauweise ziemlich ungewöhnlich war. Am Ende eines Flurs befand sich unmotiviert eine Wand – fast als habe der Baumeister genug gehabt und beschlossen, den Flur vorzeitig abzuschließen.
Die Dienstboten gingen nach Einbruch der Dunkelheit nicht gerne durch diesen Flur. Warum wußten sie selbst nicht genau. Es war einfach so ein Gefühl. Es ging das Gerücht, daß vor vielen Jahren jemand im Haus eingemauert worden sei.
Als ich versuchte, von Granny M. etwas darüber zu erfahren, bekam ich zu hören: »Unsinn. So dumm würde kein Mallory sein. Es wäre höchst unbekömmlich gewesen.«
»Nonnen wurden auch eingemauert«, gab ich zu bedenken.
»Nonnen – die haben nichts mit den Mallorys zu tun.«
»Aber es war vor langer Zeit.«
»Meine liebe Annalice, es ist Unsinn. Und jetzt geh zu Mrs. Gow und bring ihr ein bißchen von der Kalbsfußsülze.«
Mrs. Gow war jahrelang unsere Haushälterin gewesen und lebte jetzt mit ihrem Sohn über dem Baugeschäft, das zwischen Klein-und Groß-Stanton lag.
Ich konnte nicht umhin, Granny M. zu bewundern, die eingemauerte Vorfahren ebenso rigoros abtat, wie sie Granny C. beschieden hatte.
Aber dieser Winkel im Flur ließ mir keine Ruhe. Nach dem Dunkelwerden ging ich oft dorthin, und immer hatte ich so ein bestimmtes gruseliges Gefühl. Einmal bildete ich mir sogar ein, etwas berühre mich sachte an der Schulter, und ich hörte ein zischendes Flüstern.
Ich glaubte dem uralten Gerücht, so wie ich auch von Korallenstränden träumte, wenn ich meine Karten kolorierte.
Ich besuchte regelmäßig das Grab meiner Mutter und pflegte dort die Sträucher. Oft dachte ich an sie. Durch Granny C.s Erzählungen, die immer ein bißchen weinte, wenn sie von ihrer Flora sprach, hatte ich mir ein Bild von ihr gemacht. Flora war schön, zu gut für diese Welt gewesen, sagte ihre Mutter. Sie war ein sanftes, liebenswertes Mädchen. Sie hatte mit sechzehn geheiratet, ein Jahr später wurde Philip geboren; sie war erst einundzwanzig, als sie starb.
Ich hatte Granny C. erklärt, wie furchtbar traurig es mich mache, daß Flora durch mich gestorben war. Granny M. hätte auf dergleichen nur erwidert: »Unsinn. Du verstehst nichts davon und hast deshalb nichts dazu zu sagen. So was kommt vor, und sie war eine schwache Natur.«
Granny C. hingegen war gefühlvoller. Sie hatte gesagt, meine Mutter habe ihr Leben gern für mich hingegeben. Aber das bekümmerte mich nur noch mehr. Nie ist einem schlimmer zumute, als wenn einem große Opfer gebracht werden.
Deshalb sprach ich mit Granny C. längst nicht so viel über meine Mutter, wie mir lieb gewesen wäre.
Doch ich besuchte ihr Grab. Ich pflanzte einen Rosenstrauch darauf und Rosmarin »zur Erinnerung«. Meistens ging ich heimlich hin, denn nicht mal Philip sollte wissen, daß ich mich an ihrem Tod schuldig fühlte. Manchmal sagte ich laut zu ihr, ich hoffe, sie sei jetzt glücklich, und es tue mir so leid, daß sie starb, als sie mich zur Welt brachte.
Eines Tages wollte ich Wasser für die Sträucher auf ihrem Grab holen. Ein Stück weiter weg waren eine alte Pumpe, Gießkannen und Krüge. Als ich mich vom Grab meiner Mutter abwandte, stolperte ich und fiel der Länge nach hin. Ich hatte mir die Knie etwas aufgeschürft, aber das war nicht von Bedeutung. Beim Aufstehen sah ich, daß der Stein, der meinen Sturz verursacht hatte, zu einer Einfassung gehörte.
Ich griff zwischen das Unkraut und entdeckte die Umfriedung einer kleinen Parzelle. Ich hatte immer gedacht, dieses Stück Land zwischen den Gräbern der Mallorys sei ungenutzt.
Neugierig rupfte ich etwas von dem wirren Gestrüpp aus, und tatsächlich – hier war ein Grab. Da es keinen Grabstein hatte, hatte ich es bisher nicht bemerkt. Aber jetzt entdeckte ich eine schmutzige Platte, deren Buchstaben fast unkenntlich waren.
Ich lief zur Pumpe und holte Wasser. Mit einem alten Lappen, mit dem ich mir nach dem Wässern der Pflanzen die Hände abzuwischen pflegte, wusch ich die Erde von der Grabplatte.
Ich fuhr bestürzt zurück. Ein Schauder lief mir den Rücken hinab, denn der Name auf der Platte hätte mein eigener sein können.
Ann Alice Mallory
gestorben am 6. Februar 1793
im Alter von 18 Jahren
Sicher, ich hieß Annalice, und auf der Platte waren die Namen getrennt ... aber die Ähnlichkeit erschreckte mich.
Ein paar Sekunden lang hatte ich das unheimliche Gefühl, mein eigenes Grab zu betrachten.
Wie gebannt starrte ich darauf. Wer war sie, die da auf ewig zwischen den toten Mallorys ruhte?
Aufgewühlt kehrte ich nach Hause zurück. Langsam beruhigte ich mich. Warum sollte nicht eine meiner Vorfahrinnen einen Namen ähnlich dem meinen haben? Viele Familien behielten Namen durch Generationen bei. Ann Alice. Annalice. Achtzehn Jahre. Sie war so alt wie ich, als sie starb.
Beim Abendessen sagte ich zu Granny M.: »Ich hab’ heute auf dem Friedhof ein Grab entdeckt ...«
Sie zeigte kein großes Interesse.
Ich sah Philip an. »Der Name war fast wie meiner.«
»Ach«, sagte Philip, »ich dachte, du wärst die einzige Annalice.«
»Sie hieß Ann Alice Mallory. Wer war sie, Granny?«
»Der Name Ann kommt in der Familie häufig vor. Und Alice auch.«
»Warum habt ihr mich Annalice genannt?«
»Das war meine Idee.« Granny M. sagte das, als sei es die bestmögliche Wahl gewesen und die Sache damit erledigt. »Es gab so viele Anns und Alices in der Familie. Ich fand beide Namen etwas gewöhnlich, aber weil du eine Mallory warst, habe ich die beiden zu einem verschmolzen. Du mußt zugeben, er ist wirklich apart.«
»Wie ich schon sagte«, bemerkte Philip, »du bist die einzige.«
»Das Grab da draußen ist völlig vernachlässigt.«
»Das ist oft so mit Gräbern, wenn die Insassen eine Zeitlang tot sind.«
»Sie wurde vor fast hundert Jahren begraben.«
»Das ist lange her«, sagte Philip.
»Es war ein seltsames Gefühl ... wie ich den Namen unter dem Unkraut fand ... fast wie mein eigener ...«
»Ich muß hingehen und nachsehen, ob’s da nicht auch einen Philip gibt«, sagte mein Bruder.
»Sicher, es gibt mehrere Philips.«
»Du hast eine morbide Vorliebe für Grabinschriften«, meinte Philip.
»Ich denke gern über all die Mallorys nach ... Menschen, die vor uns in diesem Haus gelebt haben ... irgendwie sind sie mit uns verbunden ... es ist eine lange Ahnenreihe.«
»Es freut mich, daß du so ein starkes Familiengefühl hast«, sagte Granny M. kurz und bündig, und damit war das Thema für sie erledigt.
Als ich wieder zum Friedhof ging, um das Grab vom Unkraut zu befreien, bat ich einen Gärtner um einen Strauch, den ich dort pflanzen wollte. Er kratzte sich am Kopf und meinte, jetzt sei keine Pflanzzeit. Aber er gab mir einen Rosenstrauch, und ich sagte, ich wolle auch Rosmarin.
»Das geht nie an«, erklärte er mißmutig.
Dann würde ich eben neue Pflanzen setzen, sagte ich mir. Ich pflanzte die Sträucher ein und säuberte die Grabplatte. Jetzt sah das Grab schon anders aus, wie wenn jemand sich etwas aus Ann Alice Mallory machte.
Ich dachte oft an sie. Sie war vermutlich in der Villa geboren worden, hatte zweifellos achtzehn Jahre dort gelebt. Und zudem trug sie meinen Namen. Sie hätte ich sein können.
Sie drängte sich pausenlos in meine Gedanken. Das war ziemlich unheimlich.
1793 war sie gestorben, vor nicht ganz hundert Jahren. Wie mochte es damals hier zugegangen sein? Ziemlich wie heute vermutlich. In den Dörfern hatte sich das Leben nicht sehr verändert. Draußen in der Welt fanden damals große Umwälzungen statt. Die Französische Revolution war im Gange, und in Ann Alices Todesjahr wurden der König und die Königin von Frankreich hingerichtet.
Heute lebte niemand mehr, der Ann Alice gekannt hatte. Selbst Mrs. Terry war noch nicht geboren, als Ann Alice starb. Mrs. Gow war neunundsiebzig. Vielleicht hatte sie von ihren Eltern etwas gehört? Die könnten Ann Alice gekannt haben.
Bei meinem nächsten Besuch bei Mrs. Gow wollte ich das Thema zur Sprache bringen.
Mrs. Gow war vierzig Jahre lang unsere Haushälterin gewesen. Sie war mit achtundzwanzig Witwe geworden und war damals in Stellung gegangen.
Die Gows waren, wie Mrs. Gow selbst es ausgedrückt hätte, der übrigen arbeitenden Bevölkerung unserer Gemeinde »um einiges überlegen«. Sie waren etwas Besseres mit ihrem Bau- und Tischlereigeschäft, das nicht nur für Klein- und Groß-Stanton, sondern auch für die nähere Umgebung da war.
Mrs. Gow war, wie alle Gows, immer ein wenig überheblich. Als ob sie jedermann ständig daran erinnern müßten, daß sie aus besserem Holz geschnitzt seien.
Ich kannte Mrs. Gow seit meiner Kindheit. Damals war sie eine stattliche, würdige Gestalt in Schwarz, vor der Philip und ich einen gewissen Respekt hatten.
Auch später noch hatte ich immer das Gefühl, mich ihr fügen zu müssen. Einmal fragte ich Granny M., warum sie Mrs. Gow so respektvoll behandelte. »Was ist so Besonderes an Mrs. Gow? Warum müssen wir so rücksichtsvoll mit ihr sein?«
»Sie ist eine gute Haushälterin.«
»Manchmal benimmt sie sich, als ob ihr die Villa gehört.«
»Das ist nun mal die Art guter Dienstboten, ihre Treue zu beweisen.« Granny M. schwieg eine Weile nachdenklich, dann sagte sie, als wundere sie sich allmählich selbst darüber: »Die Gows wurden in diesem Haus stets geachtet. Sie haben Geld ... Ein Glück für uns, daß wir eine Frau wie Mrs. Gow haben. Wir dürfen nicht vergessen, daß sie für ihren Lebensunterhalt nicht auf die Stellung angewiesen ist.«
Die Gows waren sichtlich etwas Besonderes. Granny M. verwöhnte Mrs. Gow stets etwas. Die gewöhnlichen Geschenke, die den Bedürftigen zukamen, waren nichts für sie – Decken und Kohle zu Weihnachten und dergleichen. Für Mrs. Gow mußte es ein Fasanenpaar sein, Kalbsfußsülze ... fast die Geschenke einer Freundin. Mrs. Gow gehörte nicht zur Oberschicht, aber auch nicht zur Dienstbotenklasse, sie schwebte selbstsicher dazwischen. Ihr Schwiegervater und ihr Mann waren, als sie noch lebten, immerhin Handwerksmeister gewesen. Und William, Mrs. Gows einziger Sohn, führte das blühende Geschäft nun fort.
Ich wollte Mrs. Gow aufsuchen und sehen, ob ich nicht etwas über Ann Alice in Erfahrung bringen konnte.
Ich überreichte ihr das Marzipankonfekt, das ich der Köchin abgeschwätzt hatte, weil Mrs. Gow es besonders gern aß, setzte mich und begann zu fragen.
»Ich habe neulich auf dem Friedhof das Grab meiner Mutter besucht.«
»So eine liebe, nette Dame«, bemerkte Mrs. Gow. »Ich werde nie den Tag vergessen, an dem sie von uns ging. Wie lange ist das her?«
»Achtzehn Jahre.«
»Ich hab’ immer gesagt, das steht sie nicht durch. Sie war zu zart. So ein hübsches Ding. Sie ging ihm über alles.«
»Sie meinen meinen Vater? Sie können sich bestimmt weit zurückerinnern, Mrs. Gow.«
»Ich hatte immer ein gutes Gedächtnis.«
»Ich hab’ auf dem Friedhof ein Grab entdeckt. Es war sehr vernachlässigt. Ich habe die Steinplatte ein bißchen saubergemacht, und da stand fast mein Name. Ann Alice Mallory. Sie starb 1793 mit achtzehn Jahren.«
Mrs. Gow schürzte die Lippen. »Das liegt weit zurück.«
»Fast hundert Jahre. Haben Sie je von ihr gehört?«
»Ich bin noch nicht hundert, Annalice.«
»Aber Sie haben so ein gutes Gedächtnis. Vielleicht hat Ihnen jemand von ihr erzählt.«
»Ich bin erst in diese Gegend gekommen, als ich Tom Gow geheiratet habe.«
»Ich dachte, vielleicht hat irgendwer in der Familie mal etwas erwähnt.«
»Mein Tom war älter als ich, und er ist erst 1810 geboren, und da war sie ja schon lange tot, nicht? Komisch, von der Jahreszahl, die du nanntest, wurde in der Familie oft gesprochen.«
»So?«
»Wann, sagtest du, ist sie gestorben? 1793? Ja, in dem Jahr wurde unser Geschäft gegründet. Ich hab’s mir gemerkt, die Zahl steht über dem Firmeneingang. ›Gegründet 1793‹ steht da. Das war dieselbe Zeit.«
Ich war enttäuscht. Mrs. Gow interessierte sich viel mehr für die Errungenschaften der Bau- und Tischlereifirma Gow als für das Grab. Sie ließ sich ausführlich darüber aus, wie beschäftigt ihr Sohn William sei und daß er daran denke, einen großen Teil seinem Sohn Jack zu übertragen. »Man muß ihnen Verantwortung geben, sagt William. Dann sieht man erst, Annalice, was zuverlässige gute Arbeit bewirken kann. Alle Welt weiß, daß die Gows die beste Arbeit leisten, und ich möchte einen hören, der mir da widerspräche.«
Bei Mrs. Gow kam ich nicht weiter, und ich beschloß, es bei Mrs. Terry zu versuchen.
Ich traf sie im Bett an. »Ah, Sie sind’s«, sagte sie. Ihre Augen versuchten gierig in meinem Korb zu erspähen, was ich mitgebracht hatte.
»Diese Hitze läßt nicht nach«, stöhnte sie kopfschüttelnd. »Na ja, das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Wissen Sie, daß sie letzten Samstag in der Scheune getanzt haben ... und noch nach Mitternacht, bis in den Sabbath hinein. Was kann man da erwarten? Und mich fragen sie dann, was ist mit der Dürre, hm? Was ist mit dem Vieh? Was ist mit dem vertrockneten Gras?«
»Warum fragen sie Sie, Mrs. Terry?«
»Tja, warum? Sie sollten lieber in ihre eigenen Seelen gucken, jawohl. Es ist ein Gottesgericht, und es kommt noch schlimmer, wenn sie nicht vom Übel ablassen. Bereuet, sage ich zu ihnen, solange noch Zeit ist.«
»Haben Sie je von Ann Alice Mallory gehört?«
»Äh? Wie bitte? Das sind Sie doch, oder?«
»Nein, ich bin Annalice. Ich meine Ann Alice ... zwei getrennte Namen.«
»Ich fand das immer überkandidelt. Warum konnten sie Sie nicht einfach Ann oder Alice nennen? Warum mußten sie so’n Kuddelmuddel machen und Ihnen zwei Namen in einem geben? Den Namen Ann hat man in der Villa oft gehört. Und Alice auch.«
»Ich meine beide zusammen. Ann Alice.«
»Nein, nie gehört.«
»Sie sind neunzig, Mrs. Terry. Ist das nicht wunderbar?«
»Das macht das gottesfürchtige Leben.« Sie besaß immerhin den Anstand, die Augen niederzuschlagen. Ihre Gottesfürchtigkeit währte erst zwanzig Jahre, und ich hatte gehört, daß Mrs. Terry, nachdem Jim Terry auf See den Tod gefunden hatte – und auch während seiner Abwesenheit zu seinen Lebzeiten –, nicht abgeneigt war, samstagsabends im Gebüsch oder gar in ihrer Hütte das zu treiben, was man hier »ein bißchen vom Besten« zu nennen pflegte.
»Ganz gewiß«, sagte ich und blickte so unschuldig drein, als hätte ich nie von ihrem heimlichen Tun gehört; denn ich wollte sie unbedingt bei guter Laune halten. »Ich hab’ auf dem Friedhof ein Grab entdeckt. Ann Alice Mallory. Sah wie mein Name aus, und ich dachte mit Schaudern, daß mein Grab ganz ähnlich sein wird, wenn ich sterbe.«
»Passen Sie nur auf, daß es Sie nicht erwischt, wenn Sie mit all Ihren Sünden beladen sind.«
»Daran hab’ ich eigentlich weniger gedacht.«
»Das ist ja das Schlimme. Die lugend von heute – die denkt nicht. Ich habe mir von meiner Daisy versprechen lassen, daß sie, wenn’s mit mir zu Ende geht, den Pastor holt, bloß daß er mir drüber weghilft ... obwohl ich’s nicht nötig hätte.«
»Bestimmt nicht. Ihr Platz im Himmel ist Ihnen sicher, und ich wette, man schickt Ihnen eine Engelschar, die Sie hinaufbegleitet.«
Sie schloß die Augen und nickte.
Ich war schrecklich enttäuscht. Kein Mensch schien etwas über Ann Alice zu wissen. Mrs. Terry war kurz nach ihrem Tod geboren. Sie war eine Hiesige, die ihr ganzes Leben in dieser Gegend zugebracht hatte. Der Name war doch gewiß mal erwähnt worden. Ich kannte nicht einen Dorfbewohner, den nicht interessierte, was in der Villa vorging.
»Mrs. Terry, das Mädchen in dem Grab starb, kurz bevor Sie geboren wurden. Haben Sie nie gehört, daß jemand sie erwähnt hat?«
»Nein. Darüber sprach man nicht.«
»Sprach man nicht? Meinen Sie, es war ein verbotenes Thema?«
»Ach, ich weiß von nichts.«
»Erinnern Sie sich, wovon man so in Ihrer Kindheit redete?«
»Ja, es ging immer um die Gows. Über die wurde dauernd geredet. Daß die Gows so hochnäsig waren und so ... und daß sie’s weit gebracht hatten mit ihrem eigenen Geschäft ... darüber haben die Leute geredet. Meine Mutter sagte immer, ›guck sich einer die Mrs. Gow an. Die mit ihrer roten Haube ... geht in die Kirche wie ’ne Dame. Keiner käm auf die Idee, daß die vor ein paar Jahren noch Habenichtse waren, wie wir anderen alle‹.«
»Jaja«, sagte ich etwas ungeduldig, »wir wissen, daß es die Gows zu was gebracht haben.«
»Oh, es war nicht immer so ... wie ich gehört habe.«
»Ihr Geschäft besteht schon lange Zeit. Seit 1793, steht über dem Firmeneingang. Gegründet 1793. Das war das Jahr, in dem das Mädchen starb.«
»Die eine geht in die Ewigkeit ein, und die andere verdient eine Menge Geld und bildet sich ein, sie ist was Besseres als wir anderen.«
»Sie können sich also nicht erinnern ...«
»Da war mal so ein Gerede ... nein, ich kann mich nicht erinnern. Irgendwas über eine von den Damen in der Villa. Sie ist plötzlich gestorben, glaube ich.«
»Ja, Mrs. Terry, ja!«
Mrs. Terry zuckte die Achseln.
Ich half nach: »Sie müssen doch etwas gehört haben.«
»Ich weiß nicht. Alle Menschen sterben. Bleibt nur zu hoffen, daß sie vorher Zeit hatten zu bereuen.«
Sie seufzte, und schon war sie wieder bei den Gows. »’s war nicht recht. Gab ’ne Menge Gerede deswegen. Die konnten nichts falsch machen, diese Gows. Ich erinnere mich, ist schon lange her. Ich war damals noch ein kleines Küken. Erwischt haben sie ihn. Wie hieß er doch gleich? Verflixt, könnt’ ich mich doch bloß erinnern. Ja doch, Tom, glaub’ ich. Richtig, Tom Gow. Auf frischer Tat ertappt mit ’nem Fasan in der Joppe ... hat gewildert. Wurde vor den Friedensrichter gebracht ... und was geschieht? Die Gows gehen zum Herrn, und eh’ man sich’s versieht, stolziert Wilderer Gow auf dem Platz herum, stolz wie zwei Pfauen. Kommt ungeschoren davon. Wie finden Sie das? Die reinste Vetternwirtschaft. War nicht recht. So was mögen die Leute nicht. Der Herr hätte wohl alles getan für die Gows.«
»Das muß Jahre her sein«, sagte ich ungeduldig. Der Triumph der Gows interessierte mich nicht.
»Wie gesagt«, fuhr sie fort, »ich war damals noch ’n kleines Küken. .. Aber so war es immer. Die Gows hatten immer die Villa hinter sich. So sagten jedenfalls die Leute.«
»Sie haben es sehr weit gebracht. Ich finde, dafür muß man sie bewundern.«
»Mit Hilfe von oben ... hieß es.«
»Es heißt aber auch, ›hilf dir selbst, so hilft dir Gott‹. Sie sollten das wissen, Sie stehen doch mit dem Allmächtigen auf viel vertrauterem Fuße als wir anderen.«
Ironie kam bei ihr nicht an. Sie nickte weise und sagte: »So ist es.«
Darauf verabschiedete ich mich. Mir war klargeworden, daß ich bei ihr nichts über Ann Alice Mallory in Erfahrung bringen würde.
Ich erzählte es Philip. »Warum dieses Interesse?« fragte er. »Bloß weil sie fast denselben Namen hatte wie du?«
»Es ist so ein Gefühl.«
Philip war immer skeptisch, was meine Gefühle betraf. Er lachte mich aus.
»Wollen wir reiten?« fragte er.
Ich ritt gern mit ihm und sagte ohne zu zögern zu. Aber Ann Alice ging mir nicht aus dem Sinn. Unentwegt dachte ich an die geheimnisvolle junge Frau in dem vergessenen Grab.
Die Hitze wurde noch schlimmer. In der Luft war eine Stille, die nichts Gutes zu verheißen schien.
Alle sagten, es sei zu heiß zum Arbeiten, zu heiß, sich zu rühren, fast zu heiß zum Atmen.
Es wird bald umschlagen, hieß es. Meine Güte, wir brauchen Regen.
Ich war wider alle Vernunft enttäuscht, weil meine Bemühungen, etwas über die Frau, die mich bis in meine Träume verfolgte, herauszufinden, sich als vergeblich erwiesen. Mrs. Gow war zu jung, um sich zu erinnern, und Mrs. Terry war so besessen von ihrem Neid auf die Gows, daß sie sich nicht auf das eigentliche Thema konzentrieren konnte. Wen konnte ich sonst noch fragen?
Warum ging mir das so nahe? Warum war es mir so wichtig? Bloß weil ich ihr Grab entdeckt hatte und ihr Name ähnlich wie meiner und sie ungefähr in meinem Alter war, als sie starb? Es war fast, als wäre sie lebendig gegenwärtig. Es sei typisch für mich, mich mit so einer Sache abzugeben, sagte Philip. Was spielte es heute noch für eine Rolle, was mit dem Mädchen geschah? Sie war tot, oder?
Sie war unglücklich, dachte ich. Ich fühle es. Es ist im Haus. Ich habe es an ihrem Grab gespürt.
Warum war ihr Grab als einziges so vernachlässigt? Es war, als hätte jemand sie beerdigt und gewollt, daß sie vergessen wurde.
An diesem Nachmittag war es zu heiß, um draußen spazierenzugehen oder zu reiten. Ich machte es mir im Garten auf einem Sessel im Schatten bequem und lauschte auf die Bienen. Der Lavendel war schon stark gelichtet; die Blüten waren gesammelt und zu Säckchen für Schubladen und Schränke verarbeitet worden, deshalb machten sich die emsigen kleinen Insekten über den blauen Ehrenpreis her. Träge beobachtete ich eine Libelle, die über den Teich schoß, an welchem eine Hermesfigur wie im Flug erstarrt stand. Ich sah es golden aufblitzen, wo die Fische im Teich herumschwammen. Überall herrschte Stille, als warte die ganze Natur gespannt, daß etwas geschah.
Die Ruhe vor dem Sturm, dachte ich.
Nach dem Abendessen saßen wir müßig herum. Granny M. sagte, heute sei es ihr zu heiß gewesen, um nach Groß-Stanton zu fahren, und ich konnte ihr nur beipflichten.
Wir zogen uns früh zurück. Ich schlief schlecht bei der Hitze, und gegen zwei Uhr morgens kam das Gewitter. Ich hatte nicht tief geschlafen und war augenblicklich hellwach, als anscheinend direkt über meinem Kopf ein Donnerschlag loskrachte. Ich fuhr hoch. Das langerwartete Gewitter war endlich da.
Ein Blitzstrahl erhellte das Zimmer, gefolgt von einem weiteren Donnerschlag.
Der Himmel schien in Flammen zu stehen. Nie hatte ich solche Blitze gesehen. Ich hörte Rumoren im Haus. Einige Dienstboten waren wohl auf den Beinen.
Die meisten Gewitter waren harmlos und gingen rasch vorüber. Dieses aber war direkt über uns, und die Donnerschläge folgten dicht nacheinander.
Ich stand auf, zog Morgenrock und Pantoffeln an, und da hörte ich den bislang lautesten Donnerschlag. Ich stand wie versteinert; mein Herz raste vor Schreck.
Dann hörte ich es wieder, direkt über uns. Ich vernahm ein Geräusch, wie wenn Mauern einstürzten.
Ich lief in den Flur hinaus. Philip war schon da.
»Irgendwo hat’s eingeschlagen«, rief er.
»Du meinst ... im Haus?«
»Ich weiß nicht.«
Wieder ein Krachen, dann noch eins und noch eins.
Granny M. erschien. »Was ist passiert?« wollte sie wissen.
»Wir wissen es noch nicht«, sagte Philip. »Ich glaube, es hat im Haus eingeschlagen.«
»Dann sollten wir lieber mal nachsehen.«
Ein paar Dienstboten waren hinzugekommen.
»Mr. Philip meint, es hat vielleicht eingeschlagen«, sagte Granny M. »Nur keine Panik. Viel kann es nicht sein, sonst hätten wir es längst gemerkt. Oh!«
Wieder ein Donnerschlag direkt über uns.
»Philip ... und Sie, Jennings.« Sie wies auf den Butler, der soeben am Schauplatz erschienen war. »Sie gehen am besten mal nachsehen. Was meinen Sie, wo könnte es sein?«
»Ich würde sagen, es ist das Dach, Mrs. Mallory.«
»Dann regnet es sicher rein«, sagte Philip. »Das sollten wir schleunigst herausfinden.«
Ich hörte den Regen an die Fenster schlagen, als Philip mit Jennings und ein paar anderen die Treppe hinaufrannte.
Granny M. und ich folgten ihnen.
Dann kam ein Ausruf von Philip. »Das Dach ist beschädigt.«
Ich nahm Brandgeruch wahr, aber es war kein Feuer. Das hätte der Regen auch schnell gelöscht. Wasser ergoß sich in den Flur.
Granny M. blieb ruhig und Herrin der Lage. Behältnisse aller Art wurden herbeigeschafft, um den Regen aufzufangen. Über all der Geschäftigkeit und Aufregung wurde das Gewitter fast vergessen.
Es donnerte immer noch.
Ein Hausmädchen schrie hysterisch.
»Das macht sie immer, wenn’s donnert, Miss«, erklärte mir ein Mädchen. »Das ist wegen ihrer Tante, die hat sie im Schrank eingeschlossen, als sie fünf war, und ihr gesagt, Gott wäre böse und bestrafte die Welt ...«
Zwei Mädchen gingen, ihre hysterische Gefährtin zu beruhigen.
Jennings war so ruhig wie Granny M. Er begutachtete den Schaden und sagte: »Vor morgen früh können wir nichts machen, Mrs. Mallory. Wir müssen Gow kommen lassen.«
Das Gewitter hielt eine Stunde an. Wir leerten Eimer voll Regenwasser aus und taten unser Bestes, um weiteren Schaden zu verhindern. Zu unserer großen Erleichterung hörte es dann zu regnen auf, und es tröpfelte nur noch in die Behältnisse.
»Was für eine Nacht«, sagte John Barton, der von seinem Quartier über dem Stall gekommen war, um zu helfen.
»Keine Sorge, Mrs. Mallory«, meinte Jennings. »Es ist halb so schlimm. Ich gehe zu Gow, sobald sie offen haben.«
»Und jetzt«, entschied Granny M., »könnten wir alle was Warmes vertragen. Heißen Punsch. Jennings, wollen Sie das bitte veranlassen. Für die Familie in meinem Salon, und sorgen Sie dafür, daß auch in der Küche serviert wird.«
Dann saßen wir in Granny M.s Zimmer und lauschten auf das schwache Donnergrollen in der Ferne, schlürften heißen Punsch und versicherten uns gegenseitig, daß wir ewig an diese Nacht zurückdenken würden.
Am nächsten Morgen kam William Gow, um den Schaden zu begutachten. Es habe auch in einem anderen Haus am Anger eingeschlagen, erzählte er. Die Leute sagten, es sei das schlimmste Gewitter seit hundert Jahren gewesen.
William Gow verweilte eine Zeitlang auf dem Dach, und als er herunterkam, machte er ein ernstes Gesicht.
»Schlimmer als ich dachte«, sagte er. »Gibt ’nen Haufen Arbeit ... abgesehen von der Dachreparatur, und Sie wissen ja, Mrs. Mallory, wie schwer die richtigen Ziegel für diese alten Häuser zu kriegen sind. Sie müssen mittelalterlich und trotzdem robust sein. Aber das ist noch nicht alles. Das Gebälk ist zum Teil beschädigt und muß ersetzt werden.«
»Gut, Mr. Gow«, sagte Granny M., »geben Sie mir nur Bescheid, was alles repariert werden muß.«
»Ich würde mir gern die Holzverkleidung an der Stelle, wo es eingeschlagen hat, genauer ansehen. Ein Teil muß ausgewechselt werden, sonst fault es und bricht ein.«
»Untersuchen Sie nur alles gründlich«, gebot Granny, »und dann reden wir darüber.«
Den ganzen Vormittag verbrachte er mit Klettern, Abklopfen und Prüfen.
Dieweil machte ich einen Spaziergang durchs Dorf. Viele Sträucher waren zu Boden gedrückt, aber die Luft roch frisch. Überall waren Pfützen, und das ganze Dorf war auf den Beinen, um die neuesten Nachrichten auszutauschen.
In einer plötzlichen Eingebung besuchte ich Mrs. Terry. Sie hockte mit der Miene eines alten Propheten im Bett. »So ein Gewitter, was Wunder! Ich saß im Bett und sagte: ›Gib’s ihnen, o Herr. Nur so kann man es diesen Sündern zeigen.‹«
Ich mußte an das Hausmädchen denken, das man als Fünfjährige in den Schrank gesperrt und dem man gesagt hatte, das Gewitter drücke den Zorn Gottes aus, und fand, die Rechtschaffenen konnten recht viel Unbill über die Welt bringen.
»Ich bin sicher, der Allmächtige war froh über Ihren Tip.« Ich konnte mir diese bissige Bemerkung nicht verkneifen.
»Man sagt, in der Villa hat es auch eingeschlagen«, fuhr Mrs. Terry fort, ohne auf meine Worte einzugehen. »Im Dach, nicht wahr?« Ich glaubte Enttäuschung zu vernehmen, weil der Schaden nicht größer war. »Und bei den Carters auch. Na, das sind ja auch richtige Herumtreiber. Und stellen Sie sich vor, ihrer Amelia haben sie ein goldenes Kettchen mit Medaillon gekauft. In ihrem Alter.«
»Und die Beschädigung ihres Hauses ist nun die Strafe, weil sie sich herumtreiben und ein goldenes Medaillon gekauft haben?«
»Ich weiß nicht. Alle Menschen bekommen ihre verdiente Strafe. So steht es in der Bibel.«
»So? Wo denn?«
»Ist doch egal wo. Hauptsache, es steht drin.«
»Ich bin richtig froh, daß Sie es überlebt haben, Mrs. Terry.«
»Oh, ich hab’ gewußt, daß mir nichts passiert.«
»Offensichtlich stehen Sie unter dem Sonderschutz des Himmels. Aber die Rechtschaffenen kommen nicht immer davon. Denken Sie an die Heiligen und Märtyrer.«
Aber Mrs. Terry wollte sich nicht auf ein theologisches Streitgespräch einlassen. Sie murmelte nur: »Das wird ihnen eine Lehre sein ... vielleicht.«
Als ich wieder zu Hause war, ging ich nach oben, um zu sehen, wie William Gow und sein Gehilfe vorankamen. Ich traf Gow in dem Flur, den ich den Spukwinkel nannte. »Ich hab’ mir diese Wand angeguckt, Miss Mallory. Die Feuchtigkeit ist durchgedrungen. Sehen Sie sich das an. Die ist total morsch.«
»Was schlagen Sie vor?«
»Ich denke, wir sollten die Wand einreißen. Ich versteh’ gar nicht, was die hier zu suchen hat. Die Vertäfelung ist nicht aus demselben Material wie der übrige Flur.«
»Meine Großmutter ist bestimmt einverstanden, daß Sie tun, was Sie für richtig halten.«
Er beklopfte die Wand und schüttelte den Kopf. »Ist schon merkwürdig«, meinte er. »Ich sprech’ mal mit Mrs. Mallory.«
Es folgte eine ausführliche Besprechung über die nach dem Gewitter notwendig gewordenen Reparaturen. Der Schaden war gar nicht so groß, trotzdem waren mehr Arbeiten erforderlich, als ich anfangs dachte. Das Dach war von größter Wichtigkeit und wurde sofort in Angriff genommen, und anschließend nahmen sich William Gow und seine Leute das Innere des Hauses vor.
Mich interessierte besonders die Wand, die abgerissen werden mußte, weil sie sich in dem Flur befand, wo es, wie die Dienstboten meinten, spukte, und als die Leute damit anfingen, richtete ich es ein, daß ich zu Hause war.
Ich sah ihnen bei der Arbeit zu, und so kam es, daß ich als erste das Zimmer betrat.
Wir wollten unseren Augen nicht trauen. Eine Menge Staub, Steine und Gips bildete so etwas wie einen Nebel, aber da war es ... ein richtiges Zimmer. Es sah aus, als hätte jemand es nur mal eben verlassen und jeden Moment zurückkehren wollen.
William Gow rief aus: »Ja, ist denn das die Möglichkeit!«
Sein Gehilfe murmelte: »Heiliger Strohsack!«
Ich starrte hinein und war schrecklich aufgeregt. »Es war also wirklich zugemauert!« rief ich. »Das ist höchst ungewöhnlich. Das mußte doch einen Grund haben.«
Ich trat hinein. »Seien Sie vorsichtig«, hielt mich William Gow zurück. »Es muß seit Jahren verschlossen gewesen sein. Die Luft ist bestimmt nicht gut. Warten Sie lieber noch etwas, Miss Mallory.
»Also so was!« rief ich. »Es sieht aus, als wäre eben jemand hinausgegangen.
»Bleiben Sie lieber weg von dem vielen Staub, Miss Mallory. Ist nicht gesund. Lassen Sie erst mal Luft rein. Wir reißen die ganze Wand runter, Bill. So was Seltsames hab’ ich noch nie gesehen.«
Meine Ungeduld war so groß, ich mußte einfach in das Zimmer, aber ich beherrschte mich noch eine halbe Stunde. Ich stand wartend herum, fragte ständig, ob ich jetzt hineingehen könne. Schließlich meinte William Gow, als der Staub sich etwas gesetzt hatte, es sei genug frische Luft in das Zimmer gedrungen. Und zusammen gingen wir hinein.
Es war kein großer Raum, und wohl deshalb war es möglich gewesen, ihn zu verbergen. Er enthielt ein Bett mit blauen Samtvorhängen – jedenfalls schien das ihre Farbe zu sein, soweit man es unter der Staubschicht sehen konnte. Der Teppich auf dem Boden war dunkelblau. Außerdem gab es noch eine kleine Kommode, zwei Stühle und einen Frisiertisch. Auf einem Stuhl lagen ein Umschlagtuch aus Spitze und ein Paar Handschuhe. Ich betrachtete die Dinge voller Staunen. Man hatte den Eindruck, daß jemand hier gewohnt hatte bis zu der Minute, da beschlossen wurde, das Zimmer verschwinden zu lassen, und daß wer immer es war, keine Zeit hatte, das Tuch wegzuräumen oder die Handschuhe an sich zu nehmen. Es mußte eine Frau gewesen sein – falls ihr die Sachen gehörten. Und es war das Zimmer einer Frau, dessen war ich sicher. Es hatte etwas Feminines. Der Frisiertisch hatte einen gerüschten Volant, und obenauf lag griffbereit ein Handspiegel.
»Dort drüben war mal ein Fenster«, sagte William Gow neben mir.
»Natürlich. Es muß ein Fenster dagewesen sein.«
»Zugemauert«, stellte er fest. »Sieht aus, als wäre es in aller Eile gemacht worden.«
Ich starrte ihn an. »So etwas Seltsames«, staunte ich. »Wie kommt jemand dazu, ein Zimmer einfach zuzumauern und dann zu vertäfeln?«
Er zuckte die Achseln. Er war kein sehr phantasievoller Mensch.
Ich fuhr fort: »Ich hätte gedacht, man würde vorher noch die Möbel ausräumen.«
Er antwortete nicht. Seine Augen hatten etwas an dem Holz der Vertäfelung entdeckt.
»Was ist das?« fragte ich.
»Das Markenzeichen.«
»Was für ein Markenzeichen?«
»Gows Markenzeichen.«
»Wo?«
Er zeigte es mir. Es war ein winziges Eichhörnchen, das aufgerichtet saß, mit einer Nuß zwischen den Pfoten, den buschigen Schwanz in die Höhe gereckt.
Ich sah Gow fragend an, und er fuhr fort: »Ein Gow hat die Holzverkleidung gemacht. Muß mein Großvater gewesen sein. Er hat das Markenzeichen eingeführt. Wir benutzen es noch heute bei unseren Tischlerarbeiten.«
»Ja, das ist anzunehmen. Ihre Familie macht hier seit Generationen die Zimmermannsarbeiten.«
»Das versetzt einem einen ganz schönen Schreck«, sagte William Gow.
Ich fand das recht milde ausgedrückt, aber das eingeritzte Markenzeichen interessierte mich nicht weiter. Ich war viel zu überwältigt von der Entdeckung des Zimmers, viel zu neugierig, wer es bewohnt haben mochte und warum man es für nötig befunden hatte, es unzugänglich zu machen.
Als Granny M. es erfuhr, war sie baß erstaunt. Ich ging mit ihr und William Gow hinauf. Auch sie fand es seltsam, daß man die Möbel nicht entfernt hatte, bevor man das Zimmer hinter einer Holzverkleidung verbarg. »Und warum«, meinte sie, »haben sie es nicht einfach abgeschlossen, wenn sie es nicht mehr benutzen wollten?«
»Die Mallorys haben sich zeitweise schon recht merkwürdig benommen«, fuhr sie fort, womit sie sich sachte von der Familie distanzierte. Das tat sie sehr selten. Nur wenn sie nicht gerade vorbildlich handelten, sagte sie sich vorübergehend von ihnen los.
»Es muß doch einen Grund gehabt haben«, überlegte ich.
»Das werden wir wohl nie erfahren«, entgegnete Granny M. »So, und was nun? Ich denke, wir untersuchen zuerst mal die Möbel. Sie sagten, da war mal ein Fenster? Das könnten wir doch als erstes wiederherstellen. Und die Möbel ... wie lange mögen die wohl eingeschlossen gewesen sein? Wer kann das sagen? Die räumen wir sofort heraus.«
William Gow sagte: »Ich bitte um Verzeihung, Mrs. Mallory, aber lassen Sie sie lieber noch ein, zwei Tage stehen. Hier muß erst mal Luft rein. Es ist ungesund ... verstehen Sie?«
»Gut, lassen wir Luft herein. Geben Sie allen Bescheid, daß niemand hier hinein darf, bis ich es erlaube. Es wird bestimmt eine Menge Gerede geben. Sagen Sie den Leuten, daß es hier nichts zu sehen gibt. Dies ist keine Ausstellung.«
»Geht in Ordnung, Mrs. Mallory. Und wer hier reingeht, soll sich ein bißchen vorsehen. Ich weiß nicht, in welchem Zustand die Balken und der Fußboden nach so vielen Jahren sind.«
»Wir verändern nichts, bis Sie es uns sagen, Mr. Gow.«
»Ich möchte zuerst alles gründlich untersuchen, Mrs. Mallory, um sicherzugehen, daß keine Gefahr besteht, bevor etwas entfernt wird.«
»Wir werden uns danach richten.«
Ich ging mit Granny M. zu Philip hinunter. Er mußte unbedingt das Zimmer sehen. An diesem Abend sprachen wir fast nur über unsere Entdeckung.
Ich lag im Bett und konnte nicht einschlafen. Die Entdeckung hatte mich mehr erregt als alle anderen. Warum? fragte ich mich immerzu. Wie merkwürdig, daß jemand sich die Mühe machte, ein Zimmer verschwinden zu lassen. Warum es nicht einfach abschließen, wie Granny M. schon sagte?
Es ging mir nicht aus dem Sinn. Jede Einzelheit hatte ich mir eingeprägt. Das Bett mit den Samtvorhängen ... grau geworden vom jahrelangen Staub. Spinnweben hingen an der Decke. Ich sah den Frisiertisch mit dem Spiegel vor mir, den Stuhl mit dem Tuch und den Handschuhen. Hatte sie sie gerade ausgezogen, oder wollte sie sie gerade anziehen? Die Kommode ... was mochte wohl in den Schubladen sein?
Ich wälzte mich hin und her. Morgen früh wollte ich nachsehen. Was konnte das schon schaden? Ich würde vorsichtig sein. Was hatte William Gow angedeutet? Daß der Fußboden nachgeben könnte? Daß ich von der schlechten Luft vergiftet werden könnte?
Ich war plötzlich besessen von dem Verlangen, sogleich hinzugehen. Warum nicht? Ich blickte an die Decke. Dort die Treppe hinauf... den Flur entlang ...
Mein Herz fing unangenehm rasch zu klopfen an. Ein leichter Schauder durchlief mich. Halb glaubte ich an das Dienstbotengerede, daß es dort spukte, und jetzt nach der Entdeckung schien es mir um so wahrscheinlicher.
Warte bis morgen früh, sagte mein feiges Ich.
Aber es war natürlich eine Herausforderung. Wie konnte ich denn schlafen, wenn mir diese Gedanken im Kopf herumgingen und ich mich ständig fragte: Warum? Warum?
Behutsam stieg ich aus dem Bett, fuhr in Pantoffeln und Morgenrock. Mit zitternden Fingern zündete ich eine Kerze an.
Dann öffnete ich meine Tür und lauschte. Es war ganz still im Haus. Ich stieg die Treppe hinauf, hielt auf jeder Stufe inne. Gottlob kannte ich das Haus so gut, daß ich genau wußte, wo die knarrenden Bretter waren.
Jetzt war ich in dem Flur. Der Staub hatte sich immer noch nicht ganz gelegt. Ich nahm einen seltsamen Geruch wahr, es roch nach Moder, Feuchtigkeit, nach etwas, das nicht ganz von dieser Welt war.
Ich stieg über ein herausgebrochenes Stück Holz und stand im Zimmer.
Ich leuchtete die Wände und die Decke ab. Im Kerzenlicht traten die Flecken noch deutlicher hervor als tagsüber bei dem Licht, das durch ein Fenster im Flur hereinfiel. Was waren das für Flecken an der Wand beim Bett ... und auch auf der anderen Wand? Ich hob die Kerze hoch. Ja, auch an der Decke.
Fast hätte ich kehrtgemacht und wäre davongelaufen.
Ich hatte das Gefühl, daß dieses Zimmer ein schreckliches Geheimnis barg. Aber so verängstigt ich auch war, der Drang zu bleiben war stärker als meine Furcht. Es war eigentlich weniger ein Zwang, sondern eher eine Verlockung zu bleiben.
Vielleicht habe ich mir das hinterher nur eingebildet. Und doch glaubte ich, daß etwas ... irgend jemand ... mich in dieser Nacht hier heraufgerufen hatte ... weil ich diejenige sein sollte, die es entdeckte.
Mir schien, ich stand minutenlang da, und doch konnten es nur Sekunden gewesen sein. Ich sah mich im Zimmer um, und immer wieder kehrten meine Augen zu den Flecken an Wänden und Decke zurück.
»Was hat das nur zu bedeuten?« flüsterte ich vor mich hin.
Gebannt lauschte ich, als erwartete ich eine Antwort.
Vorsichtig trat ich einen Schritt vor. Die Kommode zog mich magisch an, und impulsiv ging ich hin. Ich stellte meine Kerze darauf ab und versuchte die obere Schublade aufzuziehen. Es ging schwer, aber nach einiger Anstrengung bewegte sie sich. Ich bückte mich und blickte hinein: Ein kleiner Hut aus grauem Chiffon mit einer kleinen Feder, die mit einer mit Edelsteinen besetzten Brosche festgesteckt war, daneben ein zweiter Hut, mit Margeriten verziert.
Ich schob die Schublade wieder zu. Wie ein Eindringling kam ich mir vor. Mir war, als ob mir irgendwo in diesem seltsamen Zimmer mitten in der Nacht Augen folgten, und ich hatte das unheimliche Gefühl, daß. sie mich zwangen, meine Suche fortzusetzen.
Während ich die Schublade schloß, bemerkte ich, daß aus einer zweiten etwas herausschaute – als sei sie in aller Eile zugeschoben worden. Mit ein wenig Mühe gelang es mir, sie zu öffnen. Sie enthielt Strümpfe, Handschuhe und Schals. Ich langte hinein und befühlte sie. Sie waren sehr kalt und feucht. Irgendwie stießen sie mich ab. Geh wieder ins Bett, gebot mir mein gesunder Menschenverstand. Was tust du hier mitten in der Nacht? Warte bis morgen und untersuche das Zimmer mit Philip und Granny M. Was würden sie sagen, wenn sie wüßten, daß ich schon hier war?
Ich hatte ein paar Sachen herausgenommen, und als ich sie wieder zurücklegte, berührten meine Finger etwas. Es war ein Stück Pergament, zusammengerollt wie eine Schriftrolle. Ich öffnete es. Es war eine Landkarte. Flüchtig betrachtete ich sie. Es schien sich um mehrere Inseln in einem weiten Meer zu handeln.
Vorsichtig rollte ich das Pergament wieder zusammen, und als ich es wegsteckte, stieß meine Hand an etwas anderes.
Mein Herz schlug so heftig wie nie. Es war ein großes, ledergebundenes Buch. Auf dem Deckel war das Wort Tagebuch eingeprägt.
Ich legte es auf die Kommode und schlug es auf. Nur mit Mühe konnte ich einen Schrei unterdrücken, denn auf dem Deckblatt standen die Worte: »Ann Alice Mallory zum 16. Geburtstag, im Mai 1790.«
Ich klammerte mich an der Kommode fest, denn mir war vor Schreck ganz schwindlig. Das Buch gehörte dem Mädchen in dem vergessenen Grab!
Ich weiß nicht, wie lange ich dort stand und die aufgeschlagene Seite anstarrte. Mir war, als sei ich von einer übernatürlichen Macht geleitet worden.
Sie hatte mich das Grab entdecken lassen und jetzt... das Buch.
Mit zitternden Fingern blätterte ich die Seiten um, die mit einer kleinen, leserlichen Handschrift beschrieben waren.
Jetzt glaubte ich, den Schlüssel zu meinem Geheimnis in Händen zu haben. Dies war das Mädchen, das in dem Grab beerdigt und vergessen wurde, die Besitzerin der flotten Hüte in der Schublade, des Umschlagtuches, der Handschuhe. Sie war Ann Alice Mallory – meine Namensvetterin.
Das alles mußte etwas zu bedeuten haben. Wie unter Zwang war ich zu der Entdeckung hingeführt worden, und mir war, als beobachte sie mich, das geheimnisvolle Mädchen in seinem Grab, als wünsche sie, daß ich ihre Lebensgeschichte erfahre.
Ich nahm das Tagebuch und wandte mich zum Gehen. Dann fiel mir die Landkarte ein, die ich in die Schublade zurückgelegt hatte. Ich nahm sie an mich, ergriff meine Kerze und ging leise aus dem Zimmer.
In meiner Schlafkammer sah ich mich im Spiegel der Frisierkommode. Weit aufgerissene Augen blickten mir aus bleichem Gesicht entgegen. Noch immer zitterte ich vor Erregung.
Ich betrachtete das Tagebuch, das ich auf meinen Frisiertisch gelegt hatte. Dann entrollte ich die Landkarte. In einem weiten Meer lag im Norden eine Inselgruppe und in einiger Entfernung eine einzelne Insel, daneben eine Beschriftung, klein und nicht sehr deutlich. Ich entzifferte die Worte: Insel Eden.
Gern hätte ich gewußt, wo sie lag. Ich mußte sie Philip und Benjamin Darkin zeigen. Die würden es sicher wissen.
Doch zuvor wollte ich unbedingt das Tagebuch lesen.
Irgendwo schlug eine Uhr eins. Heute nacht würde ich sowieso nicht schlafen, das stand fest. Ich würde nicht eher ruhen, bis ich wußte, was in dem Tagebuch stand.
Ich zündete noch eine Kerze an, zog Morgenrock und Pantoffeln aus und ging ins Bett. Aus Kissen machte ich mir eine Rückenlehne, dann schlug ich das Tagebuch auf und begann zu lesen.