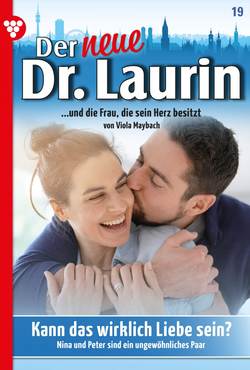Читать книгу Der neue Dr. Laurin 19 – Arztroman - Viola Maybach - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление»Guck mal, da drüben ist Per«, sagte Cleo Anders. »Sieht aus, als hätte er den halben Laden leergekauft.«
Nina Erichsen folgte dem Blick ihrer Freundin. Sie schaffte es, mit gleichmütiger Stimme zu sagen: »Er will heute Abend kochen.«
Dabei schlug ihr das Herz bis zum Hals, und nicht zum ersten Mal fragte sie sich, was plötzlich mit ihr los war. Per Ziemer war ihr Stiefvater. Ihre Mutter und er hatten geheiratet, als Nina elf Jahre alt gewesen war, vor neun Jahren also. Zur großen Freude ihrer Mutter hatten sie sich von Anfang an gut vertragen, aber das war auch nicht schwer gewesen. Nina kannte kaum jemanden, der Per nicht mochte. Er war ein so liebenswerter, kluger Mann!
Valerie Erichsen hatte ihrer Tochter erst zwei Jahre nach der Hochzeit erzählt, warum sie so lange gezögert hatte, Per zu heiraten. »Er ist ja noch jünger als ich, Nina, und ich weiß, wie das ist, wenn man zu früh Verantwortung übernehmen muss. Ich war schließlich erst siebzehn, als ich dich bekommen habe!«
»Aber Per war schon fünfundzwanzig, als ihr geheiratet habt, Mami! So jung ist das ja nun auch wieder nicht.«
»So, findest du?«
»Ja, das finde ich. Außerdem ist Per nicht wie andere Männer.«
»Da hast du allerdings recht, aber ich dachte trotzdem, dass er noch gar nicht wissen kann, ob er es ernst meint mit mir. Und mit dir. Und was er sich mit uns beiden auflädt. Mit fünfundzwanzig Jahren eine elfjährige Tochter zu bekommen ist nicht gerade einfach, und ich wollte nicht noch einmal so etwas erleben wie mit deinem Vater.«
An dieses Gespräch erinnerte sich Nina sehr gut. Sie hatte es immer toll gefunden, eine so junge Mutter zu haben, und dann hatte sie sogar einen noch jüngeren Stiefvater bekommen! Ihre Freundinnen und Freunde waren samt und sonders neidisch gewesen. Ihren leiblichen Vater kannte sie nicht, sie hatte, nach allem, was sie von ihrer Mutter über ihn gehört hatte, auch nie das Bedürfnis gehabt, ihn kennenzulernen.
Aber kurze Zeit nach diesem Gespräch war Valerie krank geworden und dann, mit nur einunddreißig Jahren, an Krebs gestorben. Da hatte ihre Hochzeit mit Per gerade erst drei Jahre zurückgelegen.
Per und Nina waren also alleingeblieben, achtundzwanzig und vierzehn Jahre alt, vereint in tiefer Trauer um die Ehefrau und Mutter. Per hatte sich rührend um seine Stieftochter gekümmert, gemeinsam hatten sie das Leben ohne Valerie zu bewältigen gelernt. Sie waren, so hatte es einmal jemand ausgedrückt, ein gutes Team geworden.
Aber etwas begann sich zu verändern, und noch wusste Nina nicht, wie sie die Veränderung benennen sollte. Sie wusste nur, dass sie diese unheimlich fand, weil sich etwas zu verschieben begann, das bislang im Gleichgewicht gewesen war.
»Erwartet ihr Gäste?« Cleo kicherte. »So beladen, wie er ist, hat er mindestens zehn Personen eingeladen. Ich bin leider nicht dabei.«
»Ich dachte, du bist verabredet heute Abend? Per hätte sicher nichts dagegen, wenn du mitkämst zum Essen.«
»Nein, nein, ich habe nur Spaß gemacht, vergiss es. Ich gehe mit Abdel ins Kino.«
»Na, dann.« Nina warf ihrer Freundin einen prüfenden Blick zu. Sie war froh, dass sich das Gespräch allmählich von Per wegbewegte. »Abdel und du, wird das was?«
Cleo schüttelte entschieden die blonden Locken. »Auf keinen Fall.«
»Wieso nicht? Er ist doch nett!«
»Nett schon, aber mehr wie ein Kumpel. Ich bin null in ihn verliebt. Und ich glaube, er ist auch nicht in mich verliebt. Aber wir haben Spaß, wenn wir zusammen sind.«
Per war verschwunden mit seinen Einkäufen, zum Glück. Er kochte sehr gut und auch gerne. Wenn er so viel einkaufte, hatte er sich offenbar vorgenommen, ein großes Menü zuzubereiten.
Sie hatten sich eigentlich immer viel zu erzählen gehabt, aber seit neuestem gab es manchmal längere Gesprächspausen, eine Art Schweigen, die Nina als bedrückend empfand. Dann suchte sie verzweifelt nach einer Geschichte, die sie ihm erzählen konnte, nur damit sie sich nicht länger anschwiegen. Sie konnte sich diese Veränderung nicht erklären. Früher hatte es solche Probleme nicht gegeben.
Sie selbst war freilich schon immer eher ruhig und zurückhaltend gewesen. Aber in vertrauter Umgebung, mit Menschen, die sie gernhatte, konnte sie auch ausgelassen und fröhlich sein. Jedenfalls war es ihr bis vor Kurzem nie schwergefallen, während der gemeinsamen Mahlzeiten mit Per zu reden. Sie fragte sich, ob es eher an ihr lag oder an ihm.
Per unterrichtete an einem Gymnasium Deutsch und Englisch, er war ein sehr beliebter Lehrer, was Nina nicht wunderte. Er bemühte sich um jede Schülerin, jeden Schüler, und er hatte für ihre Nöte immer ein offenes Ohr. Außerdem bereitete er sich gründlich auf seinen Unterricht vor. Dass er darüber hinaus auch noch gut aussah mit seinen dichten braunen Locken und den schönen dunklen Augen, tat seiner Beliebtheit sicherlich keinen Abbruch. Manchmal erzählte er von Liebesbriefen, die er in der Jackentasche fand, aber er machte sich nie darüber lustig, sondern überlegte sich, wie er damit umgehen sollte, ohne die Absenderin zu kränken oder zu demütigen. Auch im Netz fanden sich gelegentlich anonyme Liebesbriefe an ihn.
»Was ist los?«, wollte Cleo wissen. »Du bist so still. Hast du Ärger, von dem ich nichts weiß?«
Nina riss sich zusammen. Sie wollte nicht über Per reden, nicht einmal mit Cleo. Vielleicht später einmal, wenn sie etwas klarer sah, so dass sie zumindest erklären konnte, was sich zwischen ihr und ihrem Stiefvater verändert hatte. »Nichts ist los«, behauptete sie und hoffte, dass sie überzeugend klang. »Ich bin bloß müde.«
Cleo nickte, das konnte sie verstehen. Sie machten beide eine Ausbildung zur Physiotherapeutin, dabei hatten sie sich auch kennengelernt und waren schnell Freundinnen geworden. Die Ausbildung war ziemlich fordernd, sie waren oft müde.
»Ich muss los«, sagte Cleo eine halbe Stunde später. »Ich will noch mal nach Hause, bevor ich mich mit Abdel treffe. Und dir wünsche ich ein tolles Essen mit deinem Stiefpapa.«
Sie verabschiedeten sich mit einer Umarmung voneinander, dann eilte Cleo beschwingt davon, während Nina den Heimweg bedeutend langsamer antrat. Sie besah sich etliche Schaufenster so gründlich, als überlegte sie, die betreffenden Läden zu betreten und etwas zu kaufen. Dabei nahm sie kaum wahr, was sie sah, sondern sie war in Gedanken bereits zu Hause, bei Per. Während er in der Küche arbeitete, gab es keine Probleme, die traten erst auf, wenn sie einander am Esstisch gegenübersaßen. Sie konnte ihm ja nicht einmal mehr unbefangen in die Augen sehen! Manchmal kam es ihr so vor, als säße ihr ein attraktiver fremder Mann gegenüber, der eine starke Anziehungskraft auf sie ausübte.
Das war natürlich blanker Unsinn, aber so ungefähr fühlte es sich für sie an, und das erschreckte sie.
Sie kam an der Kayser-Klinik vorbei, dort hatte sie in zwei Wochen einen Termin in der gynäkologischen Sprechstunde von Herrn Dr. Laurin, der die Klinik auch leitete. Sie fragte sich, ob es möglich wäre, mit ihm über ihre Gefühle zu sprechen. Dr. Laurin war ein guter Zuhörer. Sie hatte mit ihm schon öfter über ihre Mutter gesprochen, die er gekannt hatte. Jedes dieser Gespräche war hilfreich und tröstlich gewesen.
Nur: Was sollte sie ihm eigentlich sagen? Dass sie plötzlich Herzklopfen bekam, wenn sie ihren Stiefvater sah? Unmöglich, das würde sie niemals über die Lippen bringen!
Sie verlangsamte ihre Schritte abermals. Noch war sie nicht bereit, die Wohnung zu betreten, die Per und sie sich teilten. Sie brauchte noch ein bisschen Zeit für sich.
*
Per wusste genau, warum er beschlossen hatte, an diesem Abend aufwändig zu kochen: Er musste sich vor dem Gespräch, das er mit Nina zu führen gedachte, ablenken, sonst würde er nur tatenlos in der Wohnung herumlaufen und die Sätze, die er sagen wollte, unablässig in seinem Kopf wiederholen. Er wollte aber ruhig, abgeklärt, freundlich und bestimmt wirken – und möglichst normal. Leider fühlte er sich nicht so, im Gegenteil. Er fühlte sich niedergeschlagen, unglücklich, verwirrt. Er überlegte sogar, ob er psychologische Hilfe in Anspruch nehmen sollte, denn etwas stimmte ja ganz offensichtlich nicht mit ihm.
Wie sonst hätte es passieren können, dass er sich in seine eigene Stieftochter verliebt hatte? Nina war zwanzig, er war vierunddreißig. Er hatte dieses Mädchen mit aufgezogen und die Kleine geliebt wie seine eigene Tochter. Und er hatte Valerie geliebt, Ninas Mutter. Aber Valerie war vor sechs Jahren gestorben, und in diesen sechs Jahren war Nina zu einer beeindruckenden jungen Frau herangewachsen. Sie war nicht länger das Kind, das überglücklich gewesen war, auch endlich einen Papa zu haben, noch dazu einen so jungen, unternehmungslustigen. Sie war erwachsen, und jetzt liebte er nicht mehr ihre Mutter, die nicht mehr lebte, sondern sie.
Zuerst hatte er versucht, sich einzureden, dass er seine Stieftochter jetzt natürlich anders liebte als zuvor, eben weil sie kein Kind mehr war. Natürlich liebte man eine erwachsene Tochter anders als ein kleines Mädchen, aber er hatte nur versucht, sich selbst etwas vorzumachen. Die Wahrheit war: Er liebte Nina überhaupt nicht mehr wie eine Tochter, sondern wie eine junge, begehrenswerte Frau.
Er hatte lange gebraucht, bis er sich das eingestehen konnte, und jetzt, da er sich selbst nichts mehr vormachte, empfand er seine Gefühle als Unrecht. Auch wenn sie nicht seine leibliche Tochter war, so hatte er sie doch in den Jahren vor Valeries Tod immer nur als Tochter gesehen. Sie war sein Kind. Dieses Kind durfte er nicht so lieben, wie er es jetzt tat. Er durfte Nina nicht begehren. So sah er das, aber er kam gegen seine Gefühle nicht an. Wenn er nur daran dachte, dass sie jemals erfahren könnte, wie es in ihm aussah, wurde ihm übel. Sie würde ihn verachten und wahrscheinlich nie wieder ein Wort mit ihm sprechen.
Deshalb musste er heute dieses schwierige Gespräch mit ihr führen und dabei unbedingt freundlich, aber vor allem bestimmt auftreten. Sie würde seinen Wunsch nicht verstehen und nach den Gründen fragen. Das war sein Schwachpunkt, er wusste es. Die Gründe klangen vorgeschoben – aus einem einfachen Grund: weil sie es waren, denn was wirklich hinter seinem Wunsch steckte, konnte er ihr ja nun einmal nicht sagen.
Er versah das Huhn mit der Füllung, die er zuvor hergestellt hatte, band es zu und bepinselte es mit einer Öl-Kräutermischung, bevor er es in den Ofen schob. Nina würde bald kommen. Eigentlich hätte sie längst zu Hause sein sollen. Wahrscheinlich war sie aufgehalten werden.
Er war dabei, die Suppe zu würzen, als er hörte, wie sie die Wohnungstür öffnete. Er wappnete sich für das, was kommen würde, atmete noch einmal tief durch und wandte sich ihr zu, als sie von der Tür her sagte: »Hallo, Per, tut mir leid, dass es etwas später geworden ist.«
»Nicht so schlimm«, antwortete er, »ich hatte genug zu tun. Du kommst genau zur rechten Zeit. Hoffentlich hast du guten Appetit mitgebracht.«
Sie nickte und trat näher, während sie schnupperte. »Huhn?«, fragte sie.
»Ja, gefülltes Huhn mit Süßkartoffelpüree, davor eine Suppe, die Nachspeise verrate ich noch nicht.«
»Gibt es einen Grund dafür, dass du so aufwändig gekocht hast?«
Er zögerte, aber nur kurz. Sie jetzt anzulügen wäre mit Sicherheit ein Fehler, also sagte er: »Ja, ich muss etwas mit dir besprechen. Aber das heben wir uns für später auf. Zuerst erzähl mir, was du heute erlebt hast. Das Huhn braucht noch eine Dreiviertelstunde, aber mit der Suppe können wir bald anfangen.«
Sie kam seiner Aufforderung nach, alles wirkte ganz normal. Per entspannte sich allmählich. Vielleicht lief der Abend ja besser als befürchtet.
*
Leon Laurin begab sich ins Untergeschoss der Klinik, um seinem Schwiegervater den ersten Besuch an seinem neuen ›Arbeitsplatz‹ abzustatten. Professor Dr. Joachim Kayser, der die Kayser-Klinik seinerzeit gegründet und die Leitung schließlich an Leon übertragen hatte, war vor Wochen in der Klinik aufgetaucht und hatte erklärt, er brauche etwas zu tun. Und er hatte auch schon eine Idee gehabt, was das sein könnte: Er wollte das Archiv mit den Patientenakten auf den neuesten Stand bringen, also digitalisieren.
Leon war angetan gewesen von der Idee, denn bisher hatte sich niemand dieser Arbeit annehmen wollen, weil es immer so viel Wichtigeres zu tun zu geben schien. Und auch ohne solche zusätzlichen Aufgaben waren natürlich alle mehr als ausgelastet.
Daraufhin war unten, in einem recht kleinen Raum neben dem Archiv, Joachim Kaysers Büro eingerichtet worden, mit allem, was er für die Arbeit brauchte, und heute war der Tag, an dem er seine Arbeit aufgenommen hatte.
Er klopfte und trat ein, nachdem jemand von drinnen etwas geantwortet hatte.
»Ach, du bist es«, begrüßte der Professor seinen Schwiegersohn. »Das geht ja hier zu wie im Taubenschlag. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Leute schon bei mir vorbeigekommen sind, um sich mit eigenen Augen davon zu überzeugen, dass der ehemalige Klinikchef jetzt tatsächlich im Keller sitzt und eine Arbeit erledigt, die bisher jede Sekretärin abgelehnt hat.«
Er klang bei seinen Worten ziemlich vergnügt, fand Leon. Aber er hatte sich diese Arbeit ja auch selbst ausgesucht.
»Darf ich dir einen Kaffee anbieten? Wie du siehst, hat man mich mit einer ziemlich guten Kaffeemaschine ausgerüstet. Überhaupt kann ich nur sagen, dass meine Ausstattung hier unten großzügiger ausgefallen ist, als ich es erwartet hätte.«
»Für den Klinikgründer war uns kein Aufwand zu groß.« Leon lächelte breit bei diesen Worten. »Ich nehme gern einen Kaffee, zumal diese beiden Sesselchen sehr gemütlich aussehen. Setzt du dich einen Moment zu mir oder hast du zu viel zu tun?«
»Zehn Minuten kann ich erübrigen, aber dann will ich Ruhe zum Arbeiten haben. Ich brauche noch ein Schild ›Bitte nicht stören‹, das ich bei Bedarf an die Tür hängen kann. Sonst bilden sich alle, die gerade nichts zu tun haben, ein, sie könnten mal auf einen Schwatz bei mir hereinschauen, und ich komme mit meiner Arbeit nicht weiter. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Niemand soll denken, dass ich nur in die Klinik komme, um die Zeit totzuschlagen.«
»Ich wüsste nicht, wer das denken könnte«, erwiderte Leon. »Sehr gut, dein Kaffee.«
»Ist eine Messerspitze Schokolade drin, das ist das Geheimnis des Erfolgs. Den Tipp hat mir Teresa gegeben. Sie kennt sich eben nicht nur mit Mode aus.«
»Wie weit ist sie mit ihrem neuen Laden?«
Joachim Kayser machte eine wegwerfende Handbewegung. »Ein Drama ohne Ende. Du weißt ja, dass sie einen schönen Laden gefunden hat, dessen Miete auch einigermaßen erschwinglich ist, aber nun hat sich herausgestellt, dass sämtliche Stromleitungen erneuert werden müssen – und dass in dem Haus noch alte Bleirohre verlegt worden sind. Die sollen jetzt auch noch raus. Das kann sich hinziehen, dabei wollte sie ja bald starten. Jetzt überlegt sie, ob sie von dem Mietvertrag zurücktritt und sich etwas Neues sucht. Aber sonst wäre der Laden perfekt für das, was sie und ihre Freundin vorhaben. Die Größe stimmt, die Lage ist erstklassig, und die Miete, wie gesagt, ist auch in Ordnung. Also, sie überlegt noch, was sie jetzt macht.«
»Das tut mir leid. Ich habe vor ein paar Tagen noch mit ihr telefoniert, da sagte sie nur, dass es ein paar Probleme gibt, aber näher darauf eingegangen ist sie nicht.«
»Du kennst doch Teresa, sie packt lieber an als zu jammern.«
Sie lächelten einander zu. Ja, Leon kannte Teresa, denn sie hatte ihn und seine Schwester zu sich genommen und aufgezogen, als ihre Eltern gestorben waren. Und heute war sie auch noch seine Schwiegermutter, denn vor etlichen Jahren war sie ihrer Jugendliebe wiederbegegnet, dem mittlerweile verwitweten Joachim Kayser. Wenig später hatten die beiden geheiratet. Leon hingegen hatte sich in Joachims Tochter Antonia verliebt …
»Woran denkst du denn gerade, dass du so verträumt lächelst?«, erkundigte sich Joachim.
»An die Zeit, als ich mich in Antonia verliebt habe und als du Teresa wiederbegegnet bist.«
Da lächelte auch der Professor. »Schön war das«, sagte er.
Leon leerte seine Tasse. »Wieso bist du eigentlich noch hier? Es ist schon ziemlich spät, falls du das nicht mitbekommen hast. Wartet Teresa nicht auf dich?«
»Sie ist mit einer Freundin verabredet, und ich habe noch gar nicht richtig angefangen, weil dauernd jemand kam und mir einen Besuch abstatten wollte.«
Leon erhob sich. »Entschuldige, stören wollte ich dich nicht, nur kurz ›hallo‹ sagen.«
»Das weiß ich doch, und ich freue mich darüber. Aber jetzt möchte ich gern noch eine oder zwei Stunden in Ruhe arbeiten.«
»Dann gehe ich jetzt. Viel Erfolg!«
Joachim Kayser saß bereits wieder vor seinem Computer, als Leon die Tür öffnete. »Wir sehen uns!«, sagte er, ohne den Blick vom Monitor abzuwenden.
Leon schloss die Tür leise hinter sich. Er hatte seinen Schwiegervater schon lange nicht mehr so lebhaft und voller Tatendrang gesehen, also war es offenbar eine gute Idee gewesen, ihm seine Bitte nach einer Aufgabe nicht abzuschlagen.
*
Konstantin Laurin wanderte noch einmal durch die Halle, in der sie heute die allerletzte Einstellung für ihren Film gedreht hatten. Es war vorbei. Die Dreharbeiten waren beendet, heute gab es noch ein großes Abschlussfest, danach würde er etliche aus dem Team vielleicht nie wiedersehen. Noch konnte er sich das nicht vorstellen. Das waren die Menschen, mit denen er wochenlang ständig zusammen gewesen war! Einige würde er nicht sonderlich vermissen, andere dagegen schon. Es war sein erster Film gewesen, in dem er gleich die Hauptrolle gespielt hatte. Der Einstieg war ihm schwergefallen, aber er hatte diese Anfangsschwierigkeiten überwunden, und er wusste, er hatte gute Arbeit geleistet.
Das musste er auch, denn er wollte ja Schauspieler werden, und noch war er völlig unbekannt. Er musste sich einen Namen machen, damit auch andere Regisseure mit ihm arbeiten wollten. Oliver Heerfeld, der Regisseur dieses Films, würde jetzt erst einmal lange im Schneideraum sitzen, bevor er die Arbeit an seinem nächsten Film aufnehmen konnte – und in dem würde es wohl keine Rolle für Konstantin geben. Er musste ja auch zuerst noch die Schule beenden, das hatte er seinen Eltern versprochen.
Sie waren enttäuscht und zuerst wohl auch entsetzt gewesen, als er ihnen gestanden hatte, dass er nicht länger Medizin studieren wollte. Dabei hatte eins immer festgestanden und war deshalb nie in Frage gestellt worden: dass nämlich seine Zwillingsschwester Kaja und er Ärzte werden und später einmal die Kayser-Klinik übernehmen würden. Und dann hatte er in der Schule Theater gespielt und schlagartig gewusst, dass es das war, was er sein Leben lang tun wollte. Die Medizin war an die zweite Stelle gerutscht. Sie interessierte ihn noch immer, aber seine große Liebe war sie nicht mehr.
Er hatte Glück gehabt, seine Eltern waren verunsichert und wohl auch unglücklich gewesen, aber sie hatten ihm keine Steine in den Weg gelegt. Nur sein Abitur sollte er noch machen, und das hatte er ihnen auch versprochen. Vielleicht würde er, wenn ihm genug Zeit blieb, parallel zur Schauspielerei auch noch Medizin studieren, aber das wollte er davon abhängig machen, wie er weiter vorankam.
»Traurig?«, fragte eine Stimme hinter ihm.
Es war Sven Tobler, der Regieassistent, der plötzlich aufgetaucht war. Seine Schwester Mara hatte Konstantin während der Dreharbeiten unterrichtet. Sie würde heute Abend bei dem Abschiedsfest nicht dabei sein. Sie hatte sich in Konstantins Filmbruder Daniel Huber verliebt, der nach einem sehr schweren Unfall in einer Rehabilitationsklinik war, wo seine Genesung aber dem Vernehmen nach gute Fortschritte machte. Mara war bei ihm und konnte deshalb nicht kommen.
»Ja. Du wahrscheinlich nicht, oder? Auf dich wartet ja schon der nächste Film.«
»Traurig bin ich trotzdem, das bin ich eigentlich jedes Mal, es sei denn, dass die Dreharbeiten wirklich unangenehm waren.«
»Das kommt auch vor?«
»Ja, natürlich, und gar nicht einmal so selten, glaub das nur nicht. Es ist nicht immer so friedlich und angenehm wie bei uns. Es gibt Regisseure, vor denen das ganze Team zittert, es gibt Schauspieler, die Starallüren haben und sich ständig produzieren müssen, es gibt Leute, die sich nicht ausstehen können, aber trotzdem zusammen gute Arbeit leisten müssen. Ich habe schon viel erlebt in dieser Hinsicht. Auch deshalb bin ich traurig, die Arbeit an diesem Film war anstrengend, aber alle haben am selben Strang gezogen, wollten vor allem gute Arbeit leisten, keiner hat sich in den Vordergrund zu spielen versucht. Das gibt es nicht so oft.«
»Ich vermisse Daniel«, sagte Konstatin. »Er hat mir viel erklärt und mir oft geholfen, wenn ich unsicher war.«
»Er kann schon wieder ohne Gehhilfe laufen, stell dir vor. Ich habe vorhin mit Mara telefoniert. Die Ärzte sind völlig begeistert von den Fortschritten, die er macht.« Sven lächelte. »Wenn du mich fragst, liegt es an Mara, dass er so gut vorankommt. Liebe verleiht bekanntlich Flügel.«
»Kommt ihr?«
Es war Oliver, der nach ihnen rief. Langsam kam er näher. »Oder habt ihr noch private Dinge zu bereden?«
»Wir haben über Daniel gesprochen«, antwortete Sven. »Es geht ihm schon viel besser. Die Ärzte meinen jedenfalls, er wird wieder völlig gesund.«
»Der Unfall hat mir schlaflose Nächte bereitet«, gestand Oliver.
»Uns allen«, sagte Konstantin.
Oliver nickte nur, dann legte er seinem Regieassistenten und seinem Hauptdarsteller je einen Arm um die Schultern und führte sie in die kleine Halle, in der sie das Ende dieser Dreharbeiten feiern würden.
Man empfing sie mit großem Hallo, an einem der langen Tische waren noch Plätze frei, dorthin setzten sie sich. Plötzlich stand ein Glas Wein vor Konstatin, von dem er einen Schluck trank – und dann noch einen. Es schmeckte ihm, und er wusste, er würde noch mehr von dem Wein trinken, auch wenn er am Ende möglicherweise betrunken war.
Er ließ den Blick schweifen, sah die Gesichter, die ihm im Verlauf der letzten Wochen vertraut geworden waren, hörte die Stimmen, die er zuordnen konnte, ohne zu sehen, wer gerade sprach oder lachte, er sah Tränen in den Augen einer Maskenbildnerin, sah einen Beleuchter, der ihm zuprostete, wurde von der Tonfrau herzlich auf die Wange geküsst und dachte: Das ist das Leben, das ich führen werde. Ich schließe Menschen ins Herz, von denen ich mich bald darauf wieder trennen muss, um wieder neue Menschen kennenzulernen, von denen ich einige auch ins Herz schließe. Und so wird es weitergehen. Wenn ich nicht verrückt werden will, muss ich Freundinnen und Freunde finden, die mir bleiben. So, wie ich eine Familie habe, die immer zu mir stehen wird, so brauche ich einen festen Freundeskreis – und vielleicht muss der gar nicht aus Filmleuten bestehen. Freunde, zu denen ich nach jedem Film zurückkehren kann und die es akzeptieren, dass ich manchmal monatelang keine Zeit für sie habe. Solche Freunde brauche ich, sonst werde ich verrückt.
Er trank noch einen Schluck Wein, merkte dann aber, dass dieser ihm bereits zu Kopfe stieg. Wenn der Abend für ihn nicht vorzeitig vorüber sein sollte, würde er vorsichtiger sein müssen. Er stand daher auf und ging hinüber zu den Beleuchtern, mit denen er sich praktisch jeden Tag unterhalten hatte, weil ihre Arbeit ihn faszinierte. Es sprach, fand er, alles dafür, dass er diese Gewohnheit auch bei ihrem letzten Zusammentreffen beibehielt.
*
Sie waren beim Dessert angelangt, als Nina sagte: »Du wolltest mit mir reden. Worüber?«
Per sah ein, dass es wenig Sinn hatte, das Gespräch noch länger aufzuschieben. Und noch weniger Sinn hatte es, jetzt noch lange um das eigentliche Thema herumzureden. Also sagte er es ganz gerade heraus: »Ich denke, es wäre gut, wenn du dir eine eigene Wohnung suchst, Nina.« Seine Stimme klang ruhig, er schaffte es sogar, sie anzusehen bei diesen Worten. Sie konnte ja nicht ahnen, wie viel Anstrengung ihn dieser Blick kostete.
Ihr Gesichtsausdruck veränderte sich so dramatisch, dass er einen Schrecken bekam. Er würde bei dem folgenden Gespräch also doch nicht glimpflich davonkommen.
»Du willst mich loswerden?«, fragte sie, und er konnte hören, wie verletzt sie war. Aber er konnte es auch sehen. Wenn sie jetzt weinte, war er verloren. Er würde aufspringen, sie in seine Arme ziehen, ihr sagen, dass das Gegenteil der Fall war, dass er eigentlich etwas ganz anderes wollte …
Er zwang sich dazu, ihr im selben Tonfall wie zuvor zu antworten. »Ich will dich nicht loswerden, ich denke nur, dass du allmählich auf eigenen Füßen stehen solltest.«
»Rede nicht von mir, rede von dir!« Nina wurde nur selten zornig, jetzt war sie es. »Du willst also lieber allein wohnen?«
Nein, dachte Per. »Ja«, sagte er. »Wenn du es so ausdrücken willst. Wir beide haben uns in unserer Trauer um deine Mutter gestützt, wir haben einander gebraucht, aber ich denke, es ist jetzt an der Zeit, dass wir nach vorne blicken, jeder von uns.«
»Hast du eine Freundin?«, fragte Nina. »Willst du deshalb, dass ich ausziehe? Damit ich euch nicht störe?«
»Nein!«, sagte Per heftig. Das Gespräch lief in eine vollkommen falsche Richtung, und er fand kein Mittel, das zu ändern. Je mehr er beteuern würde, dass sie falsch lag mit ihren Vermutungen, desto weniger würde sie ihm glauben. Dennoch fuhr er fort: »Damit hat das überhaupt nichts zu tun. Ich habe keine Freundin, und ich suche auch nicht nach einer.«
Nina hatte längst aufgehört zu essen, jetzt schob sie mit einer unwilligen Bewegung die Crème brûlée von sich. Er wusste, sie würde sie nicht mehr anrühren. »Warum dann?«, fragte sie. »Sag mir einen einzigen vernünftigen Grund!«
»Es wird Zeit, dass du erwachsen wirst und auf eigenen Füßen stehst«, wiederholte er seine Worte von vorher und hörte selbst, wie lächerlich das klang. Nina war erwachsen, viel erwachsener als andere Zwanzigjährige, und sie stand längst auf eigenen Füßen. Außerdem war die Wohnung mehr als groß genug für sie beide, vorher war sie ja auch groß genug für drei gewesen. Und wo sollte Nina überhaupt eine Wohnung herbekommen, die sie bezahlen konnte? Solche Wohnungen gab es bekanntlich in München kaum noch.
»Ich bin erwachsen, und ich stehe auf eigenen Füßen«, stellte Nina denn auch fest. »Du bist feige, Per! Du hast andere Gründe, aber du willst sie mir nicht sagen. Vielleicht kann ich dir helfen? Du fühlst dich beengt von deiner Stieftochter, du möchtest endlich wie der freie Mann leben, der du seit Mamas Tod bist, aber du hast Angst, es auszusprechen, weil ich es in den falschen Hals kriegen könnte.«
Sie stand auf, mit einer so heftigen Bewegung, dass der Stuhl, auf dem sie gesessen hatte, umkippte. Sie zuckte nicht einmal zusammen, als seine hölzerne Lehne auf das Parkett knallte. »Ich sage dir, was ich in den falschen Hals bekomme: dein blödes Rumgeeiere, die vorgeschobenen Gründe. Du hättest einfach sagen sollen, was Sache ist, das wäre ehrlich gewesen, und ich wäre damit besser zurechtgekommen.«
Sie funkelte ihn noch einmal an, dann marschierte sie aus dem Zimmer.
Per blieb sitzen, stützte den Kopf in beide Hände. Das war gründlich schiefgegangen, viel schlechter hätte es nicht laufen können. Und was das Schlimmste war: Er konnte das Missverständnis nicht aufklären, denn dann hätte er ihr die Wahrheit sagen müssen.
Er würde Nina verlieren, weil er ihr nicht sagen konnte, dass er sie liebte. Sie würde sich von ihm abwenden, weil sie dachte, er wollte sie loswerden!
Ihm kamen die Tränen, die er sich erschrocken aus den Augen wischte. Er musste sich zusammennehmen. Vor allem durfte er nicht der Versuchung erliegen, Nina zu sagen, dass er sie liebte – dass er sie liebte, wie ein Mann eine Frau nur lieben kann. Denn damit würde er sie für immer von sich wegtreiben, so viel stand fest.
*
»Auf Konny müssen wir heute wohl nicht warten«, stellte Antonia Laurin fest, als die Kinder nach dem Abendessen den Tisch abräumten. Wie immer hatte Simon Daume, der ihnen den Haushalt führte, hervorragend gekocht. Dass ihre Jüngste, Kyra, neuerdings kein Fleisch mehr aß, schien ihm keine Schwierigkeiten zu bereiten, jedenfalls beklagte er sich nicht über die Mehrarbeit, die das für ihn bedeutete.
»Er hat gesagt, es kann sehr, sehr spät werden. Oder auch früh«, erklärte Kaja.
»Er ist bestimmt traurig, wenn er nach Hause kommt«, sagte Kyra. »Vielleicht sollte einer von uns wach bleiben, damit er dann nicht ganz alleine ist.«
Antonia und Leon wechselten einen Blick. Das war typisch für Kyra. Immer war sie voller Mitgefühl für andere, ob Mensch oder Tier. Als sie noch kleiner gewesen war, hatte sie ständig verletzte Tiere nach Hause gebracht, meistens Vögel, einmal aber auch einen Igel, ein anderes Mal eine Katze, die von einem Auto angefahren worden und wenig später gestorben war. So war Kyra: Wenn ein Lebewesen litt, litt sie mit.
»Ich schreibe morgen früh Mathe«, sagte Kaja, »ich muss schlafen.«
»Ich könnte wachbleiben«, schlug Kevin vor, der Dreizehnjährige.
Das ›Sandwichkind‹, wie Antonia manchmal dachte. Der Mittlere, obwohl es den bei vier Kindern eigentlich nicht gab, in ihrem Fall, wegen der Zwillinge, aber eben doch. Er hatte, fand sie jedenfalls, den schwierigsten Platz in der Familie zugewiesen bekommen. Bei seiner Geburt waren die Zwillinge drei Jahre alt gewesen, und bis dahin hatte sich das Familienleben vor allem um sie gedreht. Zwillinge waren ja etwas Besonderes, auch außerhalb der Familie war ihnen die allgemeine Aufmerksamkeit sicher. Daran hatte sich auch durch Kevins Geburt nichts geändert. Und dann war, nach weiteren drei Jahren, Kyra auf die Welt gekommen, das Nesthäkchen.
Aber Kevin war erstaunlicherweise das gelassenste der Laurin-Kinder geworden. Er ruhte in sich, hatte ein gesundes Selbstvertrauen und ging weitgehend unbeirrbar seinen Weg. Er würde einmal Ingenieur werden. Oder IT-Spezialist. Alles, was mit Technik zu tun hatte, faszinierte ihn.
»Ich muss morgen sehr früh in die Klinik«, sagte Leon. »Wahrscheinlich stehe ich ungefähr zu der Zeit auf, wenn Konny nach Hause kommt. Oder ich werde wach, weil ich immer unruhig schlafe, wenn ich weiß, dass ich früh aufstehen muss oder dass jemand aus der Familie noch unterwegs ist. Niemand von euch muss seinen Nachtschlaf opfern.«
»Hätte mir nicht viel ausgemacht«, behauptete Kevin. »Ich habe gerade ein superspannendes Buch angefangen, das hätte ich heute Nacht durchlesen können.«
»Und morgen hättest du dann den kompletten Unterricht verschlafen, oder wie?«, fragte Antonia.
Kevin verzichtete auf eine Antwort, er grinste nur.
Eine halbe Stunde später waren Antonia und Leon allein, die Kinder hatten sich nach oben in ihre Zimmer verzogen.
Leon legte den Kopf zurück und schloss die Augen. »Meine Güte, bin ich müde«, murmelte er. »Ich habe übrigens deinen Vater heute gesehen.«
»In der Klinik?«
»Ja. Er war gut drauf, besser als seit Langem. Ich glaube, er freut sich richtig auf die Arbeit.«
»Mhm. Teresa freut sich auch auf ihr Geschäft, obwohl sich da jetzt alles verzögert, wie ich hörte.«
»Das hat mir dein Vater auch erzählt. Marode Stromleitungen, alte Bleirohre – mit solchen Hindernissen konnte sie natürlich nicht rechnen.« Leon küsste seine Frau flüchtig auf die Wange. »Lass uns schlafen gehen«, murmelte er. »Oder bist du noch nicht müde?«
Sie schmiegte sich an ihn. »Schon ein bisschen, aber eigentlich …« Sie ließ zärtlich ihre Hand unter sein Hemd gleiten.
Er öffnete die Augen. »Willst du mich wieder aufwecken?«
»Wenn du dich aufwecken lässt?«
Jetzt war er wieder völlig wach, sprang auf, zog sie mit sich in die Höhe und strebte zur Tür.
»Jetzt hast du es aber eilig«, stellte Antonia fest.
Er blieb stehen, um sie noch einmal zu küssen. Es war ein ganz anderer Kuss als der vorige: Stürmisch und leidenschaftlich war er, und als sie sich voneinander lösten, hatte auch Antonia es eilig, nach oben in ihr Schlafzimmer zu kommen, dessen Tür sie vorsichtshalber verschlossen.
Man konnte schließlich nie wissen …
*
»Das glaube ich dir nicht«, sagte Cleo. »Ihr seid ein Herz und eine Seele! Wieso will er auf einmal, dass du ausziehst? Hat er eine Freundin?«
»Das habe ich ihn auch gefragt, er hat das aber weit von sich gewiesen.«
Nina hatte lange geweint und die Wohnung erst verlassen, als sie sicher sein konnte, dass sie Cleo alles würde erzählen können, ohne sofort wieder in Tränen auszubrechen. Aber das war dann doch passiert. Cleo hatte auf den ersten Blick gesehen, dass etwas Schlimmes geschehen sein musste. Schweigend hatte sie Nina in die Arme geschlossen und an sich gedrückt. Da waren die Tränen gleich wieder geflossen.
Jetzt saßen sie nebeneinander auf Cleos Sofa, Nina hatte das Gespräch mit Per haarklein wiedergegeben.
»Klar, was soll er auch sonst sagen?«
»Die Wahrheit!«, rief Nina heftig. »Wir sind immer ehrlich zueinander gewesen, jedenfalls dachte ich das, aber ich habe mich wohl geirrt.«
»Oder er kann deine Nähe nicht mehr ertragen, weil du deiner Mutter so ähnlich siehst«, überlegte Cleo. »Wäre das nicht möglich?«
Nina rückte ein Stück von ihr ab, um ihr ins Gesicht sehen zu können. »Ist das dein Ernst?«
»Ich überlege nur, was in ihm vorgehen könnte, weil ich es gern verstehen würde«, sagte Cleo. »Per war noch nie feige, und du warst bisher noch nie enttäuscht von ihm, er hat sich eigentlich immer ganz toll verhalten. Er war total in deine Mutter verliebt, für dich war er ein super Papa, so hast du es mir jedenfalls erzählt. Ich kannte dich ja damals noch nicht, aber du hast gesagt, dass dich immer alle Kinder beneidet haben, weil er so jung und cool war und auch noch gut aussah.«
»Er hat jeden Quatsch mitgemacht. Meine Kindergeburtstage waren die tollsten von allen, weil er dabei war«, sagte Nina. Ihr kamen schon wieder die Tränen. »Und jetzt schickt er mich weg.« Mit einer fast zornigen Geste wischte sie die Tränen weg. »Ich habe meiner Mutter schon immer ähnlich gesehen. Wieso sollte er das jetzt plötzlich nicht mehr ertragen können? Außerdem ist das nur äußerlich, sonst bin ich ganz anders als sie.«