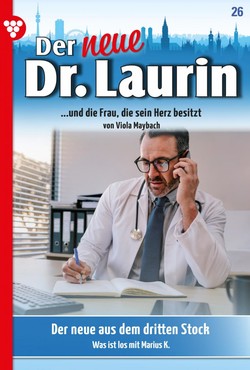Читать книгу Der neue Dr. Laurin 26 – Arztroman - Viola Maybach - Страница 3
Оглавление»Etwas stimmt mit ihm nicht!«, stellte Pia Moor fest. »Der wohnt jetzt seit vier Wochen in der Wohnung über uns – aber glaubst du, er würde auch nur einmal kurz anhalten, um mehr zu sagen als ein knappes ›Guten Morgen‹? Fehlanzeige. Er hat sich nach seinem Einzug vorgestellt, seinen Namen gesagt, und dann ist er ganz schnell wieder gegangen. Seitdem: Nichts mehr, null.«
Sieglinde Cornelius, Pias Tante, versuchte es mit einem Scherz. »Vielleicht hat er Angst vor dir.«
Pia war jedoch nicht zum Scherzen zumute, dazu war sie zu aufgebracht. »Quatsch! Wieso das denn?«
»Ich habe nur Spaß gemacht. Er könnte schüchtern sein.«
»Eher nicht, glaube ich. Aber er geht wirklich jedem Kontakt ganz bewusst aus dem Weg. Neulich kam er von oben, mit zwei Mülltüten in der Hand, als ich auch gerade Müll nach unten bringen wollte. Und wie reagiert er? Er macht natürlich keine lockere Bemerkung darüber, sondern nickt nur knapp, schießt im Eiltempo an mir vorbei, damit wir ja nicht gleichzeitig bei den Mülltonnen ankommen und er eventuell doch drei Worte zu mir sagen muss. Als ich unten ankam, war er im Keller. Ich wette mit dir, er ist nur runtergegangen, damit er nicht riskiert, mit mir zusammen wieder nach oben steigen zu müssen.«
»Du übertreibst, Schätzchen«, sagte Sieglinde mit mildem Tadel in der Stimme. Sie musste sich Pias Ärger über den neuen Mieter aus dem dritten Stock seit seinem Einzug jeden zweiten Tag anhören.
»Im Gegenteil!«, widersprach Pia temperamentvoll. »Ich beschreibe sein Verhalten äußerst zurückhaltend, Tante Siggi. In Wirklichkeit benimmt er sich wie ein Schwerverbrecher, der etwas zu verbergen hat und in der panischen Angst lebt, jemand könnte ihm auf die Spur kommen.«
Sieglinde Cornelius fing an zu lachen, sie konnte nicht anders. »Du hättest vielleicht doch Schauspielerin werden sollen«, sagte sie amüsiert. »Dein dramatisches Talent kann niemand in Abrede stellen. Jetzt lass dem Mann doch mal ein bisschen Zeit! Er ist neu im Haus, vielleicht macht er gerade eine schwere Zeit durch. Oder er legt einfach keinen besonderen Wert auf soziale Kontakte, das soll es ja geben. Was kümmert er dich denn überhaupt? Er lebt sein Leben, Valentin und du, ihr lebt eures.«
Pia seufzte. »Er sieht aber interessant aus«, sagte sie, »und du weißt doch, wie das bei Valentin zurzeit ist. Er braucht eine weitere männliche Bezugsperson neben Onkel Kurt, einen jüngeren Mann, der in der Nähe ist, einen Vaterersatz. Er redet dauernd von den Vätern seiner Freunde, was die machen, wie sie reden, welche Ansichten sie haben – und was sie mit ihren Söhnen unternehmen. Ich kann das allein nicht ausgleichen.«
»Das ist natürlich ein Problem«, gab Sieglinde zu. »Aber es muss doch nicht ausgerechnet ein menschenscheuer Nachbar sein, der Valentin den Vater ersetzt, oder?«
»Er muss ihn ja nicht unbedingt ersetzen, aber wenn er wenigstens jemand wäre, mit dem Valentin ab und zu etwas unternehmen könnte, wäre schon viel gewonnen. Ehrlich, ich weiß manchmal nicht weiter. Ich bin nicht die Respektsperson, die ein Zwölfjähriger braucht, fürchte ich.«
»Unsinn!«, widersprach Sieglinde energisch. »Du bist doch die Einzige, von der sich dein Bruder überhaupt etwas sagen lässt, und ich finde es absolut bewundernswert, wie du dich bis jetzt schlägst.«
Pia seufzte. Sie war sechsundzwanzig Jahre alt, ihr jüngerer Bruder Valentin war zwölf, ein Nachkömmling, über den ihre Eltern sehr glücklich gewesen waren. Doch das Glück hatte nicht lange gedauert, er war noch ein Kleinkind gewesen, als sich bei ihrem Vater die ersten Anzeichen einer beginnenden Demenz gezeigt hatten. Seit dem vergangenen Jahr war Pia für Valentin verantwortlich, weil ihre Eltern sich nicht mehr um ihn kümmern konnten.
Pias und Valentins Vater Emil war der Bruder ihrer Tante Sieglinde. Seine Demenz war rasch schlimmer geworden, ihre Mutter hatte ihn jahrelang allein zu Hause betreut, bis sie im letzten Jahr zusammengebrochen war. Von diesem Zusammenbruch hatte sie sich noch immer nicht wieder erholt. Jetzt lebte sie mit ihrem Mann in einer Einrichtung, wo beide gut betreut wurden, aber Pia hatte die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass ihre Mutter eines Tages doch wieder ganz gesund werden würde. Bei ihrem Vater gab es diese Hoffnung nicht.
Pias große Stütze war ihre Tante Sieglinde, die immer ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Nöte hatte. Sie und ihr Mann Kurt hätten Valentin gern bei sich aufgenommen, aber der Junge hatte sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, obwohl er beide sehr gern hatte, denn er wollte bei Pia bleiben, nichts anderes kam für ihn infrage. Pia hatte sich schließlich bereit erklärt, es zu versuchen, und eigentlich lief es auch nicht schlecht. Aber sie war nun einmal erst sechsundzwanzig und hätte ihr Leben gern auch so unbeschwert genossen wie ihre Freundinnen und Freunde, zumindest gelegentlich. Aber daran war nicht zu denken, sie war jetzt für Valentin verantwortlich, und diese Last auf ihren Schultern drückte sie mitunter sehr.
»Ja, eigentlich läuft es ganz gut, das stimmt schon«, sagte sie jetzt, »aber mir wird das manchmal zu viel, Tante Siggi, und dann wünsche ich mir jemanden, der mir die Last eine Weile einfach mal abnimmt.«
»Du weißt, wir hätten das gern gemacht, aber …«
»Ja, ich weiß. Was Valentin nicht will, das will er nicht, da hilft kein gutes Zureden. Jedenfalls: Es wäre nett gewesen, wenn ein zugänglicher, freundlicher, aufgeschlossener Mann hier ins Haus gezogen wäre, der gerne mal etwas mit einem Zwölfjährigen unternommen hätte und mit ihm die Gespräche führen könnte, die ich nicht führen kann. Ich interessiere mich nicht für Fußball oder Motorsport, ich kann diese Filme nicht ausstehen, in denen nur herumgeballert wird, ich kann mit Spielekonsolen nichts anfangen, und wie ich mit einem Jungen an der Schwelle zur Pubertät über feuchte Träume reden soll, weiß ich auch nicht.«
Sieglinde musste wieder lachen. »Das zumindest könnte Kurt auch nicht besonders gut«, sagte sie. »Die Aufklärung unserer Töchter hat er mir überlassen – und zwar vollständig.«
»Weil sie Mädchen waren, oder? Ich meine, bei Jungs hätte er das doch sicherlich selbst übernommen.«
»Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich gebe dir einen guten Rat, Pia: Lass das auf dich zukommen. Und denk nicht mehr an euren neuen Nachbarn. Wenn er keinen Kontakt haben will, lass ihn in Ruhe.«
»Das mache ich ja, denkst du, ich bin aufdringlich? Ich hadere nur ein bisschen mit meinem Schicksal, weil ich finde, es hätte auch jemand in die Wohnung ziehen können, der aufgeschlossener als Herr Klebert ist. Das hätte mein Leben enorm erleichtern können. So, jetzt habe ich genug gejammert, erzähl mir, was es bei euch Neues gibt.«
»Kurt ist erkältet und wehleidig, wie viele Männer, sobald sie sich nicht ganz wohlfühlen. Er hat aber im Büro so viel zu tun, dass er es sich nicht leisten kann, mal einen Tag zu Hause zu bleiben und sich ein bisschen zu pflegen. Und meine Museumsführungen laufen weiterhin gut, ich habe genug zu tun und Freude an der Arbeit.« Sieglinde machte eine kurze Pause. »Eurem Vater geht es schlechter«, sagte sie, »aber das weißt du ja wahrscheinlich.«
»Ja, ich war vorgestern da.«
»Ich bin gestern bei euren Eltern gewesen. Eure Mutter weint viel, sie hat das Gefühl, dass sie versagt hat, weil sie es nicht mehr geschafft hat, sich allein um ihren Mann zu kümmern. Das lässt sie sich leider nicht ausreden.«
»Ich weiß«, sagte Pia bedrückt. »Deshalb kommt sie ja auch nicht wieder richtig auf die Beine. Sie sorgt sich nach wie vor unablässig um Papa und vergisst sich selbst dabei.«
»Ich habe mit dem Pflegepersonal gesprochen, und die waren auch der Ansicht, dass sie psychologische Unterstützung braucht. Sie muss sich von diesem Schuldkomplex befreien.«
»Wenn das gelänge …«, murmelte Pia, aber sie hörte selbst, dass ihre Stimme nicht hoffnungsvoll klang.
»Es kann gelingen, Pia! Jedenfalls ist es einen Versuch wert.«
»Hat Papa dich erkannt?«
Sieglinde antwortete nicht sofort. »Nein«, sagte sie dann. »Das ist das Schwerste, Pia, dass er sich an nichts mehr erinnert. Er guckt mich ratlos an, wenn ich ihm von früher erzähle, und ich kann sehen, dass er nichts mehr davon weiß. Aber wir haben zusammen gesungen, das funktioniert immer noch. Ich fange an, und nach ein paar Takten fällt er ein. Seine Stimme klingt noch immer schön und voll, nur leider kommen mir dann immer die Tränen und ich kann nicht weitersingen. Aber wenn deine Mutter das merkt, springt sie ein.«
Wieder machte Sieglinde eine Pause, bevor sie weitersprach. »Das geht mir zu Herzen, weißt du? Dass alles, was die beiden noch gemeinsam tun können, das Singen ist. Nein, das stimmt nicht, manchmal gehen sie auch spazieren, Hand in Hand, wie früher. Aber viel mehr ist da nicht. Sie waren so lebensfrohe Menschen früher, sind gereist, waren neugierig auf die Welt, hatten viele Freunde und Bekannte, haben gerne gefeiert. Und das ist davon übriggeblieben. Das ist schon hart.«
»Für uns auch«, sagte Pia. »Wobei ich sagen muss, dass Valentin manchmal besser mit der Situation fertig wird als ich. Er nimmt Papa einfach so, wie er ist, aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass er sich an die Zeit, als er noch gesund war, gar nicht mehr erinnert. Er kennt seinen Vater eigentlich nur so, wie er jetzt ist. Bei mir ist das anders, ich habe noch so viele Bilder von früher im Kopf …«
»Am schlimmsten ist es sicherlich für eure Mutter«, erwiderte Sieglinde leise. »Ihr Mann verschwindet Stück für Stück vor ihren Augen. Ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor.«
Das Gespräch ging Pia noch lange, nachdem sie sich von ihrer Tante verabschiedet hatte, durch den Kopf, aber als ihr Bruder von einem Fußballspiel nach Hause kam, erzählte sie ihm nichts davon, denn er hatte eine klaffende Wunde an der Stirn, das Blut lief ihm über das Gesicht, und er war außer sich vor Zorn, weil es ihm nicht gelungen war, dem Jungen, der ihn so zugerichtet hatte, eine ähnliche Verletzung zuzufügen.
Pia säuberte die Wunde, wies ihren Bruder an, ein Stück Mullbinde fest darauf zu pressen, und fuhr mit ihm zu Frau Dr. Laurin in die Praxis – nicht zum ersten Mal.
*
Leon Laurin, Nachfolger von Professor Joachim Kayser als Leiter der Kayser-Klinik, Gynäkologe und Chirurg, steuerte auf ein Patientenzimmer in der Neurologie zu, als sich dessen Tür öffnete und seine Kollegin Linda Erdem herauskam. Sie lächelte ihn an. »Du wirst mit dem Patienten zufrieden sein«, sagte sie. »Es geht ihm mit jedem Tag besser, ich denke, wir können ihn bald entlassen.«
»Ich habe noch immer jede Nacht diesen Albtraum, dass er in die Klinik eingeliefert wird und wir ihm nicht helfen können, Linda.«
»Und dann wachst du auf und bist erleichtert?«
»Nicht sofort, es dauert immer ein paar Augenblicke, bis ich begreife, dass ich nur geträumt habe. Zuerst wirkt der Albtraum noch nach.«
»Wenn er nicht allmählich verschwindet, hol dir Hilfe dagegen«, sagte Linda. »Diese ganze Geschichte war schlimm, ihr standet ja alle unter Schock. Sind Herrn Daumes Schwestern noch immer bei euch?«
»Ja, und da werden sie auch bleiben, bis er wieder richtig fit ist. Das kann also noch ein Weilchen dauern. Aber die beiden sind keine Belastung für uns, im Gegenteil.« Leon lächelte. »Wir haben halt für eine Weile sechs Kinder statt vier.«
»Ich bewundere euch«, erwiderte Linda. »Und jetzt geh hinein und überzeug dich davon, dass Herrn Daumes Genesung rasante Fortschritte macht.« Sie eilte davon.
»Wie geht es Ihnen heute, Simon?«, fragte Leon Laurin, als er das Zimmer des jungen Mannes betrat, der seiner Familie den Haushalt führte und sie mit seiner Kochkunst verwöhnte. Das tat er, seit Leons Frau Antonia beschlossen hatte, noch einmal in ihren Beruf als Kinderärztin zurückzukehren, nachdem sie sich mehr als fünfzehn Jahre lang ausschließlich der Familie gewidmet hatte. Simon Daume war erst zweiundzwanzig Jahre alt, hatte sich aber in kürzester Zeit ›zum besten Haushaltsmanager der Welt‹ gemausert – so jedenfalls drückte es Leons jüngerer Sohn Kevin aus.
›Diese ganze Geschichte‹, die Linda Erdem angesprochen hatte, war ein Überfall gewesen: Es hatte morgens an der Haustür von Laurins geklingelt, Simon hatte geöffnet und war mit einem heftigen Schlag auf den Kopf niedergestreckt worden. Der oder die Räuber – die Fahndung der Polizei lief noch – hatten Bargeld, Schmuck und Wertsachen mitgenommen und waren anschließend spurlos verschwunden.
Da Simon zwei minderjährige Schwestern hatte, Lili und Lisa, für die er verantwortlich war, seit sie in kurzem Abstand beide Eltern verloren hatten, waren Leon und seine Frau Antonia übereingekommen, den beiden Mädchen anzubieten, für die Dauer von Simons Genesungszeit zu ihnen ins Haus zu ziehen. Lili war sechzehn, Lisa zwölf Jahre alt, sie hatten das Angebot ohne zu zögern angenommen. Seitdem mussten Hausarbeit und Kochen von allen gemeinsam übernommen werden, was bislang erstaunlich reibungslos klappte. Zwar waren die Mahlzeiten deutlich einfacher als das, was Simon kochte, und insgeheim sehnten sich alle nach seinen interessanten und abwechslungsreichen Menüs, aber niemand beklagte sich. Alle waren froh, dass Simon sich keiner Operation hatte unterziehen müssen – diese Möglichkeit hatte zunächst durchaus im Raum gestanden, aber jetzt war klar: Er würde auch ohne OP wieder ganz gesund werden, das allein zählte.
»Eigentlich könnten Sie mich entlassen«, antwortete Simon auf Leons Frage. »Ehrlich, ich fühle mich wieder fit, und ich möchte gern so schnell wie möglich wieder arbeiten. Es liegt mir nicht, den ganzen Tag nichts zu tun, das macht mich nur nervös.«
Leon lachte. »Sie wollen mir doch aber nicht erzählen, dass Sie sich nicht wenigstens neue Rezepte ausdenken, jetzt, wo Sie so viel Zeit haben?«, fragte er.
Simon lächelte verlegen. »Doch, das mache ich natürlich, aber ich kann sie ja nicht ausprobieren, deshalb ist das ziemlich unbefriedigend. Wenn ich jetzt eine Küche hier hätte und ein bisschen herumprobieren könnte, würde ich garantiert schneller wieder vollständig gesund.«
»Und die Kopfschmerzen?«
»Na ja, die habe ich manchmal noch«, gab Simon zu. »Wenn ich zu lange aufbleibe oder mich zu sehr anstrenge, tut mir der Kopf weh. Aber auch das wird besser.«
»Es zeigt aber, dass Ihr Kopf noch Ruhe braucht. Dr. Erdem hat Ihnen das doch sicher auch schon gesagt.«
»Ja, klar, sie sagt immer, nach einer ziemlich schweren Kopfverletzung muss man Geduld haben, sonst holt einen das später ein. Das will ich natürlich nicht.«
»Wenn wir sicher sein könnten, dass Sie sich nicht gleich wieder in die Arbeit stürzen würden, hätten wir wahrscheinlich nichts dagegen, Sie bald zu entlassen. Aber wenn Sie sich dann stundenlang in Ihre Küche stellen und alles ausprobieren, was Ihnen hier an Ideen gekommen ist, wird sich das langfristig negativ auswirken. Und das wollen wir vermeiden.«
»Ich verstehe das schon, und die Gefahr, dass ich gleich zu viel mache, besteht ja auch«, gestand Simon überraschend. »Ich merke selbst, dass ich mich zwar morgens fit fühle, dass das aber nicht sehr lange anhält. Ich werde schneller müde, ich kann mich nicht lange konzentrieren, und körperliche Anstrengung vertrage ich überhaupt nicht. Es muss alles ruhig und langsam vor sich gehen.« Er lächelte verlegen. »Ich kann noch nicht wieder bei Ihnen arbeiten, will ich damit sagen. Dieser Aufgabe bin ich noch nicht gewachsen. Ich könnte ab und zu kochen, das schon, aber putzen …« Er schüttelte den Kopf.
»Das sollen Sie ja auch gar nicht. Meine Schwester hat uns jetzt ihre Putzhilfe vermittelt, die kommt zwei Mal pro Woche, das hilft schon. Aber sie kocht natürlich nicht.«
»Meine Schwestern helfen aber schon mit, oder?«, fragte Simon besorgt. »Ich vergesse Ihnen das nie, dass Sie die beiden bei sich aufgenommen haben.«
»Wir halten das für selbstverständlich, Sie müssen das bitte nicht mehr erwähnen. Die beiden übernehmen vieles, sie haben schon mehrfach gekocht. Natürlich können sie das nicht so gut wie Sie, aber sie machen das sehr ordentlich. Und unseren Kindern tut es ganz gut, dass sie mal wieder etwas mehr mit anfassen müssen, glauben Sie mir. Wir sind alle ein bisschen verwöhnt worden von Ihnen, das merken wir jetzt wieder so richtig.«
»Ich bin auch verwöhnt«, stellte Simon ganz ruhig fest. »Ich habe einen schönen Arbeitsplatz, darf lauter Dinge tun, die ich gern tue, und ich werde noch ordentlich dafür bezahlt. Das ist Luxus.«
»Aber Sie putzen doch nicht im Ernst gern, oder? Ich weiß, wir haben schon darüber gesprochen, aber ich kann es einfach nicht glauben, dass jemand gerne putzt. Kochen ja, das verstehe ich, aber putzen …«
»Ich habe das schon immer gern gemacht, ehrlich. Wissen Sie, was ich daran toll finde?«
»Ich habe nicht die geringste Ahnung!«
»Dass man sofort den Erfolg sieht. Kochen zum Beispiel ist viel mühsamer, man muss erst viel Vorarbeit leisten, und oft weiß man noch nicht einmal, ob am Ende wirklich etwas Gutes oder sogar Außergewöhnliches herauskommt. Wenn man dagegen putzt und danach alles blinkt und blitzt, wird man sofort für seinen Einsatz belohnt.«
»Mhm«, machte Leon, »das leuchtet mir ein. Aber ich glaube, ich würde trotzdem nicht gerne putzen. Dann schon eher Gartenarbeit.«
»Unkraut jäten? Sehr, sehr mühsam, kann ich nur sagen. Fast so aufwändig wie Gemüse schneiden und Kräuter hacken …«
Sie lachten beide, dann fragte Simon: »Gibt es Neues von der Fahndung nach den Typen, die mich niedergeschlagen haben?«
»Viel mehr als das, was in der Zeitung steht, weiß ich auch nicht, aber es soll ja eine Spur geben. Die Spurensicherung hat doch bei uns im Haus Fingerabdrücke gefunden, die sich niemandem von uns zuordnen ließen, die sich aber in einer Kartei der Polizei gefunden haben.«
»Ich hoffe, sie finden sie«, sagte Simon. »Rachsüchtig bin ich nicht, aber sie sollen für das, was sie getan haben, bestraft werden.«
»Der Ansicht bin ich auch. Lili hat übrigens neulich erzählt, dass aus den USA eine Einladung gekommen ist – für Sie alle.«
»Ja, Oscar hat mir auch geschrieben.«
Oscar Becker war der Sohn einer Cousine von Simons, Lilis und Lisas verstorbener Mutter – die drei hatten nicht gewusst, dass in den USA Verwandte von ihnen lebten. Oscar hatte sich in der Heimatstadt seiner Mutter auf die Suche gemacht und hatte die drei Kinder der Cousine seiner Mutter schließlich gefunden. Ihre Begegnung war allerdings von dem Überfall auf Simon überschattet worden. Deshalb hatte Oscar zum Abschied auch nachdrücklich auf einem baldigen Wiedersehen bestanden – in den USA.
»Ich habe mir überlegt, dass Lili und Lisa in den Ferien in die USA fliegen könnten, ich bleibe auf jeden Fall lieber hier. Vielleicht später einmal.«
»Als Arzt kann ich das nur befürworten. Sie lassen es besser langsam angehen, Simon.«
»Das habe ich vor. Und mal eine Weile die Wohnung für mich zu haben, stelle ich mir auch ganz schön vor. Außerdem ist es so, dass Oscars Mutter an mir viel weniger interessiert sein wird als an Lisa, weil die ja unserer Mutter sehr ähnlich sieht. Das ist Oscar sofort aufgefallen, er kannte Jugendfotos von seiner und unserer Mutter. Ich glaube, er möchte, dass seine Mutter Lisa noch kennenlernt, sie wird ja vielleicht nicht mehr lange leben.«
Leon nickte, er kannte die Geschichte: Oscar Beckers Mutter Elisabeth hatte einen schweren Schlaganfall erlitten, sie konnte nicht mehr gut sprechen. Aber vorher hatte sie ihrem Sohn oft von jener Cousine in München erzählt, die früher wie eine Schwester für sie gewesen war. Diese Erzählungen hatten den Sohn dann letztlich zu seiner Reise nach Deutschland bewogen. Nur hatte er die Cousine eben nicht mehr ausfindig machen können, weil sie bereits verstorben war. Aber immerhin lebten ihre drei Kinder noch – und eins dieser Kinder sah seiner verstorbenen Mutter zum Verwechseln ähnlich und trug den Namen von Oscars Mutter: Elisabeth. Lisa.
»Wissen Lili und Lisa, dass Sie darüber nachdenken, sie in die USA fliegen zu lassen?«
»Noch nicht, es soll eine Überraschung werden. Lisa wird zuerst nicht wollen, sie ist ja immer ein bisschen ängstlich, aber Lili wird sie davon überzeugen, dass sie fliegen müssen, weil sie sonst Oscars Mutter möglicherweise nicht mehr kennenlernen.«
»Ich kann mir denken, dass es Ihnen schwerfallen wird, auf die Reise zu verzichten, denn Sie wollen Frau Becker ja sicherlich auch kennenlernen. Immerhin scheint sie sehr an Ihrer Mutter gehangen zu haben – und umgekehrt.«
»Natürlich möchte ich sie kennenlernen, aber jetzt kann ich so eine weite Reise nicht machen. Das muss warten. Und ich glaube, viel wichtiger ist, dass sie die Mädchen kennenlernt, in ihnen wird sie meine Mutter wiederfinden.«
Leon war beeindruckt von der Klugheit, die aus den Worten seines jungen Patienten sprach. Als er ihn verließ, konnte er jedenfalls Linda Erdem nur Recht geben: Simon war schon fast wieder gesund, und das allein war ein Grund, froh und dankbar zu sein.
*
Als Antonia Laurin sich von einer kleinen Patientin und deren Vater verabschiedete, sagte Carolin Suder, die vorne am Empfang saß und für einen reibungslosen Ablauf in der Kinderarztpraxis von Antonia und ihrer Kollegin Maxi Böhler sorgte: »Frau Moor ist gerade mit ihrem Bruder gekommen, Frau Doktor. Er hat eine ziemlich heftig blutende Wunde an der Stirn. Mal wieder.«
»Dann ziehen wir ihn vor. Wie sind wir denn in der Zeit?«
»Alles gut, kaum Verspätung«, erwiderte Carolin und ging zum Wartezimmer, um Pia Moor und ihren Bruder ins Sprechzimmer zu bitten.
In der Tat: Der Mull, den der Junge auf seine Wunde presste, war blutdurchtränkt. Er war blass, sah jedoch eher wütend und gekränkt aus als schmerzgeplagt.
»Was ist denn passiert?«, fragte Antonia ihn, als er auf der Untersuchungsliege Platz genommen hatte und sie vorsichtig den Mull abzog, um sich die Wunde genauer anzusehen.
Pia Moor schwieg, sie ließ meistens ihren Bruder reden, wenn sie der Ansicht war, dass er eine Frage besser beantworten konnte als sie. Also war sie bei dem Unfall – oder was immer zu dieser Wunde geführt hatte – nicht dabei gewesen.
»Da ist mir jemand blöd gekommen«, nuschelte Valentin.
Er war ein hübscher, lang aufgeschossener Junge, schon jetzt fast so groß wie seine vierzehn Jahre ältere Schwester. Beide hatten braune Haare, aber bei Pia Moor waren sie lang und glatt, bei ihrem Bruder kurz und lockig. Er hatte außerdem Sommersprossen auf der Nase, die bei seiner Schwester fehlten. Ihr Gesicht war eher schmal und fein geschnitten, seins war rund, die braunen Augen blickten angriffslustig in die Welt.
»Blöd gekommen?«, fragte Antonia, während sie die Wunde untersuchte.
»Na ja, der hat mich als Weichei bezeichnet, da musste ich ihm natürlich eine reinhauen, und danach hat er mir eine reingehauen, und dann kam noch ein Kumpel, der ihm geholfen hat, zu zweit haben sie mich geschubst, und ich bin geflogen und auf ’ner scharfen Kante gelandet.« Valentin hatte schnell gesprochen und weiterhin in diesem nuscheligen Ton, ohne seine Schwester oder Antonia anzusehen. Gegen Ende seines Berichts war seine Stimme immer leiser geworden. Es war offensichtlich, dass er den Kampf, bei dem er gegen zwei Gegner den Kürzeren gezogen hatte, als schwere und unverdiente Niederlage ansah und auf Rache sann.
»Das ist eine ziemlich tiefe Wunde, Valentin. Ich würde sagen, sie sollte genäht werden, da wird ein Klammerpflaster nicht ausreichen. Ich frage gleich mal drüben in der Klinik nach, ob sie das in der Notaufnahme sofort nähen können.«
Valentins Stimmung änderte sich, das merkte sie, während sie telefonierte und den Fall schilderte. Ihre Praxis war direkt mit der Kayser-Klinik verbunden, sie befand sich in den Räumlichkeiten, die durch einen Erweiterungsbau entstanden waren. Maxi und sie arbeiteten eng mit der Klinik zusammen, das hatte sich von Anfang an als Vorteil für beide Seiten erwiesen.
»Nähen?«, fragte Valentin, als sie ihr Gespräch beendet hatte. »Ich … muss ich da eine Spritze kriegen?«
»Eine kleine, ja«, antwortete Antonia.
Er biss sich auf die Lippen. Sie wusste, dass er Angst vor Spritzen hatte, seine Schwester, die noch immer nichts gesagt hatte, wusste es auch.
Jetzt ergriff sie zum ersten Mal das Wort. »Vielleicht hilft dir das, in Zukunft erst nachzudenken, bevor du dich auf jemanden stürzt und dich mit ihm prügelst«, sagte sie in sachlichem Tonfall. »Was ist das überhaupt für eine Art? Nur weil jemand ›Weichei‹ zu dir sagt, haust du ihm eine rein?«
»Ich kann mir das nicht gefallen lassen«, behauptete Valentin, »sonst wird das jeden Tag schlimmer. Man muss sich wehren, sonst wird man ein Opfer.«
»Opfer?«
»Ja, zuerst wirst du beschimpft, dann bedroht, dann verprügelt. Man muss sich Respekt verschaffen.«
»Das geht auch anders«, sagte Antonia. »Man kann sich zum Beispiel auch mit Worten wehren.«
»Manchmal, ja, aber nicht bei diesen Hohlköpfen. Die verstehen nur Schläge«, behauptete Valentin.
»Ich bin überzeugt, dass das nicht stimmt«, widersprach Pia.
Antonia kam ihr zu Hilfe. »Ich auch. Aber wir können dieses Gespräch jetzt leider nicht fortsetzen, Sie müssten bitte gleich mit Valentin in die Notaufnahme gehen, Frau Moor. Dr. Hillenberg wartet auf Sie, er wird die Wunde nähen.«
Valentin rührte sich nicht. »Ich will keine Spritze.«
»Gut«, erwiderte Antonia gelassen, »dann sag Dr. Hillenberg das, er näht sicher auch ohne Spritze.« Sie sagte das, ohne auch nur das Gesicht zu verziehen, denn natürlich würde jeder Arzt auf einer Betäubung bestehen, aber sie kannte Valentin und wusste allmählich, wie sie ihn zu nehmen hatte.
»Komm schon«, sagte Pia und packte ihren Bruder am Arm, »gehen wir. Danke, Frau Dr. Laurin, bis zum nächsten Mal.«
Antonia ertappte sich bei dem Wunsch, den beiden zu folgen, um zu erfahren, wie der Kampf um die Spritze ausgehen würde.
Sie erfuhr es dann später von ihrem Mann: Michael Hillenberg hatte sich der Wunde mit der Nadel genähert, ohne die Stelle vorher örtlich zu betäuben, und die bloße Berührung hatte schon gereicht, um Valentin eines Besseren zu belehren. Er hatte sich die Spritze mit zusammengebissenen Zähnen geben lassen und war hinterher richtig stolz auf sich gewesen.
*
Marius Klebert setzte seinen letzten Fahrgast ab und atmete auf. Er war jetzt zehn Stunden gefahren, es reichte ihm. Immerhin: Das Taxifahren ernährte ihn. Nicht so gut wie früher natürlich, aber er kam zurecht, und er hatte seine Ruhe. Er hatte ein paar Stammkunden, die er mehrmals pro Woche fuhr, die gaben auch gutes Trinkgeld. Er verdiente bislang mehr als er brauchte, aber natürlich konnten die Zeiten auch wieder einmal schlechter werden.
In seinen früheren Beruf jedenfalls würde er nicht zurückkehren. Nie mehr, nach allem, was ihm passiert war. Er versuchte, nicht zu oft daran zu denken, aber es gab Tage, an denen er die Erinnerungen einfach nicht abschalten konnte. Und Nächte, in denen ihn die Geschehnisse verfolgten, sowieso.
Heute war es gut gelaufen, das Wetter war schön, und er hatte keine Lust, in seiner Wohnung zu bleiben. Er würde einen langen Spaziergang machen und dann irgendwo eine Kleinigkeit essen.
Er hatte einen Kollegen, mit dem er sich gut verstand, einen türkischen Taxifahrer, der ein sehr netter Kerl war – mit einem Schicksal, das seinem eigenen nicht ganz unähnlich war, denn auch Ali Ucuk konnte nicht mehr in dem Beruf arbeiten, den er einmal gelernt hatte. Er war Jurist, aber um als solcher in Deutschland zu arbeiten, hätte er weitere Prüfungen machen müssen. »Da fahre ich doch lieber Taxi, schließlich muss ich meine Familie jetzt ernähren und nicht irgendwann, wenn ich mit allen Prüfungen fertig bin.«
Mit Ali traf er sich manchmal auf ein Bier, er war auch schon bei ihm zu Hause eingeladen gewesen, aber das wollte er nicht wiederholen. Keine zu engen Kontakte, keine Verpflichtungen, das war sein neuer Wahlspruch. Zum Glück kam er gut mit sich allein zurecht, er fühlte sich nicht schnell einsam, obwohl er in letzter Zeit öfter gedacht hatte, es müsste schön sein, eine Familie zu haben, in der man sich sicher fühlen konnte.
Ali hatte ihn schon mehrmals gefragt, wieso er allein war, keine Frau hatte, keine Kinder. Marius sagte dann, dass ihm die richtige Frau noch nicht begegnet sei und dass er sich gerade erst von seiner letzten Freundin getrennt habe und diese Trennung noch verarbeiten müsse. Aber das Thema schien Ali keine Ruhe zu lassen, er kam immer wieder darauf zurück. »Ein Mann wie du braucht eine Frau! Du siehst gut aus, du verdienst gutes Geld, du brauchst eine Frau und Kinder, dann würdest du auch öfter lachen.«
Marius war schon manches Mal in Versuchung gewesen, ihm die Wahrheit zu sagen, aber er wusste, dass das der größte Fehler gewesen wäre, den er machen konnte. Er würde seine Geschichte niemandem erzählen, er würde sie mit ins Grab nehmen, das hatte er sich fest vorgenommen.
Und er musste bald wieder umziehen, denn die Frau in der Wohnung unter ihm beunruhigte ihn. Vom ersten Moment an war das so gewesen. Er hatte sie nur einmal sehen müssen und gewusst, dass sie gefährlich für ihn war. Sie war sehr hübsch, hatte ein schönes Lächeln, eine angenehme Stimme, und sie stand mit beiden Beinen im Leben. In eine wie sie konnte man sich verlieben.
Halt, befahl er sich selbst. Denk nicht einmal dran!
Zuerst hatte er gedacht, der Junge, mit dem sie zusammenwohnte, sei ihr Sohn, obwohl ihm der Altersunterschied von Anfang an zu gering vorgekommen war. Aber dann hatte er aufgeschnappt, dass dieser Valentin ihr Bruder war, um den sie sich kümmerte, weil die Eltern es offenbar nicht mehr konnten. Das fand er bewundernswert, aber für ihn war es ein weiterer Grund, sich von ihr fernzuhalten. Er wollte sie nicht näher kennenlernen, denn ihm schien, dann würde er sich ganz sicher in sie verlieben, was angesichts seiner Geschichte wirklich katastrophal gewesen wäre – und voll bitterer Ironie. Wenn man sich verliebte, vertraute man einander seine Geheimnisse an. Soweit durfte er es also nicht kommen lassen. Sein Geheimnis musste sein Geheimnis bleiben.
Er rief Ali an und fragte, ob dieser Lust auf ein Bier habe, aber Ali war schon zu Hause. »Komm doch vorbei und iss mit uns. Wir überlegen, ob wir im Garten grillen.«
»Wenn ich das Fleisch einkaufen darf, bin ich dabei«, sagte Marius.
Das wollte Ali zuerst nicht akzeptieren, aber schließlich willigte er ein, und so machte sich Marius auf den Weg zum Metzger. Ein Grillabend im Garten war lockerer als ein Essen bei Alis Familie in der Wohnung.
An der frischen Luft würde er sich außerdem aufhalten, und die Gesellschaft von Alis lebhafter Familie würde ihn von den Gedanken an seine beunruhigende neue Nachbarin ablenken.
Das klang nach dem perfekten Plan für diesen Abend.
*
»Erklär mir das bitte noch einmal«, sagte Pia. »Wieso meinst du immer gleich, dass du dich prügeln musst?«
»Das meine ich ja gar nicht, aber wenn einer ›Weichei‹ zu mir sagt, und ich sage dann auch was Beleidigendes, dann schlägt er zu, und ich prügele mich auch, bloß, dass ich nicht angefangen habe, sondern er. Was soll daran besser sein?«
»Schlagen denn alle gleich zu?«
Valentin zuckte missmutig mit den Schultern und behauptete: »Die meisten, das gehört dazu. Man muss zeigen, dass man kein Opfer ist, dann wird man in Ruhe gelassen.«
»Und wieso lassen sie dich dann doch nicht in Ruhe? Du hast dich doch schon öfter geprügelt.«
Valentin druckste eine Weile herum, bis er sagte: »Sie denken, ich bin ein Weichei, weil bei mir zu Hause meine Schwester das Sagen hat.«
»Soll das ein Witz sein?«, fragte Pia. »In welchem Jahrhundert leben wir denn?«
»Ein Mann muss hart und männlich sein«, sagte Valentin. »Ich bin das nicht, ich bin zu weich.«
»Und das liegt an mir?« Pia fielen beinahe die Augen aus dem Kopf.
»Das behaupten sie jedenfalls.«
»Wer denn? Wer behauptet das?«
»Ach, mehrere. Wenn einer mal damit angefangen hat, machen die anderen das nach, und dann wird man das nicht mehr los.«
»Willst du jetzt doch lieber zu Tante Siggi und Onkel Kurt ziehen? Da hast du einen richtigen Mann, mit dem du zusammenleben kannst.«
Valentin schüttelte den Kopf. »Ich will bei dir bleiben«, sagte er. »Aber kannst du nicht heiraten?«
»So einen richtigen harten, männlichen Mann, meinst du? Damit diese komischen Typen, mit denen du es da zu tun hast, dich nicht mehr als ›Weichei‹ verspotten?«
Valentin grinste verlegen. »Das klingt ein bisschen blöd«, gab er zu.
»Nicht ein bisschen, es klingt komplett blöd. Ich bin nur froh, dass du das wenigstens selbst einsiehst.«
Als sie Valentins Gesicht sah, beschloss sie, das Thema zu wechseln.
Sie hatte gesagt, was zu sagen war, nun musste sie darauf hoffen, dass ihre Worte auf fruchtbaren Boden fielen und Valentin anfing, darüber nachzudenken.
*
»Was ist das?«, fragte Kyra Laurin und schnupperte. »Das riecht gut.«
»Polenta mit buntem Sommersalat«, antwortete Lili Daume, Simons sechzehnjährige Schwester.
»Schon wieder kein Fleisch?«, maulte Kevin.
»Doch, wir haben auch etwas Huhn dazu gebraten«, sagte Lili. »Wer will, isst die Polenta mit Huhn, die anderen ohne. Kyra und ich zum Beispiel.«
»Ich auch«, sagte Lilis jüngere Schwester Lisa schnell, wobei sie Kyra zulächelte.
Sie war nur ein Jahr älter als Kyra, die beiden Mädchen verstanden sich gut.
»Ich auch«, sagte Kaja.
»Ich esse auf jeden Fall Huhn«, sagte Kevin.
Sein älterer Bruder Konstantin und beide Eltern schlossen sich an.
»Halbe-halbe«, sagte Lili, »ist doch gut.«
Alle griffen herzhaft zu, das Essen wurde sehr gelobt.