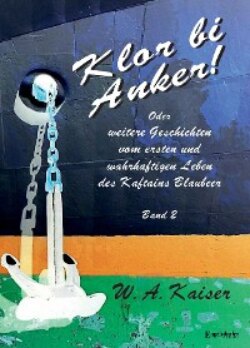Читать книгу Klor bi Anker! Oder Weitere Geschichten vom ersten und wahrhaftigen Leben des Kaftains Blaubeer (Band 2) - W. A. Kaiser - Страница 6
Hansa Victory (2003)
ОглавлениеDas schlimme Freifallbootsmanöver
Pitcairn und die HMS „Bounty“
Mann über Bord
Panamakanal
Das Desaster der „Tricolore“
Ablöser mit Handikap
Lukenprobleme #2
Osaka verlassend, navigierten wir mit der Segel-Order, den Hafen von Tauranga nicht früher und nicht später als am 06. August zu erreichen, los. Mit leerem Schiff, einem ganz leeren Schiff. Die Laderäume wurden von der Crew gewaschen, gereinigt und die vielen Beschädigungen an Wänden und Grätings repariert, die sich zwangsläufig einstellten, wenn Gabelstapler und Hubwagen auf den Decks herumfuhren. Niemand nahm Rücksicht, nicht mal unsere eigenen Leute, die, wenn sie als Raumwache eingesetzt waren, solche Schäden zu melden hätten und allein durch ihre Gegenwart dieses eigentlich verhindern sollten. Das war in der Realität eben nicht so, Fraternisierung mit dem ‚Gegner’, Augen zu und weggeguckt. In solchen Momenten waren unsere Jungs fast ohne Erinnerungsvermögen: Der Moment zählte, dass aber all diese Schäden sehr kostenund arbeitsaufwändig später durch uns selbst zu beseitigen waren, war dann für sie ohne Belang – im Moment, wenn sie als Raumwache eingesetzt waren.
Diese Arbeiten waren wichtig genug, dementsprechend waren alle anderen Arbeiten dem nachgeordnet worden. Nicht zu vergessen: Wie’s der Zufall so wollte, war unsere liebe gute „Tante Victory“ beim letzten Mal wegen mangelnder Sauberkeit in den Luken geblacklistet worden! Das war erst im März gewesen. Und die Kiwi-Bauern vergaßen so schnell nicht, ohne das Gegenteil gesehen zu haben. Also ein Makel, der uns an der Backe klebte und den wir so schnell wie möglich tilgen mussten. Zumal das nicht stillschweigend vonstattenging, sondern richtig im Rundumschlag bekannt wurde: der Charterer fand es nach uns als Erster auf dem Tisch, dass ‚sein‘ Schiff den bekannt hohen Ansprüchen der exportierenden Bauern Neuseelands nicht gerecht wurde, zusätzlich trudelte dann bei dem auch noch unser Bericht ein, der darüber Auskunft gab, dass das Schiff soundsoviel Zeit für Nacharbeiten brauchte, und in dieser Zeit nicht ladetüchtig war, wie es in den Verträgen festgeschrieben stand. Der Charterer rief dann natürlich sofort den Eigner, also unseren Reeder an, der sich nix sehnlicher wünschte, als morgens irgendeine Botschaft mit Geldforderungen auf seinem Schreibtisch zu finden. Der wiederum klingelte mich ohne Berücksichtigung des Zeitunterschiedes sofort aus den Federn und verlangte dazu Erklärungen! Tja, und wenn man dann sagen musste, dass die Luken zwar gemacht wurden, aber die Kontrollen durch den Chief Mate wohl nicht ganz so exakt gewesen waren, dann hattest du beim Reeder schlechte, sehr schlechte Karten, wenn du denn dann mal um eine Lohnerhöhung bitten wolltest.
Also ließ man das besser sein und machte Nägel mit Köpfen. Und passte scharf auf. Mit diesem Wissen machte ich natürlich Druck auf den Chief Mate, der aber auch von sich aus schon bestrebt war, die Scharte seines Vorgängers nicht noch tiefer zu hauen, sondern besser großflächig auszubügeln. So konnte man erkennen, dass auch diesen Chief Mate keine Schuldzuweisung traf; ebenso wie ich war er erst nach dem Zwischenfall hier aufgestiegen. Nur die Crew war noch die alte, die damals ihre Hausaufgaben ungenügend erledigt hatte.
Und diese, könnte man meinen, sollte selbst so viel Stolz besitzen, diese ‚Schmach‘ auszulöschen. Aber wieder einmal ein typischer Fall von ‚Denkste‘! Denen war es doch völlig egal, ob sie eine Woche oder hundert Wochen in den Luken hockten! Sie wurden nach Zeit bezahlt, egal, was am Tagesende dabei rauskam. Das war denen sowas von schnurz-pieps am Mors vorbei! Nur die täglichen vier Überstunden zählten: Das war bares Geld. Und mehr nicht. Man konnte nur kopfschüttelnd danebenstehen, wenn man den Mackern beim Arbeiten zusah! Technisch waren sie bis auf zwei einzelne Nasen wirklich doof, gerade mal, dass sie wussten, wo beim Hammer der Stiel saß und was ein Nagel war. Damit hatte es sich auch schon. Aber immer schön auf einem Haufen zusammensitzen! Könnte man verrückt werden.
Mit dem Chief Mate hatte ich dann eine Art Strategie entworfen, wie wir das Problem der mangelnden Produktivität etwas mindern konnten. Wir hatten den Fitter aus der Maschine noch dazu genommen und zwei Gruppen gebildet, die wir in zwei verschiedene Luken steckten. Und dann immer schön von 0600 Uhr morgens bis 2100 Uhr, nur durch die Mahlzeiten und Smoketimes unterbrochen. Glücklich wurden sie dadurch nicht wirklich richtig. Ich aber eigentlich auch nicht, da ich nun zeitweilig die Wache von Chief Mate übernahm, damit der seine Schafe zuhauf trieb, wenn sie meinten, unkontrolliert die Zeit absitzen zu können, was also meistens in der regulären Wachzeit des Chief Mates war. Schließlich hatte ich mit dem Chief Mate zwei Tage vor Erreichen des Hafens, als die Luken klargemeldet worden waren, einen Rundgang (mit weißen Baumwollhandschuhen!) gemacht.
Selbstverständlich wurden wir da fündig! Aber solcherart ‚Feiertage‘, dass man sich unwillkürlich genötigt sah, sein Auge scharfen Blickes in die Runde zu werfen und zu fragen, ob das nicht doch willentlich geschah? Zumal der Chief Mate vorher selbst einen Check gemacht hatte und diesen Zustand für gut befunden hatte. Und nun der Alte noch höchstpersönlich! Damit aber hätte er rechnen müssen! Ich wollte mir doch nicht vorwerfen lassen, nichts getan und mich ihm blindlings ausgeliefert zu haben, was zwar für ein ausgesprochenes tolles Verhältnis spräche, aber dafür hätte ich mir ja nun gleich gar nix kaufen können, weil das Kind erst am Brunnen mit dem Krug zusammenbrach!
Wir fanden sozusagen die Inkarnation des Bösen selbst: Vergammelte Bananen der vorigen Reise! Alleine schon, dass eine Handvoll Bananen, und die hätte sogar noch grün oder gelb sein können und nicht schwarz wie diese, zu finden war, hätte einem Besichtiger doch nichts Anderes bedeutet, als dass hier wohl sichtlich gereinigt, aber nicht sorgfältig genug und vor allem der Laderaum unkontrolliert abgenommen worden war. In summa, dass sich die Schiffsleitung auch nicht des Übereifers schuldig gemacht hatte! Dazu kamen noch etliche Beschädigungen, die übersehen worden waren und Schmierfettflecken von den Gabelstaplern. Es war eine schier endlose Latte, die wir zusammentrugen. Der Chief Mate guckte schon ganz finster. Nur noch zwei Tage bis Buffalo! Und dann flog die Schwalbe über den Eriesee … John Maynard …
Unsere Krieger mussten nochmal in die Schlacht ziehen. Zu diesem Zeitpunkt setzte uns ein wunderschön hoher, südlicher Schwell ziemlich zu. Das leere Schiff, dessen Schwerpunkt naturgemäß sehr tief lag, benahm sich dann wie ein Stehaufmännchen und es rollte stark nach beiden Seiten, was zwar am deutlichsten auf der Brücke bemerkbar wurde, aber in der Luke nicht minder hinderlich war, weil mit Kreissäge und Flex gearbeitet werden musste und sich der Boden unter einem und der ganze Raum drumrum sowieso bewegte!
Tage vorher erhielten wir die Anfrage, ob wir nicht doch etwas früher vorliegen könnten, da das Schiff vor uns die ‚pre-loading-survey‘, also genau das Ding, was wir hier gerade bekämpften, nicht bestanden hätte und wir sofort an die Pier könnten. Na, Schiet aber auch! Wir hatten doch sogar schon reduziert, um nicht zu früh dort zu sein, was ja wegen des damit verbundenen höheren Spritverbrauchs auch eigentlich nicht erwünscht war. Na, nochmal gerechnet und dann zurückgetelext: Yes, können wir! Waren also am 5. nachmittags schon da. Das hieß für den Chief: Eine Kohle mehr auflegen und für die Deckscrew: Sich sputen mit den Luken.
Am Einlauftag erhielt ich morgens die Nachricht, dass das andere Schiff die Mängel nun doch noch behoben hätte und wir demzufolge bis zum nächsten Tag auf Reede warten sollten. Auch nicht schlecht, Herr Specht!
So erreichten wir Tauranga, meinen kleinen Lieblingshafen in Neuseeland, bei strahlendem Sonnenschein und legten uns weisungsgemäß mit fünf Längen Kette zu Wasser auf siebzehn Meter Wassertiefe vor Anker.
Die ruhige See flüsterte mir angesichts der besten Voraussetzungen eine gefährliche Botschaft ins Hirn: Mach ein Bootsmanöver! Mach! Mach doch! Lass es fallen! Feigling, Feigling! – Ja, dieses Manöver sollte man mal gemacht haben und turnusmäßig wäre es sogar dran gewesen. Sicherheitshalber konsultierte ich aber dann doch lieber noch schnell den Chief, was er denn so zu meiner Absicht meinte. – Nee, antwortete er, dann passiert immer irgendwas, weil’s immer so war, wenn das Boot zu Wasser ging und er dann mit Reparatur und so’n Schiet zu tun hätte, wo er doch schon genügend Sorgen hatte mit seiner Maschine und den begnadeten Ingenieuren. Nee, besser wohl nich, oder?
Aber die Bedingungen waren geradezu bilderbuchmäßig ideal! Wie für ’n Film! Kaum Schwell, kein Wind, Sonne mit Blende 8 und die Luken waren endlich auch fertig! Außerdem wusste schon keiner mehr, wann das Boot das letzte Mal zu Wasser war. So wär’s doch schnell hinter uns zu bringen, oder? Also was soll’s? Ich gab meine Absicht dem zweiten Mate bekannt und bestimmte, wer alles mit ins Boot musste. Nach der nachmittäglichen Coffeetime ging’s zu Wasser. Der Chief schüttelte nur den Kopf und wandte sich ab. Dienst ist Dienst, sagte ich mir, nur schnell zu Wasser, eine Runde um das Schiff und wieder hoch. Konnte nicht allzu lange dauern. Außerdem war der Chief Mate, der beim Mann-über-Bord das Kommando im Boot haben würde, und der dritte Mate noch nie mit dem Boot runtergefallen.
Der Koch meldete sich sogar freiwillig, den kleinen Steward muss ich erstmal suchen, um ihm zu sagen, dass er auch Teil der Crew wäre, ebenso den zweiten Ingenieur, der sichtlich nervös und ängstlich war, die wollten nicht mit, weil ‚das nicht sicher sei‘ und anderer lahmen Argumente mehr, die vorzubringen niemand verlegen war, wenn es half, an Bord zu bleiben. Aber bei mir? Auf Granit gebissen, meine Herren! Hier fiel ins Wasser, wer’s brauchte! Letztlich waren acht Leutchen im Boot und wir starteten das Manöver.
Ich gab das Kommando zum Wassern und dann, wie erwartet, ruckte das Boot kurz auf der Laufbahn und rumpelte gleitend, immer schneller werdend die Schräge hinab und schoss ins Wasser, dass die Gischt hoch aufschäumte! The boat was waterborn! Es schnitt nur gering mit dem Bug unter und entfernte sich, eine dunkelgraue Abgasfahne hinter sich herziehend, schnell von der Eintauchstelle. Gratulation! Die Jungs, die sich neugierig auf der achteren Station eingefunden hatten, applaudierten laut. Okay, das war’s. Schnell zur bereits ausgebrachten Lotsenleiter, den Koch und Steward abgegeben, damit wir abends was zum Mampfen hätten und eine Runde ums Schiff und zurück in Mutterns Schoß.
Ich schaute mir die Aktion vom Brückendeck aus an, weil ich sozusagen anstatt des Chief Mates nun die Wache hatte. Der Wagen, also der bewegliche Teil des Davits, der gefiert wurde, um, in der unteren Endlage angekommen, wie ein Galgen das Boot mittels Drähte und Haken aufzunehmen, lief gehorsam und ohne Sperenzchen bis zur Endlage die Laufbahn hinab. Nun hätte sich eigentlich programmgemäß durch die schräge Lage des Davits die Traverse, an der die Haken zum Aufnehmen des Bootes befestigt waren, diese zu Wasser fieren lassen müssen. Was aber ausblieb. Ärgerlich, das! Ich orderte den Davit nochmal ganz nach oben. Wunschgemäß fuhr das tonnenschwere Gefährt wieder hoch. Und noch einmal mit offener Bremse den Wagen in untere Lage laufen lassen, wieder und wieder.
Es verging Zeit. Irgendwas beklemmte wohl die Traverse in der oberen Lage. Ich schickte den Bootsmann mit noch zwei Leuten nach Brechstange und Holz und dann hoch aufs Davit mit den dreien. Die hingen wie ein Schluck Wasser in der Kurve oben auf dem Davitkopf, gesichert mit einem Fallschutzgurt und strampelten sich ab, bewegten aber auch nichts. So ein Mist aber auch! Es ließ mir keine Ruhe, ich flitzte in die Kammer, zog mich schnell um und war nach kurzem wieder am Platz des Geschehens. Ich musste mir selbst den Schaden besehen. Der Chief guckte finster und begleitete mich zum Davit.
Dann kam noch der Chief Mate dazu. Mit vereinten Kräften versuchten wir, das verdammte Teil, das bombenfest saß, zu bewegen. Auf einer Seite der Traverse gelang es uns, das Teil um wenige Millimeter, immerhin aber wenigsten sichtbar, wenn auch bei Weitem nicht ausreichend, zu bewegen. Die andere Seite rührt sich aber nicht den Hauch eines Millimeters! Wir quälten uns, denn Platz war da oben auch nicht recht und die Brechstange mit Aufsatzrohr mittlerweile schon so voll Fett geschmiert, wenn man da nicht aufpasste, rutschte man ab und knallte vielleicht noch irgendwie hin oder gar runter! Aber das Ding wollte und wollte nicht.
Natürlich standen starke Mooringwinden unter dem Davit auf der achteren Station, aber wir brauchten dann einen Fixpunkt, der hinter dem Schiff angebracht sein müsste, um mit Schmackes in diese Richtung zu ziehen, da sich der Davit, wenn er ausgeklappt war, ungefähr sechs Meter hinter der Achterkante des Schiffes befand, wo die Hakentraverse eigentlich frei in Richtung Wasser nach unten laufen sollte. Dort bräuchten wir einen, der da mal anfasste, aber wir hatten nix als das Boot im Wasser. So versuchten wir es mit unserem Vier-Tonnen-Leichtgewicht von Boot, angetrieben von einem dänischen Fünfzig-PS-Diesel. Das war die einzige jämmerliche Chance, die uns zur Verfügung stand. Wir befestigten zwei dreißig Meter lange Leinen an den beiden Haken und gaben sie zum Boot runter, wo sie mit dem Aufheißgeschirr verbunden wurden. Nun fierten wir den Davit wieder in die untere Lage und das Boot sollte nun mit Karacho und Anlauf von der Bordwand nach achteraus dampfen und dabei so viel Speed wie möglich aufnehmen.
Das geschah wunschgemäß. Und nichts passierte. Das achtundzwanzig Millimeter dicke Tauwerk straffte sich – und das Boot stoppte. Mit weichem Nicken nahm es trotz seiner Maschine, die auf „Voraus Voll“ lief, wieder Fahrt übern Achtersteven auf. Wir hatten dafür gar kein Auge, wir starrten nur gebannt auf die Traverse. Tat sich da was? Ruckte das nicht doch schon etwas stärker? Also nochmal, und wieder und wieder. Es ging auf 1900 Uhr. Der Koch wartete schon über eine Stunde auf Kundschaft. Ich war dem Wetter sehr dankbar, dass sich nicht verändert hatte. Es war zwar nun dunkel, aber der Wind blieb aus und der leichte Schwell hatte ebenfalls nicht zugenommen. Immerhin günstige Bedingungen für ein Manöver wie dieses. Dann endlich geschah das Unfassbare: Die eine Seite kam völlig frei und nun hing die Traverse schon auf halb acht. Kam eine, würde auch die andere kommen! Wir enterten wieder hoch, zum x-ten Mal mit der Brechstange und das zeitigte endlich langsam Erfolge, das geringe Rucken durchs Boot hatte etwas bewirkt, zwar noch lange nicht genug, aber ausreichend für einen leichten Hoffnungsschimmer. Es dauerte noch so eine weitere halbe Stunde, bis alles jauchzte und jodelte: Die andere Seite war nun auch endlich frei! Nun konnten wir aufatmen und schon mal an das Wohl unserer Wänster denken, deren Äsung in greifbarere Nähe rückte. Wir fierten die Traverse zu Wasser und die Leute verbanden deren Haken mit dem Heißgeschirr des Bootes. Ready to heave up! Ich drückte den Nach-oben-Knopf der Anlage und folgsam hob sich das Boot langsam, das Heck voran, aus dem Wasser und – dann stand die Winde! Das hieß, der Motor drehte zwar hörbar weiter, aber die Drahttrommel drehte sich einen Scheißdreck!
Den Davit wieder runterzufieren ging problemlos, weil es über Schwerkraft geschah, daran hatte der Motor keine Aktien! Aber hoch, das schaffte der Motor nur bis zu einer gewissen Last und kein Deutchen mehr. Guter Rat war nun nicht billig! Ich konnte ja morgen früh so nicht einlaufen: das Rettungsboot vielleicht noch im Schlepp! Irgendwie war die Winde auch verdammt heiß!
Also entschied ich mich. Wir ließen das Boot wieder zu Wasser, es sollte längsseits verholen, wo wir es mit einem Ladekran an Deck hieven würden, um uns in aller Ruhe der Winde widmen zu können. Weiterhin beauftragte ich Leute, ausreichend Holz zum Abpallen bereitzuhalten und wir verholten uns alle auf das Hauptdeck. Ein erfahrener Mann hoch in den Kran, die anderen rannten und trugen, zerrten und wirbelten an Deck. Der Koch wartete immer noch. Und es war nun schon fast 2000 Uhr!
Nach einigem Hin und Her war dann endlich auch ein entsprechender Drahtstropp gefunden worden, stark genug, um das Boot gefahrlos aus dem Wasser zu heben. Ab ging die Post, sprich: der Ladehaken. Mir kamen leichte Bedenken als ich beobachtete, wie stark der Haken, noch ohne Last, begann, gefährlich hin und her zu pendeln. Da kamen Massen in Bewegung, die man mit bloßer Hand nicht mehr dirigieren konnte! Das Schiff hob und senkte sich ja doch etwas in der flachen Dünung. Und wenn das Pendel mit den Schiffsbewegungen harmonisierte, dann könnte das richtig gefährlich werden, weil sich die Bewegungen aufschaukelten! Stichwort: Resonanz! Gar nicht daran zu denken, dass dann ein schweres Boot am Haken hängen würde, das zu allem Überfluss auch noch schräge mit dem Bug abwärtszeigend hochgenommen werden musste! Denn so war das originale Aufheißgeschirr ausgelegt worden, nämlich mit der notwendigen Schräglage, um das Boot zurück in den Davit zu kriegen. Der Kranhaken wurde nochmal erreichbar für die Crew an Deck gefiert. Nur mit Mühe konnte der schwere Haken eingefangen und an ihm zwei Beiholer befestigt werden. Nur mit den beiden Leinen konnten wir etwas Kontrolle auf ihn und seine Last ausüben, indem wir sie mit ein paar Turns um die Reling ständig straff hielten!
Die beiden verbliebenen Leute im Boot befestigten den Drahtstropp am Bootsgeschirr, verließen eiligst das Boot, indem sie hurtig die Lotsenleiter hochhampelten, und wir starteten die geplante Rückholaktion. Auch am Boot befanden sich vorn und achtern Beiholer, um unerwünschte Schwingungen oder Drehungen rechtzeitig zu verhindern. An Deck war mittlerweile aus Bohlen und alten Paletten ein ‚Bett‘ für das Boot hergerichtet worden. Dort setzten wir es nach vielem Geschrei, Gezerre und Hin und Her – und nach langen bangen Minuten endlich, endlich! – ab! Krachend und knirschend setzte der Kiel des Bootes auf die hölzernen Polster auf und zerdrückte sie gnadenlos das hatten wir vorhergesehen und mit einer ausreichende Menge Holzes bedacht. Nun wurde es nur noch gelascht, so dass es nicht mehr auf die Seite fallen konnte. Schon war die um 15:20 Uhr begonnene Ausflugstour beendet. Es ging auf zweiundzwanzig Uhr. Sehr nett.
Hatte der Chief doch Recht behalten. Aber eigentlich hatten wir beide mehr dem Boot denn dem Davit den Part des Übelmanns zugetraut! Weil der Motor des Bootes früher mal überhitzt worden war, waren dort die Kühlung und Schmierung nicht mehr klar getrennt, sondern das Kühlwasser mischte sich so peu-á-peu unter das Schmieröl, was nicht gesund war und die Leistung des Motors negativ beeinflusste. Na, die Ingenieure waren noch bis gegen Mitternacht an der Winde, um die Ursachen für deren Versagen zu finden, während ich mich schon immer mal mit der Reederei in Verbindung setzte, um die nächsten Schritte zu beraten. Ich kriegte eine Adresse für eine Werkstatt hier in Tauranga, die auch gleich meinen Anruf mit der Aufforderung, morgen an Bord zu kommen, erhielt.
Unser Untersuchungsteam wurde nach Aufnahme der Winde schnell fündig: ein ausgelaufenes Lager hatte sich so festgefressen, dass die Bremsandruckscheibe gerissen war, wodurch der nichtmetallische Bremsbelag wie mit einer Raspel fein säuberlich und vollständig abgeschält worden war, bei jeder Umdrehung etwas mehr, bis Metall auf Metall schliff, und dann hielt und bremste bekanntlich gar nix mehr.
Der nächste Tag kam, nun jedoch grau und wieder nieselverhangen. Die erste Frage des Lotsen, nachdem er an Bord war, galt dem Rettungsboot. Klar, das erregte Aufsehen, wenn ein Handelsschiff sein Boot nicht im Davit, sondern an Deck sehr unorthodox geparkt hatte. Unser Partner, der den Liegeplatz ockupiert hatte und der die Huddelei mit den Luken hatte, lief aus und wir passierten uns an der Ansteuerung. Ein kleineres Schiff, auch für Europa bestimmt, aber von einem anderen Charterer. Die bekannte 90°-Kurve kurz vor dem Strand und um den ehemaligen Vulkan Mount Maunganui herum und schon waren wir in der kleinen natürlichen Bucht, die den Containerhafen, die Marina sowie die Stückgutpier, an der wir nun zum Liegen kamen, beherbergte. Gut, wieder hier zu sein. Bei den Lotsen hatte ich nie einen schlechtgelaunten oder schlechtinformierten angetroffen; sie waren alle durch die Bank gut und die Schlepper stark und modern.
Was wollte ein Blaubeer mehr vom Meer?
Schnell und gekonnt wurden wir gedreht und waren noch vor dem Abendbrot fest vertäut. Ich verabschiedete den Lotsen, klarte die Brücke auf und ging in mein Office, um auf die Behörden zu warten.
Ich wartete wenigstens zwanzig Minuten – vergeblich. Also wollte ich dann erstmal was essen gehen und wurde von der Messe aus gewahr, dass sich ein Haufen unserer Leute irgendwie am Landgangssteg zu schaffen machte. Misstrauisch ging ich nach draußen und sah den Lotsen immer noch bei uns an Deck stehen, mit den Mates und der Deckscrew, die gerade den Landgangssteg, nicht die Gangway, aus der Vertäuung lösten! Auf meine Frage, was der Grund eines solchen Tuns sei, kriegte ich zu hören, dass die Gangway doch out of order wäre. Ich guckte doof und sah den Elektriker bekümmerten Gesichts am Schaltkasten stehen. Nix ging mehr. Die ganze Kiste war abgesoffen und vorerst nicht so schnell zu reparieren. Zumal auch der Motor der Gangwaywinde einen Schlag Wasser abgekriegt haben musste und damit ebenfalls höchstens noch teurer Schrott war.
Was nicht für ein Schiff! Innerlich verfluchte ich den Herrn über mir und konnte es mir wieder mal nicht ganz verkneifen zu fragen, womit ich das alles verdient hatte. Okay also, dann die zweite Garnitur, den Landgangssteg. Ein sperriges, langes Mordsinstrument und schwer wie Hulle. Um ihn zu bewegen, musste der Proviantkran benutzt werden. Und?
Na, man wird es erraten haben, richtig! Auch der konnte nicht, weil er auch zu viel vom Wasser genascht hatte und somit ebenfalls nicht einsatzklar war. Ich entschuldigte mich mehrfach bei dem geduldig wartenden Lotsen, der mit gelassener Gemütsruhe unserem Treiben zusah. Es war aber auch zum Auswachsen! Ging denn überhaupt noch was auf diesem Luxusboot? Der Lotse bot mir an, einen mobilen Landgang vom Hafen zu organisieren, das ginge in wenigen Minuten, wäre aber kostenpflichtig. Sofort stimmte ich zu. Ja, das sollte er man machen, dann könnten die Behörden an und der Lotse von Bord und auch die Arbeiter ebenfalls mit den vorbereitenden Arbeiten beginnen. Jau, ich bestellte so ein Ding, was nur lächerliche achtzig Dollar Miete pro Tag kostete. Das war es mir doch mal eben wert. Wo gab’s denn sowas, ha?
In kürzester Frist kam auch richtig ein Gabelstapler mit so einem Ding vorgefahren und unser Problem konnte erstmal auf diese Weise gelöst werden. Ich begrüßte die Behörden, Makler, Besichtiger und Charterers Vertreter und wir gingen in meine Butze, um alles Weitere zu bekakeln und zu besabbeln. Mann, was war man froh nach jeder Problemlösung!
Der Chiefmate begann sofort mit dem Besichtiger seine Tour durch die Luken. Auch die Maschine ließ der Besichtiger nicht aus. Es war zwar schwer verständlich für uns, warum der Kiwi-Bauern-Vertreter sich nicht nur den Notgenerator vorführen lassen wollte, sondern sich sogar vom Chief auch noch die Kompressoren starten und vorzeigen ließ, genauso wie er den Sauberkeitszustand der Maschinenanlagen in seinem Besichtigungsblatt vermerkte. Mir berichtete der Besichtiger nach erfolgreicher (!) Besichtigung, dass er sehr erstaunt gewesen sei, dass wir so viele Ersatzgratings an Bord hätten. Das waren spezielle Bodenplatten aus wasserfestem Sperrholz, vierundzwanzig Millimeter dick, die eine große Anzahl Löcher für die Zirkulation der gekühlten Luft aufwiesen, auf denen in den Decks die Ladung stand. Die kalte Luft wurde mittels Gebläse von unten durch die Grätings gedrückt, durchströmte die Ladung – das war übrigens auch der Grund für die ausgestanzten Löcher in Bananen- und anderen Kisten – und gelangte im Luftstrom über der Ladung wieder zurück zu den Lüftern, die die Luft wieder durch den Wärmetauscher drückten. Wie ein Kühlschrank, bloß etwas größer. Diese Gratings hätte unser Vorgänger gar nicht vorrätig gehabt und musste sie für sehr viel Geld hier in Tauranga einkaufen, um seine Luken vorzubereiten. Indische Besatzung … Die Laderäume sollen bei denen ausgesehen haben wie Übungsplätze für Handgranaten, so elend war deren Zustand. Was musste denn das bloß für ein Eigner sein? Na, wir waren jedenfalls fein durch die Kontrolle geschlüpft, nur ein paar Nägel, die nicht zurückgeschlagen waren und nun durch einige Platten durchpikten, mussten wir kappen und dann konnte das Laden beginnen.
Aber eine kleine Hürde hielt der Flaggenstaat Liberia noch für mich bereit: Die Liberianische Sicherheitsinspektion hatte ihr Kommen angekündigt. Die kamen einmal jährlich und just das Jahr war nun um. Und ich war ja gerade auch da, nöch? Also kam noch so ein Stundenklauer und nervte mich mit Fragen, wollte Dokumente sehen, ließ sich Anlagen vorführen und checkte unsere Arbeits- und Wachsorganisation. Ich liebte es geradezu, wenn diese Leutchen kamen. Man hätte ja sonst zu viel Zeit gehabt. Übrigens hätte er, wenn denn das Boot im Davit gewesen wäre, ein Manöver sehen wollen, aber so war der Beweis ja schon schlüssig erbracht worden, dass das am vorherigen Tag bereits passiert war.
Auch die Leute der Werkstatt kamen verabredungsgemäß an Bord und beguckten sich unseren Windenschaden. Ja, meinte der Oberheini, da könnte man wohl was machen. Und da wir erst am folgenden Tag auslaufen sollten, stimmte er mich sehr zuversichtlich. Morgen wolle er mit den reparierten oder neuen Teilen zurück sein. Und solange bräuchten wir ja nun auch keinen Mobilkran, den höben wir uns bis zum Schluss auf, falls wir ihn denn überhaupt noch bräuchten. Denn falls die Werkstatt nicht in der Lage sein sollte, die Reparatur durchzuführen, müssten wir doch wenigstens das Boot wieder im Davit haben, sonst ließen die uns doch gar nicht aus dem Hafen raus. Runter für den einen Notfall ginge es ja immer, nur in unserem Falle dann nicht wieder gleich zurück. Also keine Übungen, falls die Winde nicht repariert werden konnte oder es länger dauern würde. Eine zeitliche begrenzte Ausnahmegenehmigung wäre sicherlich dafür sofort zu bekommen und würde uns eine gewisse Zeit Seefahrt genehmigen, wenigstens bis Europa.
Dann kam noch der Schiffshändler, der mich strahlend begrüßte, nicht nur, weil wir ihm einen dicken Auftrag verschafft hatten, sondern weil er mich wiedererkannte. Da war die Freude auf beiden Seiten groß. Feiner Macker. Hatte mir damals mehr als einmal geholfen und auch das Unmögliche möglich gemacht. Schön, dass er es mit uns und wir es wieder mit ihm zu tun hatten. Da konnte ich gleich meine Sonderwünsche loswerden. Er nahm mich am nächsten Vormittag mit in die Stadt, wo ich drei Stunden durch die Straßen schlenderte, in bekannte Shops einguckte und das eine oder andere einkaufte. In dieser winzigen Stadt zu spazieren war mir immer eine Freude und Erholung. Schön übersichtlich und geruhsam. Keine Wolkenkratzer säumten die Straßen, alles anheimelig und gemütlich. Ich genoss den Bummel durch Tauranga. Leider wurde es später ziemlich nieselig und wenn das so weiterginge, würden wir hier noch eine Verspätung wegen Regens kassieren. Denn dann könnte aus verständlichen Gründen nicht geladen werden. Wo die Kiwi-Bauern doch sowas von pingelig waren! In einer Kunstgalerie bekam ich auch noch die eine und andere Kleinigkeit, ehe ich mir ein Taxi rief, das mich innerhalb von zehn Minuten zurückbrachte.
Tatsächlich waren alle Luken zu und die Kräne ruhten. Kein Aas weit und breit zu sehen. Ich stapfte mit meinen Tüten den Landgang hoch. Der Blitz war immer noch mit dem Motor der Gangway beschäftigt. Vom Chief Mate erfuhr ich, dass seit Mittag nichts mehr gegangen sei, weil es mehr oder minder ununterbrochen stark nieselte. Auch gut. So hatten wir wenigstens doch noch die Chance, zum Abend an Land Essen zu gehen. Ein Repräsentant der Kiwi-Bauern lud uns dazu ein. Wir waren froh, überhaupt noch an Land zu kommen und die Gelegenheit doch so günstig am Schopfe zu packen! Das offizielle Auslaufen war weiter verschoben worden: Nun bereits auf den späten Abend. Das reichte uns ja wohl dicke! Keiner aß doch länger als zwei Stunden!
Wir wurden abgeholt, ich gab das Ziel vor: Harbourside Restaurant. Ein etwas schäbiges, aber ausgesprochen beliebtes Fischrestaurant, das von uns schon früher häufig besucht worden war. Es hatte ein uriges Flair und war offenbar auch bei den Eingeborenen gern Ziel eines Besuchs. Denn zu bestimmten Zeiten konnte nur eine Reservierung dem hungernden Gast einen Platz am gedeckten Tisch sichern. Dieses Restaurant war direkt unter einer hölzernen Brücke, die die Bucht querte, gelegen, und über diese Brücke donnerten und rasselten stündlich Güterzüge. Nicht selten konnte man dreißig oder auch vierzig Waggons zählen. Die Güterströme hatten sich vom Hafen Aucklands nach Tauranga verlagert. Mittlerweile war Tauranga zum größten Umschlagsplatz Nord-Neuseelands avanciert. Aus dem Mucker- und Fischerdorf hatte sich ein moderner kleiner, aber effektiver Universalhafen entwickelt, der expandierte. Nicht nur Holzstämme, was in Riesenmengen aus kontrolliertem Anbau, den sogenannten Holzfarmen, stammte, wurden als Bauholz verschifft, ebenso Berge von Holzchips für die Papierherstellung. Fast ausschließlich für Asien. Natürlich auch Vieh und Fleisch, genauso wie eben Früchte und Container. Autotransporter aus Japan liefen diesen Hafen ebenfalls regelmäßig an. Wie der Lotse wusste, mauserte sich das ehemalige Fischerdorf mehr und mehr zu einer großen Stadt. Zum Leidwesen der ehemaligen Dörfler, die die Abgeschiedenheit und Einsamkeit hier einst gesucht, gefunden und nun wieder verloren hatten.
Die meisten Ansiedlungen ringsum waren eh nur auf Grund der Hafenentwicklung entstanden. Hinzu kam die zunehmende Bedeutung des Tourismus. Hier gab’s schöne breite Strände und unweit Taurangas luden sogar Thermalquellen zum Besuch ein. Das ist aber so verwunderlich gar nicht, immerhin ist das hier ein aktives geologisches Gebiet, das zum sogenannten pazifischen Feuerring gehört, mit richtigen ausgewachsenen Vulkanen und Erdbeben und allem, was so dazugehörte, also auch heißes Wasser aus der Erde. Ein einzigartiges, geschütztes Refugium ist „White Island“, eine Insel, von Tauranga aus bei guter Sicht in etwa fünfzig Meilen Entfernung in östlicher Richtung zu sehen, wo die Erde noch spuckte und Schwefelgestank aus wabernden Schlammtümpeln entwich.
Man konnte diese Insel nur mit einem Heli erreichen, denn natürlichen Zugänge sind nicht existent, zu rau und zu steil sind die felsigen Ufer. Wenn man einen Tag frei hätte und das nötige Kleingeld für so eine Helitour! Mann, das wäre was! Tatsächlich hatte ich mal vor Jahren für mitreisende Passagiere dort nachfragen lassen, wo und für wieviel Knete das ginge. Aber die Antwort war niederschmetternd: Pro Person wären für eine Rundtour und zwei geführte Stunden auf der Insel um die dreihundertfünfzig Dollar fällig gewesen. Das hatten die nicht – und ich erst recht nicht. Heute bedauere ich meine damalige Entscheidung, diese Chance ungenutzt gelassen zu haben.
Wir betraten kurz nach 1800 Uhr das Restaurant, für hiesige Sitten noch viel zu früh, als dass man sich zu Abend traf, um was zu essen. Aber wir hatten trotzdem schon Mühe, einen schönen Extra-Platz zu bekommen, weil das meiste unter Vorbestellung wegging.
Natürlich waren wir zum Fischessen gekommen! Den Besten, den’s gab. Da der Chief des Englischen nicht so mächtig war, wollte er sich sofort meiner Entscheidung anschließen – wie immer. Aber er sah dann am Nachbartisch Lamm und orderte Gleiches für sich. Mein Tier hörte auf den Namen „John Dory“, ein lokaler Plattfisch, Spezialität des Hauses, solange ich schon hier verkehrte. Auf Holzkohlen gegrillt. Vorab ein wenig Ciabatta mit Knoblauch und einen trockenen, milden Hauswein. Wir sabbelten mit unserem Bauern, der sich die Schweinerippen munden ließ, über Neuseeland, Tauranga, Kiwis und was sonst noch so als Thema ergiebig war. Insgesamt eine runde Sache.
Als wir einige Stunden später aufbrachen, begann sich das Lokal richtig zu füllen. Es wurde laut, nicht nur wenn ein Zug über unseren Köpfen hinwegrumpelte! Stimmengewirr, Lachen, eilig flitzende Bedienungen, ein Kommen und Gehen. Nach diesem gelungenen Abend zwängten wir uns wie die Sardinen wieder in seinen engen Jeep, dem wir Minuten später an der Gangway unseres Schiffes wieder entstiegen. Sowas hatte man nicht alle Tage. Vollgefressen und zufrieden betraten wir die heimatlichen Stahldecks. Kein Kran drehte, alle Luken geschlossen. Der Chief Mate informierte uns, dass alles bis morgen früh gestoppt worden wäre. Es würde zu teuer, wenn die Stauer nur rumsäßen und es immer wieder anfing zu nieseln und keiner wusste, wie lange noch. Also zu diesem netten Tag auch noch eine nette Nacht der Ruhe! Hatte hier irgendwer Geburtstag oder was? Womit man sowas nur verdiente, wie? Vielleicht als ausgleichender Ersatz für das misslungene Bootsmanöver …?
Am Folgetag kamen die Werkstattleute früh an Bord zurück und reparierten erfolgreich die Winde. So konnten wir dann schon am Vormittag unser Boot mit eigener Kraft wieder mit dem Davit hochnehmen. Die horrenden Kosten eines gemieteten Mobilkrans wurden gespart. Die wartenden Schlepper gingen gegen 1300 Uhr längsseits, mit wenigen Maschinenmanövern legten wir ab, umfuhren den Bogen am Vulkankegelstumpf und suchten die Weiten des Südpazifiks. Das war Tauranga, das ich zukünftig nicht nur mit dem „Harbourside Restaurant“ in Verbindung bringen werde, sondern immer auch mit einem ganz bestimmten Bootsmanöver.
Dreizehn und ein halber Tag Seetrip lagen vor uns. Und mit etwas Glück auch drei Highlights auf unserer Route, wenn wir sie am Tage passieren würden: Pitcairn, Henderson Island und die Galapagos Inseln. Auf der viereinhalbtausend Seemeilen langen Strecke die einzigen Steine, die am Wege lagen und deshalb ganz oben auf meiner persönlichen Wunschliste standen.
Wenige Tage später bekamen wir die Order vom Charterer, erst am 23. August in Balboa, also Panama, vorzuliegen. Wie schön war denn das? Dieses als Ausgangslage nutzend, errechnete ich, dass wir Pitcairn erst am späten Abend haben würden. Dafür schon mussten wir noch etwas mit dem Speed schummeln, denn entsprechend der Order sollten wir eigentlich für den vorgegebenen Termin mit reduzierter Leistung fahren. Das aber würde die Pitcairn-Passage in eine Nachtaktion verwandeln! Und wann käme man hier noch mal vorbei? Wir logen also etwas in den täglichen Berichten, die der Charterer von mir erhielt, was Position, Geschwindigkeit und den dazugehörenden Verbräuchen anbelangte und liefen etwas schneller, um den ersten Stein noch bei Büchsenlicht anzutreffen. Danach wieder etwas langsamer, was sich dann auch wieder ausglich. Jedenfalls, was die Zeit und die dazugehörigen Verbräuche anbelangte.
Henderson Island war nur einhundertfünf Seemeilen von Pitcairn entfernt und wäre ohnehin nur bei einer Morgen- oder Mittagspassage von Pitcairn für uns zu sehen gewesen. Daher verschmerzten wir leichten Herzens, dass wir dieses Stückchen Erde nur am Radar würden beobachten können, zumal es nicht die Geschichte und bedeutende Vergangenheit hatte, wie Pitcairn es für sich beanspruchen konnte. Außerdem war Henderson laut dem Seehandbuch „infested by rats and mice“ (verseucht mit Ratten und Mäusen), Frischwasser wäre nicht verfügbar und von einer Bevölkerung könnte keine Rede sein, es war also unbewohnt. Obendrein auch noch flach wie ein Tisch! Was also war daran Besonderes? Es war just durch Anwachsen eines Korallenstocks vielleicht mal entstanden, mit Sicherheit aber nicht vulkanisch – wie Pitcairn.
Am 14. August gegen 1500 Uhr schob sich der Stein, den wir ansteuerten, hinter der Kimm hoch. Im Radar wurde das Echo schon auf knapp vierzig Meilen Entfernung angezeigt. Wir hielten nördlich auf „Point Christian“ zu, dort vorbei wollte ich dann nach dem Passieren der Nordspitze auf Südost drehen, um das einzige Dorf, Adamstown, zu sehen und dann sollte nach meinen Berechnungen die Sonne schön hinter dem Stein untergehen, so dass vorzeigbare Gegenlichtaufnahmen möglich würden. Und das war’s dann auch schon. Gott sei Dank hatten wir nur eine leicht durchbrochene Bewölkung, so dass es mit Glück schöne Schnappschüsse mit günstigen Sonnenreflexen geben könnte.
Herrlich, ja fast majestätisch erhob sich der faltige, grünbraune Stein aus den Fluten. Klingt zwar etwas schwülstig, aber beschreibt ackurat meinen Gemütszustand. Das hatte was! Ich hier bei Pitcairn! Laut Karte ging es gleich steil abwärts, die Insel ist vulkanischen Ursprungs, kein Korallenriff säumte die Insel. Klarer Fall. Mit dem Glas konnte man Palmen und Nadelbäume ausmachen. Oben auf dem Top eine hohe, dünne Funkantenne und man konnte außerdem einige weiße Spots im grüngefleckten Felskleid erkennen, die sicherlich die Dächer von irgendwelchen Behausungen darstellten. Im Abstand von nur einer Meile passierten wir einige kleinere, abgebrochene Felsen, ehe wir dann planmäßig auf Südost schwenkten, um die östliche Seite der Insel, die Landungsseite, abzusegeln. Unsere Brücke war nun mit Schaulustigen besetzt, die mit gezückten Digitalkameras auf ihren Moment warteten und nur ich hatte noch zusätzlich meine Schneckenkamera alten Stils am Anschlag.
Das Kap „Point Christian“, benannt nach dem Chef der Meuterer, es war der zweite Steuermann Fletcher Christian, wurde Steuerbord querab passiert und nun konnten wir schon die Reede von Adamstown gut einsehen. In der Bounty-Bucht lag ein kleiner Kutter. Am UKW hörte ich, wie der sich mit der Landstation unterhielt, in dessen Verlauf er das anlaufende Schiff, also uns, erwähnte. Die Gegenstelle bestätigte dem Kutter, dass er uns nun auch sähe und nun schaltete ich mich auch in den Funkverkehr ein. Ich rief die Landstation und gab ihm meinen Namen, erklärte ihm unser Woher und Wohin und begrüßte ihn. Freundlich antwortet die Gegenstelle und lud uns ein, ob wir nicht gerne für eine oder zwei Stunden hier vor Anker gehen wollten. Sie würden uns gerne Frischobst und Gemüse verkaufen und sich sehr freuen, uns als Gäste willkommen zu heißen.
Tja, Leute! Wenn man jetzt hätte wollen können dürfen, wie man wollen können dürfte! Ich hätte angehalten, sofort! Aber so musste ich ihn notanlügen und beschwatzen; und nannte den engen Zeitplan und übliche Sicherheitsbedenken meinerseits als Grund für das Ablehnen seines freundlichen Angebotes. Sicherlich hätte man diese eine oder meinetwegen auch drei Stunden durchaus abzwacken können, ohne dass das einer zu Hause mitbekommen hätte. Sogar die Seekarte dieser Insel hatte ich mir der Sicherheit wegen vorab bestellt und nun vor mir zu liegen, um gefahrlos und dicht ’dran vorbei fahren zu können. Aber nur mal angenommen, es würde dann tatsächlich etwas passieren, was auch immer: Probleme mit dem Anker oder der Hauptmaschine; man hätte ein Blackout und gar nichts ginge mehr; ein Mitglied der Besatzung käme zu Schaden; irgendwo bei uns an Bord finge es an zu brennen. Dann müsste ich schon so einen gewissen Ort nennen, wo das geschah. Wie sah sowas denn aus: Reede Pitcairn? Und dann mach mal den Leuten vom Charterer und Reeder klar, was man da gerade mal gesucht hätte und warum man überhaupt dort gewesen sei! Aber um ehrlich zu bleiben: Selbst, wenn nichts passiert wäre, wäre das doch in der Reederei eher bekannt geworden als einem lieb sein konnte. Denn so eine Geschichte blieb nicht verborgen, wenn da zwanzig Nasen zuguckten und später davon rumerzählten. Spätestens nach den nächsten Ablösungen sickerte das durch, weil es ja ein ziemlich ungewöhnliches Ereignis gewesen wäre, womit jeder hätte angeben können. Also, das musste ich mir nicht antun.
Das dichte Vorbeifahren, wenn man schon mal da war, konnte ich jederzeit ruhigen Gewissens begründen. Oder wenn tatsächlich was passiert wäre, dass man meinetwegen einen zum Arzt hätte schicken müssen, auch das wäre gegangen. Oder, wie ebenfalls schon bei „Lamberts und Büttner“ vorgekommen, dass man mit deren Billigung, sozusagen im offiziellen Auftrage, dort hinführe, um Post oder so abzugeben. Das war übrigens auf Schiffen geschehen, die ohnehin durch die Kiribatischen Inseln hindurchfuhren und dort dann mal für so ein Intermezzo für ihre Jungs gestoppt hatten.
Es blieb nur der schöne Blick und die nette Einladung. Wir segelten so dicht vorbei, dass man die wie Schwalbennester an den Hängen klebenden Bungalows gut erkennen konnte. Viel Platz konnte es dort nicht geben, denn diese Häuser verteilten sich nur an der Nordostflanke. Einen Strand konnten wir nicht ausmachen, es musste aber hier, wo die Reede war, einen Anleger und den Zugang zur Insel geben. Jedenfalls stand es so im Seehandbuch.
Ich fragte den Macker von der Signalstation, wie viele Menschen denn nun hier lebten und er wusste die Zahl auch ganz genau: exakt zweiundfünfzig Leute. Einige Babys seien unterwegs und dann erzählte er noch, dass alle sechs Monate ein Versorger aus Neuseeland vorbeikäme und Ausrüstungen und Nahrungsmittel brächte. Jetzt hätten sie sogar Internetzugang und dass sie sich von Fischfang, Ackerbau und Einnahmen durch die Herausgabe von Brief-marken ernährten, beziehungsweise ihren Lebensunterhalt bestritten.
Also, wenn man da so vorbeifuhr und sich überlegte, dass hier die Meuterer irgendwie mit dem Mut der Ahnungslosen gelandet waren, wo nix war als Busch und Palme und eben ihre Habseligkeiten, die sie mit der „Bounty“ mitbrachten und sie alles, was nicht niet- oder nagelfest war, an Land schleppten und letztlich die „Bounty“ auch noch zerstörten, um sich am Entkommen von der Insel selbst zu hindern! Hatte man sie nicht doch noch geschnappt? Nur Adams und seine Leute hatten bis zu ihrem natürlichen Tod gelebt? Ja, Meuterei zahlt sich eben nicht aus. Captain Bligh hatte dann doch noch eine Expedition ausgerüstet und einige der Meuterer, die auf Tahiti zurückgeblieben waren, gesucht und gefunden. Nur hier auf dieser Insel hatten sich die Leute gegenseitig umgebracht. Moderne Genuntersuchungen in den 80er- und 90er-Jahren hatten gezeigt, dass ausschließlich Spuren von Meuterer Adams nachzuweisen waren, dessen genetische Fingerabdrücke konnte man hier sozusagen noch vorfinden. Im Übrigen: dazu eine Buchempfehlung des Blaubeers: „Die Insel“, von Herman Melville, der weiterspann, wie es hier nach der ersten Besiedelung durch die Meuterer weitergegangen sein könnte. Ein sehr fesselndes Buch, das mich während meines Studiums begleitete.
Fast planmäßig ging die Sonne unter, nur dass es leider noch ein wenig zu früh für die richtigen Schüsse gewesen war, eine einzige blöde Stunde später wäre es schon besser gewesen.
Wir drehten wieder auf Nordostkurs, ich wünschte den Leuten auf der Insel alles Gute, bedankte mich für die freimütige und freundliche Unterhaltung und verabschiedete mich von ihnen, nicht ohne zu betonen, dass es für mich und meine Crew ein ganz spezielles Erlebnis gewesen war, an ihrer Insel vorbeizufahren.
Falls Bedarf besteht, noch einiges mehr zur „Bounty“-Geschichte zu wissen, hier eine kurze Zusammenfassung:
HMS „Bounty“ -Britisches Segelschiff, das durch die zweimalige Verfilmung der „Meuterei auf der Bounty“ berühmt wurde. Der Film beruht auf einer wahren Begebenheit, insofern als die Bounty tatsächlich Setzlinge des Brotfruchtbaums von Tahiti in die Karibik bringen sollte. Die tatsächlichen Umstände der Meuterei sind dagegen umstritten, insbesondere ist unklar, ob Kapitän Bligh tatsächlich ein brutaler Despot war, wie er besonders in der älteren Verfilmung dargestellt wird.
Die Bounty hatte auf ihrer Reise viel Zeit verloren: Zunächst konnte sie die Umrundung von Kap Horn wegen widriger Winde nicht schaffen und musste daher einen Umweg um das südafrikanische Kap der Guten Hoffnung machen und durch den Indischen Ozean, bis endlich der Pazifik von Westen her erreicht wurde. Schließlich musste in Tahiti eine bestimmte Phase im jahreszeitlichen Zyklus der Pflanzen abgewartet werden, bevor sie transportiert werden konnten. Kapitän Bligh hatte also zumindest Anlass zu Ungeduld. Nachkommen der Meuterer leben noch heute auf Pitcairn, einer Insel mit steiler Felsenküste, die in den Seekarten jener Zeit nicht verzeichnet war und die Meuterer daher vor Entdeckung schützte. Ende Dezember 1787 lichtet das britische Segelschiff „Bounty“ in England die Anker und macht sich auf die Fahrt nach Tahiti. Obwohl die Witterungsbedingungen günstig sind und keine technischen Probleme auftreten, kommt es sehr bald auf hoher See zu gefährlichen Auseinandersetzungen. Denn die Mannschaft fühlt sich durch die ungerechte Behandlung des Kapitäns Bligh gedemütigt und neigt zur Meuterei. Kann zu diesem Augenblick der erste Offizier Fletcher Christian noch einen Aufstand der Besatzung verhindern, so wird die Lage kritisch, als sich das Schiff bereits wieder auf der Rückfahrt befindet. Durch die brutale Bestrafung einiger Deserteure kommt es zum offenen Konflikt zwischen Kapitän und Untergebenen, der damit endet, dass Bligh mit einigen Getreuen in einem Beiboot ausgesetzt wird. Fletcher Christian, der das Kommando übernimmt, lenkt die „Bounty“ nach Tahiti zurück und beschließt daraufhin, sich mit einem Teil der Besatzung auf der Insel Pitcairn anzusiedeln. Indes, einige Besatzungsmitglieder bekommen bald Heimweh und beschließen, in die Heimat zurückzukehren. Als sie dort vor Anker gehen, werden sie wegen Meuterei vor ein Gericht gestellt, wo ihnen die Todesstrafe droht. In dieser Gefahr beschließen sie, die Wahrheit zu berichten und Blighs Machenschaften anzuprangern. Sie werden begnadigt, und Bligh erhält nie wieder das Kommando über ein Schiff.
Der Film, der auf einer wahren Begebenheit beruht, wurde mit einem für damalige Zeit sagenhaft hohem Budget von 2 Millionen Dollar realisiert. Doch der hohe Einsatz lohnte sich, denn der Film spielte nicht nur den doppelten Betrag ein, sondern gewann 1935 auch den Oscar für den besten Film des Jahres.
(Zitat Wikipedia)
Hier aber irrte Herr „Wikipedia“, denn Bligh erhielt sehr wohl nach dieser Meuterei weitere Kommandos und wurde darüber hinaus später sogar noch in zwei weitere Meutereien verwickelt, die sich allerdings nicht gegen ihn persönlich richteten. Er war bei weitem nicht der Übelmann, als der er in den Filmen gezeichnet wurde. Er war streng und gerecht – aber in gewisser Weise tatsächlich eher nachgebend und moderat in seinen Urteilen, verglichen mit denen seiner Zeitgenossen! Das zeigten neuere Forschungen, die die Schiffsbücher der Britischen Navy als Ausgangsbasis auswerteten. Allerdings waren die echten Tatsachen sicherlich nicht hollywoodmäßig genug.
Mitternacht hatten wir dann auf dem Radar auch die Umrisse der rattenverseuchten „Henderson“ Insel, die fern im Vollmondschein schwach auszumachen war. Und das waren die Höhepunkte Nr. 1 und 2 dieser Reise. Bis dahin wog uns ein langer, schwacher Schwell bei flauen Winden und tagelangem Sonnenschein, darüber hinaus machten wir guten Speed. Die Crew schaffte bei diesen meteorologischen Superbedingungen Quadratmeter für Quadratmeter zu entrosten und in neuem Farbglanz erstrahlen zu lassen, und es schmeichelte auch meinen Augen, zu sehen wie der Zustand des Bootes sich merklich verbesserte.
Ein paar Tage später, wir standen nur einen Tag vor Panama, lud die glatte See und die Zeit, die wir noch übrig hatten, regelrecht dazu ein, noch ein nettes Manöver zu fahren: Mann über Bord! Wir mussten ja nicht andauernd das Boot zu Wasser bringen, und schon gar nicht, wenn der Schwell hoch ging. Das wäre nun wirklich riskant gewesen, und so machten wir nur ein teilweise praktisches Training.
Ich erschien auf der Brücke und rief dem Offizier „Man over board!“ zu. Nun musste der zweite Leutnant zeigen, was er zu machen hatte und wie er was tun wollte. Das musste schnell, richtig und wohl überlegt sein. Da wir mit der Drehzahl ohnehin soweit runter waren, dass wir problemlos alle Maschinenmanöver ohne Wartezeiten fahren konnten, war auch das notwendige Hartüber-Ruder möglich, um das Schiff zur Unfallstelle zurückzubringen. Dafür gab es bestimmte Manöver, die dann entsprechend einzuleiten waren, man nennt sie „Bahnrückführungsmanöver“, die ein Schiff auf seinen genauen Gegenkurs brachten. Außerdem musste der Offizier den akustischen „Mann-über-Bord“-Alarm auslösen und die - vorher präparierte – „Mann-über-Bord“-Rauchboje über Bord werfen. Da wir in der glücklichen Lage waren, eine alte Boje noch im Bestand zu haben, wurde diese mit einem alten unbeschrifteten Rettungsring verbunden und anstatt eines echten außenbords geworfen.
Das orange Rauchsignal schmökte für fünfzehn Minuten, aber innerhalb von fünf Minuten hatten wir schon die Unglücksstelle erreicht. Und das Schlauchboot war bemannt und ‚ready to go‘. Das wäre es dann gewesen. Mit weniger Schwell im Wasser hätten wir den Rettungsring wieder auffischen können, so aber ließen wir ihn treiben, er war nicht beschriftet und alt und würdig genug war er auch, auf diese Art ausgemustert zu werden.
Im Anschluss gab’s noch eine kleine Schulung übers Überleben auf See, sprich Hinweise und Erfahrungen aus der Praxis für den Schiffbruch. Die richtigen und falschen Maßnahmen wurden benannt, diskutiert und anschließend das Ganze praktisch anschaulich geprobt. Sehr zum Gaudi der Crew durften zwei Nasen befehlsmäßig in das Pool springen, um allen zu zeigen, wie man’s richtig machte. Und als Krönung für alle hatten wir uns den Koch herausgepickt, der auf der schwimmfähigen Krankentrage ebenfalls ins Wasser gelassen wurde. Die Trage schwamm in einer stabilen Lage, so dass eine dort aufgeschnallte Person immer mit dem Kopf über Wasser war, selbst wenn sie bewusstlos sein sollte. Wir demonstrierten das leibhaftig, indem wir das Ding mit dem Opfer drin umdrehten, so dass er kurz mit dem Gesicht unter Wasser war, sich aber im Handumdrehen ohne Hilfe wieder zurückdrehte. Doof war das aber doch schon für den Koch da drinnen: Der musste alles völlig passiv mit sich geschehen lassen. Er war komplett verschnürt. Nur den Kopf konnte er bewegen. Konnte sich nicht wehren oder reagieren, war uns völlig ausgeliefert. Aber ich hatte ihm vorab mein Ehrenwort gegeben, darüber persönlich aufzupassen, dass ihm nichts geschähe. Die Trage wäre auch für den Luft-Abtransport durch einen Heli zu nutzen gewesen. Doch schon eine ganz brauchbare Konstruktion. Einfach, bewährt und zuverlässig. Diese Demonstration reichte uns. Zufrieden ließ ich das Wochenende verkünden und wünschte eine angenehme Verrichtung zum Samstag.
Früh am Morgen des 23. Augusts fädelte ich mich durch die anderen Ankerlieger mit „Voraus Ganz Langsam“ zur Ankerposition, die uns zugewiesen worden war. Balboa, Panama. Nach dreizehn Tagen und achtzehn Stunden waren wir fest am Anker auf der Reede Balboas.
Gegen 0600 Uhr wurde ich wieder geweckt, weil nun die Boardinginspektoren kamen, die das Schiff für die kommende Passage checkten und sozusagen ihr OK geben mussten, bevor wir den Kanal unsicher machen würden, beziehungsweise durften. Gegen 1000 Uhr kamen auch Agent, Quarantäne und der neue Kühlanlagen-Techniker, meine Nummer zwanzig der Besatzungsliste. Dann am Abend noch schnell das Essen hintergeschlungen, als Kapitän verkleidet und alle Gefechtsbereiche alarmiert: Der Lotse kam! Fast pünktlich kam er mit einem schnellen Boot längsseits und packte kurz darauf schon seine Gerätschaften auf der Brücke aus. Einen schweren Alu-Koffer, dem er Netz-, Sende- und Empfangsgeräte und seinen Laptop entnahm. Die Software, die er da drin hatte, reichte ihm anstatt der papiernen Seekarte. Mittels Sender und Empfänger kannte er von allen anderen Schiffen im Kanal deren Daten wie Namen, Geschwindigkeit und Kurse und bräuchte nicht mal ein Radar, wenn alle Fahrzeuge mit solchem Zeug ausgerüstet sein sollten, was sie aber noch nicht waren, weil nur die größeren Einheiten mit Lotsen diese Teile mitbekamen. Eine schätzenswerte Einrichtung, weil es ab demnächst für alle Schiffe zur Pflicht würde, diese Erkennungsanlage (AIS) zu besitzen. Auch für uns war der Einbau demnächst in Zeebrugge geplant. Außerdem brachte er noch gute Kunde: Wir sollten schon um 0300 Uhr morgen früh drüben sein. Verzögerungen waren nicht erkennbar und alles sollte smooth and easy gehen. Na, wenn’s denn man stimmte und das ganz oben auch gehört werden würde, dann wäre das ja man gut, nöch? Um halb sieben gingen wir Ankerauf und liefen in den Seekanal ein. Passierten die Panamerikabrücke und da kamen auch schon die Mooringleute an Bord. Auf jeder Station fünf und ein Bootsmann, also elf. Sie würden die Drähte der Lokomotiven bei uns festmachen. Ab ging‘s in die Miraflores-Schleusen. Das waren zwei Kammern hintereinander, dann kam ein künstlich aufgestauter kleiner See und die dritte Schleuse: namens Pedro Miguel. Alles ging schnell, reibungslos und sittsam. Dann hatte uns der nächtliche Kanal zurück. Schwülwarme Nacht, die nur vom Zirpen Abertausender Insekten und unheimlichen Dschungelgeräuschen durchbrochen wurde. Wir schoben uns fast lautlos in den Kanal, wenn man jetzt vorn auf der Back stand, würde man dies als lautlose Nachtfahrt empfinden, durch das spiegelglatte schwarze Wasser nach Nordwesten. Nur wenige Schiffe kamen uns entgegen. Es war wenig Betrieb diese Nacht. Mit uns nur ein kleiner Thunfänger, der bereits seit der Schleuse an unserm Heck klebte. Er folgte uns getreulich bis nach Cristobal, der anderen Seite, wo wir allerdings erst vor der Schleuse fast eine Stunde warten mussten, weil die Kanalbanditen das Personal der Loks gekürzt hatten. Für uns waren zwar Loks stand-by, aber man hatte nicht genug Lokfahrer. Unsere zurzeit diensthabenden Loks waren gerade am unteren Ende und brachten ein anderes Schiff raus. Endlich kroch eine Lok mit den fehlenden Drivern hoch zu uns. Mit leichter Verspätung waren wir in den Gatun-Schleusen, drei Kammern hintereinander am Stück. Jetzt ging wieder alles routinemäßig schnell und ohne Zwischenfälle. Eine Stunde später steuerte ich ohne Lotsen durch die Molen von Cristobal. Ich meldete mich ein letztes Mal ab und bedankte mich für die feine Kooperation und wünschte eine gute Wache. Nun mit vollem Schiff durch den Atlantik. Im Herbst. Wenn das man gut ginge! Aber was soll ich lange abschweifen: Es ging in der Tat besser als gut! Sozusagen brustglatte See von Panama bis hin nach Zeebrugge. Eine Wonne, nach dem Kanal-Intermezzo wieder richtig zur See fahren zu können! Bei bester Sicht hob und senkte sich das glatte Meer im ewigen Rhythmus der Dünung. Schiffe noch weit hinter der Kimm wurden sichtbar, wenn sie ihre obersten Mastspitzen über der Kimm zeigten. So eine gute Sicht war selten zu haben und ich genoss diese Überfahrt wie lange nicht mehr. Denn hier konnte es so im September/Oktober die ersten Kracher geben, dass man nicht mehr wusste, wo’s nach oben und wo nach unten ging! Aber diesmal war die Großwetterlage so gut, dass ich die Routenberatung schon kurz hinter dem Kanal verabschiedete. Da gab‘s nichts mehr zu beraten, Augen auf und durch!
Der Ärmelkanal empfing uns mit seiner besten Seite: Fast schon zu guter Sicht! Denn meine russischen und philippinischen Navigatoren ließen sich doch zu leicht verunsichern, wenn sie zu viel zu sehen hatten. Dann wurden auch alle wirklich unwichtigen Fahrzeuge wie einem Zwang gehorchend geortet und mit deren Beobachtung viel Zeit verschwendet. Ich sagte ihnen immer, dass die beste Sicht sich so bei fünf Meilen – je nach Fahrtgebiet – einpegeln würde: Informationen aus diesem Bereich gab es nicht zu wenig und auch nicht zu viel, ausreichend für eine sichere Navigation, jedenfalls in diesem Fahrtgebiet.
Die Kreideküste Englands sahen wir schon in weiter Ferne nördlich hinter der Kimm hochkommen, wir fuhren naturgemäß ostgehend etwas dichter an der französischen Küste in den Kanal hinein. Cherbourg wurde passiert und schon waren wir wieder im Verkehrstrennungsgebiet des Dover’schen Trichters gefangen. Nur eine geringe Zahl an Fischer, aber erwartungsgemäß eine Menge Fähren kreuzten unseren Kurs, alle anderen fuhren entweder mit uns mit in gleicher Richtung oder kamen uns, auf der westgehenden, nördlichen Fahrbahn, entgegen. Regelgerecht. Alles wie auf der Straße. Nur eben, dass Kreuzungen und Untiefen oder gefährliche Schifffahrtshindernisse lediglich auf der Karte oder höchstens noch durch eine ausliegende Tonne als Statthalter zu erkennen waren.
Mit einer warmen Spätsommersonne im Rücken, die sich ihrem Feierabend näherte, passierten wir Dover, das grau-weiß im beginnenden Abenddunst herübergrüßte. Nun noch zwei kleine Stunden und wir würden den belgischen Lotsen in Wandelaar aufnehmen.
Vorher passierten wir noch die Unglücksstelle der „Tricolore“, einem französischen Autotransporter der „Walenius-Line“, der an seiner Untergangsstelle knapp unter der Oberfläche auf dem Grunde lag. Zwei mächtige Dreitausend-Tonnen-Schwimmkräne gluckten dort inmitten einer Unmenge kleinerer Fahrzeuge und Pontons und waren mit Hebearbeiten zugange. Ein Riese von Autotransporter, der bei dichtem Nebel von einem anderen Schiff auslaufend überholt wurde, das vor ihm eine Kursänderung fuhr und diesem Transporter ein solches Loch zugefügt hatte, dass er binnen weniger Minuten sank. Es waren wie durch ein Wunder keine Toten zu beklagen. Der riesige Schuhkarton legte sich zum Kentern auf die Seite, aber weil’s da zu flach war, hatte es sich nur auf die Seite zur Ruhe gelegt. Und zwar derart, dass es mit keinem Teil aus dem Wasser ragte, sondern die backbordsche Schiffsseite gerade so eben unter dem Wasserspiegel lag, was nach diesem Unglück in sehr kurzem Zeitraum zu zwei Folgekollisionen mit anderen Schiffen führte, die die Position noch nicht kannten!
Daher resultierte im Nachhinein nun eine gewisse Hektik am Wrack: Jedes Fahrzeug, das die Unglücksstelle passieren wollte, wurde lange vorher über Funk befragt, ob ihm die Unglücksposition bekannt wäre. Außerdem lagen eine französische Fregatte und ein britischer Wächter stand-by und sorgten mit ihrer Gegenwart für Ordnung und Beachtung. Verständlich, wenn auch das Wrack dicht an oder sogar in den belgischen Hoheitsgewässern lag, wurde extra eine französische Gesellschaft gegründet, die das Abwracken und die Entsorgung leitete. Das erklärte die Anwesenheit der französischen Fregatte, wie mir der Lotse erklärte.
Der leuchtendrote Schiffskörper wurde nun vor Ort in sieben ‚handliche‘ Teile von dreitausend Tonnen zerschnitten, übrigens mit der gleichen Methode, wie auch schon die „Kursk“ ihrer Nase beraubt wurde: Ein mit Diamanten gespickter Spezialdraht mit sägenden Eigenschaften wurde unter dem Wrack in zuvor ausgespülten Kanälen hindurchgesteckt und dann wurde dieser Draht unter Spannung hin und her gezogen, zwar sehr langsam, aber sehr wirksam und effektiv. Die Ladung bestand aus dreitausend hochkarätigen Personenwagen der Marken Volvo, Saab und BMW mit einem Gesamtwert von runden fünfzig Millionen Dollar.
Als wir später die Schleuse passierten und im Hafen ankamen, konnten wir unweit unseres Liegeplatzes eine abgesägte wuchtige Sektion vom Achterschiff des Wracks auf einem Ponton erkennen. Dort am Ufer wurde dann der Rest erledigt, das Kleinschneiden, Auftrennen und Sortieren. Zu diesem Zweck war extra ein Liegeplatz geschaffen worden. Und immer noch wurden die Pkws da rausgeschnitten, sehr teurer Schrott. Außerdem waren große Mengen an Brenn- und Schmierstoffen an Bord gewesen, die noch ganz andere und besondere Vorkehrungen benötigten. Es würde eine gute Weile brauchen, bis das Wrack und seine Ladung endgültig verschwunden waren. Die Versicherungsgesellschaft hatte es zur Bedingung gemacht, dass absolut nichts an der Unfallstelle zurückbleiben durfte, alles musste abgeborgen werden. Auch hier wurde das Geld zur treibenden Macht, denn den Versicherungen könnte es eigentlich schnurz und piepe sein, wie die Umwelt darunter litt, wenn da nicht ihr Geld dranhinge. Es wurde bekannt, dass Tausende verendeter Wasservögel Opfer dieses Unglücks wurden.
Der Zugang zum Hafen von Zeebrugge ist nur nach Passage einer sehr großen Schleuse möglich. So brauchte man sich keine Sorgen zu machen, dass das Wasser infolge Gezeiten ‚verschwand‘ und man auf dem Trockenen säße, was anderenfalls zusätzliche Vorkehrungen seitens des Schiffes und der Verladeeinrichtungen notwendig machen würde.
Wir löschten die Kiwis mit vier Gangs und das ging schön schnell. Geruhsam lagen wir so im Hafen, als ich dann an einem Nachmittag mal wieder von meinem guten, alten Kumpel Hiob kontaktet wurde, oder besser, er suchte meine Nähe. War das nicht nett? Und hatte abermals eine Botschaft für mich vorbereitet: Laderaum 4D, der bewusste, stänke wieder nach Schweröl! Verstärkt und nicht weglüftbar!
Nein! – Nicht schon wieder!
Das Telefon stand nicht still. Reeder und Charterer mussten unverzüglich von der Sachlage informiert werden! Wir bestellten für uns einen Besichtiger. Dazu noch einen, der für den Charterer arbeitete und einen, der dem Ladungsempfänger diente, jeder hatte für sich einen eigenen unabhängigen Besichtiger angefordert. Außerdem musterten noch sieben Leute ab, deren Papiere und Gehälter ich auch noch fertigzumachen hatte. Es war schon etwas Trubel um mich rum. Zu allem Überfluss war der neue Chief Mate eine trübe Tasse und kein helles Licht, so dass ich mich um vieles selber kümmern musste, obwohl eigentlich er hätte sein Licht leuchten lassen müsste. Na ja, ein Russe. Und weil das noch lange nicht reichte, erschien unglücklicherweise der neue – deutsche – Chief Ingenieur ohne gültiges US-Visum.
Nach unzähligen Telefonaten mit der Reederei fiel dann die finale Entscheidung: Der Chief musste wieder nach Hause fahren, sich ein US-Visum besorgen und käme dann, wenn alles gut ging, nach Panama nachgeflogen, um dort abzulösen. Das rief nicht gerade eitel Freude bei dem auf dem Sprung sitzenden alten Chief hervor. Dessen Haussegen hing nun in der Distanz recht schief, konnte man sich ja leicht ausmalen: Die Frau hatte bereits eine Auszeit genommen, alles war bei denen auf Urlaub geschaltet, die Koffer gepackt, der Geist schon längst weit voraus bereits zu Hause und nun das! Verständlich, aber nicht zu ändern! Das war die echte Seefahrt! Keine Chance für Sentimentalitäten, das war Seefahrt und kein Streichelzoo.
Einen der von diesem Umstand direkt Betroffenen kannte ich ja recht gut: Das war nämlich ich selbst! Denn in den nächsten zehn Tagen hatte ich den ungnädigsten, unwirschesten und ungerechtesten Mann neben mir am Tisch drei Mal täglich auszuhalten! Ohnehin ein spezieller Spezialist. Ein Abendbrot ohne ein Glas Spreewaldgurken auf der Back war keines. Ich sprach ihn daraufhin an, weil das ja nun nicht gerade angenehm aussähe: ein Konservenglas mit Schraubdeckel auf der Back zwischen allerfeinstem Porzellan. Sowas kannte ich von zu Hause so gar nicht.
Er schon, wie er mir versicherte, denn nichts wäre schlimmer, als die sauren Grünlinge profan mit der eigenen Gabel zu entnehmen oder sie in eine extra Schale zu legen, gefällig, dem Auge angedient. Nein! Um Gottes willen bloß das nicht! Denn die Keime und der beschleunigte Verderb des Glasinhaltes durch die Einführung einer ‚Fremdgabel‘ wären leicht vorhersehbar. Dazu gab es hier nun ein Extraglas, in dem die Gurkengabel geparkt wurde. Nur mit der, und ausschließlich mit der und keiner anderen, war der Inhalt der Konserve zu entnehmen! Ein Freak! Aber hatten wir nicht alle einen an der Klatsche? Irgendwie und irgendwo? Verhaltensgestörte Seeleute, so nannte meine Frau mit einem Augenzwinkern uns Typen, und hatte damit sicherlich mehr als nur Recht.
Die Inkarnation dieser Gurkenmanie erlebte ich, als ich eines Abends das Etikett der Konserve studierend („Echte Spreewälder …“) und einen Blick auf unseren Wandkalender werfend, etwas lakonisch im Raum stehen ließ, dass genau mit dem heutigen Tag das Verfallsdatum des Glases erreicht wäre. Wie witzig und so ein Zufall, denn eigentlich guckte ja kein Aas (außer den Filipinos, denen so ein aufgedrucktes Datum trotz Unverständnis um die Unterschiede zwischen mindest haltbar bis und zu verbrauchen bis ebenso ein sehr heiliger Gral war) auf diese Angabe. Bestürzt griff sich der Chief den Behälter, und lesen und nach dem Steward rufen waren eines. Sofort verlangte er ein neues Glas, das bitteschön kein abgelaufenes Datum aufweisen dürfe. Seine Stimme klang echt zornig und überaus entrüstet, als wenn ihm jemand ans nackichte Leder wollte. Beschwichtigend redete ich ihm zu, dass es da doch immer Karenzzeiten gäbe und von dieser Konserve, solange schmeckend, keine lebensverkürzende Gefahr ausginge. Barsch ließ er mich wissen, dass nicht umsonst solche Daten da drauf wären und er seine Erfahrungen hätte! Okay?
Meine Nerven wurden in der Folgezeit bis zum Panama Kanal auf keine geringe Probe gestellt. Bei allem Verständnis für seine Lage reichte mir seine ewige Litanei über die Ungerechtigkeit der Welt und insbesondere gegen die Kleinen bald bis Oberkante Unterlippe, so dass wir die letzten Tage kaum mehr als das notwendig Dienstliche miteinander bekakelten.
Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, wurde dann nicht auch noch der Koch abgelöst! Himmel, Herr Gott, hilf! Nun also keine europäische Cousine mehr, sondern eine uns sattsam bekannte von den Philippinen! Das ging auch gleich richtig am Auslauftag schon los, mit Schmackes und Caracho!
Hatte doch der neue Teufel aus der Bulettenschmiede in der Fleischlast die Leber nicht gefunden, dafür aber das Schweinsblut, das die Filipinos zu gerne aßen: Aufgekochtes dickes Blut als Suppe mit Bauchspeck- oder Pansenstückchen als Einlage. Leider mit einem so sehr üblen Gestank verbunden, dass mein Körper darauf nur mit heftigem Würgereiz oder Flucht antworten konnte. Weil der Koch aber sehr wohl wusste, dass der europäische Leckertähn auf dererlei Köstlichkeiten aus Asien gerne verzichtete, gab’s für uns irgendwas anderes, ich glaube, es war Bratwurst oder so. Also was völlig anderes und durchaus ebenso ‚gesund‘.
Blöderweise hatte der Chief nun aber vorher einen Blick in die Kombüse geworfen und das Blut gesehen. Daraufhin strafte er uns durch strikte Nahrungsaufnahmeverweigerung für die nächsten zwei Tage; er wurde nicht mehr an unserer Back gesehen. Weil es ihm zu sehr ekelte, wenn auf einem Herd solche und unsere Gerichte zugleich zubereitet würden, wie er mich wissen ließ. Der Koch könnte ja mal versehentlich die Kellen beim Umrühren vertauschen! Na ja, in diesem Stil ging es dann bis zuletzt.
Der neue Koch wusste gar nicht, wie ihm geschah. Wollte er es doch allen nur recht machen. Er bot dem Chief sofort eilfertig an, alles so zu machen, wie er das auch mochte, wenn er es ihm nur vorher mitteilen würde. Er war offensichtlich über seinen ungewollt schlechten Start ziemlich betrübt. Zu Recht, aber man kann ja nicht in die Nasen reingucken, um sich rechtzeitig auf spezielle Eigenarten vorzubereiten. Schon leicht besorgt habe ich ihn dann beiseite genommen und ihm verklickert, dass der Chief eine besondere Situation zu bewältigen hätte, weil sein Urlaub gekanzelt worden war und dass solche Situation besonders bei Familie Chief seine mitfühlende und vergebende Milde erforderlich machte.
Übrigens war der neue Koch der einzige und wirklich echte Schiffsopa mit seinen dreiundsechzig Jahren. Nicht der Beste, gewisslich das nicht, aber einer der saubersten Köche, die ich je kennenzulernen die Ehre hatte. Der hatte öfter den Putzlappen als den Kochlöffel in der Hand! Was doch auch nicht zu verkehrt war. Zugegeben war doch das Gros seiner Gerichte recht schmackhaft und man musste ja nun auch wirklich nicht alles essen, was aus der Schmiede kam. Wir sollten hier doch nur überleben! Satt machte uns ganz was anderes! Zum Beispiel Lukenprobleme.
Wir erhielten noch einen Haufen Ausrüstung und Ersatzteile und Öl aus Deutschland, wo ich auch immer noch ein halbes Auge drauf habe musste, um nichts in die Grütze gehen zu lassen. Und tatsächlich musste das Bier nachgeordert werden, weil irgendwo die beiden Paletten nicht bestellt oder aufgeladen worden waren. Also schnell noch bei einem anderen Schiffhändler nachgefasst und das „Einzig Wahre“ anliefern lassen.
Aber zurück zu unserem Lukenproblem im Hafen von Zeebrugge.
Doch, so stellten die Besichtiger fest, es stänke im bewussten Laderaum auffallend nach Schweröl und auch die Früchte aus diesem Deck würden etwas anders schmeckten. Prophylaktisch wurden auf die Schnelle vierzehn Leer-Container angefordert, die auch bald an der Pier standen, worin die Ladung aus diesem Deck verstaut wurde, um sie von der anderen Ladungsteilen zu separieren. Auch mir reichte man zwei Früchte zum Kosten und ich sollte sagen, welche aus dem bewussten Deck stammte. Ich schmeckte ebenfalls den Unterschied heraus. Die eine Frucht schmeckte nun nicht gerade nach Schweröl, sondern eher unbestimmt nach etwas Chemie, aber definitiv wahrhaftig störend. Tja, wat war ich nich ’n Pechvogel!
Es wurde die Frage gestellt: An wen die Schuldzuweisung zu adressieren sei? Das Schiff? Und wenn ja, warum? Was hatten wir falsch gemacht, die wir doch unsere handwerklichen provisorischen Reparaturen von der Klassifikationsgesellschaft Germanischer Lloyd sogar haben abnehmen lassen! Also versammelten sich schließlich drei Besichtiger, der Kapitän und der Chief Mate in der Luke. Und rochen dort an dem Rohr, welches es als mutmaßliche Ursache des Schadens in die engere Wahl der Jury geschafft hatte. Die undichte Stelle war ja damals in Bolivar mit einer strengen 1:1-Zementmischung abgedichtet worden. Na, ich roch zwar etwas, einen leicht fremdartigen Geruch, hütete mich aber, dieses in Gegenwart der gegnerischen Besichtiger zuzugeben. Auch mein Besichtiger roch nix. Die anderen rochen etwas und der Dritte im Bunde auch wieder nix. Nun konnte es durchaus sein, dass die Chemikalie, die wir zum Anlösen des ausgelaufenen Schweröls verwandten, selbst in die Isolation gesickert war und mit Warmwerden des Laderaumes wieder flüchtig wurde und austrat. Denn definitiv hatten wir während der Überreise nichts gerochen. Und unser Augenmerk war auf diesen Umstand in diesem Deck definitiv fokussiert gewesen! Die täglichen Kontrollrunden des Chiefs Mates (Pulptemperatur) waren nachgewiesen und wir selbst hatten ja ein übergroßes Interesse, Mängel sofort zu beseitigen oder aufzuspüren. Und nun das!
Übrigens erfuhr ich später, was der Flug der anderthalb Container Reparaturmaterialien nach Ecuador und die beiden Spezialisten gekostet hatten: rund sechshundert Riesen! Netter Spaß, wenn sich das nun wiederholen sollte! Not haben war immer auch teuer, da konnte man schon zulangen, wenn der andere gar nicht anders konnte als den Preis zu zahlen.
Schließlich entnahmen sie Luftproben vom Laderaum, die an der Uni von Antwerpen untersucht werden sollten, deren endgültige Ergebnisse aber binnen Wochenfrist nicht zu kriegen sein würden. Schöne Aussichten!
Weil unsere Meinungen soweit auseinanderdrifteten, was den Geruch anbetraf, dort der Verfechter des Ladungsempfängers, der sagte, dass durch Schuld des Schiffes die Ladung dieses Decks verdorben worden sei, hier wir, die wir auf dem Standpunkt standen, dass es gar nicht röche oder nur vernachlässigbar gering, wenn überhaupt. Als Dritter der Besichtiger des Charterers, der meinte, dass er ebenfalls nichts riechen könne, so musste eine finale Entscheidung her! Der Empfänger ließ durchklingen, dass er durchaus eine gerichtliche Entscheidung anstreben würde, wenn wir auf unserem Punkt beharren würden. Ich ließ mich aufklären, weil ich davon viel zu wenig verstand, dass dies bedeuten würde, dass ein vom Gericht bestellter Gutachter hier seinen vereidigten Riechkolben reinstecken würde, um mal reinzuriechen und zu Protokoll zu geben, dass es stänke oder dass es eben nicht stänke. Sein Urteil wäre dann bindend für alle Besichtiger und Gutachter, egal welchen Coleurs als Richtlinie. Da würde es dann nix mehr dran zu rütteln geben.
Aber es war wieder einmal Wochenende, und da solche Gerichtsbarkeiten schon gar nicht an Wochenenden – ganz im Gegensatz zu Elefanten und ehrlichen Seeleuten – arbeiteten, musste das Schiff, bis man denn weiterkönnte, arrestiert werden. Also ab an die Kette!
Sagt man so, bedeutete in unserem Fall, dass es dem Schiff per gerichtlichen Strafbescheid polizeilich verboten wurde, den Hafen zu verlassen. Was ja hier eh nicht ging, von welcher Warte man das auch betrachten wollte, denn die Schleuse, durch die wir immer mussten, stand ja eh nicht unter meiner Fuchtel. Insofern hatte dieser Arrest eher nur eine theoretisch-juristische Seite, denn eine praktische.
Zu guter Letzt erhielt aber der Riechende einen Anruf, der alles klärte. Die ersten flüchtigen Ergebnisse, bei Gott nicht die gesamte Spektralanalyse, der Geruchsproben besagten, dass die und die Kohlenwasserstoffe, die eben nur im Schweröl zu finden wären, in dem und dem Maß vorlägen. Und die schienen eindeutig und zweifelsfrei über den zulässigen EU-Werten zu liegen. Na, das war es ja dann wieder mal! Für die betroffene Ladung wurde eine Bankbürgschaft verlangt, die die Reederei hinterlegen musste und damit wurde der Arrest aufgehoben und wir durften wieder auslaufen.
Wie ich später erfuhr, konnte aber die gesamte Ladung zu ihrem vollen Wert und unter dem Strich ohne Schaden für die Reederei verkauft werden. Auch die Bürgschaft wurde voll zurückgezahlt. Die Ladungsempfänger begasten die betroffene Kiwi-Partie und behandelten sie mit Ozon und konnten so die Kohlenwasserstoffe fein rauskriegen. Wie genau das geschah, entzog sich natürlich völlig meiner Kenntnis. Aber wer mit Insektiziden, E-Nummern, Pestiziden und Nahrungsmitteln handelte, dem war sicherlich kein Trick unbekannt, aus brauner Paste Köstlichkeiten zu zaubern und somit auch ein solches Wunder möglich zu machen.
Nachdem ich meine sechs Leute ab- und sieben angemustert hatte, die Ladung gelöscht und Ausrüstung an Bord genommen worden war, konnten wir endlich ungestraft und ungestört auslaufen. Und mal ehrlich: Es fiel mir nicht schwer, diesem Hafen meinen Rücken zu kehren. Bloß wech! So schön es auch war, wieder mal in Europa zu sein, Besuch und Zeitungen zu kriegen, so schön war es doch immer wieder, dem Ganzen „Auf Wiedersehen“ zu sagen. Das Allerschwerste beim Abschiednehmen war ja immer, die aufkommende Freude darüber zu verbergen, dass man abhauen durfte. Am Schlimmsten war noch immer Deutschland. Denn da kamen zusätzlich auch immer noch Leute der Reederei mit klugen Fragen und Ratschlägen, die kaum Rücksicht auf die privaten Belange des Einzelnen nahmen. Nee, Europa: Gut und schön, aber einfach war das nicht.
Nun volle Pulle wieder zurück zum Krummfruchtholen nach Puerto Bolivar. Dort, in unserem zweiten ‚Heimathafen‘, ließ man uns wenigstens mehr in Ruhe, was jedoch auch nicht immer die beste Lösung war, besonders, wenn man irgendwelche Hansels mal wirklich dringend brauchte. So gesehen waren wir schon Gefangene des ewigen Ying-Yang-Dingens, nie war alles gut, nie war alles schlecht. Es kam darauf an, wie man sich selbst eingestellt hatte und gewillt war, es zu betrachten, dass man neben all dem alltäglichen Frust auch immer noch etwas Schönes und Bewahrenswertes für sich herauspickte, das zählte dann unterm Strich! Nicht etwa der Ärger und die liebe Not mit irgendwelchen Ländern und Leuten!