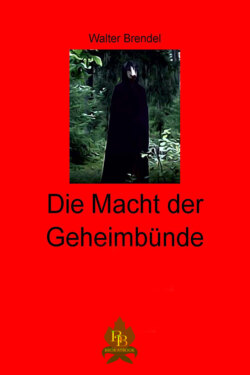Читать книгу Die Macht der Geheimbünde - Walter Brendel - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеHieroglyphen
Hieroglyphen sind eine auf die Verwendung an Tempel- und Grabwänden ausgerichtete Monumentalschrift. Das Schriftsystem enthält neben orthographischen Aspekten viele Eigenheiten, die sich ausschließlich mit der ornamentalen Wirkung, der Platzausnutzung oder magischen Sichtweisen erklären lassen. Wie einige besonders gut erhaltene Beispiele noch zeigen, so etwa die Inschriften in den Gräbern im Tal der Könige, wurden die Hieroglyphen ursprünglich vielfach farbig geschrieben. Die Farbe entsprach Teils der Naturfarbe des dargestellten Gegenstandes, teils war sie rein konventionell festgelegt. In Einzelfällen konnte allein die Farbe zwei ansonsten formgleiche Schriftzeichen unterscheiden; dies gilt besonders für mehrere Hieroglyphen mit rundem Umriss.
Ägyptische Wörter werden auch innerhalb eines Textes durchaus variabel geschrieben. Die Hieroglyphenschrift ist trotz der starken Bildhaftigkeit (derer sich die Ägypter bewusst waren), kaum eine Bilderschrift.
Die hieratische Schrift ist ebenso alt wie die Hieroglyphenschrift. Sie ist eine kursive Variante der Hieroglyphenschrift, die zum Schreiben mit einer Binse auf Papyrus oder ähnlich geeignetem Material (wie Ostraka aus Kalkstein oder Ton) konzipiert war. Zunächst war sie nicht auf religiöse Texte beschränkt, die im Mittleren Reich teilweise auf Papyrus in Hieroglyphen geschrieben wurden, erst mit der Einführung des Demotischen als Alltagsschrift wurde sie auf die Niederschrift religiöser Texte beschränkt. Daher rührt auch ihr von Herodot überlieferter griechischer Name. Das Hieratische bildet die gleichen Elemente wie die Hieroglyphen ab. Dadurch, dass sie schnell geschrieben wurden, flossen die Zeichen häufiger ineinander und abs-trahierten im Laufe der Zeit immer stärker von den bildhaften Hieroglyphen; dennoch blieben die Prinzipien des Schriftsystems die gleichen.
Ägyptische Hieroglyphen
Geheimnisvolle Schriftzeichen sind den Geheimbünden eigen. Besondern gern wir auf Hieroglyphen zurück gegriffen.
Die altägyptischen Hieroglyphen sind die Zeichen des ältestenbekannten ägyptischen Schriftsystems. Ägyptische Hieroglyphen sind keine reine Bilderschrift, sondern eine auf Bildern basierende Kombination aus Konsonanten- und Sinnzeichen, die etwa von 3200 v. Chr. bis 300 n. Chr. In Ägypten und Nubien für die früh-, alt-, mittel- und neuägyptische Sprache sowie das an das Mittelägyptische angelehnte sog. Ptolemäische Ägyptisch benutzt wurde. Sie setzt sich aus Lautzeichen (Phonogramme), Deutzeichen (Determinative) und Bildzeichen(Ideogramme) zusammen. Mit ursprünglich etwa 700 und in der griechisch-römischen Zeit etwa 7000 Zeichen gehören die ägyptischen Hieroglyphen zu den umfangreicheren Schriftsystemen. Eine Reihenfolge ähnlich einem Alphabet existierte ursprünglich nicht, erst in der Spätzeit wurden Einkonsonantenzeichen vermutlich in einer alphabetischen Reihenfolge, die große Ähnlichkeiten mit den südsemitischen Alphabeten zeigt, angeordnet.
Die Bezeichnung „Hieroglyphen“ ist die eingedeutschte Form des altgriechischen „heilige Schriftzeichen“ oder „heilige Eingrabungen“, das aus „heilig“ und glýph ō „(in Stein) gravieren/ritzen“ zusammengesetzt ist. Diese Bezeichnung ist die Übersetzung des ägyptischen „Schrift der Gottesworte“, das die göttliche Herkunft der Hieroglyphenschrift andeutet.
Nachdem die Hieroglyphen seit dem 4. Jahrhundert n. Chr. In Vergessenheit geraten waren, keimte das Interesse an den Hieroglyphen in der Renaissance in Europa wieder auf, jedoch standen den Gelehrten nur spätantike griechische Texte zur Verfügung, etwa die Hieroglyphica des Horapollo, die eine Mischung aus richtigen und falschen Informationen zur Bedeutung der Hieroglyphen enthält, indem sie auch phonetische Zeichen als Logogramme auffasst und durch sachliche Übereinstimmungen zwischen Bild und Wort erklärt. Dazu kamen die arabischen Grammatiken des Koptischen, der letzten Sprachstufe des Ägyptischen. Dies reichte zur Entzifferung dieser Schrift nicht aus. Die Angaben Horapollos führten die Bemühungen des deutschen Jesuiten und Universalgelehrten Athanasius Kircher und einiger anderer Gelehrten in die Irre. Nachdem Kirchers Entzifferungsversuche bald als falsch erkannt worden waren, wurden wesentliche Fortschritte, die schließlich zum Durchbruch führten, durch den während Napoleons Ägyptenfeldzug bei Schanzarbeiten nahe der Stadt Rosetta gefundenen Stein von Rosetta möglich. Er enthält ein griechisches, hieroglyphisch-ägyptisch und demotisch geschriebenes Dekret aus der Ptolemäerzeit, wodurch er einen idealen Anknüpfpunkt für weitere Untersuchungen darstellte. 1802 gelang dem Schweden Åkerblad die Entzifferung einzelner demotischer Wörter auf dem Stein von Rosetta, 1814 erreichte der englische Physiker Thomas Young weitere Fortschritte beim Verständnis des demotischen Textes, außerdem erkannte er die Verwandtschaft des Demotischen mit den Hieroglyphen. Zwei Jahre später entdeckte er für viele hieratische Zeichen ihre hieroglyphischen Gegenstücke. Jean-François Champollion zeigte anhand der Namen „Ptolemäus“ und „Kleopatra“, dass auch die Hieroglyphen phonetische Zeichen besaßen. Durch den Vergleich mit weiteren bekannten Königsnamen, besonders Namen römischer Kaiser, gewann Champollion die Lautwerte vieler Hieroglyphen, zunächst Ein-, dann auch Mehrkonsonantenzeichen. Auf diesen Entdeckungen aufbauend konnte Champollion durch den Vergleich ägyptischer Texte mit dem Koptischen zahlreiche weitere Zeichen entziffern und damit Grammatik und Wortschatz des Ägyptischen erschließen.
Nach der altägyptischen Überlieferung hat Thot, der Gott der Weisheit, die Hieroglyphen geschaffen. Die Ägypter nannten sie daher „Schrift der Gottesworte“.
Die Anfänge dieser Schrift lassen sich bis in die prädynastische Zeit zurückverfolgen. Die früher gewöhnlich zugunsten der Keilschrift entschiedene Frage, ob die sumerische Keilschrift oder die ägyptischen Hieroglyphen die früheste menschliche Schriftdarstellen, muss wieder als offen gelten, seit die bislang ältesten bekannten Hieroglyphenfunde aus der Zeit um 3500 v. Chr.(Naqada III) in Abydos aus dem prädynastischen Fürstengrab U-j zum Vorschein gekommen sind. Die schon voll ausgebildeten Hieroglyphen befanden sich auf kleinen Täfelchen, die – an Gefäßen befestigt − deren Herkunft bezeichneten. Einige der frühen Zeichen ähneln sumerischen Schriftzeichen. Daher ist eine Abhängigkeit nicht ganz auszuschließen, aber auch in um-gekehrter Richtung möglich. Diese Frage wird kontrovers diskutiert.
Die Hieroglyphenschrift begann offenbar als Notationssystem für Abrechnungen und zur Überlieferung wichtiger Ereignisse. Sie wurde rasch mit den zu kommunizierenden Inhalten weiter entwickelt und tritt bereits in den ältesten Zeugnissen als fertiges System auf.
Die ägyptischen Hieroglyphen wurden zunächst überwiegend in der Verwaltung, später für alle Belange in ganz Ägypten benutzt. Außerhalb Ägyptens wurde diese Schrift regelmäßig nur im nubischen Raum verwendet, zunächst zur Zeit der ägypti-schen Herrschaft, später auch, als dieses Gebiet eigenständig war. Um 300 v. Chr. wurden die ägyptischen Hieroglyphen hiervon einer eigenen Schrift der Nubier, der meroitischen Schrift abgelöst, deren einzelne Zeichen jedoch ihren Ursprung in den Hieroglyphen haben. Die althebräische Schrift des 9. bis 7.Jahrhunderts v. Chr. benutzte die hieratischen Zahlzeichen, war ansonsten aber ein von der phönizischen Schrift abgeleitetes Konsonantenalphabet. Mit den Staaten des Vorderen Orients wurde vorwiegend in akkadischer Keilschrift kommuniziert. Es ist anzunehmen, dass sich die Hieroglyphen wesentlich schlechter zur Wiedergabe fremder Begriffe oder Sprachen eigneten als die Keilschrift. Wie groß der Anteil der Schriftkundigen an der Bevölkerung Ägyptens war, ist unklar, es dürfte sich nur um wenige Prozent gehandelt haben: Die Bezeichnung „Schreiber“ war lange synonym mit „Beamter“. Außerdem gab es in griechischer Zeit in den Städten nachweislich viele hauptberufliche Schreiber, die Urkunden für Analphabeten ausstellten.
Von 323 bis 30 v. Chr. beherrschten die Ptolemäer (makedonische Griechen) und nach ihnen das römische und byzantinische Reich Ägypten, die Verwaltungssprache war deshalb Altgriechisch. Das Ägyptische wurde nur noch als Umgangssprache der eingesessenen Bevölkerung benutzt. Trotzdem wurde die Hieroglyphenschrift für sakrale Texte und das Demotische im Alltag verwendet. Die Kenntnis der Hieroglyphen wurde auf einen immer enger werdenden Kreis beschränkt, dennoch wurden ptolemäische Dekrete oft in Hieroglyphen geschrieben. So enthalten ptolemäische Dekrete die Bestimmung, dass sie „in Hieroglyphen, der Schrift der Briefe (d. h. Demotisch) und in griechischer Sprache“ veröffentlicht werden sollten. Gleichzeitig wurden die Zeichen auf mehrere Tausend vervielfacht, ohne dass das Schriftsystem als solches geändert wurde. In dieser Form begegneten interessierte Griechen und Römer dieser Schrift in der Spätantike. Sie übernahmen bruchstückhaft Anekdoten und Erklärungen für Lautwert und Bedeutung dieser geheimen Zeichen und gaben sie an ihre Landsleute weiter. Mit der Einführung des Christentums gerieten die Hieroglyphenendgültig in Vergessenheit, die letzte datierte Inschrift stammt von 394 n. Chr. Je nach Schreibmaterial und Verwendungszweck lassen sich verschiedene Untersysteme der ägyptischen Hieroglyphen unterscheiden, hauptsächlich die Hieroglyphen selbst und das Hieratische. Obwohl die Zeichen in ihnen unterschiedliche Formen annahmen, blieb das Funktionsprinzip der Hieroglyphenschrift gewahrt.
Mysterienkult
Als Mysterienkult oder Mysterienreligion wird ein Kult oder eine Religion bezeichnet, deren religiöse Lehren und Riten vor Außenstehenden geheim gehalten wurden. Die Aufnahme in eine solche Kultgemeinschaft erfolgt gewöhnlich durch spezielle Ini-tiationsriten.
Das Wort Mysterium geht auf das griechische mysterion und dieses wiederum auf myein, „schließen“, zurück. Für Nichtinitiierte war der Mysterienkult „geschlossen“. Die initiierten Mitglieder wurden Mysten genannt.
Sachlich ist eine Definition schwierig, weil die Mysterienkulte ihr Geheimnis weitgehend gewahrt haben. Ihre Mythen und Riten können meist nur mit einem großen Ungewissheitsfaktor und vielen Mutmaßungen anhand antiker Schriften und archäologischer Funde rekonstruiert werden.
Die bekanntesten Mysterienkulte der antiken Welt sind die Mysterien von Eleusis, die samothrakischen Mysterien, der Dionysoskult, der Kult des Liber Pater in Rom und in Süditalien, der Mithraskult, der Kybele- und Attiskult, der Isis- und Osiriskult. Einige dieser Kulte stammen offensichtlich aus dem Orient; ob sie alle orientalischen Ursprünge sind, wie manchmal behauptet wird, ist jedoch unsicher. Die eleusinischen Mysterien, die samothrakischen Mysterien und der Dionysoskult gelten weithin eher als nationalgriechisch.
Große Teile der griechischen und später der römischen Bevölkerung waren Anhänger von Mysterienkulten. Der übliche Ahnenkult (d. h. die fiktive Abstammung von antiken Göttern)reichte nicht mehr aus. In den Mysterienkulten waren die verehrten Gottheiten nicht von Geburt an göttlich; sie hatten wie ein Mensch Schmerz und Tod erfahren und diesen dann überwunden. Dadurch waren sie dem Menschen näher als die Götter der alten Polisreligion.
Zum allgemeinen Wesen der Mysterienkulte gehören, schlagwortartig gesagt, der sterbende und auferstehende Gott, der Mutterkult, die Wiedergeburt zu irgendeiner Art von Unsterblichkeit. Man hat diese drei Phänomene in ein System gebracht, indem man den Mysteriengott als einen mit den Jahreszeitensterbenden und auferstehenden Vegetationsgott erklärt hat. Der Vegetationsgott ist natürlich mit der Mutter Erde eng verbunden, weniger einleuchtend dagegen ist die Auffassung, dass im Kreislauf des Daseins die Verheißung eines ewigen Lebens im Jenseits erkennbar sein soll. Gewiss ist jedenfalls, dass der sterbende und auferstehende Gott und die Große Mutter das im Kreise laufende Leben irgendwie geschaffen und in Gang ge-bracht haben.
Sekte
Sekte (lat. secta „Richtung“, von sequi, „folgen“, in der Bedeutung beeinflusst von secare, „schneiden, abtrennen“) ist eine ursprünglich wertneutrale Bezeichnung für eine philosophische, religiöse oder politische Gruppierung, die durch ihre Lehre oderihren Ritus im Konflikt mit herrschenden Überzeugungen steht. Insbesondere steht der Begriff für eine von einer Mutterreligion abgespaltenen religiösen Gemeinschaft. So ist beispielsweise das Christentum als Sekte aus dem Judentum hervorgegangen.
Aufgrund seiner Geschichte und Prägung durch den kirchlichen Sprachgebrauch bekam der Ausdruck abwertenden Charakter und verbindet sich heute mit negativen Vorstellungen, wie der möglichen Gefährdung von etablierten religiösen Gemeinschaften oder Kirchen, Staaten oder Gesellschaften.
Die moderne Religionswissenschaft hat das Wort Sekte durch neutrale Bezeichnungen wie religiöse Sondergemeinschaft oder neureligiöse Gemeinschaft ersetzt. In der Rechtswissenschaft findet der Begriff „Neue religiöse Bewegung“ Verwendung.
Aus dem illustrierten Sektenkatalog eines unbekannten Künstlers (um 1647)
In der Antike wurden als „Sekte“ zunächst diejenigen bezeichnet, die den Anschauungen eines bestimmten Philosophen folgten. Die ersten Christen wurden als „Sekte der Nazarener“, eine Richtung des Judentums bezeichnet.
Paulus verwendete das Wort α ἵ ρεσις (phon. „hairesis“, Streben,spätantik: philosophische Schule, Sekte, bzw. altgr. Verfehlung)in seinen Briefen für Spaltungen innerhalb der Gemeinde (z. B.1 Ko 11,19). Diese Spaltungen wurden von ihm negativ bewertet, ohne dass er dabei einer bestimmten Richtung unter ihnen den Vorzug gab.
In der Alten Kirche wurde der Begriff hairesis immer mehr für Abweichungen von der gemeinsamen Lehre der miteinander in Kommunion stehenden christlichen Gemeinden verwendet und mit Beginn des fünften Jahrhunderts hatte er schließlich in der Westkirche die Bedeutung „Irrlehre“.
Dieser Begriff wurde von der lateinischen Kirche des Mittelalters als secta, Sekte, übernommen. So wurden die Protestanten als secta lutherana bezeichnet und auch im deutschen Sprachgebrauch sprach die katholische Kirche bis ins 20. Jahrhundert in manchen Texten von „Sekten“, wenn sie die evangelischen Kirchen meinte.
Im landläufigen Sprachgebrauch werden als Sekten oft religiöse Gruppen bezeichnet, die in irgendeiner Weise als gefährlich oder problematisch angesehen werden, oder die in orthodoxer theologischer Hinsicht als „Irrlehre“ angesehen werden. Dies umfasst auch lang bestehende christliche Gemeinschaften, die sich in Lehre und/oder Praxis vom Herkömmlichen unterscheiden, als auch neue Gruppen, insbesondere solche, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden sind und als „Jugendreligion“ bezeichnet werden, weil sie anfänglich viele junge Mitglieder hatten. „Sekte“ wird heute oftmals als Kampfbegriff gebraucht. So wird sogenannten Sekten häufig vorgeworfen, sie würden sich v. a. aus wirtschaftlichen Gründen als religiöse Glaubensgemeinschaften ausgeben, um den besonderen Schutz des Staates, größere Freiheiten und Rechte, sowie die Befreiung von Steuern zu genießen. Bekanntestes Beispiel dafür ist Scientology.
Das Thema Sekten führt auch immer wieder zu Kontroversen. Dabei stehen sich zwei Lager gegenüber: auf der einen Seite vorwiegend die, die sich auf die Religionsfreiheit berufen und die wertende Einschränkung von religiösen Gruppen scharfverurteilen, mehrheitlich Vertreter von religiösen und weltanschaulichen Minderheitsgruppen und Verfechter der Religions-freiheit, unter den Akademikern mehrheitlich Religionswissenschaftler, einige Soziologen und Juristen. Auf der anderen Seite finden sich diejenigen, die neureligiöse Gruppen scharf verurteilen, weil sie die Freiheit von Individuen beschneiden würden oder nach unkontrollierter gesellschaftlicher Macht streben, darunter Vertreter der großen Kirchen, Mitarbeiter staatlicher Stellen sowie Initiativen von betroffenen Familienangehörigen oderehemaligen Mitgliedern, Psychologen, Soziologen, Politologen und Juristen.
Im Einzelnen drehen sich die Kontroversen häufig um mutmaßliche oder tatsächliche…
• Einschränkungen der Religionsfreiheit religiöser Randgruppen, etwa durch Kritik ihrer Praktiken und juristische Zwangsmaßnahmen
• Einschränkungen der religiösen Freiheit durch unterschiedliche Grade der gesetzlichen Anerkennung
• Einschränkungen der Meinungsfreiheit von Gruppenmitgliedern
• Einschränkungen der Bewegungsfreiheit von Gruppenmitgliedern
• wirtschaftliche Ausbeutung der Mitglieder durch lange Arbeitszeiten und minimales Gehalt
• sexuelle Ausbeutung oder Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch Gruppenmitglieder
• Menschenrechtsverletzungen durch gruppeninterne, gerichtsähnliche Verfahren
• Personenkulte um die Anführer der betreffenden Gruppe
• Familienkonflikte, insbesondere bei Familien wo ein Elternteil die Gruppe verlassen hat und die Kinder in der Gruppe bleiben
• Behinderung von Kindern beim Zugang zu Ausbildung, ärztlicher Versorgung und Familienangehörigen außerhalb der Gruppe.
In manchen Fällen werden solche Vorwürfe einseitig gegenüberreligiösen Randgruppen erhoben, während das gleiche Verhalten bei etablierten Kirchen übersehen wird oder die Schuld Einzelpersonen zugewiesen wird, während bei religiösen Rand-gruppen die Strukturen dafür verantwortlich gemacht werden.
Vereinzelt geraten sogenannte Sekten im Zusammenhang mit Gewaltaktionen in die Schlagzeilen.
Besonders spektakuläre Beispiele sind:
• der Massenselbstmord der über 900 Mitglieder des Peoples Temple 1978 in Guyana,
• Mordanschläge gegen angebliche Widersacher durch Swami Omkarananda und einige Anhänger des von ihm gegründeten Divine Light Zentrum,
• die Church of the Lamb of God dessen Führer Ervil LeBaron in den 1970er Jahren ca. 25 Rivalen ermorden ließ,
• der Salmonellen-Anschlag 1984 auf mehrere Salatbarsin der Kleinstadt The Dalles durch OshoMitglieder, beidem ca. 750 Einwohner erkrankten,
• der bewaffnete Widerstand der Davidianer gegen die US-Behörden 1993, bei dem vier Polizisten und später über 80 Mitglieder starben,
• die Massenselbstmorde innerhalb der Sonnentempler, bei denen zwischen 1994 und 1997 in der Schweiz, in Kanada und in Frankreich insgesamt 74 Mitglieder ums Leben kamen,
• die Colonia Dignidad, in der Kinder missbraucht und politische Gegner gefoltert wurden,
• der Heaven's Gate-Massenselbstmord mit 39 Toten,
• am 17. März 2000 der Massenmord an Mitgliedern des Movement for the Restoration of the TenCommandments of God in Uganda mit über 1000 Toten.
• Yahweh ben Yahweh, Führer der Nation of Yahweh,verantwortlich für fast zwei Dutzend grausame Morde in den 80er Jahren.
• Die Organisation von Jeffrey Lundgren, die 1989 eine fünfköpfige Familie umbrachte, die der Anführer für nicht „überzeugt“ genug hielt. Lundgren wurde 2006 hingerichtet.
Der größte Anschlag einer Sekte gegen Außenstehende in der modernen Zeit war das Giftgasattentat in der U-Bahn von Tokio im Jahr 1995, bei dem zwölf Menschen starben und etwa 1000 verletzt wurden. Einzelne Geheimgesellschaften der Vergangenheit
Pythagoreer
Als Pythagoreer bezeichnet man im engeren Sinne die Angehörigen einer religiös-philosophischen Schule, die Pythagoras von Samos in den zwanziger Jahren des 6. Jahrhunderts v. Chr. in Unteritalien gründete und die nach seinem Tod noch einige Jahrzehnte fortbestand. Im weiteren Sinn sind damit alle gemeint, die seither Ideen des Pythagoras (bzw. ihm zugeschriebene Ideen) aufgegriffen und zu einem wesentlichen Bestandteil ihres Weltbildes gemacht haben.
Von Pythagoras sind keine authentischen Schriften überliefert, nur einige ihm zugeschriebene Verse sind möglicherweise echt. Schon in der Antike gab es unterschiedliche Meinungen darüber, welche der als pythagoreisch geltenden Lehren tatsächlich auf ihn zurückgehen. Die Unterscheidung zwischen ursprünglichem bzw. frühpythagoreischem und späterem Gedankengutgehört bis heute zu den schwierigsten und umstrittensten Fragen der antiken Philosophiegeschichte. In der Forschung ist sogar strittig, ob es sich bei der Lehre des Pythagoras tatsächlich um Philosophie und um wissenschaftliche Bestrebungen handelte oder um eine rein mythisch-religiöse Kosmologie. Zu diesen Schwierigkeiten trägt das frühe Einsetzen einer üppigen Legendenbildung bei.