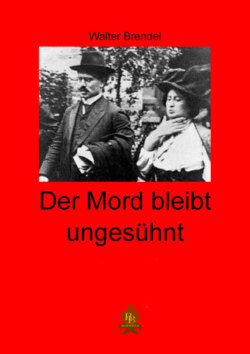Читать книгу Der Mord bleibt ungesühnt - Walter Brendel - Страница 5
Die göttliche Rosa
ОглавлениеSie war eine Aufrührerin im Wilhelminischen Reich, ihre Ermordung 1919 machte sie zur Märtyrerin der deutschen Linken jenseits der SPD. Zu ihrem Todestag pilgern bis zu hunderttausend hinaus ans Grab von Rosa Luxemburg.
Rosa Luxemburg ist die Ikone der revolutionären Linken vieler Länder, deren Patronin, eine Art ungeschütztes Warenzeichen. Ihren berühmtesten Satz - "Freiheit ist immer nur Freiheit des anders Denkenden" - zitieren FDP-Koryphäen ebenso selbstverständlich wie die der LINKEn.
Die Feministinnen berufen sich auf ihr Vorbild, Margarethe von Trotta drehte 1985 einen ihrer einfühlsamen Filme über sie, Barbara Sukowa spielte die Hauptrolle. Die Flut der Biografien reißt nicht ab, die Apologeten, die der DDR nachtrauern oder weiterhin einen dritten Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus suchen, überwiegen naturgemäß. Aber auch der politisch völlig unverdächtige Franzose Max Gallo, der einst François Mitterrand als Präsidentensprecher diente, widmete der Frau ein Buch, deren Lebensbogen sich zwischen der deutschen Reichseinheit 1871 und den revolutionären Wirren nach dem Ersten Weltkrieg spannt.
100 Jahre nach ihrer Ermordung ist Rosa Luxemburg das Objekt übergroßer Verehrung, in Europa kommt ihr nur die spanische Bürgerkriegsheldin Dolores Ibarruri, genannt "La Pasionaria", gleich, die in Spanien Kultstatus genießt und mit 93 Jahren einen friedlichen Tod starb. Rosa Luxemburg aber ist durch die Ermordung zur Märtyrerin geworden, wie Ché Guevara dank seines gewaltsamen Todes in Bolivien zum Märtyrer wurde.
Sie war vieles, was man zu ihrer Zeit besser nicht war: eine Revolutionärin, als Frauen noch nicht das Wahlrecht besaßen; eine Polin, als Polen geteilt war; eine Jüdin zu Zeiten wiederkehrender Pogrome; zusätzlich hinkte sie, weil das eine Bein nach einem frühen Hüftleiden kürzer geriet als das andere.
Rozalia Luksenburg, so hieß sie ursprünglich, stammte aus einer jüdischen Familie, in der man Polnisch sprach und Jiddisch fluchte. Ihr erstes Pogrom erlebte sie 1881 in Warschau, da war sie zehn Jahre alt. Das Gymnasium durfte sie besuchen, weil sie den Numerus clausus erfüllte, der den Anteil jüdischer Schüler begrenzte.
Als sie 1888 studieren wollte, musste sie ihr Land verlassen. Frauen waren an den polnischen Universitäten nicht zugelassen, und überdies suchte die zaristische Geheimpolizei nach ihr. Polen war, eine stete Demütigung für den romantischen Nationalismus dieses Landes, zwischen Österreich, Preußen und Russland geteilt. Warschau gehörte zum Beutegut des Zarenreiches - und die berüchtigte Polizei Alexanders III. jagte die junge Sozialistin. Rozalia hatte sich einer Gruppe um den Dachdecker Marcin Kasprzak angeschlossen, die eine sozialdemokratische Partei nach deutschem Vorbild aufbauen wollte und vom friedlichen Zusammenleben der Völker träumte.
Kasprzak organisierte ihre Flucht. Einem katholischen Pfarrer erzählte er, die junge Frau sei vom tiefen Wunsch beseelt, zum Christentum überzutreten, gegen den Willen ihrer Eltern. Der Kirchenmann schmuggelte sie versteckt im Stroh seines Fuhrwerks
über die Grenze nach Westen.
Die 18jährige ging nach Zürich, dem Sammelplatz für sozialistische Emigranten vornehmlich aus Deutschland und Russland. Sie agitierte für den "Sturz des Zarentums".
Nebenbei studierte sie Staatswissenschaften an der Zürcher Universität. Sie war 22 Jahre alt, als sie mit ihrem Freund Leo Jogiches, einem introvertierten Unternehmersohn aus Wilna, und Adolf Warszawski, dem Ehemann einer Schulkameradin, die "Sozialdemokratie des Königreichs Polen und Litauen (SDKPiL)" aus der Taufe hob. Der jungen, schwungvollen Frau oblag es bald, die Parteizeitung herauszugeben.
Die SDKPiL gehörte in die Reihe linksdoktrinärer Politsekten, die in der Emigration aus dem Boden schossen. So ziemlich sämtliche Gründungsmitglieder fanden später Aufnahme ins Pantheon des Welt-Kommunismus: Felix Dserschinski rief die sowjetische Terrorpolizei Tscheka ins Leben, den Vorläufer des KGB, Warszawski war bis in die dreißiger Jahre Vorsitzender der polnischen KP, Luxemburg und Jogiches riefen in den Wirren der Nachkriegszeit 1918 die KPD aus.
Unter den Emigranten galt Rosa Luxemburg als brillante Theoretikerin. Die kleine, charismatische Frau mit dem großen Kopf und den leuchtend schönen Augen zog die Menschen wie ein Magnet an.
Über den ersten Auftritt der damals 22 Jahre alten Studentin auf einem internationalen Arbeiterkongress 1893 berichtete später Karl Kautsky, die theoretische Eminenz der SPD, dass die junge Frau "begeisterte Zustimmung, ja schwärmerische Bewunderung derjenigen gewann, deren Sache sie vertrat". Er berichtete aber auch vom "bittersten Hass derjenigen, gegen die sie den Kampf aufnahm". Zeit ihres Lebens löste sie diese extremen Gefühle aus.
Für eine leidenschaftliche Sozialistin, die um die Jahrhundertwende die Revolution vorantreiben wollte, war Deutschland der Mittelpunkt der Welt. Keine europäische Partei konnte sich mit der SPD messen.
Um einen deutschen Pass zu erhalten, ging sie eine Scheinehe mit dem Schriftsetzer Gustav Lübeck ein. Die beiden sahen sich nach der standesamtlichen Trauung in Basel erst fünf Jahre später wieder, bei der Scheidung.
Am 16. Mai 1898 traf Luxemburg um 6.30 Uhr morgens mit dem Schnellzug in Berlin ein. Sie mochte weder die Metropole Preußens, die vor Vitalität und Selbstbewusstsein förmlich explodierte, noch die Deutschen, die Kaiser Wilhelm II. zujubelten und dem Imperialismus anhingen. "Ich hasse sie aus ganzer Seele", schrieb sie an Jogiches, "es soll sie der Schlag treffen."
Luxemburg nahm sich ein Zimmer am Tiergarten, sie lernte das Wahlhandbuch der SPD auswendig und kreuzte in der Parteizentrale in der Katzbachstraße auf, wo Wahlkampfhektik herrschte, denn am 16. Juni 1898 standen Reichstagswahlen an.
Im Wilhelminischen Reich lebten am Ausgang des 19. Jahrhunderts 3,5 Millionen Polen; unter ihnen wollte Luxemburg für die SPD und die Weltrevolution werben. Ihre Wahlkampftournee durch Schlesien geriet zum Triumphzug.
Sie schrieb Artikel für den "Vorwärts", das Kampfblatt der frühen SPD, und für die "Neue Zeit", das Theorie-Organ der Partei. Mehr als Journalistin denn als Politikerin nahm sie teil an der großen theoretischen Debatte, ob der gesellschaftliche Fortschritt in Deutschland besser mit einer Reform oder einer Revolution herbeizuführen sei, die die SPD auf Jahrzehnte beseelte und zugleich lähmte.
Trauerzug für Luxemburg und Liebknecht: Diese Aufnahme von der Beisetzung des ermordetem KPD- Führers Karl Liebknecht und anderer Opfer des Spartakus-Aufstandes wurde auch als Postkarte verbreitet. Die sterblichen Überreste von Liebknechts Mitstreiterin Rosa Luxemburgs wurden erst am 1. Juni 1919, fast ein halbes Jahr nach der Tat, aus dem Landwehrkanal geborgen
Eduard Bernstein, ein ehemaliger Angestellter des Bankhauses Rothschild in Berlin,
hielt den Kapitalismus für reformfähig und die Weltrevolution für eine Chimäre. Sein
Widerpart war Karl Kautsky, der Lordsiegelbewahrer der reinen Lehre. Ihm zur Seite
trat Luxemburg, die Bernstein "vulgärökonomische Schnitzer" vorwarf und ihn am liebsten aus der Partei geworfen hätte.
Die Revisionismusdebatte machte Luxemburg berühmt und zu einer Wortführerin der Parteilinken. Autogrammjäger umlagerten sie auf den Parteitagen, sie werde, berichtete sie stolz ihrem Geliebten Jogiches, "die Göttliche" genannt. Die Pressekommission der SPD machte sie zur Chefredakteurin der "Sächsischen Arbeiterzeitung".
Keiner Frau vor ihr, keiner nach ihr wurde diese Ehre zuteil.
Als die bundesdeutsche Frauenbewegung 70 Jahre später nach Vorbildern in der Geschichte suchte, stieß sie zwangsläufig auf die Journalistin, Theoretikerin und Revolutionärin Luxemburg. Sie behauptete sich in der patriarchalischen SPD, sie war
emanzipiert, führte ein freies Liebesleben, einer ihrer Männer war 15 Jahre jünger als
sie. Von schieren Frauenthemen hielt sie jedoch wenig, sie lästerte im Gegenteil über
die Treffen "dieser Glucken", wie sie die Zusammenkünfte der Suffragetten nannte.
Ganz kleinbürgerlich träumte sie, die weitgehend vom Geld ihrer Männer lebte, von einem geordneten Leben ohne Politik in einer Wohnung mit "hübschen Möbeln", Ferien auf dem Lande und "dazu ein kleines, klitzekleines Würmchen", wie sie an Jogiches schrieb, dem die Revolution erheblich wichtiger war als das kleine private Glück.
Die Briefe Luxemburgs mit teils poetischen, teils kitschigen Passagen zählen zu den
Juwelen der romantischen Briefliteratur aus dem Geiste des Sozialismus. Späte Bewunderer stilisierten Luxemburg zu einer Heroine der Menschlichkeit, weil sie solche Sätze niederschrieb wie: "Mir ist der Friede und der einfache Wunsch jedes anderen Menschen ein Heiligtum, vor dem ich lieber zusammenbreche, als es roh anzutasten."
In ihren moralisierenden Herzensergüssen rückte sie Hedwig Courths-Mahler nahe: "Gut sein ist die Hauptsache! Einfach und schlicht gut sein."
Rosa Luxemburg auf einem SPD-Parteitag: Die spätere Mitbegründerin der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) forderte im sogenannten Revisionismusstreit, der um die Wende zum 20. Jahrhundert unter den Sozialdemokraten tobte, mit harten Formulierungen die Ächtung des pragmatischen Parteigranden Eduard Bernstein
Das war die Herzensgute, Moralische, die von ihren Biografen geradezu verehrt wird.
Luxemburg aber verstand sich im Kern als Revolutionärin, und da dachte sie durchaus
in den herrschenden Freund-Feind-Bildern.
Während der Berliner Jahre blieb sie Mitglied in der Parteiführung der polnischen SDKPiL, die wiederum Teil der Russischen Sozialdemokratie war. Dort lieferten sich Bolschewiki und Menschewiki erbitterte Auseinandersetzungen. Auch Luxemburg beschimpft Parteifreunde als "Feiglinge" oder "Seuche" und wollte Opponenten "zerschlagen" und "vernichten". Über einige ihrer Gegner schrieb sie 1909 in einem Brief, man müsste sie "ohne Umstände erschießen".
Die Russische Revolution 1905/06 erlebte sie in den Auswirkungen auf Polen mit. Sie war während des Aufruhrs als "Anna Matschke" nach Warschau geeilt und half, die Seiten der Revolutionszeitung "Czerwony Sztandar" zu füllen. Am 4. März 1906 wurde sie verhaftet. Nur durch Bestechung kam sie frei. Nach den Erfahrungen in Warschau stand ihre Überzeugung fest, dass einzig der Massenstreik die Revolution hervorrufen könne, in Russland wie in Deutschland.
Die Sozialdemokraten unter August Bebel redeten unverdrossen von der Revolution,
betrieben jedoch die reformerische Veränderung der Gesellschaft. Die SPD sei, so schrieb Kautsky, eben "eine revolutionäre, nicht aber eine Revolution machende Partei".
Die Historiker nennen den Schwebezustand zwischen Ausgrenzung und Einbeziehung die "negative Integration" der SPD im Kaiserreich. Dieser Prozess fand am 4. August 1914 seine Krönung, als die SPD den Kriegskrediten im Reichstag zustimmte.
Das war die große, schreckliche Enttäuschung im Leben Rosa Luxemburgs, sie zog
den Bruch mit der SPD nach sich. Mit Jogiches und anderen linken Kriegsgegnern gründete sie die Gruppe Internationale, aus welcher der Spartakusbund hervorging.
Drei der vier Kriegsjahre verbrachte sie in Haft: im Königlich-Preußischen Weibergefängnis in Berlin, im posischen Wronke und in Breslau. Die zierliche Frau hielt dem kaiserlichen Ankläger entgegen: "Ein Sozialdemokrat steht zu seinen Taten
und lacht Ihrer Strafen. Und nun verurteilen Sie mich." Spätestens dieser Auftritt machte sie zur anbetungswürdigen Heldin der Kriegsgegner.
Rosa Luxemburg: Die sozialistische Politikerin war Mitbegründerin des Spartakusbundes, der am 30.12.1918 zusammen mit Bremer Linksradikalen die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) gründete. Als die KPD jedoch einen Boykott der Wahlen zur Nationalversammlung beschließt, sind sie und ihr Mitstreiter Karl Liebknecht dagegen
Im Gefängnis rechnete Luxemburg mit ihrer Partei ab. Sie kanzelte die Genossen als
"Schildknappen des Imperialismus" ab, als "Haufen organisierter Verwesung" und "Hunde", die den "wohlverdienten Fußtritt bekommen" müssten. Als 1917 parteinterne
Kriegsgegner die "Unabhängige SPD" (USPD) gründeten, schloss sie sich, wenn auch widerstrebend, mit dem Spartakusbund an.
Im Gefängnis schrieb sie im Sommer 1918 auch jene Sentenz, die sie unsterblich machte: "Freiheit ist immer nur Freiheit des anders Denkenden." Sie findet sich in einer Schrift über die Russische Revolution, die nach ihrem Tode veröffentlicht wurde.
Als sie den erhebenden Satz formulierte, der an die idealistischen Grundsätze des frühen Marx anknüpfte, kannte sie den gleichaltrigen Lenin seit knapp zwei Jahrzehnten.
Er hatte sich jahrelang mit ihrem Freund Jogiches befehdet, dennoch schätzte Luxemburg ihn. "Ich rede gern mit ihm", notierte sie, "er ist gebildet und hat eine gar so hässliche Fratze, die ich gern sehe."
Politisch waren beide selten einer Meinung. Luxemburg ahnte bereits 1905, dass Lenins Diktatur des Proletariats tatsächlich die "Diktatur einer Handvoll Politiker" bedeuten würde. Sie warf ihm später vor, in Russland mit seiner Terrorherrschaft den
"Sozialismus zu kompromittieren", und grenzte sich ab: "Freiheit nur für die Anhänger
der Regierung ist keine Freiheit." Im Herbst 1918 milderte sie allerdings ihr Urteil gegenüber dem russischen Experiment ab. Sie habe ihre Vorbehalte und Bedenken,
schrieb sie, "in den wichtigsten Fragen fallen lassen".
Besonders friedlich wäre es in einem Sozialismus à la Luxemburg kaum zugegangen. Sie lehnte das nationale Selbstbestimmungsrecht ab und wollte den neu gegründeten Staaten wie Polen oder Georgien sofort "den Hals umdrehen".
Dennoch brachte die ursprüngliche Kritik am Leninismus ihr bleibenden Ruhm ein. Wer immer fortan, von Georg Lukács bis Ernst Bloch, von den ungarischen Aufständischen
1956 bis zu den Reformkommunisten in Prag 1968, einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz anstrebte, berief sich auf Rosa Luxemburg.
Sie durfte am 9. November 1918 das Breslauer Gefängnis verlassen, fuhr ins revolutionär bewegte Berlin, übernahm die "Rote Fahne", das Blatt des Spartakusbundes, und rief zum "Bürgerkrieg" und zur Errichtung einer Diktatur des Proletariats auf. Den Sozialismus auf Grund eines parlamentarischen Mehrheitsbeschlusses einführen zu wollen, wie es der SPD unter Friedrich Ebert, dem Nachfolger Bebels, vorschwebte, sei "eine lächerliche kleinbürgerliche Illusion". Sie plädierte für eine direkte Herrschaft der Arbeiter- und Soldatenräte, die sich in vielen Städten seit dem Aufstand der Matrosen in Kiel gebildet hatten.
Ende Dezember 1918 gründeten Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht mit ihrer Spartakusgruppe die KPD als revolutionäre deutsche Kraft. Sie schrieb das Programm, wollte Widerstand "mit eiserner Faust und rücksichtloser Energie" brechen.
Dem politischen Gegner gelte "das Wort: Daumen aufs Auge und Knie auf die Brust".
Einmal errungene Macht müsse mit "Zähnen und Nägeln" verteidigt werden.
Trotz dieser Rhetorik gehörte Luxemburg in der KPD zum moderaten Flügel. Ihre Genossen - junge, ungeduldige Männer, die gerade von der Front zurückkehrten - wollten die Macht sofort erobern und riefen zum Putsch vor der Wahl zur Nationalversammlung am 19. Januar auf. Wie immer im Augenblick der Entscheidung war Luxemburg hin- und hergerissen, schloss sich am Ende widerstrebend den Putschisten an.
Am 5. Januar 1919 geriet eine Demonstration von KPD und USPD außer Kontrolle. Bewaffnete Demonstranten besetzten die Druckereien des "Vorwärts" und des Berliner Tageblatts", der Spartakusaufstand war ausgebrochen. Rosa Luxemburg rief
das Proletariat in der "Roten Fahne" dazu auf, die Regierung Ebert zu stürzen.
Friedrich Ebert, der es versäumt hatte, eine loyale republikanische Volkswehr aufzubauen, rief auch rechtsextreme Freikorps um Hilfe. Der grausige Mord machte aus Rosa Luxemburg die Märtyrerin der deutschen November-Revolution.
Familienporträt Rosa Luxemburg
Am 15. Januar 1919 stöberten Mitglieder der Wilmersdorfer Bürgerwehr sie bei Wilhelm Pieck in der Mannheimer Straße auf und verschleppten sie in das Hotel Eden in der Kurfürstenstraße. Dort wartete ein Trupp Soldaten, angeführt von Waldemar Pabst, einem Generalstabsoffizier der Garde-Kavallerie-Schützen-Division. Er ließ sie zu sich bringen, und stellte ihr die Frage: "Sind Sie Frau Rosa Luxemburg?" - "Wenn Sie es sagen", antwortete sie. Um 23.40 Uhr gab Pabst Befehl, die Revolutionärin wegzuschaffen. Den Befehl, sie umzubringen, hatte er schon vorher gegeben.
Vor dem Hotel schlug sie einer der Soldaten mit dem Gewehrkolben bewusstlos, das Mordkommando warf die Ohnmächtige in den Wagen. Wer ihr wenig später in den Kopf schoss, ist unter Historikern bis heute umstritten. Die Leiche warfen die Mörder in den Landwehrkanal. Sie wurde nach über vier Monaten an einer Berliner Schleuse
angeschwemmt.
Den angemessensten Nachruf auf Rosa Luxemburg schrieb ihr Antipode aus der Revisionismus-Debatte, Eduard Bernstein: "An ihr hat der Sozialismus eine hoch begabte Mitstreiterin verloren, die der Republik unschätzbare Dienste hätte leisten können, wenn nicht falsche Einschätzung der Möglichkeiten sie ins Lager der Illusionisten der Gewaltpolitik geführt hätte."
Luxemburg und der ebenfalls getötete Liebknecht bekamen ein Grab auf dem Friedhof in Friedrichsfelde, in einem weitab gelegenen Feld, nicht leicht erreichbar für Kundgebungen, wie es die Berliner Behörden angeordnet hatten.
Mies van der Rohe errichtete dort 1926 ein Revolutionsdenkmal, die Nazis zerstörten
es neun Jahre später mitsamt dem Grab. Von Rosa Luxemburgs Zinksarg blieb nichts als ein metallener Griff übrig.
Seit 1951 steht die neue Gedenkstätte am Haupteingang zum Friedhof. Aus der alljährlichen Demonstration zu "Rosa und Karl" machte die SED einen der üblichen
Vorbeimärsche zur Huldigung der Märtyrer der Arbeiterbewegung. Mittlerweile erhebt
die Linke so etwas wie ein Monopol auf Rosa Luxemburg.
Rosa Luxemburg dürfte die am meisten verkannte und vereinnahmte Person in der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung sein - und das „große I“ können wir uns
im Begriff „Arbeiterbewegung“ tatsächlich sparen; ein erheblicher Teil der vielfachen Fehlinterpretationen von Luxemburg ist gerade der Tatsache geschuldet, dass in dieser Männer-dominierten Bewegung eine authentische Frau und Revolutionärin nicht den ihr angemessenen Platz haben sollte, was im Übrigen nicht im Widerspruch zu dem interessanten Vorgang steht, dass linke Männer zu dieser großen Revolutionärin durchweg ein intimes Verhältnis haben und diese postum ausschließlich mit Vornamen ansprechen, was meines Wissens bei keinem einzigen Mann, z. B. Karl Liebknecht, Leo Trotzki, Wladimir Iljitsch Lenin, und wohl auch bei keiner anderen Frau, z. B. Clara Zetkin, erfolgt.
Eine klassische falsche Frontstellung, die aufgemacht und wo Rosa Luxemburg vereinnahmt wird, ist diejenige zwischen „Massenspontanität“ und „Parteidisziplin“. Diese Frontstellung ist an ihren beiden Polen fragwürdig, wenn nicht falsch. Es ging Rosa Luxemburg zum einen um die Betonung der entscheidenden Bedeutung von Massenaktionen. Zum anderen wandte sie sich zwar gegen eine zentralistisch definierte Parteidisziplin; gleichzeitig betonte sie jedoch die Notwendigkeit einer revolutionären Organisation - und zwar als logisches Pendant zu den Massenaktionen.
Zunächst sollten wir uns verdeutlichen, in welchen Zeiten Rosa Luxemburg ihre politischen Positionen hinsichtlich der Bedeutung von Massenaktionen entwickelte. Es
gab überall in den industrialisierten Ländern große sozialdemokratische und revolutionäre Organisationen. Diese hatten wirklichen Masseneinfluss und orientierten ihre Anhängerschaft auf eine revolutionäre Veränderung. Anfang des 20. Jahrhunderts, als viele sozialdemokratische Führer einen graduellen Marsch in den Sozialismus vorgaukelten, ihr Programm in „Minimal-“ und „Maximal“-Programme aufteilten, wobei das letztere auf Sonntagsreden begrenzt blieb, legte Rosa Luxemburg den Akzent auf die Massen und ihre selbständigen Aktionen.
Zumindest ein Teil der Wirklichkeit Anfang des Jahrhunderts bestätigte die Richtigkeit dieser Orientierung. 1902 gab es den großen belgischen Generalstreik, 1905 kam es zur Russischen Revolution - mit der Bildung von Räten und noch gering verankerten revolutionären Parteien; 1910 entwickelte die deutsche SPD die Kampagne zum preußischen Wahlrecht; vor dem Ersten Weltkrieg gab es auf internationaler Ebene breite Demonstrationen für Frieden; 1914 kippte die Stimmung, und die Massen zogen Gegeneinander, unter nationalen Fahnen, in den Krieg; 1917 fand die – siegreiche - Oktoberrevolution in Russland statt, geprägt von einer fast ideal zu nennenden Mischung von Massenaktionen und organisierendem Eingreifen der (bolschewistischen) Partei; 1918 kam es in Deutschland zur Novemberrevolution, eine im erheblichem Maß durch spontane Massenaktionen getragener Revolte mit nur schwachen - aber gezielt eingreifenden - Kräften einer organisierenden Partei (Spartakusbund, KPD, Obleute). Rosa Luxemburg äußerte vor diesem Hintergrund der realen Klassenkämpfe, Revolten und Revolutionen: „Die Massen(...) lernen nicht aus Broschüren und Flugblättern, sondern bloß aus der lebendigen politischen Schule, aus dem Kampf und in dem Kampf, in dem fortschreitenden Verlauf der Revolution.“
Sie ging in ihrer Analyse von vergleichbaren Überlegungen aus, wie sie von Marx in
seinen „Pariser Manuskripten“ und später im „Kapital“ formuliert worden waren: Die arbeitende Klasse ist zunächst einmal atomisiert, zersplittert, individualisiert, entfremdet - ist „Klasse an sich“ und damit nicht revolutionär. In Massenaktionen allerdings kann punktuell die „Klasse für sich“ aufscheinen - in diesen Aktionen können
Massen diese, ihnen von den herrschenden Verhältnissen aufgezwungene Verdummung und Manipulation sprengen und emanzipatives Bewusstsein entwickeln. Das Proletariat müsse sich „zur Masse wieder sammeln,(...) aus Fabriken und Werkstätten, aus Schächten und Hütten heraustreten(...), die Pulverisierung und Zerbröckelung(...) überwinden, zu der es im täglichen Joch des Kapitals verurteilt ist“.
Rosa Luxemburg plädierte dafür, die Massen durchaus kritisch zu sehen und all ihre
reaktionären, aus dem beschriebenen Alltag entspringenden Tendenzen zu bekämpfen.
Gleichzeitig gibt es bei ihr nicht die Spur jener Massenverachtung, die heute oft gerade in der radikalen Linken gepflegt wird. Dabei hätte Rosa Luxemburg ausreichend Anlass für eine vergleichbare Haltung gehabt - der massenhafte Gang des europäischen Proletariats in den jeweils nationalen Krieg gegen die eigenen Klassenbrüder und -schwestern, den dieses 1914 - 1918 praktizierte, war ernüchternd
und hätte Anlass sein können, Massenaktionen mit fortschrittlichem Inhalt ganz abzuschreiben.
Doch gerade sie war es, die nach der schrecklichen Erfahrung mit 1914 weiter auf die Massen setzte, die jede kleine Regung wie Arbeitsverweigerung in der Rüstungsproduktion, Kriegsdienstverweigerung, Friedensdemonstrationen usw. als
Hoffnungsschimmer aufnahm und im November 1918 recht behalten sollte, als massenhaft dasselbe Proletariat dem Kriegswahn ein Ende setzte. Im Dezember 1918, auf der Gründungsversammlung der Kommunistischen Partei Deutschlands (Spartakusbund), appellierte Luxemburg:
„Wir müssen die Massen erst darin schulen, dass der Arbeiter- und Soldatenrat der Hebel der Staatsmaschine nach allen Richtungen hin sein soll, dass er jede Gewalt übernehmen muss und sie alle in dasselbe Fahrwasser der sozialistischen Umwälzung
leiten muss. Davon sind auch noch diejenigen Arbeitermassen, die schon in den Arbeiter- und Soldatenräten organisiert sind, meilenweit entfernt (...) Aber das ist nicht ein Mangel, sondern das ist gerade das Normale. Die Klasse muss, indem sie Macht ausübt, lernen, Macht auszuüben. Es gibt kein anderes Mittel, es ihr beizubringen.
Wir sind nämlich zum Glück über die Zeiten hinaus, wo es hieß, das Proletariat sozialistisch schulen, das heißt: ihnen Vorträge halten und Flugblätter und Broschüren verbreiten. Nein, die sozialistische Proletarierschule braucht das alles nicht. Sie werden geschult, indem sie zur Tat greifen.“
Massenaktion war in Luxemburgs Denken strategische Voraussetzung für die revolutionäre Veränderung der Gesellschaft. Worman Geras formulierte dazu in seinem Buch über Luxemburg: „Die Schaffung eines revolutionären Bewusstseins in den breitesten Massen hat zur unabdingbaren Voraussetzung, dass diese Massen an
Kämpfen von außerordentlicher Reichweite und Kampfbereitschaft teilnehmen. Die
Massen lernen in der Aktion.“ Zu einem früheren Zeitpunkt argumentierte Luxemburg:
„In der Revolution, wo die Masse selbst auf dem politischen Schauplatz erscheint, wird das Klassenbewusstsein ein praktisches, aktives. Dem russischen Proletariat hat deshalb ein Jahr der Revolution jene >Schulung< gegeben, welche dem deutschen Proletariats 30 Jahre parlamentarischen und gewerkschaftlichen Kampfes nicht künstlich geben können.“
Auch der erstgenannte Pol in dieser Frontstellung ist schwerlich mit Rosa Luxemburg Theorie und Praxis vereinbar. Richtig ist, dass sich Luxemburg gegen einen Kadavergehorsam in der revolutionären Partei wandte. Gleichzeitig betonte sie jedoch
die Notwendigkeit der Organisierung, der Organisation bzw. Partei, ja, der Führung der Massen durch eine lebendige Partei, die zwischen Massenaktion und politisch-strategischer Orientierung gewissermaßen die „Vermittlung“ darstellen würde.
Just in diesem Sinne schrieb sie: „Die Äußerungen des Massenwillens im politischen Kampfe lassen sich nämlich nicht künstlich auf die Dauer auf einer und derselben Höhe erhalten, in eine und dieselbe Form einkapseln. Sie müssen sich steigern, sich zuspitzen, neue, wirksamere Formen annehmen. Die einmal entfachte Massenaktion
muss vorwärtskommen. Und gebricht es der leitenden Partei in den gegebenen Moment an Entschlossenheit, der Masse die nötige Parole zu geben, dann bemächtigt sich ihrer unvermeidlich eine gewisse Enttäuschung, der Elan verschwindet, und die Aktion bricht in sich zusammen.“
Nach Beginn des Ersten Weltkriegs sah Luxemburg dieses dialektische Verhältnis
noch enger gefasst. 1918 erkannte sie die wesentliche Schwierigkeit im Kampf für eine sozialistische Lösung „im Proletariat selbst, in seiner Unreife, vielmehr in der Unreife seiner Führer, der sozialistischen Parteien.“
Rosa Luxemburgs Positionen müssen im Zusammenhang mit ihrer - von Friedrich Engels übernommenen - Analyse gesehen werden, es gehe um „Sozialismus oder Barbarei“. Sie betonte unermüdlich und in Widerspruch zur sozialdemokratischen Führung, dass es kein Hinüberwachsen in einen Sozialismus geben würde, dass es
der bewussten, revolutionären Massenaktion bedürfe, um die Barbarei zu vermeiden
und den Sozialismus zu ermöglichen und dass die Hauptverantwortung der Sozialdemokratie darin liege, hier treibendes Moment zu sein, in Massenaktionen mit der revolutionären, emanzipativen Zielsetzung einzugreifen.
Und heute? Gibt es Nutzanwendungen für unser heutiges Engagement? Wie ist der
scheinbare Widerspruch zwischen „Massenspontanität“ und „Parteidisziplin“ zu debattieren bzw. aufzulösen? Dazu in der gebotenen Kürze eine Antwort auf drei Ebenen:
Die Losung „Sozialismus oder Barbarei“ ist heute mehr denn je gültig, wobei wir für jede Debatte über die Begrifflichkeit „sozialistisch“ offen sein sollten. Mehr noch als vor und im Ersten Weltkrieg weist die Logik des Kapitals, der Konkurrenz und des Marktes in die Richtung Barbarei. Angesichts der sich weiter drehenden Rüstungsspirale gilt nach wie vor: „Nach Rüstung kommt Krieg“. Der Golfkrieg 1990/91 war nur ein Vorspiel, und die Bundeswehr vor Ort auf dem Balkan ist nur die Generalprobe.
Was Rosa Luxemburg kaum wissen konnte, ist die Komplettierung der Gefahr einer Barbarei durch die selbstmörderische Entwicklung der kapitalistischen Produktivkräfte
und die Gefahren ökologischer Katastrophen. Angesichts von Massenelend im Süden, neuen Kriegen in der Dritten Welt, neuer Sklaverei, Sex-Tourismus, Müll-Tourismus, Gentechnik usw. ist es mehr als gerechtfertigt, Rosa Luxemburgs Worte, gesprochen inmitten des Ersten Weltkrieges, auch für heute als zutreffend oder prophetisch zu bezeichnen: „Geschändet, entehrt, im Blute watend, voll Schmutz triefend - so steht die bürgerliche Gesellschaft da, so ist sie. Nicht wenn sie, geleckt und sittsam, Kultur, Philosophie und Ethik, Ordnung, Frieden und Rechtsstaat mimt als reißende Bestie, als Hexensabbat der Anarchie, als Pesthauch für Kultur und Menschheit - so zeigt sie sich in ihrer wahren, nackten Gestalt.“
Natürlich sind heute Massenaktionen geringer entwickelt als Anfang des 20. Jahrhunderts.
Gleichzeitig sind wir geneigt, solche weit weniger wahrzunehmen und zu analysieren. Sowohl bei den Streiks gegen die Reduzierung der Lohnfortzahlung in Deutschland als auch bei den Kämpfen gegen Entlassungen und die Verschlechterung der Sozialsysteme in Frankreich handelte es sich um Massenaktionen, bei denen auch Teilerfolge erzielt wurden.
Interessant und wichtig ist dabei auch, dass diejenigen, die in diese Massenkämpfe eintraten, sich - wie Luxemburg für ihre Zeit analysierte - während dieser Kämpfe radikalisierten, ihr Bewusstsein erweiterten. Eine Debatte um „Parteidisziplin“ oder um „revolutionäre Organisierung“ stellt sich heute kaum. Die LINKE ist keinesfalls eine revolutionäre Partei im Sinne Luxemburgs. Sehr zum Bedauern von deren ehemaligen Fraktionsführerin im Bundestag, Sarah Wagenknecht. Bliebe ganz allgemein die Organisationsfrage.
Ehrlicherweise muss ich gestehen, dass ich diese Frage nicht sehe. Die diversen linken, radikalen organisierenden Ansätze befinden sich eher auf dem Rückzug.
Wir müssen derzeit froh sein, wenn das Potential, das auf „revolvere“, auf ein umwälzen der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse setzt und das es heute zweifellos in deutschen Landen - im autonomen Spektrum, in der PDS und um diese,
in Betrieben, Büros, Gewerkschaften gibt und das weiterhin nach Hunderttausenden
Menschen zählt - weiterhin existent bleibt und weiterhin punktuell durch die eine und
andere revolutionäre Initiative erreicht wird.
Vor diesem Hintergrund gewinnt natürlich auch das Verhältnis von parlamentarische
Aktivitäten und außerparlamentarischer Aktion eine besondere Bedeutung. Auch hier
wird vielfach Rosa Luxemburg falsch vereinnahmt - im Sinne einer ultralinken Kritik
des Parlamentarismus. Zwar warf Luxemburg dem sozialdemokratischen Theoretiker
des Reformismus, Bernstein, vor, den „Hühnerstall“ des bürgerlichen Parlaments für
das berufene Organ zu halten, wodurch die gewaltigste weltgeschichtliche Umwälzung: die Überführung der Gesellschaft aus den kapitalistischen in sozialistische Formen, vollzogen werden solle. Gleichzeitig aber plädierte sie vehement dafür, in just diesem „Hühnerstall“ als Revolutionäre präsent und aktiv zu sein - was der zusammen mit ihr ermordete Kampfgenosse Karl Liebknecht auch mit „revolutionärer Professionalität“ und just damit die Reaktion zur Weißglut reizend, betrieb.
Luxemburg untermauerte diese Dialektik des Spannungsverhältnisses „parlamentarisches Engagement“ und „außerparlamentarische Massenaktion“ folgendermaßen: „Bei dem ruhigen, >normalen< Gang der bürgerlichen Gesellschaft wird der politische Kampf nicht durch die Masse selbst in einer politischen Aktion geführt, sondern, den Formen des bürgerlichen Staates entsprechend, auf repräsentativem Weg (...) Sobald eine Periode revolutionärer Kämpfe eintritt, d. h. sobald die Masse auf dem Kampfplatz erscheint, fällt die indirekte parlamentarische Form des politischen Kampfes weg.“
Schließlich erscheint eine „Nutzanwendung“ von Rosa Luxemburgs Gedanken darin zu bestehen, sich für sozialistische Demokratie und gegen Schreibtisch-Strategie einzusetzen. Luxemburg wandte sich gegen alle „fertigen Revolutionskonzepte“, auch gegen solche ihrer Freunde Lenin und Trotzki. So schrieb sie kurz nach der Oktoberrevolution, mit der sie sich voll solidarisch erklärte.