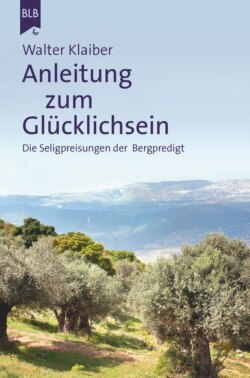Читать книгу Anleitung zum Glücklichsein - Walter Klaiber - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEinleitung
Die Frage nach dem Glück
Glücklich sein – wer würde das nicht wollen? Viel Glück! wünschen wir einander bei vielen Gelegenheiten. Aber was ist wahres Glück? Was ist nötig, um glücklich zu sein? Wenn wir eine kleine Umfrage starteten, würden die meisten wahrscheinlich sagen: Gesundheit, oder: eine intakte Familie, vielleicht auch Reichtum. Aber da würde es schon Bedenken geben. Unsere Medien sind ja voll von Berichten über sehr reiche Menschen, die alles andere als glücklich sind. Wenn wir uns selbst beobachten, so sind es eigentlich immer nur Augenblicke, in denen wir sagen: Ich bin glücklich! Es sind Augenblicke, in denen wir durch die Liebe eines anderen oder die Zuwendung von Menschen, die uns wichtig sind, beschenkt wurden. Es sind Momente, in denen wir erfahren, dass sich eine befürchtete gefährliche Diagnose als falsch erwiesen hat oder dass wir eine Prüfung mit Auszeichnung bestanden oder den gewünschten „Traumjob“ erhalten haben. Die Beispiele zeigen: Glücklich sein hat etwas mit Dankbarkeit zu tun. Sie zeigen aber auch, dass Glück oder Glücksgefühle eher etwas für den Augenblick zu sein scheinen und oft schnell einer nüchterneren Betrachtung weichen. Glück hat offenbar ein sehr kurzes Verfallsdatum. Nicht umsonst sagt der Volksmund: Glück und Glas, wie leicht bricht das!
Glück steht also unter dem Generalverdacht, etwas Flüchtiges und Unzuverlässiges zu sein, auf das man sein Leben besser nicht baut. Das mag einer der Gründe sein, warum das Wort in der Bibel nur selten vorkommt. In der Lutherbibel findet es sich bezeichnenderweise nur im Alten Testament und auch dort oft mit einem pessimistischen Beiklang wie in dem Wort Hiobs: „Wie eine Wolke zog mein Glück vorbei“ (Hiob 30,15). Früher sang man zwar in manchen christlichen Kreisen mit Begeisterung das Lied: „Welch Glück ist’s, erlöst zu sein“, aber auch das scheint etwas aus der Mode gekommen zu sein.
Und doch bleibt die Faszination des Glücks. Dabei ist jedem nachdenklichen Menschen klar, dass wahres Glück noch etwas anderes ist, als den Jackpot im Lotto zu knacken oder eine Traumreise in die Karibik zu gewinnen. Wahres Glück hat etwas mit einem erfüllten Leben zu tun und ist unabhängig vom Bankkonto. Es gibt ein Märchen, das von einem kranken König erzählt, der, um geheilt zu werden, das Hemd eines glücklichen Menschen braucht. Als seine Kundschafter endlich einen Menschen finden, der sagt, er sei glücklich, ist es ein armer Köhler, der kein Hemd besitzt. Das mag eine Übertreibung sein, denn Armut kann auch weh tun und unglücklich machen. Aber doch berührt sich diese Aussage mit einem zentralen Wort der Botschaft von Jesus, der gerade die Armen seligpreist.
Was aber haben die Seligpreisungen mit der Frage nach dem Glück zu tun? Denn nach Auskunft vieler Bibelübersetzungen sagt Jesus ja: „Selig sind die Armen“. Selig – das klingt doch viel seriöser als glücklich. Aber meint es wirklich etwas ganz anderes? Schauen wir in ein Wörterbuch, zeigt sich, dass dieses etwas altertümlich klingende Wort eine weit gefächerte Bedeutung hat: „Nach dem Tode der himmlischen Freude teilhaftig“, lesen wir dort als Erklärung. Aber auch „überglücklich, wunschlos glücklich“ kann es bedeuten. Geht es bei den Seligpreisungen vielleicht doch nicht nur um die himmlische Seligkeit, sondern auch um das wahre Glück auf Erden?
Seligpreisungen außerhalb der Bibel
Seligpreisungen findet man nicht nur in der Bibel. Sie sind in der ganzen antiken Welt eine beliebte Form zu sagen, wer es gut hat und wessen Leben gelingt. Bei den alten Griechen werden sie gerne als Gratulationsformel benutzt. Dasselbe griechische Wort, das in unseren Bibeln meist mit selig wiedergegeben wird, wird deshalb in diesem Zusammenhang mit glücklich übersetzt. Dabei kann es um sehr schlichte Weisheiten gehen. „Glücklich ist, wer Besitz oder Verstand besitzt“, ist ein solches Beispiel. Der Spruch: „Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist“, könnte also gut eine griechische Seligpreisung sein.
Aber es gibt auch Seligpreisungen, deren Aussagen sehr viel tiefer reichen. Auch religiöse Themen und die Frage nach einem Leben nach dem Tod können durch sie angesprochen werden. So heißt es von Menschen, die in die Geheimnisse der sogenannten Mysterien eingeweiht wurden und denen dabei durch das Zeigen bestimmter Symbole die Aussicht auf ein ewiges Leben anschaulich gemacht wurde: „Glücklich, wer von den Menschen das geschaut hat.“ Wahres Glück kann darin bestehen, sein Leben auch über den Tod hinaus geborgen zu wissen.
Seligpreisungen im Alten Testament
Auch im Alten Testament gibt es eine solche Gratulationsformel, durch die Menschen wegen sehr unterschiedlicher Verhaltensweisen oder Situationen glücklich gepriesen werden. Das entsprechende hebräische Wort wird seit Luther im Deutschen gern mit „Wohl dem …“ übersetzt. Damit wird anerkennend oder ermutigend ausgesprochen, worin ein erfülltes Leben besteht. Dabei kann es um ganz irdische Dinge gehen. So lesen wir in dem apokryphen Buch Jesus Sirach 25,11-12: „Wohl dem, der eine verständige Frau hat … Wohl dem, der einen treuen Freund hat. Wohl dem, der klug ist.“ Sinngemäß könnte man hier auch übersetzen: „Glücklich ist, wer …“
Aber wenn es um die Frage geht, was ein gelingendes Leben ausmacht, kann im Alten Testament die Beziehung zu Gott nicht ausgeklammert werden. Das gilt für die Einzelnen wie für das Volk. „Wohl dem Volk, dessen Gott der HERR ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat“, heißt es in Psalm 33,12. Dass Gott Israel zu seinem Volk gemacht hat, das ist die Grundlage für das Glück und das Heil dieses Volkes. Gottes Treue und das Vertrauen der Menschen entsprechen einander und sind gemeinsam der Grund für wahres Glück: „Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den HERRN, seinen Gott“ (Psalm 146,5). Sich auf Gott zu verlassen, ist das Geheimnis eines gelingenden Lebens.
Wirkliches Unglück für einen Menschen bedeutet es, wenn seine Beziehung zu Gott gestört ist. Darum werden die glücklich gepriesen, bei denen das Verhältnis zu Gott wieder in Ordnung kommt: „Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist! Wohl dem Menschen, dem der HERR die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist“ (Psalm 32,1-2). Wahres Glück ist auch, wenn Menschen wissen dürfen, dass ihre Schuld vergeben und ihre Vergangenheit bereinigt ist.
Aber nicht nur die werden glücklich gepriesen, denen Gott hilft, sondern auch die, die ihr Leben und Verhalten ganz auf Gott und sein Gebot ausrichten: „Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen noch tritt auf den Weg der Sünder noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des HERRN und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht!“, heißt es in Psalm 1,1-2. In diesem Zusammenhang bekommt die Gratulationsformel einen neuen Klang: In der Feststellung, was ein gutes Leben ist, klingt ein mahnender Unterton an: So sollte man sich verhalten, wenn das Leben gelingen soll. Darum erhält der Glückwusch auch eine Begründung, die auf die positiven Konsequenzen solchen Verhaltens hinweist: „Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl“ (Psalm 1,3).
Mit dem Hinweis auf die positiven Folgen wird dann auch zu einem Handeln ermutigt, das nicht von vorneherein als Glück bringend gesehen werden mag: „Wohl dem, der sich des Schwachen annimmt! Den wird der HERR erretten zur bösen Zeit“ (Psalm 41,2). Und in dieser Perspektive können selbst sehr schwierige Lebenssituationen positiv gewertet werden: „Wohl dem, den du, HERR, in Zucht nimmst, und lehrst ihn durch dein Gesetz“ (Psalm 94,12). Das ist eine Stelle, an der man etwas zögern würde, das Wohl dem mit einem Glücklich, wer wiederzugeben. Es gibt offensichtlich auch so etwas wie paradoxe Seligpreisungen, bei denen nicht von vorneherein einsichtig ist, dass hier vom Glück der Betreffenden gesprochen wird. Aber wenn man unter Glück nicht nur ein augenblickliches Glücksgefühl versteht, sondern das, was in der Summe ein geglücktes und beglücktes Leben ausmacht, dann kann man auch die glücklich preisen, die durch schwierige Erfahrungen dazu geführt werden, sich ganz Gott zuzuwenden.
Aber auch die Menschen in Israel haben die Erfahrung gemacht, dass die Zusage von Glück und Heil im irdischen Leben nicht immer ihre Erfüllung findet. Darum blickt man im Judentum am Ende der alttestamentlichen Zeit über diese Grenze hinaus und hofft auf Gottes Handeln am Ende der Zeit, wenn er in einer neuen Welt seinen Weg mit denen, die zu ihm gehören, ans Ziel führt. In diesem Sinne heißt es in einer apokalyptischen Schrift aus neutestamentlicher Zeit: „Selig seid ihr Gerechten und Auserwählten, denn herrlich wird euer Los sein“ (Äthiopischer Henoch 58,2).
Was also ist eine Seligpreisung? Unser Überblick hat uns eine erste Antwort auf diese Frage gegeben. Eine Seligpreisung beschreibt, was wahres, erfülltes und geglücktes Leben ist. Indem sie es beschreibt, verheißt sie denen, die so leben, dass sie das Glück eines solchen Lebens erfahren. Für die Bibel ist es immer auch ein Leben mit Gott. Es ist Leben in einer Beziehung zu Gott, die Gott selbst schafft. Dazu gehört, sich von Gott in eine solche Beziehung hineinnehmen zu lassen, sie dann aber auch konsequent zu leben. Eine Seligpreisung mahnt oder befiehlt nicht. Sie lädt ein zu erkennen, welches Glück in einem Leben mit Gott liegt, und sich deshalb mit einem solchen Leben beschenken zu lassen.
Die acht Glückseligkeiten der Bergpredigt
Auf den ersten Blick war die Frage Wie finde ich das Glück meines Lebens? nicht das Thema der Verkündigung und des Wirkens von Jesus. Ihm ging es um Gott und seine Herrschaft. Erst wo Gott zu seinem Recht kommt, können auch die Menschen zu der wahren Bestimmung ihres Lebens in der Gemeinschaft mit ihm finden. Sich nicht von oberflächlichen Verlockungen zu einem schnellen Glück verleiten zu lassen und sich stattdessen auf Gottes Ruf zur Umkehr einzulassen und auf Gottes Kraft und Hilfe zu verlassen, darin sah Jesus den Weg zu einem erfüllten Leben. Diesen Weg wollte Jesus mit seinen Worten und Taten und mit seinem Leben und Sterben für die Menschen zeigen und für sie frei machen.
In den Evangelien finden wir darum immer wieder Worte von Jesus, die die Form einer Seligpreisung haben. Jesus hat diese Redeweise offensichtlich gerne benutzt, um den Menschen zu sagen, wem Gott das Glück eines Lebens in seiner Gemeinschaft zuspricht. Im Lukas-Evangelium beginnt eine der ersten Reden von Jesus, die sogenannte Feldrede, mit vier Seligpreisungen (Lukas 6,20-23). Der Evangelist Matthäus stellt an den Beginn der Bergpredigt (Matthäus 5–7) einen Abschnitt mit acht Seligpreisungen, die sehr sorgfältig aufeinander abgestimmt sind (5,3-10). Ihnen folgt noch eine Seligpreisung, die etwas anders gestaltet ist. In ihr wird kein neuer Gedanke ausgesprochen, sondern die achte Seligpreisung auf die Jünger und Jüngerinnen angewendet.
Die Bergpredigt ist die erste der fünf großen Reden, in denen Matthäus die Verkündigung von Jesus zusammenfasst. Sie stellt darum für den Evangelisten so etwas wie eine programmatische Rede dar. Deshalb ist es sehr wichtig, dass sie mit Seligpreisungen beginnt. Am Anfang steht eine Zusage. Jesus preist Menschen glücklich. Und es sind nicht die Reichen und Schönen, nicht die Erfolgreichen und Glückspilze, die er glücklich preist. Es sind Leute mit ganz anderen Kennzeichen, von denen er sagt, dass Gott ihnen nahe ist und sie in seine Gemeinschaft aufnimmt. Lesen wir, was er sagt, in einer neueren Übersetzung:
3 Glücklich die Armen im Geist,
denn ihnen gehört das Himmelreich.
4 Glücklich die Trauernden,
denn sie werden getröstet werden.
5 Glücklich die Sanftmütigen,
denn sie werden das Land erben.
6 Glücklich die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit,
denn sie werden gesättigt werden.
7 Glücklich die Barmherzigen,
denn sie werden Barmherzigkeit erfahren.
8 Glücklich die, die reinen Herzens sind,
denn sie werden Gott schauen.
9 Glücklich die Friedensstifter,
denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden.
10 Glücklich die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden,
denn ihnen gehört das Himmelreich.
Die Übersetzung des ersten Wortes mit glücklich ist ungewöhnlich, vielleicht sogar provozierend. Nicht nur die Lutherbibel, sondern auch die Einheitsübersetzung und die Zürcher Bibel schreiben selig, was zweifellos geistlicher klingt. Die Elberfelder Übersetzung und die BasisBibel haben glückselig; das scheint ein Kompromiss zu sein, hat aber einen ziemlich emotionalen Klang. Die Neue Genfer Übersetzung schreibt glücklich zu preisen sind … , eine Formulierung, die deutlich macht, es geht weniger um die Glücksgefühle der Angesprochenen, sondern um das, was Gott durch Jesus Christus über ihr Leben sagt. Die Gute Nachricht Bibel umgeht das Problem, indem sie frei übersetzt: Freuen dürfen sich …
Doch spricht vieles dafür, das Wort glücklich zu wählen, weil es am besten dem Grundtext entspricht und weil es etwas von der heilsamen Provokation deutlich macht, die darin besteht, dass Jesus die Armen oder die Trauernden glücklich preist. Dass das sehr bewusst geschieht, zeigt eine Besonderheit der Seligpreisungen. Sie sind alle begründet; es folgt immer ein Nachsatz mit denn. Das ist nötig. Denn während es ohne weiteres einsichtig ist, dass jemand glücklich genannt werden kann, der eine verständige Frau oder einen treuen Freund hat, muss man schon begründen, warum man Menschen, die arm sind oder die verfolgt werden, glücklich preisen kann. Es ist sicher auch nicht zufällig, dass gerade die erste und die letzte der Seligpreisungen die gleiche Begründung haben: denn ihnen gehört das Himmelreich. Das berührt die Grundaussage der Seligpreisungen, die beschreiben, wer zur Gemeinschaft mit Gott bestimmt ist.
Offensichtlich ist auch, dass die acht Seligpreisungen von Matthäus zu zwei Gruppen zusammengestellt worden sind. Die erste Gruppe mit den ersten vier Seligpreisungen beschreibt Situationen und Lebenseinstellungen, in denen sich Menschen ganz auf Gott ausrichten und so seine Nähe beglückend erfahren; die zweite Gruppe, die fünfte bis achte Seligpreisung, spricht von einem Verhalten, das aktiv handelnd oder auch geduldig erleidend dieser Ausrichtung auf Gott entspricht und sich so für Gottes Handeln jetzt und in der Zukunft öffnet. Auch hier fällt auf, dass in der jeweils letzten Seligpreisung jeder Gruppe das Stichwort Gerechtigkeit eine entscheidende Rolle spielt. Im Matthäus-Evangelium beschreibt dieser Begriff gerade das, was ein gelingendes Leben vor Gott ausmacht.
Diese Beobachtungen geben einen wichtigen Hinweis für die Bedeutung der Seligpreisungen in der Bergpredigt. Jede einzelne hat ihr eigenes Gewicht und beschreibt einen wichtigen Aspekt der Verkündigung von Jesus. Aber zugleich bilden sie als Gruppe ein Ganzes, eine Zusammenfassung dessen, was für Jesus der Weg zum wahren Glück bedeutet.