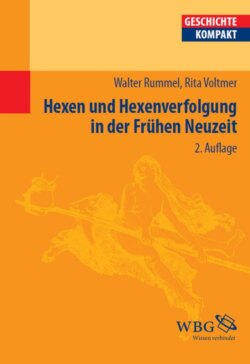Читать книгу Hexen und Hexenverfolgung in der frühen Neuzeit - Walter Rummel - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Die Grundlagen zur Erforschung der Hexenverfolgungen: Vom Umgang mit den Quellen
ОглавлениеBasis eines kritisch reflektierten Umganges mit historischen Phänomenen ist die wissenschaftlich korrekte Erschließung und Interpretation der relevanten Zeugnisse. Diese triviale Erkenntnis gewinnt im Kontext der Erforschung der Hexenverfolgungen jedoch eine besondere Bedeutung. Denn viele der Quellen, aus denen die Hexenforschung ihre Informationen schöpft, weisen – ganz abgesehen von ihrem verwirrenden Inhalt – eine Mischung aus Konstruktion, Zuschreibung und inhärenter Deutung auf, die eine distanzierte, kritische Entschlüsselung und Interpretation erschwert. So bieten gerade die Geständnisse vermeintlicher Hexen derart phantastische Details über Hexenflug und Sabbatorgien, dass manche bei der Lektüre den Entstehungskontext dieser Aussagen vergessen und, wie Jacob Grimm, Pfarrer Laven oder Margaret Murray, hinter dieser imaginären Welt eine Realität vermuten und damit der bestechenden Logik der Hexenverfolger, ihrer Argumentation und Beweisführung buchstäblich aufsitzen.
Gerichtsakten
Grundsätzlich bilden die an den lokalen Gerichten (auch an den Rügegerichten) entstandenen Akten die wichtigste Forschungsgrundlage. Wie andere Gerichtsakten auch liefern die Akten von Magie-, Zauberei- und Hexereiprozessen unmittelbare Informationen zum jeweiligen Delikt und seiner prozessrechtlichen Handhabung, zu Mechanismen von Kriminalisierung, Zuschreibung und Ausgrenzung. Daneben können aus der Analyse von Zeugenaussagen, Klageschriften und Geständnissen tiefe Einblicke in die Rechts-, Sozial-, Mentalitäts- und Alltagsgeschichte gewonnen werden. Jedoch darf man nicht davon ausgehen, in Gerichtsprotokollen die vollständige schriftliche Wiedergabe der abgelaufenen Verhandlung, der Zeugenaussagen und Verhöre vorzufinden. Vielmehr geschah die schriftliche Fixierung der gesprochenen Sprache in einem vielschichtigen Transformierungsprozess. So musste eine dialektale Sprache (der Verhörten) in einen rechtsrelevanten Text, verfasst in der jeweiligen Hochsprache oder in Latein, transponiert werden. Dabei übernahm der Gerichtsschreiber die Rolle eines interpretierenden Beobachters, welcher die Verhörsituation filterte und aus seinem spezifischen Blickwinkel heraus mit dem Medium der Schrift erfasste.
Oft sind die ursprünglichen Mitschriften verloren. Manchmal sind nur formalisierte Abschriften, Geständnisse oder Urteile erhalten. Nicht selten ist die gütliche wie peinliche Befragung der Angeklagten nur in einem lapidaren Satz zusammengefasst. Beim Transponieren einer Mitschrift in eine Abschrift unternahm der Schreiber nicht nur eine Verschönerung des Schriftbildes, sondern auch sprachliche und inhaltliche Veränderungen. Gerade zur rechtlichen Absicherung und zur Verschleierung missbräuchlicher Verfahrensführung konnten dabei ‚verräterische‘ Passagen in den Verhören der angeklagten Personen getilgt beziehungsweise verändert werden. Dies gilt im besonderen für Versendungsakten, die an eine übergeordnete, rechtsgutachtende Behörde oder beispielsweise an das Reichskammergericht verschickt wurden, und die man von allen Hinweisen auf Missbrauch, Rechtsbruch, unzulässige Manipulationen oder Folterexzesse zu reinigen versuchte.
Darüber hinaus wurden die Angeklagten oft nach einem festen Frageschema über das Hexereidelikt inquiriert, woraus sich die Gleichförmigkeit der Geständnisse ergibt. Selbst wenn der genaue Wortlaut eines solchen Interrogatoriums bekannt ist, fehlen doch Aufzeichnungen darüber, wie und in welcher Modifikation die Verhörenden dieses Schema jeweils angewandt haben. Daher kann eine Beeinflussung der Verhörten zwar vermutet, aber selten eindeutig bewiesen werden.
Hexereigeständnisse enthalten ein Gewirr von eindeutig fiktiven Elementen (Hexenflug, Buhlschaft mit dem Teufel) und möglicherweise realen Ereignissen (Versuch der Zauberei beziehungsweise Schadenzauberei), was den Historiker auf eine harte Probe stellt. Da diese Geständnisse – selbst wenn sie angeblich freiwillig, das heißt nach einer Selbstanzeige oder ohne die Anwendung der Folter erfolgten – immer unter dem spezifischen Druck einer Gerichtssituation abgelegt wurden, meistens jedoch unter Androhung und Anwendung massiver körperlicher und seelischer Gewalt, muss ihr vermeintlicher Wahrheitsgehalt niedrig angesetzt werden. Einige Historiker sind mittlerweile der Meinung, solche Geständnisse vollständig von einer historischen Interpretation auszuschließen. Ebenso wie die mittels zeitgenössischer Flugblätter und -schriften vertriebenen Holzschnitte, Kupferstücke und Zeichnungen, auf denen Hexentreiben, Flug und Sabbat, Teufelsanbetung und Schadenzauber, Folter und Hinrichtung vermeintlicher Hexen visualisiert wurden, sagen die Geständnisse weniger über tatsächliche Vorkommnisse, aber mehr über Wahrnehmungen, Imaginationen und Deutungen aus.
Narrative, fiktive und intentionale Elemente finden sich aber nicht nur in den Sabbaterzählungen, sondern bereits in den Voruntersuchungen und Zeugenaussagen, in der Konstruktion ‚verdächtiger‘ Verhaltensweisen der angeklagten Personen. Selektiv wurden jene Zuschreibungen aufgenommen, welche den bösartigen Charakter der Angeklagten beweisen sollten; entlastende Gesichtspunkte fehlen in der Regel. Aufgabe der Hexenprozessakten war nicht eine objektive Erfassung des Verfahrensganges, sondern der Nachweis, dass die angebliche Hexe oder der angebliche Hexenmeister rechtmäßig verurteilt worden war. Der ständig um Legitimation bemühte Wortformalismus mahnt zur Vorsicht. In der Regel beschreiben Hexenprozessakten das Geschehen nur aus der perspektivisch verengten Wahrnehmung der Verfolgerseite. Eine Geschichte der Hexenverfolgungen, die sich allzu vertrauensselig allein auf die Aussagen von Gerichtsakten stützt, läuft daher schnell Gefahr, zu einer bloßen „Geschichte aus der Perspektive der Sieger“ zu verkommen (Ginzburg).
Perspektivenwechsel
In den an den lokalen Gerichten entstandenen Gerichtsakten finden sich allerdings neben Anklageschriften, Verhörprotokollen und Geständnissen mitunter auch Rechtsgutachten (Advise) oder Zwischenurteile (Interlokute) übergeordneter Behörden (zum Beispiel Oberhöfe, Juristenfakultäten, Hofräte), welche aufgrund der Aktenlage über den Fortgang des Verfahrens zu entscheiden oder das Urteil der lokalen Gerichte zu bestätigen oder zu modifizieren hatten. Für die historische Analyse bedeutet die Trennung zwischen untersuchungsführender und entscheidungsfindender Behörde einen gewissen Perspektivenwechsel, selbst wenn die übergeordneten Instanzen in der Regel nur nach Aktenlage entschieden.
Wer sich daher nicht nur auf die im Umfeld der Verfahren entstandenen Zeugnisse der ‚Täterseite‘ stützen, sondern einen Perspektivenwechsel unter Einbeziehung der Opferseite vornehmen möchte, muss sein Interesse zusätzlich auf die Überlieferung der Oberhöfe, Spruchbehörden, Appellations- und Supplikationsinstanzen richten. Besondere Bedeutung erhalten hier Bittschriften und Appellationen entweder von Personen, die gegen Hexereibeschuldigungen einen Injurienprozess oder nach bereits erfolgter Anklage eine Überprüfung des Verfahrens – meist mit aufschiebender Wirkung – erreichen wollten, oder von solchen Personen, die unter der Folter ungeständig geblieben waren und nun nach ihrer Freilassung die Forderung nach Schadenersatz und Aktenkassation erhoben.
Auch bei der Analyse dieser Zeugnisse ist grundsätzlich eine quellenkritische Methode anzuwenden. Allerdings kamen in den Hexenprozessen die Verdächtigen nur unter dem Druck der Anklage zu Wort und ihre Aussagen, gefiltert durch die Niederschrift eines Notars und verzerrt durch Verhör und Folter, konnten nur noch in die Richtung gehen, den Hexereiverdacht zu bestätigen. Hingegen wurden aus den Angeklagten (oder ihren Familienmitgliedern und Rechtsvertretern) nicht selten Kläger, wenn es ihnen gelang, den Fall vor eine übergeordnete Instanz zu bringen. Damit liefern diese Zeugnisse einen entscheidenden Perspektivenwechsel im Vergleich mit den erstinstanzlich entstandenen Akten. Das kann selbst unter der Prämisse gelten, dass selbstverständlich auch die Aussagen von Prozessgegnern, Prozessopfern und deren Anwälten nicht per se die ‚Wahrheit‘ enthalten. Auch hier wurde unter der Benutzung gängiger Topoi wie dem ‚bestechlichen Richter‘, dem ‚übelbeleumdeten Zeugen‘ oder durch Unterstellung nicht weniger gängiger Motive wie Neid, Hass und Rachsucht ein bestimmter Tatbestand ‚konstruiert‘. Doch selbst topoihafte Zuschreibungen und Unterstellungen machten nur dann einen Sinn, wenn sie als plausibel gelten konnten. Außerdem wurden die in Supplikationen gemachten Vorwürfe von den Behörden der Obrigkeit überprüft; Ergebnisse reiner Phantasie durften die darin geschilderten Umstände allein schon deshalb nicht sein.
Norm und Wirklichkeit
Ginzburgs Warnung gilt auch für andere Zeugnisse. So erfordern die in obrigkeitlichen Erlassen gegen Schadenzauberei, Nekromantie und Hexerei, aber auch gegen Wahrsagerei, Heil-, Find- und Schutzzauberei gerichteten Strafsetzungen ebenfalls eine sorgfältige Quellenkritik. Nur durch Kontextualisierung und durch Heranziehen komplementärer Zeugnisse kann überhaupt überprüft werden, ob und in welchem Maße die auf der Verordnungsebene propagierten Normen in die Praxis umgesetzt worden sind. Aus der Festlegung von Strafkatalogen und Prozessformalismen im Kampf gegen Zauberei, Hexerei, Gelehrtenmagie und kleinmagisches Brauchtum musste nicht automatisch eine scharfe Verfolgung resultieren, vielmehr konnte sich hier der obrigkeitliche Versuch manifestieren, Missbräuche der lokalen Gerichte zu beseitigen, generell die Kriminaljurisdiktion in diesem Deliktfeld zu rationalisieren und dem hoheitlichen Gewaltenmonopol zu inkorporieren. So definierten einschlägige Verordnungen der habsburgischen Erzherzöge die Hexerei zwar als Angriff auf die gute Ordnung; die Verfolgung zählte somit zu den friedenssichernden Maßnahmen staatlichen Handels. Gleichwohl lancierte keiner der österreichischen Herrscher groß angelegte Hexenjagden.
Auf der anderen Seite stand die Umsetzung obrigkeitlicher Verfolgungserlasse vor beträchtlichen Schwierigkeiten. Bestes Beispiel dafür sind die auf protestantischer wie auf katholischer Seite gegen Kleinmagier (Heiler, Heilerinnen, Hexenbanner und Wahrsager) erlassenen Verordnungen, deren Anwendung oft am Widerstand der Bevölkerung scheiterte; denn dort war man nicht bereit, diese für den Alltag so wichtigen Spezialisten bei den Behörden zu denunzieren (vgl. Kap. VII.3.b).
Viele Hexereiverfahren lassen sich überdies nur mehr über dürre Rechnungseinträge nachweisen. Doch selbst noch so vollständig erscheinende Rechnungsserien sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch diese Zeugnisse Lücken aufweisen können. So wurden Hexereiverfahren gelegentlich nicht in die Rechnungslegung aufgenommen, weil die Mittellosigkeit der Hingerichteten dazu führte, dass keine Konfiskationen stattgefunden hatten. Grundsätzliches Misstrauen sollte auch gegenüber Angaben in Chroniken, Flugblättern und -schriften sowie in den einschlägigen Traktaten des Hexereidiskurses bestehen, besonders wenn dabei Zahlen zur (vermeintlichen) Höhe der stattgefundenen Hinrichtungen geliefert werden.
Überhaupt liefern Flugblätter, Flugschriften und Traktate mit ihren Exempeln keineswegs „Nachrichten“ im heutigen Sinne. Sie sind keine objektiven Berichte, keine direkten Abbilder von Realität. Vielmehr handelt es sich bei ihnen um Texte, die nur eine bestimmte Perspektive beziehungsweise eine – manchmal wesentlich später – konstruierte, interpretierende, manchmal sogar gefälschte Wirklichkeit wiedergeben. Sie stammen entweder von Personen, welche die Hexerei als real und die Hexenjagden als legitim betrachteten, oder die mit dem zugkräftigen Thema einen Gewinn versprechenden Absatzmarkt erobern wollten.
Dämonologische Traktate und Predigten aus der Feder von Theologen und Juristen, „Neue Zeitungen“, auch die Nuntiaturberichte und die jesuitische Ordenspropaganda (litterae annuae) bringen ebenfalls keinen wesentlichen Perspektivenwechsel; denn sie präsentieren zumindest während der Hauptphase der Hexenjagden eher die offiziell sanktionierte, durch obrigkeitliche Zensur kontrollierte, verfolgungsbefürwortende Hauptrichtung des Hexereidiskurses. Urteilt man allein nach diesen Zeugnissen, dann waren unterschiedslos alle Menschen von tiefer Hexenangst erfüllt, fürchteten sich vor dem nahen Ende der Welt und hielten das erbarmungslose Ausrotten der verderblichen Hexensekte für das einzig probate Mittel, die göttliche Schöpfung vor der Vernichtung zu bewahren.
So bleibt fragwürdig, ob die allseits postulierte Hexenangst tatsächlich in diesem Umfang existierte, oder ob es sich dabei nicht auch teilweise um Legitimierungsstrategien der Verfolgerseite gehandelt hat. Umso wertvoller müssen deshalb jene Zeugnisse eingestuft werden, welche geheimen Tagebüchern und Aufzeichnungen anvertraut wurden und wo mancher, wie etwa der Kölner Jurist Hermann Weinsberg († 1597) im Jahre 1589, freimütig Zweifel an Hexenglaube und Hexenjagd äußerte.