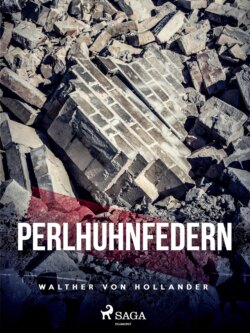Читать книгу Perlhuhnfedern - Walther von Hollander - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Perlhuhnfedern
ОглавлениеIch war ein paar Tage draußen gewesen bei Brödersdorff. Die Häuser sind da heilgeblieben. Aber die Menschen ... nein, die Menschen sind nicht heil. Irgend etwas, irgendwen hat jeder verloren. Brödersdorff zum Beispiel trauert um seine Frau, die vor dem Einmarsch der Russen sich vergiftet hat, um seine Stellung im Auswärtigen Amt, um seinen Obstgarten, der verwüstet ist und um seine Bibliothek, die irgendwer weggeschleppt hat. «Ich kann dir nichts mitgeben», sagte er beim Abschied ... «höchstens hier ...» und er reichte mir ein paar Perlhuhnfedern. «Du warst doch immer für das Bunte und Überflüssige, und vielleicht hast du jemanden, dem du das schenken kannst.»
Ich antwortete: «Nein, ich habe niemanden.»
Ich besah mir die Federn, während der Zug sich langsam wieder in das Trümmerfeld Berlins hineinschob. Sie waren flaumig – grau am Kiel, schwarzblau, mit einem bläulichen Schimmer im Fächer, mit weißen, großen Punkten die größeren, mit leichten Pünktchen und Strichen die kleineren. Lasierend, durchscheinend waren sie. Hob man sie gegen das Fenster, konnte man die trübe Trümmerlandschaft draußen wie durch einen Schleier sehen.
Am Bahnhof Friedrichstraße steckte ich sie in meine Brieftasche. Nein ... ich hatte wirklich niemanden in Berlin, dem ich so luftige, lustige Gebilde schenken konnte.
Am nächsten Nachmittag traf ich Gesine mitten auf dem Lützowplatz. Zwischen den Trümmern ging außer uns beiden kein Mensch. Sie winkte und stand dann fast erschrocken vor mir. Wir hatten uns vier Jahre nicht gesehen. Seit 43, seit damals, als wir zusammen in der Landgrafenstraße auf den Dachsparren des brennenden Nachbarhauses reitend ihr Haus retteten. «Ich habe dir Perlhuhnfedern mitgebracht», sagte ich statt einer Begrüßung. Denn jetzt, nicht wahr, ist es immer sehr aufregend, jemandem nach Jahren zu begegnen. Weiß der Teufel, was er alles erlebt hat. Schönes ist es meistens nicht.
«Danke», sagte Gesine, nahm ihr schwarzes, etwas spitzes Hütchen ab, hielt die Federn dran und nickte beifällig. «Famos, daß du wußtest, was für einen Hut ich jetzt trage.»
Wir setzten uns auf ein paar Trümmerbrocken.
Die Sonne schien gerade. Die Steine verdampften den Herbstregen. «Die haben es gut», sagte Gesine, «... können rauchen.» Ich hatte noch ein paar Zigaretten bei mir. Gesine rauchte inbrünstig, nachdem sie die Zigarette in ihre lange Bernsteinspitze gesteckt hatte.
«Die Spitze hast du gerettet», stellte ich fest.
Sie nickte, kramte in ihrer Leinentasche, die sie an einem Jagdriemen über der Schulter trug. «Ich habe doch immer Stecknadeln bei mir», murmelte sie, die Zigarettenspitze zwischen den Zähnen schwingend.
«Und sonst? Was hast du sonst gerettet?»
Sie sah mich mit ihrem hellen und schnellen Blick an. «Siehst du, da sind zwei Stecknadeln.» Sie zeigte sie mir triumphierend. «Also hast du nicht viel gerettet?» fragte ich hartnäckig. Sie steckte die Perlhuhnfedern fest, pustete in den weichen Flaum des Kiels und nickte befriedigt: «Mich habe ich gerettet mit Haut und Haar.»
«Deine Haare sind hübscher geworden. Lockerer. Hellbraun wie junge Kastanien.»
«Gute Friseuse», sagte sie und setzte sich das Hütchen mit einem Ruck auf den Kopf. «Schade, daß kein Spiegel da ist.»
Ich reichte ihr meinen handtellergroßen Taschenspiegel. Es war ein alter Reklamespiegel von Urbin. Auf der Rückseite sprach ein schwarzer Mann die lapidaren Worte: ‹Ich hab’s: Urbin!› (Jüngeren Menschen muß man wohl erklären, daß Urbin eine Schuhwichse war, die man ‹damals› in jeder Drogerie für 20 Pfennig kaufen konnte. Aber Gesine wußte sicher, was Urbin war. Sie war ja schon 28.) Sie probierte in dem winzigen Spiegel den Hut, indem sie sich hin und her den Hals verrenkte. «Nett, daß du an die Perlhuhnfedern gedacht hast. Geh’n wir?»
Sie holte mit ihrer Stecknadel den letzten Rest der Zigarette aus der Spitze und tat ihn in ihr achatenes Zigarettenbüchschen. «Sieh da», sagte ich, «das Achatene hat es auch überstanden.»
Sie antwortete nicht, aber ich sah wohl, wie ein Schatten des Unmuts oder der Trauer über ihr Gesicht zog. Vielleicht kam es nur, weil die Sonne gerade weg war. Die Steine hörten zu rauchen auf, und eine schwarze Wolkenwand schob sich über die Trümmer der Häuser. Ich wollte in die Wichmannstraße einbiegen, aber sie zog mich geradeaus durch die Nettelbeckstraße. Es ist ja einerlei. In der Gegend sehen alle Straßen gleich aus. Gleich niedergewalzt, gleich zermalmt.
«Du magst noch immer nicht durch die Landgrafenstraße gehen?» fragte ich. Sie ging noch schneller.
«Man kann hier eigentlich nirgends gehen», flüsterte sie. «Überall ... Na, du weißt ja.»
«Ja, überall ... bis der Krieg kam, haben wir doch eigentlich ganz glücklich gelebt. Was?»
«Es geht. Manchmal ja. Meist ... Ich glaube, du hast das mal gesagt. Oder war es Grünhagen? Na, einerlei ... ‹Die Lawine schiebt sich ganz langsam näher. Wir werden zermalmt und zermahlen.› So sehr fröhlich seid ihr also nicht gewesen. Und ich bestimmt nicht. Du weißt: Vater hatte es schwer. ‹Mein Herz ist ein Bleiklumpen›, sagte er immer. ‹Grau, schwer und unbeweglich!›»
Ich wollte sie ablenken und sagte harmlos: «Da drüben in der Courbièrestraße wohnte doch Carlo?»
«Ja, komm schnell. Er wohnt noch da.»
Ich blieb einen Augenblick stehen und sah über die leeren Fassaden, die geordneten Ziegelhaufen.
«Aber da steht doch kein Haus mehr?»
Der Regen setzte mit wilden Stößen ein. Er kam direkt vom Westen her. Gesine beugte ihm den Kopf entgegen. Wir gingen untergehakt hundert, zweihundert Meter und sprachen darüber, daß es in diesem Jahr so wenig geregnet habe, daß dies der erste tüchtige Regen sei, daß die Flüsse nun vielleicht doch wieder anstiegen, die Kähne wieder spreeaufwärts fahren würden, um Kohlen in die Stadt zu bringen und Licht für die langen, mageren Abende. Plötzlich blieb sie stehen und flüsterte: «Carlo liegt da noch. Unter den Trümmern.»
«Entschuldige!» sagte ich etwas töricht.
«Ich weiß es genau, aber ganz sicher weiß ich es nicht», sagte sie und ging langsam gegen den Regen gebeugt weiter. Ihr Gesicht war ganz naß. Aber nicht von Tränen. «Um sieben rief er mich noch an. Es war schon Voralarm. Ich sollte nachher ’rüberkommen. Ich sagte: Ich komme. Aber ich konnte nicht. Nebenan brannte das Haus. Du weißt ja.» Und nach einer Weile: «Unten wohnte doch Lewenow, der Bildhauer. Der ist in seinem Atelier geblieben. Zwei Gipsrösser kippten über ihn. Aber es war noch genug Platz drunter zum Atmen. Drei Stunden später war er draußen. Der einzige.»
«Und Carlo? ... Wußte denn Lewenow, daß er zu Hause war?»
Sie zuckte die Achseln. «Nein, niemand hat ihn gesehen. Niemand. Aber ich weiß es.»
«Du? Es könnte doch sein ...»
«Nein, nein. Ich weiß es. Manchmal gehe ich ja hin. Ich habe auch später da gearbeitet.»
«Wie gearbeitet? Als Trümmerfrau?»
«Ja, als Trümmerfrau. Es sieht im Hof jetzt ganz aufgeräumt aus. Du glaubst gar nicht, wie einsam es da ist hinter den Trümmerkulissen. Viele Spatzen. Ab und zu eine Katze. Manchmal kam auch ein kleiner, blanker Dackel und jagte die Katze. Es war sehr heiß in diesem Sommer. Aber ein bißchen Schatten gab’s auch. Ein Holunderbusch hat geblüht. Nachher waren Beeren dran. Kein Mensch hat sie geerntet.»
«Auch du nicht?»
«Natürlich ... ich schon. Zwei Flaschen Fliedersaft habe ich eingekocht. Ganz gut. Im vorigen Winter war ich so krank, und meine Wirtin sagte immer: ‹Wenn Sie bloß Fliedersaft hätten, Fräulein!› Habe ich nun. Du siehst: es geht steil bergan.»
Ich hätte eigentlich vom Wittenbergsplatz nach Dahlen fahren müssen. Professor Reinicke, der Sinologe, erwartete mich. Er wollte mir seine Frau vorstellen, eine Chinesin, die unter unsäglichen Schwierigkeiten in sechs Monaten von Peking nach Berlin gekommen war. ‹Ein wahres Wunder›, hatte Reinicke am Telefon gesagt. ‹Fünfundachtzig Vorschriften und zwölfhundert Grenzen. Aber sie ist doch gekommen.› Ich war sehr neugierig gewesen auf diese kleine, tapfere Chinesin, die um des bärtigen 60jährigen Professors willen viele tausend Kilometer gereist war, die alle Mächte der Welt nicht hatten hindern können, dorthin zu fahren, wohin sie wollte ...
Ich erzählte Gesine diese Geschichte, und sie meinte, eine so tapfere Frau dürfe ich nun nicht enttäuschen und müsse unbedingt hinfahren. Aber sie sah so einsam aus in diesem Augenblick, daß ich sagte: «Die Perlhuhnfedern müssen wir zwischen Löschpapier trocknen. Sonst schimmeln sie.»
Sie lächelte. «Ja, komm mit. Ein bißchen Tee hab’ ich noch. Und Nudeln. Ißt du gerne Nudeln?»
«Ja, natürlich. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der heutzutage nicht gerne Nudeln ißt.»
«Ob du gerne Nudeln ißt, will ich wissen.»
Lachend gingen wir weiter.
Gesine wohnte in der Brandenburgischen Straße. Das Vorderhaus war ausgebrannt. Man ging über einen Hinterhof, in dem ein alter Springbrunnen war, vollgefüllt mit Mörtel und zerschossenen Mauerbrocken, so als hätte das verrostete Rohr Trümmer ausgespien statt Wasser. Das Zimmer war winzig mit einem einzigen Fenster, und die Hälfte des Zimmers war noch dazu mit Holz verschalt und von innen mit Pappe verklebt. Eine recht harte, schmale Couchette, ein altmodisches Möbel aus der Zeit der Vatermörder, schien als Bett zu dienen, ein wackliger Nachttisch in der dunkelsten Ecke vertrat den Waschtisch.
An einer roten Seidenkordel hing ein kleines Büchergestell mit häßlichen Mahagonistützen, und an dem halbblinden Fenster stand der kleine, zierliche Biedermeiersekretär, das einzige hübsche Stück des Zimmers. Ein bißchen Holz war neben dem kanadischen Holzfällerofen geschichtet.
Frau Mandler, die pompöse Zimmerwirtin, kniete vor dem Öfchen, pustete aus dicken Wangen in das schlecht glimmende Holz und schwabbelte dazwischen wirres Zeug über Gesine, die in die Küche gegangen war, um die Nudeln zu kochen. Es ginge nicht, sagte sie pustend, hustend und redend zugleich, daß so ein junges Mädchen immer zu Hause säße. «Unsereiner», krächzte sie und sah mich mit dem schnellen gierigen Blick einer fetten Ratte an, «unsereiner hat ja auch was vom Leben gehabt, nicht wahr?»
Merkwürdig, daß Frau Mandler glaubte, ich hätte das gleiche vom Leben gehabt wie sie selbst. «Es muß jeder nach seiner Fasson selig werden», sagte ich abwehrend.
«Das ist keine Fasson, überhaupt keine», pustete die Mandler, «den Tag über im Bücherladen, und abends sitzt sie hier im Stuhl und sagt gar nichts, und nachts träumt sie, daß ich’s in meinem Zimmer höre.»
Das Feuer flammte auf. Frau Mandler erhob sich stöhnend. Sie beugte sich zu mir und flüsterte: «Sie ruft nach wem. Aber was hat das für’n Zweck? Tot ist tot. Damit muß sich nun mal jeder abfinden.»
Endlich ging sie. Ich nahm Gesines nasses Hütchen, um die Perlhuhnfedern zwischen Löschpapier zu legen, wie ich es ihr versprochen hatte. Ich nahm zwei Blätter vom Löscher, dabei fiel mein Blick auf Carlos Bild. Ja ... das war er. Lachend saß er auf der Bank irgendeiner Strandpromenade. Der Seewind hatte ihm die Haare in die Luft geweht. Er trug Shorts, weiße Leinenschuhe, ein weißes Hemd mit offenem Kragen. Er war das sehr anziehende Bild eines lustigen, jungen Mannes. Ich hatte ihn nicht sehr gut gekannt. Er war eigentlich Anwalt und schrieb seltsame, kleine Geschichten, witzig, pointiert und etwas grausam. Sagen wir besser, unmenschlich. Er schrieb so, wie das Leben schon damals war und wie es sich immer mehr entwickelte. Völlig gefühllos. Ich glaube nicht, daß er erwartet hatte, daß irgend jemand um ihn trauern würde.
Ich legte die Perlhuhnfedern zwischen die Löschblätter. Ich saß neben dem Ofen und tat bedächtig Sägespäne aufs Feuer. Stück für Stück, wie sich das für einen winzigen Berliner Zimmerofen gehört. Endlich kam Gesine. Sie deckte den kleinen Kacheltisch, den sie ‹meine Möbel› nannte. Es war das einzige Stück, das sie sich gekauft hatte. «Nicht übermäßig hübsch, aber sehr teuer», sagte sie.
Bevor sie sich setzte, legte sie Carlos Bild um. Ich weiß nicht, ob ich es nicht ansehen sollte oder ob Carlos uns nicht sehen sollte. Ich persönlich habe Angst vor Fotografien und mag nicht, daß sie mir immer zusehen. Ich kannte eine sehr nette Frau, die ihren Mann oft betrog. Sie hängte immer das Bild des Mannes zu, wenn sie einen Liebhaber empfing. Ich kann das sehr gut verstehen.
Gesine redete während des Essens ziemlich viel. Wie es immer ist, wenn man sich lange nicht gesehen hat, sprachen wir zuerst von dem, was gerade um uns war. Die Lebensgeschichte von Frau Mandler erzählte sie, deren Mann Gemüsegroßhändler war, in den letzten Kriegstagen als Volkssturmmann verwundet wurde und langsam einging. Von der Buchhandlung dann, in der sie arbeitete, schließlich von ihrem Vater, der nun zwei Jahre tot war. Acht Tage nach Hitler war er gestorben. Aber dessen Tod hatte er noch ‹mitnehmen› wollen. Er wollte es noch erleben, daß der zugrunde ging, wie er es immer prophezeit hatte in all den Jahren der Verfolgung und des Kummers.
«Es muß doch für ihn furchtbar gewesen sein», sagte ich, «so aus dem Beruf herausgeworfen, nichts zu tun und dann der plötzliche Tod deiner Mutter.»
Gesine lächelte. «Er hatte viel zu tun. Er haßte den Hitler. Hassen, das ist eine Beschäftigung, tagesfüllend und nachtfüllend, meinst du nicht?» Ich zuckte die Achseln. Ich wußte es nicht. Gesine sagte: «Ich glaube, er war eigentlich ganz glücklich. Wer hassen kann, hat’s gut.»
«Ja ... hassen», sagte ich. «Wenn man so denkt, was die uns alles gestohlen haben. Die nicht allein. Schon die 1914er Knaben. Damals fing’s an, daß sie den Menschen einfach alles unter dem Hintern wegzogen. Alles, was sie gebrauchen konnten für ihren verdammten Krieg. Na ... nun werden sie sich ja bald beruhigen müssen. Ist einfach nichts mehr da.»
«Und die sind auch nicht mehr da», lächelte Gesine.
«Ach ... irgend jemand ist immer da, der den Menschen alles wegnimmt», sagte ich.
«Du kriegst es ja auch nicht ’raus», sagte Gesine.
«Was?»
«Das Hassen. Ich dachte, ihr ... von der alten Generation. Ihr macht das alle gleich. Wie verrückt lieben und wie verrückt hassen. Das ist natürlich bequem.»
Ich war ein bißchen gekränkt. Wer gehört schon gern zur alten Generation? Zur älteren ..., das hilft ja nichts. Aber gleich zur alten? Ich sagte: «Die Perlhuhnfedern müssen nun eigentlich trokken sein.»
Sie stand auf und holte sie zwischen den Löschblättern heraus. Sie behielt die Federn in der Hand und pustete spielerisch hinein. «Seltsam», sagte sie, «man kann hindurchsehen und doch nicht hindurchsehen. Ich sehe dein Gesicht mit Schwarz überzogen und mit weißen Punkten drin. Aber zu erkennen bist du nicht.»
«Die Perlhühner sind flink, scheu und schlank. Das Männchen lärmte den halben Tag vor dem Stall, bis Brödersdorff das Weibchen herausgelassen hatte. Scheußliche Stimmen haben sie. Man sagt, daß sogar die Ratten sich vor ihren Stimmen fürchten.»
Gesine starrte immer noch durch die Federn.
«Wie Nacht», sagte sie versunken. «Durchsichtig. Aber man kann nichts sehen. Wie dunkle Luft, wenn die weißen Pünktchen nicht wären.» Mit einer mutlosen Bewegung warf sie die Federn auf den Tisch und trug das Geschirr hinaus. «Man müßte heute was trinken», sagte sie, «es ist so hübsch, daß ich dich getroffen habe.»
«Geh’n wir doch, ich weiß ganz in der Nähe eine Kneipe, da gibt’s einen guten Wodka.»
«Nein, ich gehe nie aus», sagte sie merkwürdig verbissen.
«Die Mandler sieht so aus, als handelte sie mit Schnaps.»
«Die handelt mit allem. Aber Geld.»
Ich gab ihr Geld, und sie kam gleich darauf mit der Flasche. Sie wiegte sich übermütig und tanzte ein paar Schritte, soweit man zwischen den Möbeln tanzen konnte. Ja, richtig ... sie war mal ein übermütiges, lustiges Ding gewesen. Und jetzt dieses arme Lächeln, das die Trauer nicht von ihrem Gesicht wegwischte! Es war ein immer dunkles Gesicht mit wenigen Fünkchen Freude drauf, ein Gesicht, wie durch Perlhuhnfedern angeschaut.
Wir tranken schnell und erzählten uns harmlos lustige Geschichten, wie ich mich als Volkssturmmann durch die russischen Truppen durchgemogelt hatte, ein paar Schlosserwerkzeuge in der Hand und immer behauptend, ich müsse im nächsten Dorf etwas reparieren. Und sie erzählte von einer lustigen Bootsfahrt havelabwärts, bis auf eine der Havelinseln und dann die Elbe hinunter bis in die Nordsee. «Es war nicht immer traurig. Auch nicht während des Krieges. So ’ne Bootsfahrt zum Beispiel», sagte sie versonnen. Sie erzählte nicht, mit wem sie gefahren war. Aber ich wußte es, weil sie das Bild umgelegt hatte. Sie sprach dann plötzlich von einigen lustigen ‹Partys›, die sie mit einem jungen amerikanischen Captain besucht hatte.
«Ich denke, du gehst nie aus», sagte ich etwas angetrunken.
«Damals ja. Er war sehr verliebt. Robby hieß er. Er wollte mich durchaus heiraten. Jetzt ist er schon lange drüben. Ich hätte alles überstanden.»
«Na und? Wäre es nicht das Vernünftigste gewesen?»
«Ja. Ich wollte auch. Wir waren schon richtig verlobt. So mit Büttenkarten. Zu komisch, wenn die Leute ernsthaft noch so leben, als wäre nichts geschehen. Als interessiere so eine Verlobung irgendeinen Deubel.»
«Wer mit wem interessiert immer», sagte ich.
«Das einzig unsterbliche Thema. Und warum wurde es nichts? Mochtest du ihn nicht?» Sie trank ihren Schnaps hastig, schüttelte sich und goß neu ein. «Ob du ihn nicht mochtest?»
Sie sah mich erstaunt an, abwehrend. Dann sagte sie leise: «Doch. Aber es ging nicht. Ich konnte ja nicht fort.»
Ich verstand sie ganz genau. Was sollte man dazu sagen? «Und dann bist du nie mehr ausgegangen?»
«Nein. Wenn’s einem dann wieder einfällt.»
«Das verstehe ich nicht.»
«Ihr seid, glaube ich, auch ganz anders. Ihr trauert so’n Stück. Erst ganz dunkel. Dann mit ’nem weißen Streifen in der Haube wie die Witwen im zweiten Jahr und dann ist es überstanden.»
«Und ihr?»
Sie winkte ab. «Ach ... wir. Mal lustig, mal traurig. Ganz genau weiß man doch nicht, was man wirklich fühlt. Oder weißt du’s?»
«Ich denke doch. Meist weiß ich’s.»
«Aber nicht immer?»
«Nein, nicht immer.»
Sie nickte befriedigt. «Wir können ... ich kann lustig sein und unten traurig sein, traurig sein und unten lustig. Wenigstens früher. Jetzt ist es immer traurig und außen? Man kann so gerade durchschauen, daß man eben noch was von der Welt sieht ... wie ...» Sie wies auf die Perlhuhnfedern. «Wirklich nett, daß du mir die mitgebracht hast. Plötzlich ist mir so viel klar.»
«Hoffentlich mit weißen Pünktchen drin», sagte ich.
Sie hob die Schultern, sie sagte leise: «Je länger er liegt, um so mehr liegt er mir auf dem Herzen. Warum kann man sich nicht lieben, solange man lebt?»
Ich antwortete nicht. Aber sie bedrängte mich, daß ich etwas sagen sollte. «Wahrscheinlich gibt es eben solche Liebe gar nicht zwischen zwei Menschen, nur in einem Menschen. Wenn der andere ihn dabei nicht stören kann.»
Sie trank langsam ihren Schnaps, als hätte sie nicht zugehört, und hielt das leere Glas zwischen den Lippen. Dann sah ich, wie langsam eine dunkle Furche über ihr Gesicht ging. Sie errötete vor Furcht und Abwehr. «Nein, nein», flüsterte sie, «das wäre schrecklich. So ist es auch nicht. Es ist ganz anders. Aber so etwas versteht ihr ja nicht.»
«Dann belehre den Unwissenden», sagte ich etwas ärgerlich.
Sie stand auf, nahm das kleine Bildchen von Carlo und legte es auf den Tisch zwischen uns. Sie sagte: «Ich habe ihn damals genauso geliebt, damals, als er lebte. Es war nicht so wie bei euch.»
«Wie war es denn bei uns?» fragte ich etwas spitz.
«Wir lebten alle gleich, wir fühlten alle gleich. Wie?»
Sie spielte schon wieder mit den Perlhuhnfedern und legte sie wie einen Kranz zu Füßen des Bildes. Sie sagte: «Er log niemals ... Darin unterschied er sich von euch allen.»
«Na hör mal, ein geschickter Schreiber, der nicht lügt!»
Sie schüttelte unwillig den Kopf. Ich fühlte, es wurde ihr schwer weiterzusprechen. «Wie soll ich das sagen, damit du es verstehst? Er sagte nicht mehr, als er fühlte, nie.»
«Und wir? Wir schwätzten, bevor wir überhaupt fühlen. Das meinst du doch?»
Sie reichte mir versöhnlich lächelnd die Hand über den Tisch. «Ich gehörte auch zu den Schwätzern», sagte sie, «du weißt ja, wenn man lange genug sagt: ich liebe dich, dann glaubt man es schließlich. Bis ich ihn traf.»
«Und dann glaubtest du nicht mehr?»
«Ich war sehr verliebt», sagte sie, «und gegen die Verlogenheit. Und darum sagte ich ihm, wie verliebt ich sei. Aber er lachte mich aus. Nein, ich sagte ihm, daß ich ihn liebte. Und darum lachte er.» Sie schauderte zusammen. Der Regen schlug mit Sturmstößen gegen das Fenster. Die hölzerne Scheibe klapperte, und einzelne Tropfen sprühten bis zum Tisch. «Man kann es nicht ausdrücken», sagte sie, «erlaß es mir.»
«Nun mußt du schon zu Ende reden», sagte ich. Sie schwieg, und wir hörten dem Regen zu, saßen beide, das Gesicht dem Fenster zugewandt, der stürmischen Dunkelheit draußen, dem unsichtbaren Herbsthimmel über den Trümmern.
«Ist es denn falsch, wenn man auf das große Gefühl wartet?»
Ich schüttelte den Kopf. Ich sagte so etwa, daß die meisten Leute ihre Gefühle in kleiner Münze ausgeben und dabei bankrott machen. Sie schien nicht zugehört zu haben. Denn plötzlich sagte sie: «Es ist falsch. Carlo hat es mir gleich gesagt. Das große Gefühl steht nicht am Anfang. Kann es gar nicht.»
Sie machte eine Pause. Ich sollte wohl widersprechen. Man kann es ja auch genau umgekehrt sagen. Es ist eben verschieden. Manchmal gibt es große, überwältigende Gefühle im Anfang, und sie verflüchtigen sich nachher wie Äther. Das hinterläßt einen kalten, weißen Fleck auf der Seele. Aber ich hatte keine Lust, eine andere Gefühlstheorie aufzustellen oder aus meinen Erfahrungen zu sprechen, die ja doch nur meine Erfahrungen sind und nicht austauschbar. Gesine trank einen Schnaps. Dann sagte sie ganz kalt: «Ich habe mich eben geirrt. Man darf nicht warten. Carlo sagte immer: ‹Soviel ich lieben kann, liebe ich dich. Genügt dir das nicht, dann laß es.› Er lachte dabei. Er war nie ernst, wenn er von Gefühlen sprach. Die anderen ... dich kenne ich ja nicht so genau, aber zum Beispiel Robby ... die anderen sind immer furchtbar ernst. Als ob Liebe was Trauriges wäre. Kann man sich denn nicht lachend lieben?» «Hat das Carlo gesagt?»
Sie nickte. Ich hob sein Bild. Ich sagte: «Er hat das auch nicht geglaubt. Bestimmt nicht. Sieh dir die Schatten des Spottes auf seinem Gesicht an.»
Sie riß mir das Bild aus der Hand und warf die Perlhuhnfedern drauf.
Ich sagte hartnäckig: «So siehst du’s erst richtig, durch die durchsichtig schwarzen Federn.»
«Ihr wollt nur nicht, daß jemand anders fühlt, daß jemand richtig fühlt», sagte sie heftig.
«Der Regen hat aufgehört», sagte ich, «ich werde nun gehen.»
Sie nickte. Aber sie hatte mich nicht gehört. Ich wagte nicht, sie aus ihren Gedanken zu wecken. Sie sagte plötzlich: «Siehst du, das hat man davon. Aber Carlo ist auch schuld daran. Nein, er ist nicht schuld, meine Eltern sind schuld, mit all ihrem Kummer. Ich wollte ihnen nicht auch noch den Kummer über mich dazu geben. Ach nein ... ich bin schuld. Ich allein. Es ist nur gerecht, daß ich leben muß und muß es tragen.»
«Wenn du willst, geht auch das vorüber. Aber du willst nicht.»
Sie lächelte schmerzlich: «Ich wollte schon. Das siehst du ja an der Geschichte mit Robby. Ich wollte schon. Ich saß zwischen den Trümmern in der Courbièrestraße, ich sagte zu Carlo: Laß mich doch laufen. Sicher gibt’s Menschen, bei denen gleich im Anfang die Liebe da ist. Aber er antwortete: Nein, das gibt es nicht.»
«Hübsche Totengespräche», sagte ich böse.
«An jenem Abend, als er mich anrief, sagte er: Es ist nicht die Zeit, daß man warten und warten kann. Und ich antwortete ihm: Wenn ich’s überstehe ... ich meinte den Angriff ... aber ich habe nie gedacht, daß mir was passieren könnte. Und mir ist ja auch nichts passiert. Weißt du noch, daß wir lachten, als wir zusammen auf dem Dach in der Landgrafenstraße saßen und das Nebenhaus löschten?»
«Du sahst auch sehr komisch aus in deinem Trainingsanzug mit dem blödsinnigen Stahlhelm auf dem Kopf.»
Wir mußten auch jetzt wieder beide lachen. Wir lachten schallend und etwas alkoholisch. Lachtränen liefen ihr über die Wangen, und plötzlich wurden es richtige Tränen. Sie verwandelten sich in einer Sekunde in Schmerztränen. Aber sie tat noch so, als lachte sie, wischte sich die Tränen ab und sagte wieder in ihrem gewöhnlichen Ton: «Damals war er schon tot.»
Sie erhob sich, legte mir beide Arme um die Schultern, sie lächelte ganz zart. Sie sagte: «Was soll man daraus lernen? Sag mir doch, was man daraus lernen soll!»
Ich antwortete nicht und versuchte, ihre Arme von meiner Schulter zu nehmen. Aber sie klammerte sich ganz fest. «Was soll man daraus lernen?»
«Laß das», sagte ich.
«Nicht wahr, es gibt nur eins, daraus zu lernen? Ein kleines Gefühl ... vielleicht kann ein großes daraus werden. Vielleicht. Oder? Man kann doch nicht warten in dieser Zeit.» Mir wurde ganz kalt. Ich sagte, ich müsse nun wirklich gehen. Wieder klatschte der Regen gegen das Holz. Sie nickte nach dem Fenster hin. Das sollte heißen, ich könne jetzt nicht gehen. Aber ich riß mich los. Ich zog fröstelnd meinen Mantel an. Sie stand blaß und sehr nachdenklich vor dem Tisch, hob die Flasche gegen das Licht.
«Leer», sagte sie. «Kein Tropfen mehr drin. Du kannst beruhigt gehen.» Sie reichte mir die Hand.
«War doch nett, dich zu sehen nach so langer Zeit.»
«Gesine ... ich ... ich möchte doch nicht gehen.»
«Leb wohl! Schau mal wieder ’rein.»
Sie begleitete mich die Treppe hinunter und schloß auf. Es regnete gerade nicht. Aber in den Traufen tröpfelte es noch. Man sah über den Trümmern ein paar Sterne. Gesine legte den Kopf ganz leicht gegen meine Schulter, rieb ihre schöne, kluge Stirn an meinem Mantel. Sie sagte leise: «Ich danke dir von Herzen.»
«Wofür?»
Sie blickte auf. Ein ganz klein wenig Helligkeit war in ihren Augen, so, als spiegelten sich die verlorenen Sterne darin. «Für die Perlhuhnfedern.» Und ehe sie die Tür zuschloß, fragte sie noch: «Meinst du ... meinst du wirklich, eines Tages ist man nicht mehr verzweifelt?»
«Das bestimmt, Gesine.»
«Unwiederbringlich», sagte sie. «Merkwürdig. Es ist doch das schwerste Wort, das bleiernste.»
«Ich weiß nicht», sagte ich, «ich finde es nicht so bleiern. Mehr schattig. Aber auch ein Trost drin. Du lebst doch.»
Sie sah mich zweifelnd an. «Ja?» fragte sie zaghaft.
«Ja, ja», sagte ich.
Sie lächelte, seufzte und schloß die Tür.
Ich schlug den Mantelkragen hoch. Die Sterne waren schon wieder weg, und hinter den Trümmern hob sich jaulend der Herbstwind. Seltsam, nicht wahr, daß mir eigentlich leicht und froh zumute war. Vielleicht war es der Schnaps.