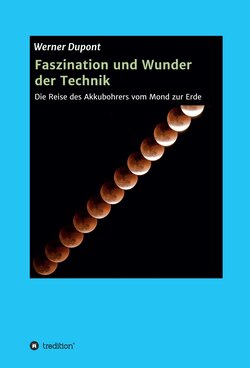Читать книгу Faszination und Wunder der Technik - Werner Dupont - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 2: Bionik
„Natürliche Repliken“
Die Schöpfung bietet die besten Vorbilder für technologische Innovationen. Bereits Leonardo da Vinci erkannte und beschrieb die wesentlichen Merkmale des Vogelfluges und begründete so die Technische Biologie, die man auch Bionik nennt. Der Begriff Bionik geht auf eine Wortprägung des amerikanischen Luftwaffenmajors Jack Ellwood Steele im Jahr 1958 zurück. Der Begriff wurde offiziell 1960 als Titel für ein diesbezügliches dreitägiges Symposium benutzt.
Ab Mitte der 1980er-Jahre begann ich, mich für bionische Themen zu interessieren. Speziell hatte ich mir zum Ziel gesetzt, eine Expertenkommission aufzubauen und zu betreuen, die mit renommierten und anerkannten Fachleuten der unterschiedlichen Sparten der Bionik interdisziplinär besetzt sein sollte.
Hier möchte ich eine in meinen Augen relevante Auswahl bionischer Themengebiete näher beleuchten. Dabei wird uns der ein und andere Experte samt zugehöriger Bionik-Disziplin begegnen. Auf dem Gebiet der Evolutionsstrategie ließ ich mich zu eigenen Anwendungen inspirieren, um diese für die Bestimmung des minimalen Radarquerschnitts von Objekten anzuwenden, also lax gesagt zur Radartarnung, was ich in diesem Kapitel näher ausführe.
Hinsichtlich des angesprochenen Falls von Leonardo da Vinci wurde von ihm festgestellt, dass sich beim Abschlag des Vogelflügels die Federn wegen ihrer besonderen gegenseitigen Lagerung zu einer geschlossenen Fläche formen, wohingegen sie sich beim Aufschlag auffächern und Luft durchströmen lassen. Da Vinci schlug zur technischen Realisierung seiner Beobachtung vor, aus Weidenruten und imprägniertem Leinen gefertigte Schaltflächen zu verwenden, die sich beim Abschlag analog schließen, beim Aufschlag jedoch mit Klappen zur Durchströmung der Luft öffnen würden. Es waren just diese Erkenntnisse, die wagemutige Männer dazu verleiteten, mit Schlagflügeln fliegen zu wollen, mit katastrophalen Ergebnissen für die „Testpiloten“.
So einfach scheint die Übertragung angepasster und ausgereifter biologischer Systeme in die Welt der Technik allerdings nicht zu sein. Professor Dr. Werner Nachtigall, einer der Pioniere der Bionik, formuliert in seiner Publikation über „Einsatz und Produktpotenziale der Technischen Biologie und Bionik“ die wesentlichen Prinzipien zum Thema „von der Natur lernen“, es handle sich keineswegs nur um eine simple Blaupause der Natur für technische Umsetzungen, sondern mehr um Inspirationen der Natur, deren technische Verwirklichungen von Fall zu Fall unter Einbringung aller hierzu relevanten Kenntnisse aus Wissenschaft und Technik investigiert werden müssten. Im Falle des zitierten Vogelflugs hat es sich vor dem inzwischen fortgeschrittenen Stand der Technik als vorteilhaft erwiesen, Erkenntnisse der Technischen Physik aus dem Teilgebiet Aerodynamik einzubeziehen. Dieses Beispiel zeigt den unabdingbaren Charakter der Interdisziplinarität der Bionik. Man nimmt also Vorlagen der Natur als Anregung für technologisch eigenständige Entwicklungen, zu deren Machbarkeit alle Wissenschaftsdisziplinen einbezogen werden. Lernen von der Natur als Anregung für eigenständiges technologisches Gestalten ist die Devise und nicht bloßes Abkupfern.
Werner Nachtigall brachte es 1993 in der folgenden allgemeinen Definition auf den Punkt: „Bionik als wissenschaftliche Disziplin befasst sich mit der technischen Umsetzung und Anwendung von Konstruktions-, Verfahrens- und Entwicklungsprinzipien biologischer Systeme.“ Demnach ist die Bionik eine klar formulierbare Disziplin und Vorgehensweise. Sie führt die durch die Vorgehensweise der Technischen Biologie entdeckten und erforschten Aspekte der Biologie einer technischen Umsetzung und Anwendung zu. Dies kann sich auf drei Komplexe beziehen, nämlich auf Konstruktionen der Natur (Konstruktionsbionik), Vorgehensweisen oder Verfahren der Natur (Verfahrensbionik) und deren Informationsübertragungs-, Entwicklungs- und Evolutionsprinzipien (Informationsbionik). Eine bionische Vorgehensweise kann also in viele technische Ansätze mit hineinspielen, die zukünftige Technologien entscheidend beeinflussen können.
Ansatzmöglichkeiten zu bionischen Vorgehensweisen, die den Einsatz und die Produktpotenziale der Technischen Biologie und Bionik kennzeichnen können, umfassen unter anderem die Materialbionik. Biologische Materialien entstehen entweder in einem einmaligen „Gussvorgang“, etwa Diatomeen- und Radiolarien-Skelette, oder in schichtweisem Aufbau, wenn Substanzen von Zellen und Zellschichten (Epithelien) abgegeben werden. Sie sind sehr unterschiedlich zusammengesetzt, von den Silikatstrukturen der genannten Kleinlebewesen über biochemische Laminatstrukturen bei horn- oder chitinigen Substanzen bis hin zu elastischen Fasern beim Knochen. Dies und die Tatsache, dass die Materialien stets aufs Feinste auf die mechanischen Anforderungen abgestimmt sind, ergeben vielfältige Vorbilder für die Technik. Dazu kommen ihre bisher nicht oder kaum erreichten Selbstheilungsmöglichkeiten und ihre totale Wiederverwendbarkeit.
Im Rahmen der Werkstoffbionik betrachtet man biologische Materialien, die zu neuen Werkstoffen führen. Hierzu gehören vor allem auch die Mehrkomponentenbauweise biologischer Materialien und Stoffe, in denen beispielsweise zug- und druckfeste Elemente in Trajektorien angeordnet sind. Sie können Vorbilder abgeben, wie überhaupt im makromolekularen und im Mikrobereich eine Vielzahl von Anregungen und Umsetzungsmöglichkeiten gegeben sind.
Unter dem Namen Lotuseffekt entstand eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte, die im Bereich der Materialwissenschaften auf der Entwicklung superhydrophober biomimetischer Oberflächen fußt. Es war der Botaniker Wilhelm Barthlott, der aus seinen Forschungen zur Rasterelektronenmikroskopie pflanzlicher Oberflächen den selbstreinigenden Effekt von Pflanzenoberflächen feststellte und den Anstoß für die technische Umsetzung gab. Es war in den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts, als Botaniker erstmals Interesse an der Lotusblume entwickelten. Am Botanischen Institut der Universität Bonn stellten Wissenschaftler fest, dass gewisse Pflanzenoberflächen wie die der Blätter der indischen Lotusblume von Wasser nicht benetzt werden und darüber hinaus vollkommen schmutzabweisend sind. Dies wird ermöglicht durch eine komplexe Grenzfläche, auf der im Abstand von tausendstel Millimetern warzenartige Erhebungen sitzen, sogenannte Papillen. Die Papillen sind mit winzigen Wachskristallen überzogen. Über diese „raue“ superhydrophobe Oberfläche rollt jeder Wassertropfen ab. Dabei nimmt er nicht nur Schmutzpartikel auf, auch schädliche Pilzsporen, Bakterien und Algen werden mitgerissen. Die Pflanze wird auf diese Weise ihre Plagegeister los und enthält Algen und Pilzsporen die von ihnen zum Überleben benötigte Feuchtigkeit vor. Galten zuvor Produkte mit möglichst glatten Oberflächen als besonders wünschenswert in Sachen Reinlichkeit, so waren es auf einmal solche mit Oberflächen nach dem Vorbild der Mikrostruktur des Lotusblattes. So eroberten in den 90er-Jahren Produkte mit Lotuseffekt den Markt, wie zum Beispiel Dachziegel und Fassadenfarben, die eine Art Pflanzenhaut haben, die sich bei Regen selbst reinigt.
Wie in diesen beiden Beispielen gezeigt, ist es also Forschern bereits gelungen, die raue Mikrostruktur auf künstlichen Oberflächen nachzubilden. Die Resultate kann man käuflich erwerben. Es gibt auch dem Vorbild der Lotusblume nachempfundenes Silikonwachs, das man auf Oberflächen aufsprühen kann, um sie gegen Umwelteinflüsse wie Verschmutzung und Regen zu schützen. Weitere Applikationen zielen auf selbstreinigende Autolacke, die allerdings naturgemäß ein mattes Aussehen zur Folge haben. Gleichermaßen denkbar sind selbstreinigende Fensterscheiben, sodass Wind und Wetter die Rolle eines Fensterputzers übernehmen.
Ein ebenfalls schmutzabweisendes Material, das jedoch nicht auf dem Lotuseffekt basiert, verdankt seine selbstreinigenden Eigenschaften der Photokatalyse, wodurch sowohl Oberflächen als auch die Luft gereinigt werden können. Im speziellen Fall handelt es sich um Titanoxid, das mit Zement vermischt auf dem Markt erhältlich ist. Die physikalische Wirkung des mit Titanoxid versetzten Zements beruht auf dem photoelektrischen Effekt. 1905 publizierte Albert Einstein seine Arbeiten zur Deutung des photoelektrischen Effektes und erhielt für seine Entdeckung des Photoeffektes 1921 den Nobelpreis für Physik. Der Vorgang der Nutzbarmachung des nur quantenmechanisch erklärbaren Effektes beruht auf der Tatsache, dass bei Einfall von Sonnenlicht auf die Titanoxidoberfläche durch die Lichtphotonen in den Atomen der obersten molekularen Schichten Elektronen herausgeschlagen werden. Die Elektronen wandern dann durch das Kristallgitter des Titanoxids zu dessen Grenzfläche. Dort kommt es zu chemischen Umsetzungen, die zur Zersetzung organischer Stoffe führen, was einem Reinigungseffekt gleichkommt. Im Rahmen der Forschungsarbeiten für einen italienischen Zementhersteller entdeckte man, dass die selbstreinigende Wirkung nicht auf Verschmutzungen an der Oberfläche der Bausubstanz beschränkt bleibt. Der photoelektrische Effekt reicht nämlich bis in die angrenzenden Luftschichten und reduziert so auch die Luftverschmutzung. Das Nanomaterial kann auch Mörtel und Farben beigemischt werden. Gebäude und Straßen, die sich sogar nachträglich beschichten lassen, können somit durch Reduzierung der Schadstoffe aktiv zur Umweltentlastung beitragen.
Titanoxid erlaubt auch im Bereich der Photovoltaik für Solarzellen nach dem Vorbild der Photosynthese neue, „natürliche“ Wege. Die Photosynthese ermöglicht als einer der wichtigsten biochemischen Vorgänge auf der Erde den Pflanzen und indirekt auch den Tieren das Leben, da diese die durch die Pflanzen produzierten Stoffe zur Nahrungsaufnahme benötigen. Bei der Photosynthese wird die Energie des Sonnenlichts, also die elektromagnetische Strahlung, mittels des Blattfarbstoffs Chlorophyll aufgenommen und in chemisch gebundene Energie umgewandelt. Die Photosynthese dient der Entwicklung neuartiger Photovoltaikzellen, wie 1994 an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne im Labor für Photonik und Schnittstellen von Professor Michael Grätzel geschehen. Grätzels Solarzelle basiert nicht auf Silizium, das sehr teuer, energieaufwendig herzustellen und schwierig zu entsorgen ist, sondern wie das Chlorophyll auf einem Farbstoff, der die Energie der Sonne einfängt. Hierzu dient der einfach und preiswert herzustellende Halbleiter Titanoxid. Eine Belebung der Photovoltaiktechnologie könnte das Resultat sein.
Verweilt man noch ein wenig in der Welt kleiner Dimensionen, so tun sich weitere technische Lösungen gemäß biologischer Vorlagen auf. Die Schuppenstruktur der Haut von Haifischen, die sogenannte Riblet-Struktur, war Ideengeber für reibungsarme Oberflächen. Haie reduzieren den Strömungswiderstand im Wasser durch ihren extrem stromlinienförmigen Körper und durch die Rillenstrukturen auf den Haihautschuppen. Diese feinen Längsriefen verlaufen alle in Strömungsrichtung. Der Zoologe Wolf-Ernst Reif erkannte, je feiner und ausgeprägter die Rillen sind, desto schneller schwimmt der Hai. Die Riefen vermindern offenbar den Strömungswiderstand des Hais, denn durch die Rillen und Rippen auf den Schuppen fließen die Wasserteilchen am umströmten Haikörper entlang. Von Vorteil ist darüber hinaus, dass die Haihautschuppen so angeordnet sind, dass sich die Rillen über die hintereinanderliegenden Schuppen fortsetzen. Entscheidende Wirkung kommt den scharfen und relativ hohen Rillenfirsten zu, die verhindern, dass bremsende Turbulenzen an der Grenzfläche zum umgebenden Wasser entstehen, und verringern so die Reibung an der Oberfläche des Hais. Damit ist letztendlich ein relativ geringer Reibungswiderstand verbunden. Die technische Umsetzung in eine „künstliche Haihaut“ beinhaltet das Aufbringen von Rillen und Rippen auf technische Materialien. Es wurden diesbezügliche Tests an vergrößerten Schuppenmodellen in einem Strömungskanal durchgeführt und festgestellt, dass bei Vorliegen ähnlicher Strömungsverhältnisse die Rillenstrukturen auf Materialien in Wasser und Luft übertragen werden können. Ein derartiges bionisches Produkt sind Riblet-Folien, wie sie beim Siegerboot des 2010 veranstalteten Segelwettbewerbs America’s Cup und bei einem Testflugzeug eines Airbus A 320 mit der erwünschten Treibstoffeinsparung eingesetzt wurden.
Das Gebiet der Materialbionik geriet aufgrund von spektakulären technischen Lösungen der Nanotechnologie, also von der Größe eines millionstel Millimeter und kleiner, in den Fokus des Interesses. Dazu gehört die Klebetechnik, die normalerweise auf die Festigkeit der Klebverbindungen ausgerichtet ist, was auch in der Regel die Rückgängigmachung der Verbindung verhindert. Die Natur lehrt uns aber, dass es sehr wohl stark haftende Verbindungen gibt, die auch reversibel sind. Natürliche Vorbilder sind zum Beispiel Käfer- und Spinnenbeine sowie die Zehen des Geckos. Bei ihnen erzeugen Lamellen im Nanometerbereich eine starke Haftwirkung durch die sogenannten Van-der-Waals-Kräfte, schwache Wechselwirkungen zwischen Atomen und Molekülen. Zur technischen Umsetzung wurde am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz ein Weg zur Herstellung von Nahtmaterial mit nanoskopischen Fibrillen herzustellen, die ein schnelles Haften und Lösen ermöglichen. Über Prototypen wurde die Funktionsfähigkeit des Prinzips nachgewiesen. Erste kommerziell ausgerichtete Resultate sind Haftfolien für Kletterroboter. Inspiriert durch das Gecko-Prinzip reicht das Einsatzpotenzial vom Automobilbau bis zur Medizintechnik. Grundsätzlich erlauben Haftroboter nach entsprechender Adaption und größenbezogener Hochskalierung auch die Inspektion von Aufzugschächten in Hochhäusern und Versorgungsleitungen großer Bauwerke.
Das, was Muscheln ihre große Stärke aufgrund kristalliner Calciumcarbonate hoher Festigkeit und Dichte verleiht, ist ebenfalls dem Erfindungsreichtum der Natur durch ihren intelligenten Einsatz der Nanotechnik geschuldet. Es werden nämlich in diesem Fall bei der Bionanotechnik organische Vorverbindungen eingesetzt. Wie am Weizmann-Institut in der Stadt Rehovot in Israel von Strukturbiologen entschlüsselt wurde, stülpen sich in die Zellmembran kleine Bläschen, sogenannte Vesikel, ein. In diese werden die carbonathaltigen und von Eiweißmolekülen umhüllten Vorverbindungen eingeschleust. Das Auskristallisieren der Nanopartikel erfolgt wie in der Chemietechnik durch Impfen mit nanokleinen Kristallkeimen. Nach diesem Prinzip entstehen Kalkstrukturen aus verschiedenen carbonathaltigen Materialien wie z. B. Calcit oder dem Calciumcarbonat Aragonit. Eine weitere Finesse der Organismen besteht in der Herstellung von unstrukturierten calciumhaltigen Verbindungen als Vorläuferverbindungen. Die Natur entwickelte zudem einen Mechanismus zur Umhüllung der Nanopartikel mit wasserabweisenden Proteinen und Zusätzen von Magnesium- und Phosphat-Ionen. Amorphe Phasen müssen außerdem vor Wasser geschützt bleiben. Das Kristallisieren in einkristalline Kalkstrukturen beginnt in den Vesikeln, wozu die Impfkeime der späteren Struktur entsprechend angeordnet werden. Der am Beispiel der Muschelschalen offenbarte Erfindungsreichtum der Natur lässt sich auch im Falle von Seeigeln beobachten. Sie stellt also sozusagen insgesamt eine Bauanleitung für nanotechnischen Erfindergeist dar.
Nano- und Mikrostrukturen ermöglichen auch eine außerordentliche Farbenpracht für industrielle Produkte nach dem Vorbild von Schmetterlingen. Die Ursachen liegen in Interferenzeffekten der strukturierten Oberflächen und Materialien. Bei den Oberflächen, die die schillernden Farben oder changierenden Farbspiele auslösen, handelt es sich um zweidimensionale kristalline Strukturen, die eine regelmäßige Gitterstruktur bilden. Abhängig vom Betrachtungswinkel entsteht dabei ein unterschiedlicher Farbeindruck. Anteile des auftreffenden Lichts werden von unterschiedlichen Strukturen der Oberfläche reflektiert. Der geringe Unterschied in der zurückgelegten Wegstrecke der reflektierten Strahlen verursacht eine Überlagerung der elektromagnetischen Wellen, die sich je nach Wegunterschied auslöschen oder verstärken können. Da das Licht aus Wellen verschiedener Frequenzen besteht, werden verschiedene Wellenlängen unterschiedlich verschoben. So kann beispielsweise das blaue Licht verstärkt werden, wohingegen das rote Licht verschluckt wird. Technisch werden derartige Strukturen unter anderem für Effektpigmente in der Kosmetik oder bei Autolacken genutzt. Je nach Betrachtungswinkel und Dicke der Pigmentschichten entstehen wechselnde Farbeffekte beim Betrachter. Der Effekt der Lichtinterferenz an strukturierten Oberflächen kann technisch nachempfunden werden durch dünne Metalloxidschichten auf Trägerpartikeln aus Siliziumdioxid, die ebenfalls zu Lichtinterferenzen führen und einen richtungsabhängigen irisierenden Farbeindruck entstehen lassen.
Der Lichtsammeleffekt bei den Augen nachtaktiver Motten ist das biologische Vorbild für die Antireflexionseigenschaften transparenter Oberflächen. Auch hier spielt die Nano- und Mikrostrukturtechnik die entscheidende Rolle. Durch die facettenartige Miko- beziehungsweise Nano-struktur des Mottenauges wird der Brechungsindex zwischen umgebender Luft und der Linsenoberfläche fließend angepasst, sodass Lichtbrechung und Lichtreflektion vermieden werden. Das einfallende Licht gelangt weitgehend vollständig in das Mottenauge und wird somit möglichst effizient genutzt. Technisch wird der Mottenaugeneffekt zum Beispiel zur Entspiegelung von Displays oder Solarzellen eingesetzt. Dabei wird das Ziel verfolgt, die entspiegelten Strukturen möglichst kostengünstig und mit hoher mechanischer Stabilität herzustellen. Entspiegelte Gläser lassen sich beispielsweise durch Sol-Gel-Beschichtungsverfahren erzeugen, bei denen sich durch ein Tauchverfahren auf dem Glassubstrat eine nanoporöse Antireflexschicht aufbringen lässt, die die Lichtreflexion auf ca. zwei Prozent reduziert. Mittlerweile sind auch Verfahren entwickelt worden, mit denen sich Antireflexstrukturen auf Kunststoffsubtraten kostengünstig herstellen lassen. Dabei werden die gewünschten Strukturen durch ein Beschichtungsverfahren in einer Gussform erzeugt und mit einer speziellen Spritzgusstechnik in einem einzigen Prozessschritt auf entspiegelte Kunststoffscheiben übertragen.
Bionische Faserverbundwerkstoffe entfalten ihre Eigenschaften aus dem Nachempfinden von Schachtelhamen und Pfahlrohren, wie man sie in botanischen Gärten findet. Deren Erforschung führte zum technischen Pflanzenhalm, einem strukturoptimierten bionischen Faserverbundmaterial mit Gradientenaufbau. Es zeichnet sich durch hohe Steifigkeit mit sehr guter Schwingungsdämpfung und einem gutmütigen Bruchverhalten aus. Diese pflanzlichen Faserverbundgewebe sind mit geringstem Material- und Energieaufwand aufgebaut, erzielen aber erstaunliche mechanische Leistungen. So ist zum Beispiel der Winterschachtelhalm aus äußerem und innerem Druckzylinder und verbindenden, abstandshaltenden Stegen aufgebaut. Dieser Sandwichaufbau mit hoher spezifischer Biegesteifigkeit und Knickstabilität verhindert Verbeulen und Knicken der dünnen Halmstruktur.
Ein weiteres interessantes Vorbild ist das Pfahlrohr, das durch den Wind angeregte Schwingungen über einen graduellen Steifigkeitsübergang zwischen Fasern und Grundgewebematrix hervorragend dämpft. Außerdem weist das Pfahlrohr ein gutmütiges, zähes Bruchverhalten auf, das im starken Gegensatz zum spröden Bruchverhalten technischer Faserverbundwerkstoffe steht. Biologen und Ingenieure kombinierten die pflanzlichen Vorbilder des ultraleichten Sandwichaufbaus des Winterschachtelhalms und der Schwingungsdämpfung des Pfahlrohrs und entwickelten daraus den technischen Pflanzenhalm. Dieser kann mittels einer speziellen Technik, der sogenannten Pultrusionstechnik hergestellt werden, wobei der Steifigkeitsgradient zwischen Fasern und Matrix mittels auf die Fasern aufgebrachter Nanopartikel erreicht wird. Die Einsatzbereiche des technischen Pflanzenhalms sind vielfältig und vor allem überall dort zu sehen, wo druck- und biegebelastete Verbundprofile eingesetzt werden. Hierzu zählen die Luft- und Raumfahrttechnik, der Fahrzeugbau, Sportgeräte und das Bauwesen. Zusätzlich können die Nebenkanäle des technischen Pflanzenhalms zum Transportieren von Flüssigkeiten oder zum Einlagern von vorgespannten stabförmigen Festigkeitsträgern genutzt werden.
Zukünftige Faserverbundtechnik könnte zudem auf der künstlichen Herstellung von Spinnenseide aus Seidenproteinen beruhen, deren Erzeugung bereits gelang. Spinnenseide ist hochfest, dehnfähig, leicht und wasserfest. Ein Faserverbundwerkstoff aus Spinnenseidenfaserbündeln oder aus natürlichen, besonders leichten Glasfasern nach dem Vorbild des Glasschwamms könnten eine Applikation sein. Dabei sind die Fasern beschichtet mit einem festen, zähen, wasserabweisenden Haftvermittler nach dem Vorbild des Klebstoffs der Seepocken, kombiniert mit einer Matrix aus Biopolymeren. Die einzelnen Bauteile sind fest und doch leicht austauschbar, zusammengefügt mit Haftstrukturen ähnlich denen der Füße von Geckos.
Erfolgsgeschichten entstehen oftmals zufällig, wie das folgende Beispiel im Zusammenwirken von Leichtbauwerkstoffen, Prothetik und Leistungssport eindrucksvoll unterstreicht. Hauptakteur ist dabei ein oberschenkelamputierter Behindertensportler. Der junge Mann spielte sehr erfolgreich Fußball und befand sich seinerzeit in Verhandlungen mit einem Profiverein. Wenige Tage nach Beginn der Vertragsverhandlungen erlitt er einen schweren Sportunfall, infolgedessen ihm das linke Bein oberhalb des Knies amputiert werden musste. Das bedeutete, dass er, um seiner Leidenschaft für „alles, was mit Sport zu tun hat“ weiterhin nachgehen zu können, eine Prothese benutzen musste. Der Behindertensportler hat sich im Behindertensport zunächst auf die Weitsprungdisziplin festgelegt und später noch die Disziplin Sprint hinzugenommen.
Während die meisten Menschen mit körperlichen Behinderungen Standardprothesen für den alltäglichen Gebrauch verwenden können, ist der Markt für Spezialanfertigungen im sportlichen Bereich sehr eingeschränkt. Dabei erscheinen für die von Athleten verwendeten Standardprothesen die möglichen Optimierungspotenziale bei Weitem nicht ausgeschöpft. So könnten für den Bereich des Leistungssports die Standardprothesen insbesondere unter dem Aspekt der Gewichtsreduzierung optimiert werden und angemessener an die in sportlichen Wettkämpfen auftretenden Belastungen ausgelegt werden. Bei der Verwendung der Standardprothesen hatte der Behindertensportler mehre Probleme mit der Standfestigkeit der gesamten Prothese. So ist vor allem der Verbindungswinkel zwischen dem künstlichen Kniegelenk und dem Fußmodul beim Weitsprung oft kaputtgegangen. Dies war zwar ein technisches Problem, doch, was noch wichtiger ist, darüber hinaus wurde eine psychologische Barriere ausgelöst. Wenn er trainierte, machte er sich stets Sorgen, dass sein künstliches Bein nicht halten könnte, und er wusste nie, wie weit er sich und die Prothese beim Sprung belasten konnte.
Beiträge im deutschen Fernsehen, speziell die Sendung Aktion Mensch lenkten die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die Situation von behinderten Athleten. Im Vordergrund dieser Berichte stand der erwähnte oberschenkelamputierte Athlet, der für die Paralympics 2004 in Athen trainierte. Die Berichte veranlassten die Europäische Weltraumorganisation ESA und mich mit meinem Team als der von der ESA beauftragte Technologievermittler zu Überlegungen, ob die Anwendung von Raumfahrttechnologien Fortschritte für behinderte Athleten und grundsätzlich für den Bereich der Prothetik ermöglichen könnten. Meine Firma, die in ihrem Kernbereich Technologietransfer langjährige Beziehungen zur Deutschen Spothochschule (DSHS) Köln pflegte, initiierte ein Projekt für und mit dem Sportler, der an der DSHS trainierte. In einem ersten Screening mit ihm und seinem Trainer kristallisierte sich heraus, dass offenbar tatsächlich das Prothesenproblem in der Standfestigkeit des besagten Winkels lag. Zur Untersuchung der vermuteten Ursachen etablierte mein Beraterteam eine Zusammenarbeit mit dem Institut für Biomechanik und Orthopädie der DSHS, an der der Sportler trainierte, und einem potenziellen Technologiegeber aus dem Raumfahrtbereich, der über umfangreiches Know-how in der Entwicklung, Konstruktion und Simulation von CFK-Bauteilen verfügte.
Der Raumfahrtursprung betraf die Entwicklung und Analyse von CFK-Strukturen, die unter anderem für das sogenannte Alpha-Magnet-Spektrometer-Experiment (AMS) auf der Internationalen Raumstation ISS verwendet wird. AMS ist ein Detektor, mit dem extraterrestrische Untersuchungen von Antimaterie, Materie und fehlender Materie durchgeführt werden. In der terrestrischen Anwendung im Sinne eines Spinoffs der Raumfahrt wurde der Verbindungswinkel zwischen dem künstlichen Knie und der Carbonfeder, die den Unterschenkel ersetzt, verbessert. Für den Weitsprung wurde hierzu ein CFK-Winkel entwickelt, der aus den für die Raumfahrt hergestellten Hochleistungsfasern bestand, mit denen die AMS-Tragestruktur gebaut wurde. Für den Sprint wurde ein Winkel entwickelt, der aus einer hochfesten Aluminiumlegierung gefertigt wurde, dem Material, das im AMS-Experiment für die Knotenelemente verwendet wurde.
Bei den verwendeten Werkstoffen nutzte man den Umstand, dass Materialien aus der Raumfahrt den besonderen Anforderungen entsprechend den immensen Vorteil aufweisen, dass sie äußerst stabil und gleichzeitig leichter sind als herkömmliche Produkte. So gelang es, das Problem mit der vorherigen Prothese, das darin bestand, dass sie oft brach, wenn sie bis an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit belastet wurde, zu meistern. Für die Disziplin Weitsprung wurde eine Schichtkörperklammer (Winkel) aus Kohlenstofffaser- und Stoffschichten hergestellt. Nach dem Feedback des Athleten wurde die erste Ausführung abgewandelt und eine weichere zweite Ausführung angefertigt. Die schichtweise Kräfteermittlung, die an mehr als 40 unidirektionalen Schichten und Stoffschichten durchgeführt wurde, war besonders wichtig, da sie gewährleistete, dass das für die Klammer ausgewählte Material stabil genug war, um der zusätzlichen Belastung beim Weitsprung standzuhalten. Die neue, steifere und widerstandsfähigere L-förmige Klammer ist sowohl leichter als auch stabiler und gibt Athleten beim Trainieren größere Sicherheit.
Detaillierte Analysen legten verschiedene Realisierungsmöglichkeiten der biomechanischen Anforderungen für verschiedene Sportarten, hier speziell Sprint und Weitsprung, für die jeweilige Anwendung optimiert, nahe. Nachdem der Behindertensportler der MST Aerospace mitteilte, dass er immer Probleme bei der Anpassung der Prothese an sein Bein hatte, wurden hierzu ebenfalls Aktivitäten entfaltet. Je nach seinem allgemeinen Gesundheitszustand konnte sich nämlich sein Stumpf ausdehnen oder verengen. Dadurch wurde die Befestigung der Prothese erschwert. Manchmal fiel sie beim Training sogar ab. Nach Gesprächen mit dem Europäischen Astronautenzentrum (EAC) in Köln-Porz wurde angeraten, den dort für das Astronautentraining vorhandenen perkutanen elektrischen Muskelstimulator (PEMS) einzusetzen, um weitere Muskelatrophie zu verhindern und die Muskelmasse aufzubauen.
Mit der Unterstützung der ESA und durch uns konnten also sowohl ein Winkel aus CFK für den Weitsprung als auch ein Aluminiumwinkel für den Sprint optimiert werden. Der Behindertensportler erreichte damit drei Goldmedaillen und zwei Weltrekorde. Bei den Paralympics 2008 bestätigte er seine Leistungen mit einer Goldmedaille im Weitsprung mit einer Weite von 6,50 Metern, die er im Jahr 2009 bei der Behindertenweltmeisterschaft im indischen Bangalore auf die Weltrekordweite von 6,72 Meter schraubte.
Verharren wir noch einen Moment bei Hochleistungsmaterialien, und zwar solchen, bei denen man sich von der Natur hat inspirieren lassen. Aus Werkstoffen werden Konstruktionen hergestellt, die Gegenstand der Betrachtungen der Konstruktionsbionik beziehungsweise der Strukturbionik sind. Diese Teilgebiete der Bionik beschreiben und vergleichen biologische Strukturelemente und bewerten die Eignung vorgegebener Materialien für spezielle Zwecke. Formbildungsprozesse im biologischen Bereich bieten weitere unkonventionelle technische Vorbilder.
Die Evolution entwickelte aus den Kleinstrukturen der Einzeller Großstrukturen vielzelliger Organismen in Tier- und Pflanzenreich. Die „arbeitsteilige“ Funktion der Organe bestimmt dabei auch die zweckmäßigen, strukturellen und räumlichen Verbundkopplungen. Es wurden etwa folgende Prinzipien angewendet: kürzestmögliche Wegstrecken für Transport und Recycling der Stoffwechselsubstrate, optimaler Ursprung und Ansatz für Longitudinalmotoren (Muskelfasern) die Bewegungsfunktion im Stützskelett, hohe Festigkeit der Stütz- und Schutzeinrichtungen (Exo- und Endoskelette) bei minimalem Materialaufwand und optimaler Strukturkopplung verschiedener Stoffe und gleichzeitiger Berücksichtigung von Bedürfnissen des Wärme- und Wasserhaushaltes bei der Anordnung und Ausformung der Gesamtstrukturen durch Zonen, aber auch durch individuell angepasste Volumenoberflächenrelationen. Auch im Bereich der biologischen Strukturen wurde also eine Optimierung stets der Gesamtfunktion und nicht die der einzelnen Elemente durch den Evolutionsprozess verfolgt.
Bei biologischen Systemen sind Struktur und Funktion, Statik und Dynamik untrennbar miteinander verknüpft, wohingegen traditionell bei technischen Bauten die Formgebung und Struktur überwiegend von statischen, architektonischen und Raumfunktionsprinzipien bestimmt werden. In natürlichen Systemen sind die im Verbund wirkenden Funktionen trotz funktionaler Strukturspezifität hochgradig integriert. Dies bedeutet im Einzelnen: Form und Struktur gewährleisten gleichzeitig Energietransport und Austausch; Form und Struktur gewährleisten Licht- und Wärmeaufnahme, Wärmenutzung und Wärmeaustausch; Form und Struktur gewährleisten eine permanente Aufnahme und Abgabe von Substanzen, Gasen und Bauelementersatz bei gleichzeitiger Formerhaltung.
Bei komplexen Gebäude- und Stadtstrukturen sind ähnliche Aufgaben zu berücksichtigen wie in biologischen Systemen. Als bionische Vorlage für allgemeine Städteplanungen bieten sich modellhaft sogenannte Thylakoidstrukturen der Chloroplaste des Pflanzenreiches an, in denen die Lichtreaktion der Photosynthese stattfindet. Diese Mikrostrukturen bestehen aus flachen Membransäcken mit Querverbindungen zwischen den oft geldrollenartig gelagerten Elementen. Sie ermöglichen optimale Lichtausnutzung, optimale Kontaktfläche zur Außenwelt und kürzeste Transportdistanzen zwischen den Elementen.
In bionischer Analogie hierzu konnten ähnliche Stadtbauten geschaffen werden, bei denen die optimal großen Oberflächen der Häuser und die Überbauungen der Straßen und Plätze für Baumbewuchs, Garten- und Parkanlagen zu nutzen sind. Die Innenräume einer solchen architektonischen Thylakoidstadt stehen mit ausreichendem Volumen für Wohn-, Fertigungsund Verkehrsanlagen zur Verfügung. In diesen Terrassenstädten wäre das Licht für Grünland und Gewächshausanlagen besser nutzbar als auf den Flächen konventionellen Landbaus. Kohlendioxidemissionen technischer Anlagen und ihre Abwärme könnten sinnvoll zu einer höheren landwirtschaftlichen Produktivität und Generationenfolge beitragen.
Aus Konstruktionselementen setzen sich Geräte zusammen. Diesbezügliche bionische Ansätze führen zur Entwicklung von Gesamtkonstruktionen nach Vorbildern aus der Natur. Besonders im Bereich der Pumpen- und Fördertechnik, der Hydraulik und Pneumatik finden sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.
Eine Entwicklung einer baden-württembergischen Firma aus dem Bereich der Steuerungs- und Automatisierungstechnik wurde der Öffentlichkeit als bionischer Muskel, realisiert durch völlig neuartige pneumatische Antriebe, präsentiert. Der bionische Muskel besteht im Wesentlichen aus einem hohlen Elastomerzylinder mit eingebetteten Aramidfasern. Wird der pneumatische Muskel „Fluidic Muscle“ mit Luft befüllt, vergrößert sich dieser im Durchmesser und wird in der Länge kontrahiert. Dadurch wird eine fließendelastische Bewegung ermöglicht.
Gemäß einer Pressemitteilung werden durch Einsatz des fluidischen Muskels Bewegungsabläufe möglich, die in Kinematik, Geschwindigkeit, Kraft, aber auch Feinheit menschlichen Bewegungen nahekommen. Bei vergleichbarer Größe erreicht der fluidische Muskel das Zehnfache der Kraft eines Zylinders, ist sehr robust und sogar unter extremen Bedingungen wie in Sand oder Staub einsetzbar. Mit seinem geringen Gewicht, der hohen Flexibilität und seinen vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ist er für die bionische Arbeit besonders geeignet.
Eine ganz andere Form der bionischen Arbeit leisten fluidische Muskeln von Festo beim sogenannten Humanoiden Muskelroboter im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes der Fachgebiete Bionik und Evolutionstechnik der TU Berlin. Beginnend mit einer Machbarkeitsstudie entstand hieraus ein Torso mit zwei anthropomorphen Roboterarmen und Fünffingerhänden. Das Schlüsselelement für die technische Umsetzung lieferten die fluidischen Muskel von Festo, deren Zugkraft mittels künstlicher Sehnen aus extrem reißfesten Dyneema-Seilen momentfrei auch über mehrere Gelenke hinweg an die gewünschten Stellglieder übertragen werden kann. So kann die Aktuatorik günstig im Körper angeordnet und die Masse der bewegten Teile klein gehalten werden. Jeweils zwei dieser kraftvollen und ultraleichten Aktuatoren können als antagonistisches Muskelpaar zusammengeschaltet werden und dienen zugleich als federnde Energiespeicher, die fließendelastische Bewegungen ermöglichen. Mit elementaren Funktionen wie Beugen, Strecken, Drehen werden im Gesamtkontext der Konstruktion mit insgesamt 48 Freiheitsgraden hochkomplexe Bewegungsabläufe realisierbar.
Der Humanoid verfügt annähernd über denselben Bewegungsradius wie ein gleich großer Mensch. Mit seinem guten Gewichts-Leistungs-Verhältnis, seiner Fähigkeit, Gegenstände zu greifen und im Bewegungsraum zu positionieren, und seinen menschähnlichen Proportionen lässt er keine Zweifel an seinem Vorbild aufkommen. Der Roboter kann sowohl vorprogrammierte Bewegungen abfahren als auch über Datenanzug und Datenhandschuh online aktuiert werden. So können alle Bewegungen des menschlichen Protagonisten mit einer leichten Zeitverzögerung von etwa 0,5 Sekunden selbst auch über große Entfernungen direkt auf den Roboter übertragen werden. Daher kann der bionische Stellvertreter an Orten eingesetzt werden, die dem Menschen nicht zugänglich oder für ihn zu gefährlich sind. Die Palette potenzieller Anwendungsgebiete erstreckt sich vom terrestrischen Umfeld über die Tiefen des Ozeans bis zu Arbeiten im Weltraum.
Bionische Raffinesse in Form strömungsoptimierter Pinguingeometrie war Pate für einen technologischen Versuchsträger namens b-Ionic Airfish, einen Flugkörper mit Ionenstrahltriebwerk. Ionenstrahlantriebe wurden ursprünglich für Weltraumanwendungen konzipiert und arbeiten mit hohen Gleichspannungsfeldern. Solche Antriebe wurden am 1. Physikalischen Institut der Justus-Liebig-Universität Gießen erforscht und in Form des von dem Institut entwickelten Radiofrequenz-Ionen-Triebwerks (RIT) hergestellt. Die von einem solchen Triebwerk erreichbaren Rückstoßkräfte sind im luftleeren Raum sehr klein und bewegen sich im Millinewtonbereich. Dort reicht dies jedoch aus, um durch stetige Beschleunigung massereicher Ionen über lange interplanetare Flugstrecken hohe Geschwindigkeiten zu erreichen. In der Atmosphäre kann das gleiche Prinzip eingesetzt werden, um Luftionen zu beschleunigen und kleine Rückstoßkräfte für hochfliegende Flugkörper leichter als Luft zu erzielen.
Hohe Gleichspannungsfelder von 20.000 bis 30.000 Volt entreißen an dünnen Kupferdrähten umgebenden Luftmolekülen Elektronen. Die dadurch entstehenden positiven Luftionen werden dann mit hoher Geschwindigkeit von 300 bis 400 Metern pro Sekunde zu den negativ geladenen Gegenelektroden in Form von streifenförmigen Aluminiumfolien beschleunigt und reißen neutrale Luftmoleküle mit. Dies erzeugt einen effektiven Ionenwind mit einer Geschwindigkeit von bis zu zehn Metern pro Sekunde.
Dieser Ionenstrahlantrieb wird in den schwenkbaren Stummelflügeln der Flugkörper eingesetzt und arbeitet nahezu lautlos und ohne bewegte Teile und macht das Flugobjekt beliebig steuerbar. Die flächige Luftbeschleunigung über der Tragfläche entspricht quasi dem mechanischen Schlagflügelantrieb von Pinguinen und treibt den b-IONIC Airfish an.
Zukünftige Einsatzmöglichkeiten für atmosphärische Ionenantriebe liegen aber nicht schwerpunktmäßig auf dem Erzielen einer Vortriebskraft, sondern vielmehr in den Gebieten der Widerstandsreduktion und Widerstandsaufhebung. Hierzu sei darauf hingewiesen, dass Pinguine um ihren Körper eine Luftblase haben, gebildet durch Mikrobläschen im Federkleid, die den gesamten Körper umhüllt. Der hervorragende Widerstandsbeiwert liegt nicht nur in der geometrischen Besonderheit der Form, sondern auch in der Grenzschichtbeeinflussung mittels der umgebenden gasförmigen und flüssigen Phasen begründet.
Strömungsphänomene der beschriebenen Art spielen auch in der Ventiltechnik eine große Rolle. Nach der Realisierung des Airfish mittels pneumatischer Strukturen und Schlaufenpropellerantrieben wurde beim nachfolgenden Versuchsträger die konsequente Fortsetzung der gezielten Beeinflussung des Strömungswiderstandes durch einen Ionenstrahl an der Oberfläche thematisiert. Davon ableitbar ist eine gezielte Reibungsreduktion mittels Ionenwind. Dadurch würde ein b-IONIC Airfish der Zukunft in der Luft „schwimmen“ wie ein Pinguin im Wasser.
Bei der bionischen Prothetik wird wie bereits oben bezüglich Werkstoffthemen angesprochen die Entwicklung von Prothesen für den behinderten Menschen zukünftig einen wesentlichen Teil der Medizintechnik ausmachen. Die Prothesen werden sich nicht nur auf mechanischen Gliedsatz beschränken, sondern beispielsweise als Seh- und Hörprothesen direkt in die Sensorik eingreifen. Entscheidend wichtig wird sein, inwieweit es gelingt, die Informationsleiter der Biologie und der Technik – Neurone und Kabel – zu verbinden. Hierfür gibt es hoffnungsvolle Ansätze. Aber auch das Abgreifen von Potenzialen an Muskeln von Extremitätsstümpfen und die Ansteuerung von muskelähnlichen Stellgliedern in der Prothese kann sicherlich deutlich weiterentwickelt werden. Die direkte Interaktion von Mensch und Maschine gehört im weitesten Sinn hierzu.
Die bionische Robotik geht davon aus, dass Roboter heute meistens mit Stellgliedern arbeiten, die genau, aber ruckartig positionieren. Die Natur arbeitet ganz anders: Nichtlineare Stellglieder (Muskeln) positionieren die Extremitätsspitze nicht von Anfang an präzise, werden aber bis zum Erreichen des Kotaktpunkts in eigentümlicher Weise – an ihre Nichtlinearitäten angepasst – nachgesteuert. Die Nachahmung dieser natürlichen Technologie in einer bionischen Robotik steckt ebenfalls noch in den Kinderschuhen und könnte wie auch die bionische Prothetik sehr wesentlich werden.
Hinsichtlich der Klima- und Energiebionik stellen passive Lüftung, Kühlung und Heizung wesentliche Gesichtspunkte dar. Das Studium natürlicher Konstruktionen und die Analyse sogenannter primitiver Bauten beispielsweise in Zentralamerika und Nordafrika kann zu unkonventionellen Anordnungen und Einrichtungen führen. Dazu gehören die Idealausrichtung zu Sonne und Wind, Dachformen, Nischen in der Erde, eine ideale Unterkellerung und Luftführung vom kühlen Erdreich in die sommerwarmen Räume, eine Luftumwälzung mit Gasaustausch unter Verwendung poröser Materialien und die Energiespeicherung in wärmeaufnehmenden Systemen. Mit der Übernahme solcher natürlichen Prinzipien, wie sie beispielsweise die Termiten verwirklichen, können bis zu 80 Prozent der elektrischen Energie zur sommerlichen Kühlung und 40 bis 60 Prozent der Energie zur Winterheizung gespart werden. Symbiotische Integration von Pflanzen in die Wohnlandschaft kann zur Verbesserung des Sauerstoffpartialdrucks und zur Nahrungsversorgung dienen.
Die Energiebionik befasst sich mit Energiewandlungen in lebenden Organismen, Strukturen und Systemen der Natur, um dadurch ähnliche technische Systeme, Verfahren und Geräte für die Energiewandlung und Energieproduktion zu entwickeln und herzustellen. Ebenso stehen Systeme im Fokus des Interesses, die zur Reduktion des Energieaufwands und Energieeinsatzes oder zur Optimierung des Energieverbrauchs von der Natur evolutiv entwickelt wurden, wie auf dem Innovationskongress im österreichischen Villach im Jahr 2012 thematisiert. In engem Zusammenhang mit energetischen Fragestellungen stehen Aspekte der Klimatisierung. Passive Lüftung, Kühlung und Heizung sind wesentliche Gesichtspunkte.
Hinsichtlich passiver Ventilation von Bauten und Häusern sei folgendes Fallbeispiel angeführt: Der Präriehund Cynomys erzeugt unter Nutzung des Bernoulli-Prinzips durch unterschiedliche Gestaltung der Ein- und Ausgänge seines Baus trotz unterschiedlicher Richtungen des darüberströmenden Windes eine eindeutig gerichtete Luftströmung durch den Bau. Damit ventiliert er ohne eigenen Energieaufwand sein Heim. Analog nutzt die alte iranische Architektur in ariden Regionen mithilfe von Kuppelbauten und Windtürmen die Windströmung nach ähnlichen Prinzipien. Da die Luft vom Windturm zum Wohngebäude durch unterirdische Gänge geleitet wird, wird die Erdkühle und Erdfeuchtigkeit zur Temperierung und Klimatisierung benutzt.
Die Präriehunde wissen zwar nichts vom Bernoulli-Effekt, aber sie nutzen ihn souverän aus, was durch ein genetisches Programm bedingt ist. Beim Bau einer neuen Höhle wird die ausgebuddelte Erdmasse nur an einer der beiden Öffnungen verteilt. Dort entsteht dann ein immer höher werdender „Vesuv-Kegel“ mit Plateau. Wenn der Wind darüberstreicht, entsteht eine Saugkraft und die Luft wird an dieser Stelle aus dem Bau herausgezogen. An der gegenüberliegenden Öffnung, die flach ist und keine Erhebung hat, wird die Luft im Stil einer vollautomatischen Zwangsventilierung eingesaugt. Es spielt dabei auch keine Rolle, von wo der Wind bläst, da der „Vesuv-Kegel“ gleichmäßig rund ist. Die Wohnräume unter der Erde sind mit Heu ausgepolstert. Dieses nimmt die Bodenfeuchtigkeit auf und wird vom durchströmenden Wind ventiliert. Auch dadurch wird die Strömung ein wenig abgekühlt, also wieder eine vollautomatische wind- und damit letztendlich sonnengetriebene Klimatisierung.
Die Energiebionik fördert eine Vielfalt in der Natur praktizierter Prinzipen als Blaupause für technische Problemstellungen zutage. Man denke zum Beispiel an den Start eines Albatros, den er nur mit großen Anstrengungen bewerkstelligen kann, wie es humorvoll in Walt Disneys Bernhard und Bianca gezeigt wird, wo die beiden Mäusepolizisten per „Albatros Airlines“ zum Ort des Verbrechens reisen. Ist er aber erst einmal in der Luft, dann ist seine Flugleistung unglaublich. Er kann Tausende Kilometer fliegen, ohne Zwischenlandung und ohne auch nur einmal mit den Flügeln zu schlagen.
Albatrosse beherrschen die Technik des dynamischen Segelflugs, wobei sie den Windgradienten nutzen. Mit zunehmender Höhe steigt die Windgeschwindigkeit an – am Boden ist sie wegen der Reibung praktisch null, erst in einigen Hundert Metern Höhe entspricht sie der Geschwindigkeit, die sich aus der Differenz zwischen Hoch- und Tiefdruckzonen ergibt. Durch geschickte Flug- und Wendemanöver verwandeln Albatrosse Geschwindigkeitsunterschiede in Auftriebskräfte, um sich nach einer Wende zum richtigen Zeitpunkt wieder beschleunigen zu lassen und so weiter.
Niedrigenergieprozesse sind ein Credo der Natur, das heißt, sie kommt in der Regel mit wenig Energie aus. Deshalb geht es bei der Energiebionik primär um die Erlangung des Verständnisses, wie die Natur bestimmte Aufgaben erledigt und wie daraus Anregungen gewonnen werden können. Wie und ob das technisch umgesetzt werden kann, ist üblicherweise die Herausforderung für interdisziplinär zusammengesetzte Teams, die Mitglieder mit naturwissenschaftlichen und ingenieurtechnischen Ausbildungen umfassen.
Als Beispiel dafür sei hier der Mottenaugen-Effekt angeführt. Bereits in den 1960er-Jahren wurde entdeckt, dass die Augen von Motten praktisch kein Licht reflektieren, denn jede Reflexion bedeutet einen Lichtverlust. Die Motten können ihre Lichtausbeute dadurch steigern und sehen in Dunkelheit besser. Der Effekt beruht auf kleinsten Noppen auf der Oberfläche, durch die eine scharfe Grenze des Lichtbrechungsindex zwischen Augen und Luft vermieden wird. Technisch wurde dieses Prinzip bereits realisiert – etwa, indem Strukturen kleiner als die Wellenlänge des Lichtes in eine Glasplatte geätzt werden. Dadurch ließe sich im Idealfall die Ausbeute einer Photovoltaikanlage um sieben Prozent steigern.
„Leise wie ein Eulenflügel“ lautete das Motto der Produktpräsentation für eine neue Ventilatorgeneration einer im Bereich der Lüftungstechnik tätigen Firma mit Hauptsitz in Baden-Württemberg. Das Unternehmen entwickelte einen neuen Ventilatorflügel nach dem Vorbild von Eulenflügeln mit dem Ergebnis, dass der Ventilator flüsterleise ist. Zudem wird dieser „bionische Ventilator“ aus einem biobasierten Polyamid hergestellt. Die Firma hat die Vorteile der bionischen Vorgehensweise erkannt und entsprechend in der Formgestaltung ihrer neuen Ventilatorgeneration eingesetzt. Besonders der extrem leise Flug der Eule hat die Entwickler des Unternehmens inspiriert. Ventilatorflügel mit einer gezackten hinteren Kante wie beim Eulenflügel sind nun in vielen Bereichen ein markantes Kennzeichen von Produkten des Industrieunternehmens. Diese Geometrie nach Vorbild des Eulenflügels reduziert das Geräusch des Ventilators maßgeblich. Neu ist auch der Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen für die Kunststoffherstellung. Als Material für den neuen Axialventilator wählte man ein biobasiertes Polyamid. Die extrem leisen und energieeffizienten Ventilatoren finden Einsatz in der Kältetechnik, bei Klimaanlagen, in Heizungen, in Wärmepumpen und zur Elektronikkühlung.
Nachfolgend werden im Stil einer Schaufensterfront weitere Muster der Bionik gezeigt. Amerikanische Forscher experimentierten mit einem neu entwickelten Pflaster, das nicht mit Klebstoff beschichtet, sondern mit Hunderten von Mikronadeln aus Kunststoff besetzt ist. Diese dringen in das Gewebe ein, schwellen dort an und halten das Pflaster fest. Das Pflaster schont die Haut und lässt sich leicht wieder entfernen. Das Vorbild ist der Kratzwurm, ein Fischparasit, der möglichst lange in seinem „Lebensraum“ bleiben und seinen Wirt nicht verlassen will. Deshalb dringt der Wurm mit seinem dünnen Rüssel in die Darmwand des Fisches ein, wo der Rüssel durch die Einlagerung von Wasser sein Volumen vergrößert und sich dadurch fest im Gewebe verankert. Während der Kratzwurm jedoch nur einen einzigen Anker besitzt, ist das neuartige Pflaster dicht mit Nadeln besetzt. Sie haben einen Kern aus Polystyren, der seine Form nicht verändert, und eine Spitze aus einem Gemisch von Polystyren und Polyacrylat, das Wasser aufnehmen kann und dabei anschwillt. Sobald die Nadeln ins Gewebe eingedrungen sind, nehmen sie Wasser auf und verankern sich darin.
Krankenhausärzte in Boston, die das Pflaster entwickelten, sahen Anwendungsmöglichkeiten vor allem dort, wo eine sichere Fixierung wichtig ist. Dies ist bei transplantierter Haut – z. B. bei Patienten mit schweren Verbrennungen – der Fall, die derzeit in der Regel durch Klammern fixiert wird. Das Pflaster scheint hier die ideale Alternative zu sein, denn es sitzt fester, beeinträchtigt das Gewebe mitsamt den Nerven und Gefäßen weniger und verringert auch noch das Infektionsrisiko. Zudem lässt sich das Pflaster schonend entfernen, wenn seine Funktion erfüllt ist.
Nach Meinung seiner Erfinder hat das Pflaster weiteres Potenzial. So könnten die Nadelspitzen mit Arzneistoffen wie Antibiotika oder wundheilungsfördernden Substanzen beladen werden, die dann nicht mehr die Barriere der Hornzellschicht zu durchdringen brauchen, sondern direkt in das lebende Gewebe der Haut gelangen und dort ihre Wirkung entfalten können.
Schlangenhaut gegen den Verschleiß lautete die Devise der Kieler Bionik-Forscher. Quietschende Bremsen, ratternde Scheibenwischer und abgefahrene Reifen sind einige Beispiele für den Verschleiß technischer Bauteile, die uns nicht nur im persönlichen Alltag zu schaffen machen. Die Kieler Forscher wollten deshalb eine neue reibungs- und wartungsarme Polymeroberfläche erschaffen. Sie schauten sich von der Haut der kalifornischen Kettennatter die Mikrostrukturen einer reibungs- und wartungsarmen Polymeroberfläche ab, die Wissenschaftler der Christian-Albrechts-Universität Kiel entwickelt haben.
Wenn man die neue Technik auf Werkstoffe überträgt, kann der Wartungsaufwand für die Materialien sinken. Die Reibungskräfte an der neuartigen Oberfläche werden durch die Mikrostruktur um bis zu dreißig Prozent gegenüber anderen, unstrukturierten Oberflächen reduziert. Dies hat mit den Bauchschuppen der Natter zu tun. Die Forscher untersuchten genauer, welche Kräfte insbesondere beim Stick-Slip-Verhalten, also dem Rückgleiten der Schlangen, wirken und wie diese durch die Mikrostruktur beeinflusst werden. Dieses Phänomen tritt immer dann auf, wenn zwei Körper übereinander hinweggleiten. Dabei entstehen Vibrationen, die im großen Maßstab beispielsweise zu Erdbeben führen und im kleinen Maßstab bei Bremsen als Quietschen zu hören sind. Im Test stellten die Wissenschaftler bei der Verwendung der von der Schlange inspirierten Mikrostruktur ein deutlich vermindertes Rückgleiten fest. Eingesetzt auf den Wischblättern eines Scheibenwischers kann die Technik das nervige Rattern beenden.
Ungeahnte Kräfte entwickelt eine künstliche Haut, die ein Wissenschaftlerteam des Max-Planck-Instituts (MPI) für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam präsentierte. Die Forscher haben eine Membran hergestellt, die sich sehr schnell aufrollt, wenn sie in Kontakt mit den Dämpfen organischer Lösungsmittel wie etwa Aceton kommt. Mit dem Folienaktuator werden biologische Strukturen nachgeahmt, die sich wie die Venusfliegenfalle oder die Deckel der Samenkapseln von Mittagsblumen bei einem Reiz von außen bewegen. Dabei kommt ihr Aktuator den biologischen Vorbildern besonders nah, weil die Forscher darin erstmals zwei Designprinzipien anwendeten, die Materialwissenschaftler bisher nicht für solche Systeme genutzt haben. Zum einen konzipierten sie die Membran so, dass deren Oberseite hart ist, das Material darunter aber allmählich weicher wird. Zum anderen wird die Folie von Poren durchzogen, die dem Lösungsmittel einen raschen Zugang in die Membran gewähren. Daher reagiert diese auf den äußeren Reiz schneller als andere Aktuatoren. Solche Materialien können als künstliche Haut und Muskeln etwa für Roboter dienen, eignen sich aber auch als Sensoren.
Pflanzen kennen keine Muskeln, viele sind aber trotzdem ziemlich rührig. So öffnen sich die Samenkapseln der Mittagsblume, wenn sie nass werden, also wenn die Bedingungen günstig sind, damit die Samen gedeihen können. Sobald die Kapseln trocken liegen, schließen sich die Deckel wieder. Die Aussicht auf eine erfolgreiche Fortpflanzung verdankt die Mittagsblume der ausgeklügelten Struktur der Kapseldeckel. Da deren Unterseite anders als die Oberseite Wasser aufnehmen kann und dabei aufquillt, klappen die feuchten Deckel auf, während sie sich im trockenen Zustand wieder zusammenfalten. Ganz ähnlich funktioniert der biomimetische Aktuator der MPI-Forscher. Dessen Membran reagiert auf einen äußeren Reiz gut zehnmal schneller als frühere Polymeraktuatoren. Sie führt zudem eine größere Bewegung aus. Dabei übt die Membran eine Kraft aus, mit der sie etwa das Zwanzigfache ihres eigenen Gewichtes anheben kann. Und sie funktioniert sogar dann noch fast tadellos, wenn sie extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist.
Materialwissenschaftler haben bereits verschiedene Ansätze verfolgt, um biomimetische Aktuatoren zu entwickeln, die sich wie biologische Vorbilder verhalten. Zunächst kamen sie jedoch nicht an das natürliche Vorbild heran. Wie bei den mechanischen Teilen von Pflanzen macht auch hier die Struktur des Materials den Unterschied. Die Membranen wiesen einen Gradienten, also ein Gefälle im Grad der Vernetzung auf, und waren außerdem porös. Dank dieser beiden Strukturmerkmale regierte der Aktuator schnell und mit einer großen Bewegung. Bis dato bestanden Aktuatoren in der Regel aus zwei Schichten, die unterschiedlich viel Flüssigkeit aufnahmen. Solch eine Materialkombination kann aber nur relativ kleine Bewegungen ausführen und ist dabei sogar noch langsam. Viele dieser Systeme lassen sich auch nur aufwendig herstellen, einige gehen kaputt, wenn sie zu heiß oder trocken werden.
Ihren besonders leistungsfähigen Membranaktuator erhielten die Forscher, indem sie zunächst in einer entsprechenden Lösung eine Membran aus einem ionischen Polymer erzeugten. In diese Folie eingelagert sind voluminöse Säulenmoleküle, die mögliche Anknüpfungspunkte zu ionischen Polymeren tragen. Die molekularen Säulen und Ketten vernetzten die Forscher nun mit einer Ammoniaklösung, die die Anknüpfungspunkte der Säulen aktivierte. Der Clou ist dabei, dass die Forscher der Ammoniaklösung nur von einer Seite Zugang zu der Membran gewährten, weil diese auf einer Glasunterlage lag. Die Lösung sickerte also nur langsam von oben in die Folie ein. Daher verknüpfte sie die Komponenten an der Oberseite stark, aber immer weniger, je tiefer es in die Membran hineinging. Die wässrige Lösung hat jedoch noch einen weiteren Effekt, da sie auch Poren in der Folie hinterlässt.
Durch die Poren breitet sich der Dampf des Lösungsmittels wie etwa des Acetons schlagartig in der Membran aus. An der Oberseite, die stark vernetzt und hart ist, richtet der organische Treibstoff des Aktuators allerdings nicht viel aus. In Richtung der Unterseite dagegen immer mehr, denn dort löst es das ionische Polymer und lässt das Material aufquellen, wodurch sich die Membran biegt.
Solche Aktuatoren können überall dort nützlich sein, wo ein Material mit einer Bewegung auf einen äußeren Reiz reagieren soll. So kann eine Membran der besagten Art Robotern gleichzeitig als künstliche Haut und Muskel dienen. Ihr besonderer Charme liegt darin, dass für die Bewegung keine Extraenergie aufgewendet werden muss. Die liefert vielmehr der Reiz selbst.
Ein weiteres ziemlich unerwartetes Einsatzgebiet der Membran kam den Forschern in den Sinn, während sie verschiedene Lösungsmittel zum Antrieb des Aktuators testeten. Es zeigte sich nämlich, dass die Membran sehr charakteristisch auf die jeweiligen Lösungsmittel reagierte, und zwar sowohl bezüglich der Stärke der Bewegung als auch bezüglich der Reaktionszeit. Demzufolge eignet sich die Membran vorzüglich als Sensor, der zwischen verschiedenen organischen Lösungsmitteln unterscheiden kann.
Die MPI-Forscher entschieden sich konsequenterweise zur Weiterentwicklung des von ihnen eingesetzten Materials. Hierbei standen Forschungen im Vordergrund, um Aktuatoren zu entwickeln, die nicht wie hier besprochen durch ein Lösungsmittel motiviert werden, sondern durch Licht.
Muscheln bestehen aus dem äußerst bruchfesten Material Perlmutt, in dem Proteine und Calciumcarbonat im optimalen Schichtdickenverhältnis übereinander geschichtet sind. Nach diesem Muster haben Forscher vom Max-Planck-Institut für Metallforschung in Stuttgart Titanoxid und ein Polymer derart übereinandergestapelt, dass auf diese Weise ein stabiler Verbundstoff entstanden ist.
Die Forscher trugen die beiden Komponenten schichtweise auf eine Siliziumunterlage auf, wobei sie für das Titanoxid eine Dicke von rund 100 Nanometern wählten. Die Stärke der Polymerschicht variierten sie zwischen 5 und 20 Nanometern. Alle Sandwichstrukturen, die die Forscher auf diese Weise erzeugten, hielten deutlich höheren Belastungen stand als reines Titanoxid vergleichbarer Dicke. Am stabilsten war der Verbundstoff, wenn die Schichtdicken dasselbe Verhältnis wie im Perlmutt aufwiesen. Es brach nämlich erst unter viermal größerem Druck als reines Titanoxid.
Die elastischen Polymerschichten wirken dabei wie gummiartiger Kitt zwischen zwei Mineralschichten und fangen Risse ab. In einem harten Material wie Titanoxid würden solche Schäden zwar erst unter großem Druck auftreten, da ein hartes Material aber meist auch spröde ist, frisst sich ein Riss durch es hindurch, sobald er entstanden ist – das Material bricht.
Um die bruchfesten Eigenschaften noch zu verbessern, entschieden sich die Forscher, ein Verbundmaterial aus kristallinem Titanoxid herzustellen anstelle der Verwendung von ungeordnetem und damit weniger stabilem Titanoxid. Der Werkstoff kann weiße Farbschichten oder schmutzabweisende Beschichtungen kratzfest und elektronische Bauteile bruchsicher machen. In optimierter Form würde es sich zudem als leichtes und robustes Material für die Beschichtung medizinischer Implantate eignen.
Muscheln ziehen im Perlmutt 40 Nanometer dicke Proteinschichten, die weich oder elastisch wie Gummi sind, zwischen 400 Nanometer messende Lagen von Aragonitkristallen, ein Mineral aus Calciumcarbonat. Deswegen ist das Material ihrer Schalen rund dreitausendmal bruchfester als reiner Aragonit.
Klettverschlüsse haben sich auf breiter Front in Haushalt und Industrie durchgesetzt. Als der Schweizer Erfinder George de Mestral nach einem Jagdausflug um 1950 wieder einmal mühsam die vielen Kletten aus dem Fell seines Hundes zupfen musste, kam ihm eine geniale Idee. Nach dem Vorbild der Natur konstruierte er einen Verschluss aus vielen kleinen Schlingen und Haken, den Klettverschluss. Das Haken-Ösen-Prinzip kommt vielseitig zum Einsatz. Als Alternative zu Schnürsenkeln, zum Befestigen medizinischer Bandagen und Prothesen oder als Kabelschutzmanschette in der Elektronik von Automobilen und Flugzeugen.
Leider sind gängige Klettverbindungen aus Kunststoff nicht besonders beständig gegenüber Hitze und aggressiven Chemikalien. Dabei kann es beispielsweise im Automobilbereich sehr heiß werden. Schon in Krankenhäusern werden zur Reinigung aggressive Desinfektionsmittel eingesetzt und im Fassadenbau sind herkömmliche Klettbänder zu schwach.
Wissenschaftler der TU München haben in Kooperation mit Partnern aus der Industrie eine Lösung für derartige Anwendungsgebiete entwickelt, die den Namen Metaklett trägt und als stählerne Klettverbindung realisiert ist. Temperaturen über 800 Grad Celsius oder aggressive Lösungsmittel sind kein Problem für den metallischen Klettverschluss, der bei Zug parallel zur Klettfläche eine Haltekraft von bis zu 35 Tonnen aufweist. Senkrecht zur Klettfläche hält sie immer noch eine Zugkraft von sieben Tonnen pro Quadratmeter stand. Dennoch kann sie jedermann rasch und ohne jegliches Werkzeug lösen.
Feuermelder nach Art des schwarzen Kiefernprachtkäfers können helfen, Großbrände zu vermeiden. Bestimmte Insekten fliegen gezielt Waldbrände an, da sie auf die Nutzung der durch das Feuer geschaffenen Nahrungsressourcen spezialisiert sind. Einige dieser ca. 40 Insektenarten „spüren“ dabei das Feuer durch spezielle Infrarotrezeptoren.
Diese dienen in einem vom Institut für Zoologie der Universität Bonn geführten Bionik-Projekt als natürliches Vorbild für neuartige technische Sensoren. Waldbrände verursachen allein in der Europäischen Union jährlich Schäden in Höhe von 2,5 Milliarden Euro. Eine effektive Früherkennung kann helfen, die Entstehung von verheerenden Großbränden zu verhindern. Neuartige bionische Infrarotsensoren nach dem Vorbild des Schwarzen Kieferprachtkäfers sollen dabei helfen.
Als unmittelbare Vorlage für die Sensorentwicklung dienen die photomechanischen Infrarotrezeptoren des Prachtkäfers der Gattung Melanophila. Durch die Simulierung eines großen Öltankfeuers, das in Kalifornien unglaublich große Mengen von Melanophila-Käfern anlockte, kann es als wahrscheinlich angesehen werden, dass die Käfer ein Großfeuer mithilfe ihrer Infrarotsensoren aus über 100 Kilometern Entfernung orten können.
Die thermomechanischen Eigenschaften der die Infrarotstrahlung absorbierenden Strukturen werden zudem mit modernen materialwissenschaftlichen Methoden untersucht, um die Wirkmechanismen auch im Mikro- und Nanobereich zu verstehen. Mit den an den biologischen Infrarotrezeptoren gewonnenen Ergebnissen werden bereits seit Jahren verschiede Demonstratoren und Prototypen hergestellt.
Hervorstechende Vorteile derartiger Sensoren sind eine relativ einfache Bauweise, die starke Miniaturisierung der einzelnen Sensorelemente und eine geringe Störanfälligkeit. Die neuartigen Infrarotsensoren ermöglichen die Herstellung robuster Feuermelder und die Produktion von Feuer- sowie Hitzedetektoren zur Verwendung in Gebäuden und Fahrzeugen. Einfach zu betreibende und zu bedienende wärmebildgebende Sensoren könnten zudem als Nachtsichtassistenten in Automobilen, Infrarotsichtgeräten für Feuerwehreinsätze sowie in der Grenzüberwachung und Minensuche eingesetzt werden.
Weitere Anwendungsfelder sind Diagnoseverfahren in der Medizin, Temperaturüberwachung in der Industrieproduktion und die Qualitätssicherung im Baugewerbe. Beispielsweise ermöglichen einfach zu handhabende Infrarotsichtgeräte, dass Hausbesitzer selbst Wärmeleckagen ihrer Häuser ermitteln und Verbesserungen an der Dämmung durchführen können. Dies hilft bei der Energieeinsparung – dem Prachtkäfer sei Dank.
Insekten spielen auch die Hauptrolle im Fall der nachfolgenden Innovation. Bei ihr geht es um die ausgeklügelte Funktionsweise von Insektenaugen, durch die Forscher des Jenaer Fraunhofer-Instituts für angewandte Optik und Feinmechanik zu einem bionischen Projekt angeregt wurden, der Funktionsweise dieser optischen Systeme auf den Grund zu gehen. In diesem Zusammenhang wurden Minikameras entwickelt, die aufgrund ihres von Insekten adaptierten Facettenaugenprinzips in der Lage sind, in ihrem Einsatzfeld des Kfz-Innenraums die Augenbewegungen des Fahrers zu beobachten und einen drohenden Sekundenschlaf zu erkennen. Der optische Sensor nach dem Facettenaugenprinzip von Insekten würde dann schwere Unfälle und Todesopfer im Straßenverkehr verhindern helfen.
Der geringe Abstand zwischen Linse und Fotorezeptoren sowie die geringe Größe der Optik machen Facettenaugen zu einem perfekten Vorbild für technische Kamerasysteme. Anfangs realisierte künstliche Facettenaugen konnten aufgrund ihrer geringen Bildqualität allerdings nur als einfache abbildende optische Sensoren eingesetzt werden. Dadurch wurde die notwendige Kompetenz für ein hierzu erforderliches systemtechnisches und interdisziplinäres Managementkonzept auf den Plan gerufen.
Konkret wurden im Rahmen diese interdisziplinären Ansatzes Vertreter aus den Bereichen Tierphysiologie, Experimentalphysik und Mikrooptik zusammengeführt, um aus dem gewonnenen Verständnis natürlicher Facettenaugenprinzipien ganz neue Wege in der Entwicklung optischer Systeme zu gehen. Insbesondere werden neuartige Prinzipienkombinationen untersucht, die eine deutlich höhere Schärfe der ultrakompakten Objektive zulassen. Diese erfordern ein beträchtlich komplizierteres Optikdesign, modifizierte Technologien und komplexere Aufbau- und Verbindungstechnik.
Die resultierenden facettierten ultraflachen Abbildungssysteme liefern Bildauflösungen, die ihren Einsatz in der Mikroskopie, im Gesundheitswesen, der Überwachungstechnik oder sogar als sehr kompakte Kamera im Mobiltelefon erlauben. Mit seiner geringen Baugröße ist dieses Objektiv prinzipiell sogar in Kreditkarten oder Folien anwendbar. Ein wesentlicher Bestandteil des Facettenaugenprojektes betrifft auch die Verfügbarmachung effizienter Massenfertigungsverfahren der Polymermikrooptiken auf Glas im Wafer-Maßstab für die neuartigen insekteninspirierten optischen Systeme.
In einem vom Dresdener Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM) geführten bionischen Projekt werden auf Basis von Knochenumbauprozessen computergestützte Methoden zur Konstruktion, Simulation und Fertigung gradierter zellularer Strukturen entwickelt. Ziel ist zum Beispiel der Einsatz von Dauerimplantaten im Kieferbereich oder Leichtbaustrukturen für den Automobil-, Flugzeug- und Anlagenbau. Der Knochen mit seiner massiven, dichten äußeren Randschicht, der sogenannten Kompakta, und den schwammartigen Knochenbälkchen, der Spongiosa, als natürlich gewachsene Verbundstruktur gewährleistet eine hohe Steifigkeit bei geringem Gewicht.
Um diese geniale Entwicklung der Natur auch in der Technik nutzbar zu machen, hat das IFAM deshalb das sogenannte MPTO-Verfahren (Multiple Phase Topology Optimization) entwickelt, das die örtliche Verteilung verschieden dichter Materialien in einer mechanisch belasteten Struktur mit dem Ziel hoher Steifigkeit optimiert. Mit MPTO können Faserstrukturen des Knochenschwamms in menschlichen Oberschenkelknochen in guter Übereinstimmung mit Röntgenaufnahmen nachgeahmt werden. Das in diesem Vorhaben entwickelte Softwareprogramm ermöglicht die Abbildung der Dichteverteilung des Knochens auf eine schwammartige Struktur, die mittels moderner Fertigungsverfahren erzeugt wird. Die mit den neuen Methoden gewonnenen Leichtbaustrukturen aus Titanlegierungen, Aluminium oder Keramiken weisen im Vergleich zu konventionellen Lösungen bis zu 30 Prozent Gewichtsersparnis bei einem sehr geringen Steifigkeitsverlust auf.
Insbesondere für Anwendungen mit bewegten Massen wie Autos, Flugzeugen und Maschinen führt dies bei der Bewegung zu einem entsprechend niedrigeren Energieverbrauch und damit zu nachhaltigen Produkten. Dies gilt in der Medizintechnik auch für die Lebensdauer von Endoprothesen, die für die Verbraucher zudem eine bessere Funktionalität als herkömmliche Produkte bringen.
Nun zu einem Beispiel aus der Klebetechnik nach Gecko-Art. An der Decke kleben wie ein Gecko – das ist keine Utopie mehr. Möglich macht dies das patentierte Gecko-Tape, das Bionik-Forscher der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel in Zusammenarbeit mit der Firma Gottlieb Binder in Holzgerlingen entwickelt haben. 2011 hat die Hightech-Folie bei den weltweit renommierten IF Product Design Awards einen Hauptpreis verliehen bekommen.
Die Jury urteilte, dass das Produkt seinen Gold Award verdient hat, weil es kein Klebeband ist, das klebt wie ein Klebstoff, sondern dank seiner Oberflächenstruktur spurlos wieder entfernt werden kann. Das Material haftet nicht nur auf glatten, sondern auch an unebenen Oberflächen und sogar auf Menschenhaut, weswegen es auch Potenzial für medizinische Anwendungen hat. Das Gecko-Tape ist den Haftmechanismen von Gecko- und Käferfüßen nachempfunden. Bei diesem neuen klebstofffreien System beruht die Haftkraft ausschließlich auf der besonderen Geometrie der Mikrostrukturen.
Bei der Herstellung dient wie beim Kuchenbacken eine Form als Vorlage, in die gleichsam als Negativbild die gewünschte Oberfläche eingegossen werden kann. Die künstlich hergestellte Folie kann immer wieder verwendet werden, löst sich rückstandsfrei und hält sogar auf feuchten, rutschigen Untergründen. Angewendet werden kann das innovative, umweltschonende und materialsparende Produkt in unterschiedlichen Bereichen – vom Haushalt bis zur Medizin.
Sogar der englische Fernsehsender BBC ließ sich von den einzigartigen Eigenschaften der Haftfolie überzeugen. Für einen Dokumentarfilm über Materialien der Zukunft berichtete das britische Team sehr eindrucksvoll durch eine Demonstration, bei der ein Wissenschaftsjournalist an einer mit der Hightech-Folie versehenen 20 x 20 Zentimeter großen Plexiglasscheibe wie ein Gecko oder Spider-Man an der Decke klebte.
Eine verblüffende Fähigkeit von Fischen soll im Kampf gegen die Wasserverschwendung helfen. In einem vom Institut für Zoologie der Universität Bonn geführten Bionik-Forschungsvorhaben wurde das sensorische Seitenliniensystem der Fische entschlüsselt und daraus ein technischer Strömungssensor entwickelt. Damit lassen sich Lecks in Trinkwasserrohren aufspüren oder der Atemstrom von Intensivpatienten überwachen.
Die Entwicklung von Strömungssensoren nach dem Vorbild des Seitenliniensystems der Fische erlaubt eine breit gestreute, präzise und kostengünstige strömungstechnische Überwachung. Die kleinen Sensoren erlauben eine größere Messgenauigkeit, sehr kleine Abmessungen und Kostenersparnisse.
Bis zu 40 Prozent des Trinkwassers gehen in Städten durch Undichtigkeiten in Leitungssystemen verloren. Der von den Forschern der Universität Bonn zusammen mit einer mittelfränkischen Firma für Wassermesstechnik entwickelte Sensor kann Lecks in Wasserrohren oder Gasleitungen aufspüren, da nach jedem Leck das Strömungsvolumen abnimmt.
In diesem Fall haben Fische Pate für eine technische Entwicklung gestanden. Sie sind auch bei Dunkelheit sehr gut über ihre unmittelbare Umgebung informiert. Mit ihrem Seitenlinienorgan, das aus bis zu 4.000 winzigen Einzelsensoren besteht, nehmen sie hochempfindlich lokale Wasserbewegungen und Druckgradienten war, wie sie zum Beispiel von vorbeischwimmenden Artgenossen oder Feinden erzeugt werden. Sie nutzen diese Fähigkeit zur Ortung von Objekten, zur räumlichen Orientierung oder auch zum gezielten Energiesparen bei der Fortbewegung.
Der nach Fischvorbild entwickelte technische Sensor ist nicht einmal so groß wie ein Fingernagel. Und er soll vor allem bei der lückenlosen Überwachung von Gas- und Flüssigkeitsströmen helfen, die eine große wirtschaftliche Bedeutung hat. Zum einen weil so die Wasserverschwendung eingedämmt werden kann, zum anderen könnte ein stetiger Gas- oder Flüssigkeitsstrom erhebliche Energiemengen einsparen.
Auch die Flora steuert in erheblichem Maße Vorbilder für technologische Errungenschaften bei. So hat die südafrikanische Paradiesvogelblume Pate für den Bau einer innovativen Fassadenverschattung gestanden. Für die bionische Fassadenverschattung nach dem Vorbild der Strelitzie, wie die Paradiesvogelblume auch heißt, wurden die Forscher eines Gemeinschaftsprojektes des Botanischen Gartens Freiburg und des Instituts für Tragkonstruktion und Konstruktives Entwerfen der Universität Stuttgart prämiert. Die Forscher, ihre Mitarbeiter und Vertreter des Instituts für Textil- und Verfahrenstechnik (ITV) Denkendorf wurden mit dem Techtextil-Innovationspreis für Architektur ausgezeichnet. Die Doktorand/innen, die das Projekt bearbeiteten, erhielten für ihre Arbeiten im Oktober 2012 den International Bionic Award der Schauenburg-Stiftung, den am höchsten dotierten Preis für Nachwuchsforscher/innen aus dem Bereich der Bionik.
Die bionische Fassadenverkleidung Flectofin ist eine naturinspirierte, wandelbare Konstruktion für die Architektur. Sie funktioniert wie eine vertikale Jalousie. Bei dem stufenlos einstellbaren Klappmechanismus lässt sich die Ausrichtung der Lamellen bei Bedarf verändern. Auf verschleißanfällige und wartungsintensive Gelenke und Scharniere haben die Bionik-Projektentwickler dabei verzichtet.
Stattdessen basiert die elastische Verformung auf dem Klappmechanismus in der Blüte der Strelitzie. Die Blume wird von Vögeln bestäubt, die sich auf eine eigens von der Pflanze gebildete „Sitzstange“ aus verwachsenen Blütenblättern niederlassen. Durch das Gewicht des Vogels klappen die Blütenblätter auf und die Pflanze gibt Pollen ab, die der Vogel auf die nächste Blüte überträgt.
Das ist die Grundlage für den technischen Klappmechanismus, der aus einem glasfaserverstärkten Kunststoff besteht, hochelastische Eigenschaften hat und gut verformt werden kann. Das Auf- und Zuklappen der Lamellen ist an das Biegen eines in die Lamelle integrierten Stabes gekoppelt, wodurch sie um bis zu 90 Grad umklappen.
Dieses Grundprinzip lässt sich zu verschiedenen Versionen weiterentwickeln. Da der Klappmechanismus ohne technische Gelenke oder Scharniere funktioniert und sich die sogenannten Tectofin-Systeme auch auf aufwendig zu beschattenden, gekrümmten Fassaden anbringen lassen, erhoffen sich die Forscher einen wichtigen Impuls für das Bauwesen der Zukunft.
Der multifunktionale Rüssel von Elefanten verleiht dem Roboterbau schwergewichtige Argumente. Die technische Universität Berlin, das Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automation IFF Magdeburg und zwei Industriefirmen fanden sich zusammen, um die hochflexiblen und sicheren Bewegungsmöglichkeiten des Elefantenrüssels technisch umzusetzen. Bei diesem Projekt mit dem Namen Brommi umfassen zwei verschiedene Roboterinnovationen, die mit einem Kamerasystem und einer Bildverarbeitung ausgestattet sind, das betreffende Objekt. Das erlaubt das Erkennen von Objekten sowie dessen gezielte Aufnahme und Abgabe innerhalb eines Pick-and-Place-Szenarios.
Der Roboter Brommi-TAK ist ein ausschließlich mit pneumatischen Muskeln betriebener Mehrsegmentmanipulator. Er besteht nach dem Rüsselvorbild aus ineinandergeschobenen Segmenten, in denen die Funktionsweise der Natur mit zwei Knochen, einem Gelenk und drei Muskeln technisch nachgebildet sind. Durch den innovativen Aufbau mit neuartigen Materialien ist das System leichter und so beweglicher und ressourceneffizienter als in einem starren Aufbau.
Die inhärenten Eigenschaften der verwendeten technischen Muskeln führen zu einem nachgiebigen und sicheren Roboterrüssel, der den Menschen bei seiner täglichen Arbeit unterstützen kann. Der zweite Roboter, Brommi-SMK, ist aus Multigelenken mit Elektromotoren modular aufgebaut. Jedes einzelne Multigelenk kann sowohl eine Schubbewegung als auch eine rüsselgleiche Flexionsbewegung ausführen.
Seine Baugröße lässt sich den zweckbezogenen Bestimmungen anpassen. Durch die Schubbewegung kann eine große Arbeitsraumhöhe realisiert werden, dem aufgrund der besonderen Bewegungsmöglichkeiten ein geringerer Bewegungsraum gegenübersteht.
Roboter gewinnen eine immer größere Bedeutung in der industriellen Produktion. Durch den demografischen Wandel in Europa beteiligen sich immer weniger Menschen an der Generierung des Strukturwandels durch die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten der Maschinen.
Neben der industriellen Produktion ermöglicht ihre hohe Sicherheit die Erschließung neuer Anwendungen wie beispielsweise im Pflege-, Domestik- und Life-Science-Bereich. Die neuen Roboter zeichnen sich durch ein gutes Masse-Leistungs-Verhältnis aus, das die Handhabung von hohen Lasten bei einer geringen Eigenmasse ermöglicht. Dies wird durch eine konsequente Leichtbauweise erreicht und ermöglicht einen ökonomisch vorteilhaften Betrieb.
Der Trend geht von bisher steifen Konstruktionen, die weich geregelt wurden, hin zu Konstruktion und Entwicklung von weichen und nachgiebigen Strukturen, ähnlich wie in der Biologie. Diese werden dann je nach Anwendung und Einsatz nur so weit wie nötig positionsgenau und steif geregelt. Dieser Paradigmenwechsel führt zu vorteilhaften Lösungen, da sie z. B.in der Mensch-Maschine-Interaktion inhärent sicherer sind und darüber hinaus auch ressourceneffizienter agieren.
Weiterhin ermöglicht die hohe Sicherheit der mechanischen „Elefantenrüssel“ den Verzicht von trennenden Schutzeinrichtungen, was im Mensch-Maschine-Kontakt zu einer erheblichen Platzeinsparung in der Produktion führt.
Die Baubionik favorisiert „natürliches Bauen“ im Sinne einer Rückbesinnung auf traditionelle Baumaterialien, die auch in der Biologie verwendet werden, wie beispielsweise Tonmaterialien mit ihren baubiologisch interessanten Eigenschaften. Andererseits gewinnt man aus dem Studium biologischer Leichtbaukonstruktionen Anregungen für temporäre technische Leichtbauten. Solche Anregungen können beispielsweise kommen von Seilkonstruktionen (Spinnennetzen), Membran- und Schalenkonstruktionen (biologische Schalen und Panzer), schützenden Hüllen, die den Gasaustausch erlauben (Eischalen, Etagenbauten, Integration abgehängter Einheiten, wandelbare Konstruktionen), Konstruktionen mit stärker wiederverwendbaren Materialien, als die Technik das bisher kennt, idealen Flächendeckungen (Blattüberlagerungen) und Flächennutzungen (Wabenprinzip). Wichtig sind Abstimmungen von einzelnen Wohnelementen in der Gesamtfläche und ihre Ausrichtung zu Sonne und Wind in Analogie zu Blattüberdeckungen und Blütenkonstruktionen.
Bei der Sensorbionik stehen Fragen des Monitorings von physikalischen und chemischen Reizen sowie deren Ortung und Orientierung in der Umwelt im Vordergrund. Das Problem, chemische Substanzen beispielsweise rechtzeitig im Körper des Menschen (Stichwort: Zuckerkrankheit) oder bei großtechnischen Konvertern (Stichwort: Biotechnologie) festzustellen, wird immer wichtiger. Sensoren der Natur, die für alle nur denkbaren chemischen und physikalischen Reize ausgelegt sind, werden verstärkt nach Übertragungsmöglichkeiten für die Technik abgetastet.
Bionische Kinematik und Dynamik umfassen die Hauptlokomotionsforen im Tierreich wie Laufen, Schwimmen und Fliegen. Fluidmechanisch interessante Interaktionen zwischen Bewegungsorganen und umgebenden Medien finden sich im Bereich kleiner bis mittlerer Reynolds-Zahlen zur Charakterisierung laminarer Strömungen (Mikroorganismen, Insekten) ebenso wie in der Region sehr hoher Reynolds-Zahlen zur Charakterisierung turbulenter Strömungen, die an den Reynolds-Bereich von Verkehrsflugzeuggen heranreichen (Wale). Fragen der Strömungsanpassung bewegter Körper, des Antriebsmechanismus von Bewegungsorganen und ihrer strömungsmechanischen Wirkungsgrade stehen im Vordergrund. Auch Fragen der funktionsmorphologischen Gestaltung beispielsweise von Flügeln oder Rümpfen können interessante Anregungen geben. So zieht beispielsweise die Oberflächenrauheit von Vogelflügeln infolge der Eigenrauheit des Gefieders in bestimmten Bereichen positive Grenzschichteffekte nach sich. Man kann dies auch bei der Verbesserung der Wirkungsgrade und der Laufruhe sowie der Lärmreduktion bei Pumpen und Lüftern einsetzen.
Die Neurobionik betreffend befinden sich Datenanalyse und Informationsverarbeitung unter Benutzung intelligenter Schaltungen von je her in einer stürmischen Entwicklung. Insbesondere die Verschaltung von Parallelrechnern und die Entwicklung neuronaler Netzwerke könnten weitere Anregungen aus dem Bereich der Neurobiologie und der Biokybernetik bekommen. Da sich dieses Gebiet auch in Bezug auf die biologische Grundlagenforschung rasch weiterentwickelt, ist in den nächsten Jahren mit einer verstärkten Interaktion zum Nutzen beider Disziplinen zu rechnen.
Als Bestandteil der Evolutionsbionik sind die Evolutionstechnik und -strategie darauf ausgerichtet, die Verfahren der natürlichen Evolution für die Technik nutzbar zu machen. Insbesondere dann, wenn die mathematische Formulierung bei komplexen Systemen und Verfahren noch nicht so weit gediehen ist, dass eine rechnerische Simulierung möglich wäre, bleibt die experimentelle Versuchs-Irrtums-Methode als interessante Alternative. Dies hat bereits selbstverständlichen Einzug in die Entwicklung beispielsweise von Schiffen und Flugzeugen, in Verkehrsleitsysteme und in den Maschinenbau gehalten.
Ein Fallbeispiel angewandter Evolutionsstrategie, wie sie von Professor Dr. Ingo Rechenberg begründet wurde, soll nachfolgend als Nachweis ihrer Praxistauglichkeit beschrieben werden. Im konkreten Fall bestand die Aufgabe in der Aufklärung der Elementarprozesse in kleinen metallischen Teilchen mit besonderem Augenmerk auf deren dielektrischen Eigenschaften hinsichtlich der Absorption elektromagnetischer Strahlung durch metallische Teilchen im Submikrometerbereich. Mitte der 1980er-Jahre berichteten Kölner Festkörperphysiker über ungewöhnliche elektrische Eigenschaften derartiger mesoskopischer Teilchen. Unter dem Schlagwort „Size Induced Metal Insulator Transition“ (SIMIT) und seinen potenziellen Anwendungsmöglichkeiten ließ das noch in der Grundlagenforschung angesiedelte Thema eine Reihe von Fragen zu seinen industriellen Nutzungsmöglichkeiten offen.
Im Vordergrund der nachfolgend skizzierten Experimente standen die quasistatische elektrische Leitfähigkeit und die Absorption elektromagnetischer Strahlung (mesoskopischer) Metallteilchen im Submikrometerbereich. Dabei war das Hauptziel die Bestimmung des elektrischen Widerstandes von Metallteilchen mit Durchmessern im Bereich von 10 Nanometern bis zu einigen Mikrometern. Der besagte elektrische Widerstand eines Materials wird auch als dielektrische Konstante bezeichnet, abgekürzt mit DK. Da eine Kontaktierung derartig kleiner Teilchen weder möglich noch wünschenswert ist, wurde zur Ermittlung der Leitfähigkeit die Absorption elektromagnetischer Wellen herangezogen. Diese wiederum leitet sich aus der dielektrischen Funktion des Materials ab. Da die Gleichstromleitfähigkeit festzustellen war, musste die Frequenz der eingestrahlten Welle hinreichend klein sein, das heißt kleiner beziehungsweise gleich 100 Gigahertz. Aus diesem Grund wurden die Experimente mit Mikrowellen bei Frequenzen von bis zu einigen 10 Gigahertz durchgeführt, sodass die Bedingung für den quasistatischen Grenzfall erfüllt war.
Die Messungen wurden an Proben durchgeführt, die aus einem nichtleitenden Matrixmaterial (z. B. Öl, Harz, Keramik) und darin verteilten mesoskopischen Metallteilchen (z. B. Silber, Indium, Platin) bestanden. Gemessen wurde das Absorptionsverhalten des Vielteilchensystems und nicht das der Einzelteilchen. Die Konzentration beziehungsweise der Füllfaktor der metallischen Teilchen musste etwas kleiner als ein Drittel sein, um Perkolationseffekte beziehungsweise Clusterbildungen im Sinne von Verklumpungen zu vermeiden.
Bei bekannter möglichst enger Verteilung der isolierten Metallteilchen liefern gemäß der Arbeiten der Kölner Wissenschaftler die Messwerte für die DK der Probe bestehend aus Matrix und Teilchen, unter Verwendung eines entsprechenden Modells die Abhängigkeit der dielektrischen Funktion der Metallteilchen von der Teilchengröße.
Zur Bestimmung der Teilchengrößenabhängigkeit der elektrischen Leitfähigkeit war also aufgrund der verwendeten Messmethode zunächst die Ermittlung einer physikalischen und mathematisch darstellbaren Größe nötig, die proportional zur Leitfähigkeit war. Zur Messung der DK der recht kleinen Proben mit wenigen Kubikzentimetern Probenvolumen wurde die Methode des teilgefüllten Hohlleiters verwendet. Die Probe wurde dabei in der Mitte eines Rechteckhohlleiters (8–12 GHz, X-Band) platziert. Im Falle flüssiger Matrixmaterialien befand sich die Probe (z. B. ein Öl-Indium-Kolloid) in einem Teflonschiffchen.
Der SIMIT kann nur quantenmechanisch auf der Basis des Wellencharakters der Leitungselektronen beschrieben werden. Von herausragender Bedeutung ist dabei die Tatsache, dass die Kohärenzlänge der Elektronenwellenpakete, die normalerweise klein im Vergleich zu den Abmessungen eines Körpers ist und somit den klassischen Ausdruck für die Leitfähigkeit (Drude-Modell) zur Folge hat, mit der Ausdehnung der kleinen Teilchen vergleichbar wird. In einem derartig kleinen Volumen tritt sozusagen eine stehende Elektronenwelle mit nicht vorhandener Beweglichkeit auf. Diese größeninduzierte Lokalisierung der Leitungselektronen (Übergang von dreidimensionalem zu quasi nulldimensionalem Verhalten!) ist verbunden mit einer entsprechenden Diskretisierung des für Vollmaterialien (quasi-)kontinuierlichen Energiespektrums. Der Abstand der elektronischen Energieniveaus ist invers proportional zur zweiten Potenz der Durchmesser der Metallteilchen und kann somit über das Teilchengrößenspektrum definiert eingestellt werden. Dies ist insbesondere für das absorptive Verhalten der kleinen Teilchen, das heißt die gezielte Einstellbarkeit von Anregungsenergien, von größter Bedeutung. Hinsichtlich des Bereiches von Radarwellen (30–100 GHz) liegt der entsprechende Teilchengrößenbereich bei 10 bis 100 Nanometern.
Die obigen Ausführungen über das „Einsperren“ der Leitungselektronen in den kleinen Teilchenvolumina sind bezüglich der Gitterschwingungen (Phononen) entsprechend übertragbar. So fehlen in einem Submikrometerteilchen die langwelligen Phononen, welche zur Zerstörung der elektronischen Phasenkohärenz führen würden. Kurioserweise führt somit bei den kleinen Teilchendurchmessern das Fehlen der unelastischen Streuprozesse zu einer Erhöhung des elektrischen Widerstandes (das heißt, die Leitfähigkeit nimmt ab, je idealer der Kristall ist). Bislang gibt es noch kein theoretisches Modell, das (auf den Welleneigenschaften der Elektronen beruhend) den SIMIT erklärt.
Die hier beschriebenen Experimente und ihre Interpretationen stellen den Stand der Forschungsarbeiten hinsichtlich der dielektrischen Antwort beziehungsweise der elektrischen Leitfähigkeit vollständig dar. Als zentrale Ergebnisse der Untersuchungen sei zusammenfassend festgehalten: Die elektrische Leitfähigkeit kleiner metallischer Teilchen mit Durchmessern unterhalb weniger Mikrometer nimmt proportional zum Teilchenvolumen ab. Der größeninduzierte Metall-Isolator-Übergang im Nanometerbereich ist universell, das heißt, sein Auftreten hängt nicht vom speziellen Metall ab und sollte auch für Halbleiter auftreten. Die elektrischen beziehungsweise dielektrischen Eigenschaften mesoskopischer Teilchen sind aufgrund der Größenabhängigkeit definiert einstellbar.
Die bisher beschriebenen Arbeiten hatten ausschließlich das Ziel, die Teilchengrößenabhängigkeit der elektrischen Leitfähigkeit festzustellen. Die hierzu verwendete Methode der Mikrowellenabsorption lieferte die entsprechenden Aussagen bezüglich der dielektrischen Funktion. Für die Bestimmung sowohl des Absorptions- als auch des Reflexionskoeffizienten ist die vollständige Kenntnis der dielektrischen Funktion zielführend. Und auch die Kenntnis des Realteils der DK ist erforderlich. Der Realteil ist im betrachteten Teilchengrößenbereich kleiner 100 Nanometer positiv und steigt mit zunehmendem Teilchendurchmesser an. Das Verhalten für größere Teilchenvolumina ist nicht bekannt, insbesondere nicht der Übergang zum Bulk-Limes, in dem der Realteil (große) negative Werte annehmen muss. So ist derzeit eine quantitative Abschätzung des Reflexions- und Absorptionsverhaltens auf Teilchendurchmesser von maximal 100 bis 200 Nanometer beschränkt.
Die für diese Abschätzung interessanten optischen Konstanten lassen sich aus der dielektrischen Funktion des Materials berechnen. Es zeigt sich, dass mit zunehmender Teilchengröße die Absorption elektromagnetischer Strahlung drastisch ansteigt. Gleichzeitig steigt aber auch das Reflexionsvermögen an, da beide Größen eng miteinander verknüpft sind.
Im Hinblick auf die Realisierung einer möglichst reflexionsfreien Oberfläche von Metallkörpern, auf die wir uns nun konzentrieren wollen, besteht die zu lösende Aufgabe darin, einen Metallkörper (mit einem Reflexionskoeffizienten nahe dem Wert 1, der für Totalreflexion steht) durch eine Beschichtung derartig zu tarnen, dass die elektromagnetische Welle nahezu reflexionsfrei in das Beschichtungsmaterial eindringt und dann in das Material absorbiert wird. Die elektromagnetische Signatur eines metallischen Körpers wird dadurch weitestgehend eliminiert. Diese Anforderungen könnten durch eine Beschichtung erfüllt werden, bei der mesoskopische Metallteilchen in einer nichtleitenden Matrix (z. B. Kunststoff, Keramik) in Form einer Gradientenstruktur hinsichtlich Teilchengröße und Füllfaktor eingebettet sind. Nahe der Oberfläche sollten Größe und/oder Füllfaktor der Teilchen gering sein, um das Reflexionsvermögen gegen Luft niedrig zu halten (bei entsprechend geringer Absorption). Ein allmähliches Ansteigen von Teilchengröße und/oder Füllfaktor innerhalb der Beschichtung könnte dann die gewünschte Absorption (bei geringer Reflexion) bewirken.
Ein zentrales Problem stellt das Reflexionsvermögen der Beschichtung gegen Luft dar. Selbst wenn nahe der Oberfläche keine metallischen Teilchen vorhanden sind, tritt eine nicht unerhebliche Reflexion am Matrixmaterial auf. So beträgt die Reflexion einer Teflonmatrix mit ihrer relativ geringen DK gegen Luft etwa drei Prozent bei senkrechter Inzidenz. Dieses Problem kann durch ein entsprechendes Oberflächenprofil (Pyramidenstruktur) minimiert werden, sodass ein gradueller Übergang von der DK der Luft hin zur DK des eigentlichen Absorbers erfolgen kann. Ein grundsätzlich anderer Ansatz zur Lösung des Problems beruht auf der Vorstellung, die DK des Matrixmaterials durch Dotierung mit Teilchen, die eine sehr kleine DK aufweisen, zu minimieren.
Um zu einer Abschätzung des Reflexionsvermögens eines mit kleinen metallischen Teilchen dotierten Materials zu gelangen, wird eine Schichtstruktur betrachtet, die als Approximation der oben diskutierten Gradientenstruktur dient. Hierzu sei auf die zu tarnende Metalloberfläche eine Anzahl n aufgebracht, die durch die folgenden Parameter charakterisiert sind: Dicke der jeweiligen Schicht, DK der für alle Schichten gleichen Matrix, DK der Metallteilchen der jeweiligen Schicht. Füllfaktor der Metallteilchen der jeweiligen Schicht, DK der für alle Schichten gleichen halbleitenden Teilchen und Füllfaktor der halbleitenden Teilchen der jeweiligen Schicht. Aus diesen Parametern lässt sich für jede Schicht die DK des effektiven Mediums bestimmen und hieraus wiederum das Reflexionsvermögen und die Absorption der einzelnen Schichten innerhalb einer vorgegebenen Struktur.
Die weitere Aufgabe besteht nun darin, aus der Menge der aufgeführten Parameter den Parametersatz zu ermitteln, der für eine vorgegebene Gesamtschichtdicke das minimale Reflexionsvermögen liefert. Um diese äußerst komplexe Aufgabenstellung des Auffindens dieses Minimums in dem hochdimensionalen Parameterraum effizient zu lösen, wurde eine aus dem Bereich der Bionik stammende evolutionsstrategische Methode angewendet, die im konkreten Fall wie folgt charakterisiert ist:
1. Start mit einem beliebigen Parametersatz, für den das zugehörige Reflexionsvermögen berechnet wird
2. Auswürfeln von Veränderungen der Werte des Parametersatzes innerhalb eines vorgegebenen Bereichs (Mutation) und Berechnung des zu den neuen Werten zugehörigen Reflexionsvermögens
3. Auswahl des zum kleineren Reflexionsvermögen gehörigen Parametersatzes (Selektion) für erneutes Erzeugen zufälliger Veränderungen der Parameter
4. Fortsetzung des Verfahrens, bis eine weitere Verkleinerung des Reflexionskoeffizienten nicht mehr zu erwarten ist
Bei der Anwendung des geschilderten Verfahrens muss beachtet werden, dass nicht zwangsläufig das globale Minimum des Reflexionskoeffizienten ermittelt wird, sondern eventuell nur ein lokales Minimum. Um dies weitestgehend zu verhindern, ist es wichtig, das Mutationsfenster, das heißt denn Bereich, in dem die Änderungen zu einem bestimmten Parametersatz ausgewürfelt werden, hinreichend groß zu wählen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten großer (allerdings seltener) Mutationen, die zum Verlassen eines lokalen Minimums führen. Neben der Festlegung des Mutationsfensters ist das Selektionsprinzip von zentraler Bedeutung. Bei dem oben beschriebenen Verfahren würde der durch Mutation entstandene Parametersatz grundsätzlich für weitere Mutationen ausgewählt, sofern er den niedrigeren Reflexionskoeffizienten liefert. Hierdurch kann jedoch eine Entwicklung verhindert werden, bei der sich aus einem zunächst ungünstigen Parametersatz nach einer Vielzahl von Schritten schließlich bessere Werte für den Reflexionskoeffizienten ergeben, als sie mit dem selektiven Parametersatz möglich sind (insbesondere durch langsame Konvergenz in ein tieferes oder das globale Minimum).
Aus diesem Grund wird folgende Modifikation der Strategie verwendet. Beim Start wählt man nicht nur einen, sondern mehrere beliebige Parametersätze (x Stück). Für jede dieser x Spezies werden x Mutationen ausgewürfelt. Aus den dann vorliegenden x·(x+1) Parametersätzen werden die x besten (das heißt diejenigen mit den kleinsten Reflexionskoeffizienten) ausgewählt und für diese jeweils wieder x Mutationen erzeugt. Dieses Verfahren beinhaltet sowohl den Vorteil der schnelleren Konvergenz als auch die Möglichkeit, dass sich zunächst ungünstig erscheinende Spezies nach weiteren Mutationsschritten durchsetzen können.
Basierend auf den bisherigen Ausführungen wurde ein numerisches Verfahren entwickelt, das die Bestimmung des Reflexionsvermögens der beschriebenen Schichtstruktur nach evolutionsstrategischen Prinzipien durchführte. Es wurden eine Reihe von Simulationsrechnungen für verschiedene Gesamtschichtdicken, Anzahlen von Schichten innerhalb einer Struktur und Frequenzen der auftreffenden Welle durchgeführt. Die zentralen Ergebnisse bezüglich Absorptionsgrad und Designkonzept von Beschichtungen mit mesoskopischen Metallteilchen stellten sich wie folgt dar:
Bei einer aus vier Schichten bestehenden Schichtstruktur ergab sich mit einer Schichtdicke von drei Millimetern bereits eine Reflexionsminderung von 20 Dezibel.
Es hat sich im Laufe der Arbeiten gezeigt, dass die hier beschriebene Evolutionsstrategie der Aufgabenstellung angemessen war, sodass auf eine weitere Verfeinerung verzichtet werden konnte.
Die Prozessbionik dient nicht nur dazu, natürliche Konstruktionen auf ihre technische Verwertbarkeit abzuklopfen, sondern mit besonderem Vorteil auch Verfahren, mit denen die Natur die Vorgänge und Umsätze steuert. Eines der wesentlichen Vorbilder ist die Photosynthese im Hinblick auf eine zukünftige Wasserstofftechnologie. Weiter können Aspekte der ökologischen Umsatzforschung mit großem Gewinn untersucht werden im Hinblick auf die Steuerung komplexer industrieller und wirtschaftlicher Unternehmungen. Schließlich sind die natürlichen Methoden der praktisch totalen Wiederverwendbarkeit, des – fast vollständigen – Vermeidens von Deponiematerial, wert, in allen Details auf eine Übertragbarkeit untersucht zu werden.
Wichtige Anregungen entstammen der Organisationsbionik für das Management komplexer Systeme. Komplexes Management muss in die Lage versetzt werden, vorausschauend allen Anforderungen eines auch nur mittleren Industriebetriebes gerecht zu werden. Im Gegensatz dazu laufen Organisationsfragen im Bereich der belebten Welt, sei es im Einzelorganismus (die Gesamtkomplexität einer Fliege ist größer als die der gesamten deutschen Volkswirtschaft!) als auch in Organismensystemen und schließlich in ökologischen Systemen, äußerst störungsarm ab. Die funktionellen Querbeziehungen von Ökosystemen, beispielsweise bei einem Waldbrand, sind bereits komplexer als die eines größeren Industriebetriebs. Aus der Art und Weise, wie die Natur Informationen organisatorisch benutzt, lässt sich in analoger Übertragung vieles für Technik und Verwaltung lernen. Dieser Punkt ist sehr zunftsträchtig, wird aber zur Zeit noch sehr zögernd aufgegriffen.