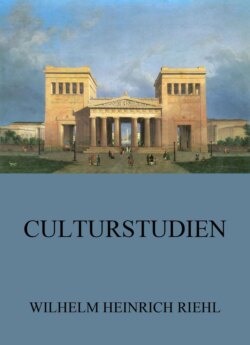Читать книгу Culturstudien - Wilhelm Heinrich Riehl - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Volkskalender im achtzehnten Jahrhundert.
Оглавление1852.
Volkslitteratur ist heutigen Tages eine vornehme Liebhaberei geworden, und der Kalendermacher ist nicht mehr sprüchwörtlich der letzte unter den Bücherschreibern: litterarische Aristokraten schreiben Kalender, und Volksbildungsvereine von reichen Leuten geben Kalender für die Armen heraus. Vor hundert Jahren war es anders, und unsere heutigen Kalender dürfen nicht ahnenstolz sein auf ihre löschpapiernen Vorfahren. Dafür sind aber die letzteren doch wenigstens in ihrer Wirksamkeit wahre Volkskalender gewesen und getreue Spiegel der damaligen Volksbildung und Volkssitte. Die meisten der heutigen Volkskalender zeigen, was die gebildete Welt aus dem Volk machen möchte, die alten, was das Volk damals wirklich war.
Das deutsche Volkskalenderwesen des achtzehnten Jahrhunderts theilt sich, entsprechend dem letzten Satze, in zwei Perioden. Die erste reicht beiläufig bis zu den achtziger Jahren. Bis dahin war der Kalender in der Regel ein historisches Volksbuch, welches in seinen Monatstafeln die Geschicke des künftigen Jahres prophezeite, in dem gegenüberstehenden fortlaufenden Texte aber einen Geschichtsabriß des vorigen Jahres gab. Auf dem Standpunkte der bildungslosen Masse selber stehend, befriedigte also der Kalender wesentlich deren Aberglauben und Neugierde. Mit den achtziger Jahren aber bringt die Tendenz der Aufklärung und Volksbelehrung einen merklichen Umschwung in diese Kalenderlitteratur. Statt der zeitgeschichtlichen Berichte sind jetzt die Blätter mit moralischen Anekdoten und nützlichen Belehrungen, statt der astronomischen Zeichen und Verse, statt der Wetterregeln und »Erwählungen« mit altklugen, gemachten Sittensprüchen erfüllt, und während die Tafel des Aderlaßmännleins bis dahin den Kalender beschloß, beschließt ihn nun das große Einmaleins und die Zinstabelle. Der Kalendermacher hatte vordem mitten im Volk gestanden als ein Herold seines Aberglaubens, als sein Prophet, als sein Hof- und Leibhistoriograph. Jetzt tritt er vor und über das Volk und wird sein gestempelter und privilegirter litterarischer Schulmeister. Früher hatten wir darum nur Eine Art des Volkskalenders, entsprechend der in den großen Zügen gleichartigen Physiognomie der bildungslosen Masse; jetzt haben wir deren unzählige, denn jeder Litterat will nach seiner Individualität diese Masse bilden.
Die volksbildenden Kalender, wie sie gegen Ende des vorigen Jahrhunderts aufkamen, schufen allmählig einen Ablagerungsplatz für einen ungeheuren Lehr- und Agitationsapparat, den wir jetzt kaum mehr an den Mann zu bringen wüßten, wenn uns plötzlich die Kalender ausgingen. Aber erst als man die Bedeutung der in jeder Volksgruppe ruhenden politischen und socialen Macht zu ahnen begann, konnte man es der Mühe werth halten, durch Kalender auf sonst literarisch unzugängliche Kreise zu wirken. Was lag der ächten Rococo- und Zopfzeit daran, ob dem gemeinen Mann auch noch außerhalb der Kirche und Schule Bildungsstoffe zugeführt würden! er war ja nur eine ruhende Potenz, die man darum getrost auf sich beruhen und für sich selber sorgen ließ. Die gänzliche Umgestaltung der Volkskalender seit länger als einem halben Jahrhundert ist ein Siegeszeichen der socialen Politik. Wir haben jetzt Volkskalender der politischen Parteien, mehr noch der kirchlichen; die Regierungen lassen Kalender schreiben, weil sie wissen, daß sie mit ihren officiellen Zeitungen niemals bis zu den Bauern durchdringen können, und die Opposition säumt dann auch nicht, ihrerseits mit Kalendern in's Feld zu rücken. Nationalistische und orthodoxe Kalender werben um Land und Leute; protestantische Traktatengesellschaften lassen aus ihren Traktätchen Volkskalender zusammenstellen, und katholische Kleriker streiten in Kalendern »für Zeit und Ewigkeit« mit dem Eifer und der Derbheit mittelalterlicher Predigermönche für ihren Kirchenglauben. Man schreibt Bauernkalender, die niemals ein Bauer liest, um Dorfgeschichten zu ediren, und illustrirte Kalender, welche Pfennigmagazin und Conversationslexikon zugleich ersetzen sollen; dazu landwirthschaftliche Kalender, statistische Geschäftskalender, Jugendkalender und Gott weiß was sonst noch. Die Geschichte aller dieser Kalender bildet eine wesentliche Ergänzung zur Geschichte der Journalistik.
Ich bin so glücklich, in mehreren starken Quartbänden eine Sammlung der verschiedenartigsten, in Nürnberg, Frankfurt, Straßburg, Berlin und Wien erschienenen Volkskalender zu besitzen, die irgend ein Kuriositätenliebhaber, vermuthlich in den neunziger Jahren, aus fast allen Jahrzehnten seines Jahrhunderts zusammengetragen hat. Da mein Sammler auch die schlechteste Scharteke nicht verwarf, so bot sich mir hier ein Material, wie man es wohl schwerlich auf einer Bibliothek oder bei einem Antiquar wiederfinden wird, und indem ich seit meinen Jugendjahren mich häufig an der Betrachtung der barbarischen Holzschnitte und der Lektüre des wunderlichen Textes ergötzte und später noch vergleichende Studien anderswoher hinzuzufügen suchte, ward es mir in diesem wenig betretenen Grenzwinkel der Litteratur fast so heimisch, wie es Einem bei öfterem Fußwandern selbst in einer Wüstenei werden kann.
Die alten Kalendermacher waren unstreitig meist die Hefe der damaligen schreibenden Welt, und das will viel sagen; sie waren aber doch so einflußreich wie unsere besten heutigen Volksschriftsteller. Noch in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts war der Kalendermacher eine geheimnißvolle, magische Person, ein halber Hexenmeister. Ja man kann sagen, diese Leute, die in ihrer Mehrheit eine Körperschaft von miserablem literarischem Gesindel bildeten, sind die letzten »Seher« des deutschen Volkes gewesen. Darum sagt der Bauer heute noch, wenn Einer träumend und sinnend dreinschaut, man meint »er mache Kalender.«
Als der poesiereiche uralte Volksaberglaube von der nüchternen gebildeten Welt des achtzehnten Jahrhunderts nicht mehr recht verdaut wurde und in dem gelehrten Bücherwesen nirgends mehr eine Freistatt fand, da verbarg er sich zu allerletzt noch in den grauen Löschpapierblättern der Volkskalender.
Aus demselben Grund, aus welchem weise Frauen zu Ariovist's Zeit den Germanen geboten, daß sie nicht vor Neumond die Schlacht beginnen sollten, gebot vor hundert Jahren Magister Gaup, der Kalenderschreiber, den deutschen Bauern, daß sie vor Neumond beileibe nicht purgiren und arzneien möchten. Denn das wachsende Licht bringt Fülle und Gesundheit, das abnehmende Zerstörung und Untergang. In den alten Kalendern, die ein ganzes System solcher »Erwählungen« durchführen, werden die positiven Geschäfte (wie Säen, Pflanzen u. dgl.) überhaupt in die Zeit des wachsenden, die negativen (wie Holzfällen, Haarschneiden u. dgl.) in die des abnehmenden Mondes verlegt.
Da fühlte sich der Kalendermacher seinem Publikum gegenüber als ein Ausleger der geheimen kleinen Naturkräfte und der großen Weltgesetze. Und wie der altgermanische Seher der öffentlichen Würde des Priesters oder der privaten des Hausvaters nicht entbehren durfte, so fetzte der Kalenderschreiber vor hundert und mehr Jahren nicht leicht seinen Namen auf das Titelblatt, ohne die Beifügung hochtönender wissenschaftlicher Prädikate. Wer sich die öffentliche Würde eines Artium liberalium Magister nicht zuschreiben konnte, der schuf sich ganz eigens eine private, die seinen Einblick in »alles Wirkens Kraft und Saamen« anzeigte, als z.B.: Marcus Freund, Miraculorum Dei amator, oder Christoph Adelsheim, Art. Mathem. cultor strenuus. Oder verschmähte es Einer, dem gemeinen Mann lateinischen Sand in die Augen zu streuen, dann schrieb er sich mindestens in ehrlichem Deutsch etwa wie Jakob Holderbusch: »der göttlichen Wahrheit Liebhaber.«
In dieser selben Zeit, wo die Gesellschaft von oben herab immer aufgeklärter und nüchterner wurde, mußten die Männer der geistigen Berufe dem Volke gegenüber noch immer die Maske des Magus vorhalten um ihren Credit zu behaupten. So thaten es die Pfarrer und Ärzte, warum nicht auch die Kalendermacher? Die Charlatanerie war als eine Nothwendigkeit in der Sitte anerkannt, so lange man Perücken und Zöpfe trug, darum ist es ganz in der Ordnung, daß auch die Zöpfe der heutigen Welt noch so große Stücke auf allerlei gelehrten und amtlichen Hokuspokus halten.
Es gehörten aber auch für einen zunftgerechten Kalendermacher in der That ganz absonderliche Kenntnisse dazu – freilich theilte er sie mit manchem Schäfer und Scharfrichter – um die letzten Reminiscenzen von Astrologie, Wahrsagerei und Zeichendeuterei, deren Verständniß in diesem Zeitalter nur noch schwach fortdämmerte, mit gehöriger Sicherheit anzuwenden. Das bunte Gemisch von System und Willkür, von alter mystischer Überlieferung und neuer rationalistischer Kritik macht die Kalender des achtzehnten Jahrhunderts als Urkundenbücher des absterbenden Volksaberglaubens besonders interessant. So ist z.B. in den Tabellen, welche angeben, was aus der Farbe des beim Aderlaß abgezapften Blutes zu Prophezeien sei, der alte Aberglaube mit wirklichen physiologischen Beobachtungen und Folgerungen aufs seltsamste verwebt, und die diätetischen Regeln bekunden die instinktive Weisheit des medicinischen Volksglaubens, der eben so oft durch seine klare Erkenntnis; den Naturforscher überrascht wie durch das Helldunkel seiner uralten Symbolik den Germanisten. Bei dem sogenannte» »Aderlaßmännlein,« nämlich bei der Tabelle über die Tage, wann es gut oder schlecht zur Ader zu lassen sei, ist namentlich die altheidnische symbolische und astrologische »Erwählung« noch in ihrer vollen Reinheit beibehalten. Die Aderlaßtafel regelt sich nach dem Mondwechsel, und jeder der dreißig Tage des Mondlaufs hat seine stehende Bedeutung, die aber für alle Jahreszeiten und Monate die gleiche ist. Wer z.B. am siebenten Tage nach dem Neumond zur Ader läßt, bekommt Augenschmerzen, wer am vierten, stirbt eines jähen Todes, wer am 25. der wird klüger und verständiger. Diese Aderlaßtafel hat merkwürdig lange ihren Platz behauptet; sie ist in vielen Kalendern sogar in's neunzehnte Jahrhundert herübergeführt worden. Bei den lehrsamen rationalistischen Kalendern aus den ersten Jahrzehnten der Aufklärungsperiode macht es einen äußerst komischen Eindruck, die eifrigsten Predigten wider den Aberglauben im Texte zu lesen, während gegenüber bei den einzelnen Monatstagen noch der ganze Hokuspokus der schwarzen und rothen Erwählungs- und Vordeutungszeichen abgedruckt ist, und auf dem Titelblatt noch die astrologische Erklärung der Constellationen, und auf dem Schlußblatt die Aderlaßtafel prangt. Es erinnert dieß an die bekannte Geschichte von dem Schiff, welches in der Passagierkajüte englische Missionäre und im Güterraum Götzenbilder englischen Fabrikates nach Indien führte. So ließ man auch noch lange das Aushängeschild der Prophezeiung auf den Kalendertiteln fortbestehen, wahrend inwendig höchstens noch das Wetter prophezeit wurde, und der »Astrologische Sibyllen- und Weissagungskalender« bringt zur Zeit der französischen Revolution nur noch Orakelsprüche, wozu es der auf dem Titel prangenden Bilder der vier Sibyllen nicht bedurft hätte, wie etwa auf den blutgetränkten September 1793: »Wie lacht der Ueberfluß und welchen reichen Segen will nicht Pomona itzt vor unsre Füße legen!«
Die durchgängige Fortführung der Aderlaßtafel in der Spätzeit des achtzehnten Jahrhunderts ist übrigens auch um deßwillen beachtenswerth, weil sie eigentlich auf Lebensgewohnheiten berechnet ist, die damals im Allgemeinen kaum mehr existirten. Im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert war es ein weitverbreiteter Brauch, selbst bei dem gemeinen Mann, durch häufiges periodisches Blutabzapfen bei gesundem Leibe, durch Abführungen und Schwitzbäder sich vor Krankheiten zu schützen. Purgiren, Aderlassen und Schwitzen vertrat bei den Altvordern die Stelle unserer Landausflüge und Badereisen. Damals waren die Baderstuben öffentliche Lokale, annähernd von einer Bedeutung für den geselligen Verkehr wie jetzt die Wirthshäuser, Conditoreien und Kursäle. Man ließ sich kollegialisch schröpfen, wie man kollegialisch kneipt. In der damaligen Volkslitteratur finden wir zahllose Gleichnisse und Redebilder von dem Treiben in den Baderstuben hergenommen, und auf politisch-satyrischen Holzschnitten aus der Zeit des dreißigjährigen Kriegs sind die Fürsten häufig als Badergesellen dargestellt, die den Völkern gehörig Schröpfköpfe aufsetzen und die Ader schlagen; statt des Blutes rinnen dann Goldstücke hervor. Damals also hatte das Aderlaßmännlein in den Kalendern noch einen Sinn. Vor sechzig Jahren dagegen standen die Menschen schon längst nicht mehr so voll im Safte, daß sie sich aus bloßer Vorsicht regelmäßig Blut hätten abzapfen müssen. Gewiß war dieß wenigstens nicht nicht bei dem Mittelstande der Fall, auf welchen jene Kalender zunächst zielten, wählend sich bei vereinzelten abgeschlossenen Bauernschaften allerdings ein Nachklang der seltsamen Sitte des periodischen Aderlasses bis auf unsere Tage erhalten hat. Allein auch der Kleinbürger wollte zu unserer Großväter Zeit die altgewohnten Erwählungen der Aderlaßtafel nicht missen, obgleich er hier eigentlich gar nichts mehr zu erwählen hatte.
In der Beschreibung der Planeten, ihrer »Eigenschaften, natürlichen Zuneigungen und Bedeutungen« spielten die letzten Nachklänge der mittelalterlichen Mystik der Naturkunde in das aufgeklärte achtzehnte Jahrhundert herüber. Aber auch eine moderne Schule der Naturphilosophie hat die Qualitäten der Planeten wieder ganz ähnlich phantastisch ausgedichtet wie der Kalenderschreiber vor hundert Jahren. Dieser gibt jedem Planeten nach alter Ueberlieferung ein besonderes Temperament. Saturn ist kalt und trocken, Jupiter warm und feucht, Mars hitzig und trocken, Venus feucht und warm, Merkur warm und trocken. Dazu kommt die Sonne, die heiß und trocken, und der Mond, der kalt und feucht ist. Der Gedanke von unterschiedenen Temperamenten der Gestirne ist uralte Volkspoesie, die bis in's deutsche Heidenthum hinaufreicht. In einer Sage aus der Grafschaft Mark wird dem nachherigen Mann im Mond, als ihn der Herr zur Rechenschaft zieht, die Wahl gelassen ob er in der Sonne verbrennen oder im Mond erfrieren wolle. Er zieht das Erfrieren vor und läßt sich in den kalten Mond setzen.
Aus den Thierkreiszeichen, welche die einzelnen Monate charakterisiren, weissagt man den Charakter der im Monat Geborenen, aus planetarischen Constellationen den Gesundheitszustand des kommenden Jahres. Die Staatsprognostica aber werden eben so gut wie das Wetter nach den Mondwechseln berechnet, und dieses Zusammenwerfen des Wetters und der Politik hat gewiß eine tiefe humoristische Wahrheit für eine Zeit, wo das Staatsregiment noch wie eine andere göttliche Weltordnung über den Häuptern der Unterthanen stand. Die Staatsprognostica sind meist in delphischem Doppelsinn abgefaßt: Epigramme und Sinnsprüche, die man damals von Lessing bis zu den Kalenderschreibern herab viel selbständiger kultivirte als heutzutage, dazu aber auch allegorische Räthselspiele in Holzschnitten, die mit mythologischen Figuren, Wappen und Devisen überdeckt sind. Letzteres deutet auf das siebzehnte Jahrhundert zurück, wo nicht nur der Gelehrte, sondern auch der schlichte Bürger sich an derlei harten Nüssen gern die Zähne ausbrach. Auf den zahllosen fliegenden Blättern dieser früheren Zeit ist die politische Satyre fast immer in allegorischen Gestalten versteckt, und selbst der Handwerker muß in den Tagen des dreißigjährigen Krieges oft mehr Mythologie im Gedächtniß gehabt haben, als gegenwärtig mancher litterarisch Gebildete. Auch jene Einblattdrucke fanden also ihre letzte Zuflucht in den Volkskalendern, wie denn überhaupt das fliegende Blatt des siebzehnten Jahrhunderts aufgegangen ist zum Theil in der Zeitung, zum Theil im Kalender des achtzehnten. In unsern Tagen hat endlich die letzte Siegerin, die Journalistik, auch die Publicistische Hälfte der alten Kalender in ihrem allverschlingenden Vorrathshause geborgen.
Ganz eigenthümlich sind die »Beschreibungen der Gewitter« im alten Hauskalender gewesen. In diese Vorherverkündigungen aller einzelnen Gewitter des Jahres und die daran geknüpfte Deutung spielt noch das altdeutsche Heidenthum herüber, welches so mancherlei Bezüge des Cultus und der Weissagung im Gewitter fand und den rothbärtigen Donnar nicht blos als einen donnernden Jupiter verehrte, sondern auch als einen Gott des Landmannes und des Ackerbaus. Kein Volk macht sich wohl in Spruch und Fluch so viel mit Donner und Wetter zu schaffen, wie das germanische, und ein Kalender, welcher in den Sommermonaten nicht wenigstens jede Woche ein Donnerwetter aufziehen läßt, wäre vor hundert Jahren gar kein ächter Volkskalender gewesen.
Wollte ein Germanist der Geschichte des Kalenders Schritt für Schritt folgen, so könnte er damit aufs natürlichste eine systematische Darstellung des ganzen deutschen Volksaberglaubens und eines guten Stückes der Volkssitten verbinden. Für eine Zeit, wo man es noch nicht der Mühe werth hielt, über solche Dinge Buch zu führen, ist der Kalender geradezu ein Quellenwerk zur Entwicklungsgeschichte der Volksphantasie.
*
Sollten die Titel der alten Kalender effektvoll sein, dann mußten sie entweder recht martialisch und grauselig klingen, wie etwa der »Kriegs-, Mord- und Tod-, Jammer- und Nothkalender,« oder mysteriös wie »die klugen Sibyllen, ein Zeit- und Wunderkalender« und »die neuen schwedischen Glücks- und Unglückssterne,« oder bombastisch anspruchsvoll wie »der verbesserte und neue europäische Geschichts-, Haus- und Staatskalender,« seltener volksthümlich gemüthlich, wie »der lustige Bauer,« »der hinkende Bote« u. s. w.
In den ehedem so beliebten »Türkenkalendern« ward die Phantasie des deutschen Volkes, welche seit alten Tagen träumt, daß von Osten her ein neuer Völkersturm der Barbaren die abendländische alte Welt in Trümmer stürzen werde, mit unerhörten Gräuel- und Bluthistorien aus den Türkenkriegen gesättigt und aufgeregt. Der gemeine Mann hatte noch starke Nerven, und wo man sie erschüttern wollte, bedurfte es starker Mittel. Ein gemüthlicher Hauskalender ohne Mord- und Todtschlag wäre eine Suppe ohne Salz gewesen. Auf den Titelkupfern durfte es an einer Sonnenfinsterniß und einem langschwänzigen Kometen nicht fehlen, deren unheimlicher Schein etwa im Vordergrund eine Landschaft beleuchtete, und im Hintergrund eine Seeschlacht, zur Rechten eine brennende Stadt und zur Linken ein auffliegendes Schiff. Vielleicht ist hierbei die Wahrnehmung nicht ganz uninteressant, daß die Räuber- und Verbrechergeschichten, welche in der späteren Volkslitteratur eine so große Rolle spielen, vor der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts kaum in den Kalendern vorkommen; man schwelgte damals vielmehr noch in dem Gräuel der Verwüstung durch Krieg und Naturereignisse. Erst nachdem die Ritter- und Räuberabenteuer in der vornehmeren Litteratur der Sturm- und Drangperiode sich eingebürgert hatten, wurden sie allmählig auch in den Kalendern Mode.
Der alte Kalender als Hausbuch wurde erst vollständig durch die fortlaufende Mittheilung der Zeitgeschichte. Unsere Urgroßväter, die doch noch sehr selten eine Zeitung zu Gesicht bekamen, wären in ihrer Kenntniß der gleichzeitigen Weltläufte lediglich auf Gerüchte und örtliche Ueberlieferungen beschränkt gewesen, wenn sie nicht in den besseren Kalendern die politischen Annalen des abgelaufenen Jahres erhalten hätten. Schon aus dieser Aufgabe erhellt übrigens, daß der damalige Volkskalender viel mehr noch auf die große Masse des Bürgerstandes als der Bauern zielte. So spiegelt uns der alte Kalender auch nicht sowohl die Gesittung des Bauern als des Kleinbürgers, und erst in unserer Zeit, wo das Bürgerthum zu einer so viel höheren Stellung aufgestiegen ist, denkt man bei einem Volkskalender zunächst an einen Bauernkalender. Durch ihren historisch-politischen Theil waren nun die Kalender des achtzehnten Jahrhunderts dem Mittelstände dasselbe, was ihm im neunzehnten die Tagespresse geworden ist. Unsere geduldigeren Vorfahren begnügten sich dabei freilich, den Zusammenhang der Weltbegebenheiten erst ein Jahr nachdem selbige vorgefallen waren, zu erfahren, brauchten sich dann aber auch um so weniger mit der Conjecturalpolitik zu plagen. So ging es ganz vortrefflich vor der französischen Revolution; als aber von da an die Geschichte rascher zu schreiten und das Blut auch des gemeinen Mannes wilder zu pulsen begann, konnte der hinkende Bote des Kalenders mit seiner Jahresrundschau nicht mehr nachkommen, und gab Politik und Zeitgeschichte an die Journalistik ab. Dafür nahm er jetzt vom vornehmen Almanach bis zum Dorfkalender herab jenen bunten Kram von Erzählungen und Anekdoten, Gedichten und Räthseln auf, den ihm nach einem Menschenalter abermals die Zeitung, als Feuilleton und Unterhaltungsblatt, streitig machen sollte. So überall um sein Monopol gebracht, hat er heutigen Tages das frühere culturgeschichtliche Interesse fast ganz verloren.
Wenn ich übrigens von dem politischen Inhalt der alten Kalender rede, so ist dabei natürlich nur an den trockensten Bericht der Staatsbegebenheiten, nicht an irgend eine Beurtheilung derselben oder gar an eine tendenziöse Einwirkung auf das Volk zu denken. Auch in dieser Hinsicht hält die Geschichte des Kalenders Schritt mit der Geschichte der Journalistik. An der Stelle, wo jetzt unsere Zeitungen Wahlsprüche führen, wie »Für Freiheit und Gesetz,« »Mit Gott für König und Vaterland« u. s. w., führte der deutsche »Reichspostreiter« damals ja auch nur sein gemüthliches » Relata refero.« Die Art, wie die Zeitgeschichte in den alten Volkskalendern berichtet wird, ist dann freilich oft originell genug, ein redendes Zeugniß für die politische Naivetät selbst der mittleren Bürgerklassen und zugleich für deren Beschränktheit und Kleinigkeitskrämerei. Als sich der zweite schlesische Krieg nach Böhmen gewälzt hatte, kann der Kalenderschreiber nur bedauern, daß dadurch die böhmischen Fasanen in den deutschen Hofküchen sehr rar geworden, da die preußischen Husaren nicht gar säuberlich mit diesem vornehmen Federvieh umgegangen seien. Die mit Holzschnitten illustrirten breiten Schilderungen von Krönungs-, Vermählungs- und Leichenfeierlichkeiten großer und kleiner Potentaten sind klassische Sittenbilder einer Zeit, wo die Idee von Volk und Staat dem Volke selbst nur leibhaftig wurde in der Erscheinung des Fürsten und seines Hofes. Beim Abschluß des Hubertsburger Friedens stellt darum der Kalenderschreiber alle weiteren Betrachtungen über die politische Bedeutung dieses weltgeschichtlichen Ereignisses, wie billig, bei Seite, um für die Schilderung des Umzugs, den der Friedensherold sammt Gefolge in Berlin gehalten, Raum zu gewinnen. Der Herold aber trug einen römischen Helm, einen Küraß mit darüber geworfenem Tigerfell, kurze Hosen, und wie der Kalender wörtlich berichtet, »saubere« weiße Strümpfe. Ein Holzschnitt in einem andern Kalender zeigt uns das Schloß Hubertsburg, aus dessen Thoren zwölf Postillone lustig blasend in die verödete Landschaft hinaussprengen, um den Frieden in alle Welt zu verkündigen, darüber aber schwebt ein Posaunenengel mit dem Spruch: »Des Herrn Gnade hat uns diesen Frieden geschenkt.« So malte man in treuherzig frommer Weise den Hubertsburger Frieden zu einer Zeit, da man die Staatsprognostica – für's Volk – noch gleich dem Wetter nach den Mondwechseln berechnete und da das deutsche Volk seine politischen Schicksale noch gleich dem Wetter in demüthigem Schweigen hinnahm als Fügungen des Herrn.
*
Diese alten Kalender können uns lehren, wie ungerecht wir gegen uns selber sind, indem wir die Gegenwart beschuldigen, daß sie eine größere Kluft als je zuvor zwischen den Gebildeten und dem Volk bestehen lasse. Ein Blick auf das achtzehnte Jahrhundert zeigt das Unwahre dieser Meinung. Von den ungeheuren wissenschaftlichen und litterarischen Reformen dieser ganzen Periode spiegelt sich kaum ein leiser Schimmer selbst in jenen Kalendern, die viel mehr für den Bürger als den Bauersmann bestimmt waren. Niemand wird beim Durchblättern der ledernen zeitgeschichtlichen Annalen dieser Volksbücher ahnen, daß Lessing, Möser, Goethe, Herder, daß so viele bedeutende Philosophen und Historiker gleichzeitig ihre epochemachenden Werte geschrieben. In Styl und Inhalt bleibt sich der Kalender durch's ganze achtzehnte Jahrhundert wunderbar gleich; auch zur Zeit der französischen Revolution steht er noch bei Gottsched, wie damals auch der deutsche Kleinbürger in seinen poetischen Studien noch bei Gellert und Hagedorn stand, obgleich Schiller und Goethe, ja die Begründer der romantischen Schule in den höheren Bildungskreisen bereits das Feld behaupteten. Vereinzelte Versuche, wie von Chr. D. Schubart, für das Volk zu schreiben, zeigten vielmehr, daß zwischen dem Kleinbürger und Bauern und der gediegeneren Litteratur fast alle Anknüpfungspunkte fehlten. Abgesehen davon, daß nur litterarische Handlanger für den Volkskalender arbeiten, hielt es der Kalendermacher nicht einmal der Mühe werth, aus den Werken der besseren Autoren gelegentlich für seine Zwecke zu stehlen, obgleich doch für solche Kleinigkeiten damals noch freie Pürsch bestand. Erst viel später lernte es der Kalender von der Journalistik, aus reicher Leute Leder den Armen Schuhe zu schneiden.
Aehnlich steht es mit den Kalenderbildern, die durch's ganze achtzehnte Jahrhundert äußerst roh, kindisch und geistlos sind. Ein akademischer Künstler hätte am Hungertuche nagen müssen, um sich zu Skizzen für einen Volkskalender herabzulassen. Selbst Chodowiecki, der die Kunst der volksthümlichen modernen Charakterskizze in kleinen Federzeichnungen gleichsam neu wieder entdeckt hatte, berührte in seinen Einflüssen kaum die Sphäre dieser Kalender. Sein fleißiger Nachfolger, Heinrich Ramberg, nahm später auf ein Menschenalter die Zeichnung der Almanachs-Kupferstiche in Pacht und gewann bei der wunderbaren Fruchtbarkeit und Leichtigkeit seines Talents allerdings eine Art culturgeschichtlicher Bedeutung für die Charakteristik der feinen Welt. Allein gerade diese Almanache, die das Bedürfniß einer oberflächlichen litterarischen Unterhaltung tief in den Mittelstand herab verbreiteten, sind das schärfste Widerspiel ächter Volkslitteratur, und obgleich die Kupferstiche meist das Beste an den prunkenden Büchelchen waren, so fiel doch von ihrem ungeheuern Bilderreichthum kein befruchtender Keim in das verkommene Volkskalenderwesen. Als wir neuerdings unsere Volkskalender mit würdigeren Holzschnitten auszuschmücken begannen und auch die besten Meister es nachgerade nicht mehr unter ihrer Würde hielten, für den Kalender zu zeichnen, da konnten die Künstler von den nächst vorhergegangenen Perioden nichts lernen. Sie mußten zu Studien aus den Werken Dürers und Holbeins, der alten Niederländer und der alten Italiener zurückgreifen, ja auf die kostbaren Miniaturen des Mittelalters, wenn sie recht volksthümlich ächte Figuren und Arabesken für den Kalender erfinden wollten. Denn mögen wir auch in der modernen Volkslitteratur noch so viel Verkehrtes begonnen haben, so sind wir doch wenigstens zu der goldenen Einsicht gekommen, daß für das Volk nur gerade das Beste gut genug sei. In diesem Glauben allein werden wir's erringen, daß unsere Bildungslitteratur und Kunst auch dem Volke wieder näher zu Herzen geht.
Vor Alters gab es unter dem gemeinen Mann häufig kalenderfeste Leute wie bibelfeste. Denn der litterarische Inhalt des Kalenders, der jetzt ein zufälliger geworden, war früher ein nothwendiger; es gab zwar auch damals viele Kalender, aber nicht vielerlei wie heute; es existirte der einheitliche Begriff eines deutschen Volkskalenders, der jetzt ganz verloren ist. Der gemeine Mann konnte dem Kalenderschreiber genau nachrechnen, ob er Sitten und Bräuche, Aberglauben und Prophezeihungen richtig angegeben und angewandt, ja er wußte selber eigentlich das Meiste von vornherein auswendig, was er alljährlich im Kalender wieder las; den ganzen volksthümlichen Inhalt des Kalenders hatte er im Kopf wie die Bibel und wußte ihn auszulegen für seine persönlichen Verhältnisse: darum war er kalenderfest. Jetzt klagt man bereits, daß in unsern Volkskalendern alles mögliche Gemeinnützige abgehandelt sei, aber die gemeinnützige Belehrung über den Kalender selbst sei allezeit vergessen, während doch die Zeichen und Begriffe des Kalenders von den Wenigsten mehr verstanden würden! So erschien denn auch vor mehreren Jahren in Ulm ein Buch, betitelt »der wohlerfahrene Kalendermann,« welches bereits einem Bedürfnisse abzuhelfen glaubt, indem es das Volk belehrt über den Kalender. Vor hundert Jahren wäre eine solche Belehrung sehr überflüssig gewesen. Bibel, Gesangbuch und Kalender waren damals wirklich die drei nothwendigen und ausschließlichen Hausbücher des gemeinen Mannes; der Kalender umfaßte alle weltliche Weisheit, wie Bibel und Gesangbuch alle geistliche. Aber diese weltliche Weisheit war nur der Spiegel von des Volkes eigenen Phantasiestücken und Ueberlieferungen. Jetzt ist der Kalender ein Werkzeug der Volksbildung geworden, die von außen sich erst einzuschleichen trachtet bei dem Bauern und Kleinbürger. Darum ist er nicht mehr das einheitliche, nothwendige und ausschließliche Hausbuch. Dennoch könnte er wenigstens den Charakter der inneren Nothwendigkeit wieder gewinnen, wenn er nämlich ausgehend von der Weisheit des Volkes selber und scheinbar nur als ein Herold dessen eigenster Gedanken, dennoch den Keim einer vertieften Gesittung in sich zu bergen und so ein Lehrer des Volkes zu weiden wüßte, indem er doch scheinbar nur ein Spiegelbild desselben wäre. Der Kalenderschreiber aber, welcher dieses Kunststück verstünde, soll ein rechter Hexenmeister genannt und nicht verbrannt werden.