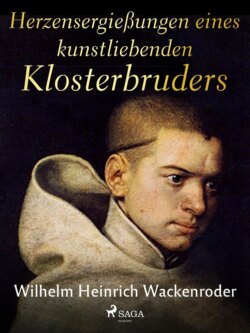Читать книгу Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders - Wilhelm Heinrich Wackenroder - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EIN VORWORT
ОглавлениеWilhelm Heinrich Wackenroder, der 1773 in Berlin geboren wurde, zählt zu den Begründern der frühromantischen Kunsttheorie. Gleichaltrig mit dem Jugendfreunde Ludwig Tieck, ein Jahr jünger als Novalis und Friedrich Schlegel, steht er doch dem Kreise der Romantiker persönlich fern. Sein kurzes Leben verlief äußerlich in den bescheidenen Bahnen des Sohnes aus gutem Hause, der sein Brotstudium vollendete, einem bürgerlichen Beruf zustrebte und ihn nicht eben gern, aber mit Ernst und Gewissenhaftigkeit auszufüllen sich anschickte. Als er, kaum fünfundzwanzigjährig, 1798 starb, lag von ihm nichts vor als die anonym erschienenen, von Tieck herausgegebenen „Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders“. Posthum veröffentlichte der Freund 1799 ein zweites Bändchen: „Phantasien über die Kunst für Freunde der Kunst,“ Zu beiden hat Tieck selbst Aufsätze beigesteuert. Dies und ein starker geistiger Anteil an Ludwig Tiecks Malerroman „Franz Sternbalds Wanderungen“, der unvollendet 1798 erschien, ist Wackenroders Hinterlassenschaft.
So eng dies Leben und so schmal dies Werk erscheinen mag: aus der romantischen Welt ist es nicht mehr wegzudenken. Kann man die Brüder Schlegel mit der Schärfe ihres kritischen Geistes das Hirn der Romantik nennen, so ist Wackenroder ihre Seele, von weiblich reizsamer Empfänglichkeit und untrüglichem Instinkt, von inniger Lauterkeit des Herzens und einer fast wehrlosen Weichheit der Empfindung, die ihn zum Ertasten und Erahnen des Tiefsten in der Kunst befähigte, ihn aber auch am frühesten von allen der Zerstörung preisgab.
Wackenroder hat zum erstenmal Themen angerührt, die seither von Begriff und Wesen der deutschen Romantik nicht mehr zu trennen sind: die altdeutsche Kunst Albrecht Dürers und die altdeutsche Stadt Nürnberg, die Malerei der italienischen Renaissance, vor allem Raffaels, die religiöse Weihe aller Kunst und Kunstbetrachtung, die Verherrlichung der Musik als Sprache der Seele, die unaussprechliche Seligkeit des Schaffens und zugleich die tiefe Gefährdung des Künstlers. Er hat als erster den Blick gleichzeitig auf beide Schwesterkünste der Dichtung, Malerei und Musik, gerichtet und damit einen Grundzug aller Romantik bezeugt: das Streben zur Annäherung und Verschmelzung der Künste, hin zu dem universalen Makrokosmos eines Gesamtkunstwerks, von dem damals Novalis und der Maler Philipp Otto Runge träumten und dessen letzte Frucht Richard Wagners Musikdrama ist. In dieser neuen oder doch erneuerten Fragestellung sind Wackenroders Aufsätze eine der bedeutsamsten Programmschriften der jungen Romantik.
Im Mittelpunkt seiner Kunstanschauung steht die Auffassung der Kunst als Religion, als einer Offenbarung des Göttlichen. Man könnte ihn, wäre das Wort weniger vieldeutig und mißverständlich, einen Mystiker der Kunstbetrachtung nennen; denn seine Einstellung zum Kunstwerk gleicht in Glut und Andacht und inniger Versenkung in vielem dem Verhältnis jener Frommen zu ihrem Gott, der ihnen im Seelengrund erschien.
Zwei wunderbare Sprachen sind uns geschenkt: die der Natur, die uns Gottes Wunder offenbart, und die der Kunst, die zu reden wenigen Auserwählten unter den Menschen vom Himmel gegeben ist, Beide sind heilige Zeichen, „Hieroglyphenschrift“ des Schöpfers und seiner Macht. Bedeutungsvoll nimmt Wackenroder den Begriff der Hieroglyphe auf, den die Geniezeit seit Johann Georg Hamann etwa gefunden und der Romantik überliefert hatte: die heilige Sprache Gottes und seiner Schöpfung, auf die es zu hören und die es zu enträtseln gilt.
Die Kunst hat also höchsten Rang als Künderin Gottes und seiner Wunder, sie ist selbst „eine Art von Schöpfung, wie sie sterblichen Menschen hervorzubringen vergönnt war“.
So fordert denn auch die Betrachtung ihrer Werke die Weihe und Andacht religiöser Übung. Wackenroder beschreibt uns, „wie und auf welche Weise man die Werke der großen Künstler der Erde eigentlich betrachten und zum Wohl seiner Seele gebrauchen müsse“; und dies Wort: „zum Wohl seiner Seele gebrauchen“ verleiht der Kunst ihre religiöse Würde und eine fast sakramentale Bedeutung, Es richtet sich gegen die rationale Bildkritik des vorhergehenden 18. Jahrhunderts, die sich in Wiedergabe des Bildinhalts und in Erörterung der Technik erschöpfte und darüber die Seele des Kunstwerks vergaß. „Bildersäle werden betrachtet als Jahrmärkte, wo man neue Waren im Vorübergehen beurteilt, lobt und verachtet; und es sollten Tempel sein, wo man in stiller und schweigender Demut und in herzerhebender Einsamkeit die großen Künstler als die Höchsten unter den Irdischen bewundern und mit der langen, unverwandten Betrachtung ihrer Werke in dem Sonnenglanze der entzückendsten Gedanken und Empfindungen sich erwärmen möchte.“
Ist die Kunst Geschenk, Sprache und Künderin des Göttlichen, so muß der Umgang mit ihr auch dem Gebete gleichen, das man nicht in irdischer Zerstreuung, sondern zu erhobener Stunde in Sammlung und Stille verrichtet. Nicht das kalte Prüfen und Vergleichen, sondern die Versenkung in die Gemälde ist das allein Wesentliche. „Sie sind nicht darum da, daß das Auge sie sehe; sondern darum, daß man mit entgegenkommendem Herzen in sie hineingehe und in ihnen lebe und atme.“ Damit ist die kritisch-räsonierende, verstandesmäßige Betrachtungsweise der Aufklärungszeit überwunden und eine rein gefühlshafte Erfassung des Kunstwerks an ihre Stelle getreten. Wackenroder geht es nicht mehr wie der früheren Zeit um die Erkenntnis vornehmlich technischer Einzelheiten, über denen das große und einheitliche Ganze verlorenging, nicht um den Aufbau des Bildes und die Zeichnung der Figuren, um Gewänder oder Baumschlag, um Licht und Farben, sondern einzig und allein um das zu religiöser Inbrunst gesteigerte Erleben der Kunst in einem demütigen und verehrenden Herzen.
Von solcher Andacht zum Kunstwerk, von Sammlung und Meeresstille der Seele war zuerst Johann Joachim Winckelmann erfüllt gewesen, dessen Schriften seit 1755 die edle Einfalt und stille Größe und die kanonische Geltung der griechischen Werke verkündeten. Auch in seiner Haltung lebt, bis in die sprachliche Formulierung erweisbar, ein mystisches Element, so griechisch und gott-los vom Christlichen aus gesehen seine Welt- und Lebensanschauung erscheinen mag, und in dieser religiösen Inbrunst des Kunstgenusses ist er in der Tat Wackenroder verwandt. Nur in der Art ihrer Frömmigkeit scheiden sich beide. Winckelmanns erzwungenes Konvertitentum bleibt zeit seines Lebens äußerliche Zutat, welche die antikisch-heidnische Grundsubstanz seines Wesens nicht berührt. Auch er ist Mystiker, vom Neuplatonismus und vielleicht auch von der mächtigen Tradition des heimischen Pietismus befruchtet, aber ihm ist die Schönheit an sich das göttliche Geheimnis, das es zu verehren gilt, die selig in sich selbst ruhende Vollkommenheit der Leiber griechischer Menschen und Götter. Wackenroders Innigkeit fließt zum erstenmal aus christlicher Quelle, ihm ist zuerst das Kunstwerk Offenbarung der Macht und Größe des einen, persönlichen Gottes.
Ein ähnlicher Ton der Ehrfurcht vor den Werken großer Kunst war schon einmal in der Geniezeit erklungen, Goethes Hymnus „Von deutscher Baukunst“ (1773), voller und brausender im Lebensgefühl der Sturm- und Drang-Zeit als die zartere Verhaltenheit des Klosterbruders, steht ihm dennoch in der Grundhaltung nahe und zählt zu den geistesgeschichtlichen Ursprüngen der „Herzensergießungen“.
Diese Auffassung der Kunst als Religion und Gottesdienst bedingt auch Wackenroders Künstlerbegriff, Dreißig Jahre zuvor hatte der Sturm und Drang das Prometheische, die vorbildlose Autonomie und das gottähnliche Schöpfertum des Künstlers entdeckt, der den Mikrokosmos seines Werks in souveräner Freiheit aus dem Nichts erschafft, so wie der größte Künstler, Gott, den Makrokosmos des Alls. Dies Wissen um das unbegreifliche Wunder des Schöpferischen im Menschen bleibt in der Romantik erhalten. Darüber hinaus ist Wackenroders Stellung von seinem Urerlebnis der Göttlichkeit aller Kunst bestimmt, trägt also abermals einen religiösen Zug. Wenn die Kunst göttliche Sprache ist, dann ist ihr Träger geheiligt, Auserwählter und Priester, so wie damals Novalis sagt, daß Dichter und Priester im Anfang eins gewesen seien, oder wie später die Künstlergestalten in Eichendorffs Erzählungen um das Priesterliche ihrer heiligen Berufung wissen.
So sieht es Wackenroder: Ist schon der bloße Genuß des Kunstwerks Gebet und Gottesdienst, zu dem der Mensch in innerer Einkehr und Seelenstille sich rüsten muß, um wieviel mehr ist der dieser Gottessprache Mächtige und mit ihr. Begabte, der Künstler, ein priesterlich Geweihter. Auf das heilige Leben dieser Gottgesegneten kommt es an. Das in den „Herzensergießungen“ so stark hervortretende biographische Element ist keine belanglose oder äußerliche Zutat und auch nicht nur durch die Anekdotenfreudigkeit der Quellen bedingt, sondern ergibt sich notwendig aus der innersten Überzeugung des Verfassers, ist Allerwesentlichstes: diese Lebensläufe sollen beweisen, daß der Künstler auch in seiner äußeren Existenz ein Gesalbter des Herrn ist.
In diesem Sinne schreibt Wackenroder Künstlergeschichte, nicht mit der naiven Stoff- und Sachfreude der alten Chroniken, aus denen er schöpfte, sondern erfüllt von der sentimentalischen Sehnsucht nach der einfältigen Frömmigkeit einer Kunstauffassung, die er in seiner Gegenwart vergebens suchte. Er erzählt das Leben der alten Maler seinen Quellen nach, deren wichtigste die Vitensammlung des Giorgio Vasari (um 1550) ist und von deutschen Gewährsmännern die „Teutsche Akademie der edlen Bau-, Bild- und Malerei-Künste“ des Joachim von Sandrart (1675). Ihnen entnimmt er seinen Stoff, oft wörtlich nacherzählend, häufiger frei bearbeitend. Ein Vergleich mit den Quellen lehrt, daß der Romantiker eben da erweitert und verändert, wo es um die psychologische Vertiefung und das neue Künstlerideal geht, das den alten Berichten notwendig fehlen mußte.
Die mystische Stille der Seele ist die erste und unerläßliche Voraussetzung nicht nur für das Nacherleben und den Genuß des Kunstwerks, sondern auch für seine Empfängnis im Herzen des Schöpfers. Nicht im Sturmwinde, sondern im sanften Säuseln erscheint der Gott. Das ruhelos brausende Leben des Piero di Cosimo, das Wackenroder dem Vasari nacherzählt, ist nicht gottgesegnet: „seine Seele erfreut sich nie, still auf einem Gedanken oder einem Bilde zu ruhen“, und niemals vermochte er, „sich in einfacher und heiterer Schönheit zu spiegeln“. Er kann für Wackenroder kein „wahrhaft echter Künstlergeist“ sein. So wie die Unio mystica sich nur in der. Stille des einsamen Seelengrundes vollzieht, muß auch die Seele des Künstlers ein reiner Spiegel sein. „In dem tobenden und schäumenden Meere spiegelt sich der Himmel nicht; — der klare Fluß ist es, worin Bäume und Felsen und die ziehenden Wolken und alle Gestirne des Firmaments sich wohlgefällig beschauen.“
Mit diesem Ideal der in sich ruhenden, spiegelreinen Stille der Künstlerseele steht Wackenroder in einer geistesgeschichtlichen Überlieferung, die in der deutschen Romantik ihren stärksten Ausdruck fand: bei Novalis und Friedrich Schlegel, bei E. T. A. Hoffmann und Eichendorff und am schönsten vielleicht in Jean Paul Friedrich Richters „Vorschule der Aesthetik“, ja weiter im 19. Jahrhundert bei Eduard Mörike, bei Adalbert Stifter und noch bei Gottfried Keller. Wackenroder gibt diesem romantischen Geniebegriff den Sonderakzent einer nazarenisch-frommen Einfalt und ursprünglichen Kindlichkeit, den er aus den reinen Tiefen der eigenen Seele schöpfte. Wenn Goethe einmal zu Riemer sagt, die Menschen seien nur so lange produktiv in Poesie und Kunst, als sie noch religiös seien, — dann würden sie bloß nachahmend und wiederholend, so spricht dies tiefe Wort Wackenrodets innerste Überzeugung aus: nur in der schlichten Frömmigkeit der alten Zeiten, als Religion, Kunst und Leben noch ungeteilt eins waren, entsteht wahre Kunst.
So stilisieren die „Herzensergießungen“ Leben und Werk der alten Maler; sie geben nicht geschichtliche Wirklichkeit im wissenschaftlichen Sinne, sondern Ideal und frommes Wunschbild, eine sentimentalisch-sehnsüchtige Utopie, projiziert in die romantische Ferne vergangener Jahrhunderte. Am bezeichnendsten sind dafür die Anekdoten der „Malerchronik“, die fast alle von der unbegreiflich hohen Würde der Kunst und von der demütigen Frömmigkeit ihrer Träger berichten: so wenig historische Wahrheit wie Winckelmanns Antikenbild oder Klopstocks Vorstellung von germanischer Frühe, aber wie diese eine große Fiktion, von befruchtender Wirkung auf den Geist der romantischen Kunst.
Wackenroders Wahl seiner Gegenstände ist durch diese Haltung bestimmt. Seine Welt sind die italienischen Maler der Renaissance, vor allem der Hochrenaissance: Michelangelo, Lionardo und Raffael, ihre Zeitgenossen Piero di Cosimo, Francesco Francia, Albertinelli, spätere wie Carracci, Domenichino und sogar schon der von E. T. A. Hoffmann so geliebte Franzose Jacques Callot. Daneben werden ältere Künstler, Giotto und Fra Angelico da Fiesole, nur flüchtig erwähnt, und von altdeutschen Gestalten erscheint nur Albrecht Dürer.
Dies ist Wackenroders enges Pantheon, verklärt von jener romantischen Sehnsucht zur Frühe, von der wir sprachen, zurück in ein erträumtes goldenes Zeitalter des ersten Anfangs und Neubeginns, einer ersten, paradiesesnahen Ursprünglichkeit und frommen Einfalt des Lebens. Vor allem ist. es der „göttliche Raffael“, dessen Name mit einer religiösen Weihe und ehrfürchtigen Scheu immer wieder genannt wird, zum erstenmal mit diesem Nachdruck. Wohl hatte schon das 18. Jahrhundert den Meister anerkannt und namentlich die technische Vollendung seiner Gemälde bewundert, und tiefer schürfend preist Winckelmanns Erstlingsschrift über die Nachahmung der griechischen Werke von 1755 die selig ruhende göttliche Stille im Antlitz der eben für Dresden gewonnenen Sixtina. Aber so feierlichen Klang gewinnt Raffaels Name erst jetzt als Inbegriff des romantischen Künstlerideals. Bei Wackenroder beginnt seine Stilisierung in das Nazarenisch-Fromme und Einfältige hinein, das sich in der Spätromantik steigert und in J. D. Passavants großer Lebensbeschreibung (1839 ff.) einen späten Höhepunkt findet.
In dieser Verherrlichung der italienischen Malerei lebt neben dem Drang zur Frühe als zweites romantisches Herzthema das Südweh des Zeitalters, die Italiensehnsucht aus nordischer Dunkelheit heraus, für die Goethes Hégire nach Rom das größte Beispiel bildet. Auch Wakkenroder hat dieses Fieber gekannt, wenngleich es ihn nicht mit der verzehrenden Stärke packte wie andere Romantiker. Er plante in der Göttinger Zeit eine Italienfahrt zu dritt mit Tieck und dessen Freund Burgsdorff, eine Flucht in den Süden wie Eichendorffs Helden und alle die romantischen Maler: er selbst wollte als Musiker, Tieck als Dichter in Rom leben. Es ist vielleicht kein bloßer Zufall, daß sich der Plan zerschlug und wohl Tieck in späteren Jahren, aber nie Wackenroder den Weg in den italienischen Hörselberg fand. Bezeichnend, daß diejenigen Beiträge in den „Herzensergießungen“, die diesen Gedanken aussprechen („Sehnsucht nach Italien“ und „Brief eines jungen deutschen Malers in Rom an seinen Freund in Nürnberg“), nicht von ihm, sondern von Tieck verfaßt sind; und Tieck ist es auch, dessen Künstlerroman „Franz Sternbalds Wanderungen“ das Thema des nach Rom pilgernden altdeutschen Malerjünglings dichterisch gestaltet.
Wackenroder ist der Südverzauberung nicht erlegen wie so manche Künstler seiner Zeit. Er hat sich wie Philipp Otto Runge oder Caspar David Friedrich auch hier seine Selbständigkeit bewahrt. Ihm scheint es gut, daß sein Albrecht Dürer nicht den Weg nach Rom und zu Raffael gefunden hat: „Er würde nicht er selber geblieben sein; sein Blut war kein italienisches Blut.“
So steht in den „Herzehsergießungen“ neben den Malern der italienischen Renaissance die altdeutsche Kunst, neben dem göttlichen Raffael die symbolhafte Gestalt Albrecht Dürers als Inbegriff deutschen Wesens. Auch Wackenroders Dürerverehrung nimmt ein Thema auf, das nach und neben der Verkennung durch den Rationalismus des 18. Jahrhunderts die Sturm- und Drang-Zeit ein Menschenalter vorher zuerst angeschlagen hatte. Was aber in den Briefen und Äußerungen des jungen Goethe etwa oder in einem noch vorsichtig verteidigenden Aufsatz seines Darmstädter Freundes Merck nur zögernd anklingt, das ist in den Bekenntnissen des Klosterbruders voll entwickelt: jener Ton begeisterter Verehrung, der von da an in dem Dürerbild der deutschen Romantik nicht mehr verklingt.
Zwar ist es durchaus nicht so, als solle nun die altdeutsche Kunst die italienische verdrängen oder auch nur höher gewertet werden als jene. Nur ein einziger Aufsatz ist in der Erstausgabe der „Herzensergießungen“ dem Nürnberger Meister gewidmet (erst später kommt die „Schilderung, wie die alten deutschen Künstler gelebt haben“ hinzu). Und eben in diesem vielberufenen „Ehrengedächtnis“ tritt der altdeutsche Maler zwar völlig gleichberechtigt neben den großen Italiener, aber jede Übersteigerung oder Verabsolutierung liegt dem Frühromantiker fern. Dürer steht neben Raffael, nicht an seiner Stelle, und in dem Traumgesicht, das den Aufsatz beschließt, erscheinen die beiden Großen, vom Himmel herabgestiegen, Hand in Hand.
Einer der wesentlichsten und eigentümlichsten Gedanken von Wackenroders Kunstanschauung tritt hier zutage: die Forderung der Toleranz. Nicht die einseitige Überwertung der Kunst, sei es des eigenen, sei es des fremden Volkes, ist sein Wille und Ziel, sondern die Verteidigung der Gleichberechtigung beider. Sichtlich spüren wir den Einfluß Johann Gottfried Herders, der zum erstenmal in Deutschland historisches Verstehen jeder geistesgeschichtlichen Erscheinung aus Zeit und Raum heraus gelehrt und die Entwicklung der Menschheit als eine Fuge aufeinanderfolgender und ineinanderverschlungener, aber selbständiger und gleichwertiger Völkerstimmen begriffen hatte.
Aber auch dieser Toleranzgedanke ist bei Wackenroder religiös verankert. Wenn die Kunst heilige Sprache und Gottesgeschenk ist, dann sind auch alle ihre Ausdrucksformen gleichberechtigt und gleich wertvoll, alles Stimmen der Geschöpfe Gottes, und keine darf auf Kosten der andern mißachtet werden. Diesen Sinn hat der für Wackenroders Denken ungemein aufschlußreiche Aufsatz: „Einige Worte über Allgemeinheit, Toleranz und Menschenliebe in der Kunst“, dem später in den „Phantasien“ noch ein zweiter, ähnlicher, folgt. So wie alle Dinge und Geschöpfe der Natur Gott angehören und sein Lob verkünden, ein jedes mit seiner anerschaffenen Stimme und nach seiner besonderen Art, ein jedes Ihm zum Wohlgefallen, so hat auch die Kunst aller Völker und aller Zeiten ihr Recht und ihren Wert, weil jede in ihrer Zunge doch die eine Sprache des Schöpfers spricht. „Er erblickt in jeglichem Werke der Kunst unter allen Zonen der Erde die Spür von dem himmlischen Funken, der, von ihm ausgegangen, durch die Brust des Menschen hindurch, in dessen kleine Schöpfungen überging, aus denen er dem großen Schöpfer wieder entgegenglimmt. Ihm ist der gotische Tempel so wohlgefällig als der Tempel der Griechen; und die rohe Kriegsmusik des Wilden ist ihm ein so lieblicher Klang als kunstreiche Chöre und Kirchengesänge.“
So stehen auch Nord und Süd, deutsche und italienische Kunst gleichberechtigt nebeneinander, verschiedene Stimmen der einen großen Kunst zum Lobe des Himmels. „Liegt Rom und Deutschland nicht auf einer Erde? Hat der himmlische Vater nicht Wege von Norden nach Süden wie von Westen nach Osten über den Erdkreis geführt? Ist ein Menschenleben zu kurz? Sind die Alpen unübersteiglich? — Nun, so muß auch mehr als eine Liebe in der Brust des Menschen wohnen können.“ Fern jeder deutschtümelnden Überspitzung wird im Düreraufsatz diese Meinung zum Schluß ausgeprochen: „Nicht bloß unter italienischem Himmel, unter majestätischen Kuppeln und korinthischen Säulen — auch unter Spitzgewölben, kraus-verzierten Gebäuden und gotischen Türmen wächst wahre Kunst hervor.“
Neben der neuen Wertung Dürers ist Wackenroders zweite romantische Tat die Entdeckung der altdeutschen Stadt. Zu Pfingsten 1793 unternahmen die beiden zwanzigjährigen Studenten von Erlangen aus jene berühmte Reise nach Nürnberg, die einen Markstein in der Rückwendung der Romantik zur deutschen Vergangenheit darstellt. Wir besitzen von diesen mehrfach wiederholten Wanderungen ein zweifaches Zeugnis des Dichters: einmal die für die Eltern, zumal für den Vater, einen typischen Vertreter der älteren Generation des Rationalismus, bestimmten Reisetagebücher des Dichters, und zweitens als einziges poetisches Denkmal eben das „Ehrengedächtnis unsers ehrwürdigen Ahnherrn Albrecht Dürers“, von dem schon öfter die Rede war.
Aber wie verschieden ist der Ton in beiden! Die Reisebriefe: brav, vorsichtig und fast ein wenig ängstlich, wohlerzogen alles Wissenswerte aufzeichnend, vor allem auch volkswirtschaftliche Einzelheiten, im Sinne der üblichen Bildungsreise des 18. Jahrhunderts, und noch ganz ohne romantischen Enthusiasmus und Überschwang. Wie nüchtern wird der Eintritt in Nürnberg beschrieben: „Die Stadt hat wegen der vielen schwarzen, mit gotischem Prunk an Bildern und Zieraten reich überladenen Kirchen, wegen der alten, ganz von Quadern gebauten, festen Häuser, die häufig mit Figuren von Menschen und Tieren bemalt und auch mit sehr alten Basreliefs in Stein geziert sind, ein antikes, abenteuerliches Ansehen. Aber sowohl aus- als inwendig scheinen mir doch fast alle Häuser keine Spur von modernem Geschmack zu haben. Keine einzige neumodische Fassade. Die Haustür ist oft klein und schwarz und fast immer verschlossen. Man klingelt, sie springt auf; man geht durch dunkle Winkel eine schlechte Treppe hinauf und findet selbst Männer wie Herrn von Murr und Herrn Schaffer Panzer in Zimmern, die durch eine Bibliothek angenehm werden, an Fenstern mit kleinen runden Scheiben nach dem Hofe oder einem Gäßchen zu sitzen.“ Das hätte fast jeder Reisende damals schreiben können. Ganz anders der Ton der „Herzensergießungen“! „Nürnberg, du vormals weltberühmte Stadt! Wie gerne durchwanderte ich deine krummen Gassen; mit welcher kindlichen Liebe betrachtete ich deine altväterlichen Häuser und Kirchen, denen die feste Spur unsrer alten vaterländischen Kunst eingedrückt ist! Wie innig lieb’ ich die Bildungen jener Zeit, die eine so derbe, kräftige und wahre Sprache führen!“
Das ist jener beseelte Klang, der weiterschwingt in dem Nürnbergbild der Romantiker: bei Ludwig Tieck, E. T. A. Hoffmann und dem Schwaben Justinus Kerner, bei dem Maler Ludwig Richter und — ein spätromantischer Ausklang — in den Alt-Nürnbergischen Geschichten „Norika“ (1829) des Dichters und Kunsthistorikers August Hagen. Nun wird Nürnberg gleichsam zum Symbol romantischer Begeisterung für die altdeutsche Zeit, nach der seit dem Sturm und Drang die Sehnsucht ging. In diesem Geiste Wackenroders wurde 1828 in Nürnberg Dürers dreihundertster Todestag als Fest der romantischen Künstler gefeiert, von dem uns die Lebenserinnerungen Ludwig Emil Grimms berichten, auch das eine späte Frucht der „Herzensergießungen“.
Es ist lehrreich, nach dem Umfang des tatsächlichen historischen Wissens und der Anschauung zu fragen, die Wackenroder für seine Aufgabe mitbrachte. Er hat die verherrlichte altdeutsche Zeit als Bildungserlebnis wohl am frühesten und gründlichsten im Schrifttum kennengelernt. Sein Lehrer war der Berliner Prediger Erduin Julius Koch, dessen Fleiß und Gelehrsamkeit wir ein erstes, noch heute unverächtliches bibliographisches Kompendium der deutschen Literatur verdanken. Durch dessen literargeschichtliche Vorlesungen angeregt, hat sich Wackenroder mit der älteren Dichtung beschäftigt, und noch in der Göttinger Zeit hat er für Koch gelesen und exzerpiert. So lernt er die schon im frühen 18. Jahrhundert von dem Schweizer Bodmer wiederentdeckten Minnesänger in der Manesseschen Handschrift kennen, die der allzeit betriebsame Tieck dann neu bearbeitete. Andere altdeutsche Dichtungen folgen, er liest Teile der Edda und den unvermeidlichen Ossian. Wir besitzen von Wackenroder das Bruchstück einer Studie über Hans Sachs, auch einen der Lieblinge des jungen Goethe, das uns den eindringlichen Ernst dieser Beschäftigung verrät. Alles das gehört in den Umkreis der Bestrebungen um die Neubelebung altdeutscher Dichtung, die im 18. Jahrhundert beginnen, in der Romantik von den Brüdern Schlegel und Tieck, Arnim, Brentano und Görres fortgesetzt werden und die dann schließlich bei den Brüdern Grimm, Ludwig Uhland, ihren Altersgenossen und Nachfolgern, zur spätromantischen Begründung der Wissenschaft vom Deutschtum, der Germanistik, führen. In dieser sogenannten Deutschen Bewegung hat auch Wackenroder seinen bescheidenen Platz.
Die Werke der bildenden Kunst, die der Dichter aus eigener Anschauung kannte, sind auch für die damalige Zeit an Zahl nicht eben groß. Von den bedeutenden Galerien seiner Zeit hat er Kassel und Dresden gesehen, hat die von Anton Ulrich von Braunschweig angelegten Sammlungen in dem Lustschloß Salzdahlum bei Hannover kennengelernt, die hauptsächlich Niederländer und späte Italiener enthielten, und am häufigsten besuchte er von Erlangen aus die im 18. Jahrhundert sehr angesehene Gemäldegalerie auf Schloß Weißenstein bei Pommersfelden im Fränkischen, in der ebenfalls Niederländer, italienische Spätrenaissance und Barock am stärksten vertreten waren. Von alledem wird in Briefen und Selbstzeugnissen nur Pommersfelden ausführlicher erwähnt, und wir wissen nicht, welche Wirkung etwa Dresden auf ihn ausübte, wo fast gleichzeitig mit Wackenroders Buch das Gemälde-Gespräch des Schlegel-Kreises entstand; So kannte er die Präraffaeliten und auch die deutsche Kunst vor Dürer so gut wie gar nicht, und auch seine beiden Lieblinge doch nur ungenau, zumal die Pommersfeldener Madonna, die ihn so entzückte, heute nicht mehr als Raffaels Werk gilt.
Diese geringen Kenntnisse sind vielleicht nicht nur auf den Mangel an Anschauungsmöglichkeiten zurückzuführen. Wackenroder ist überhaupt seinem Wesen nach kein Augenmensch, zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt wie Goethe oder Wilhelm Heinse oder auch nur wie Winckelmann. Er ist kein visueller Typ: stilistische oder formale Beobachtungen suchen wir in seinen Bildbetrachtungen vergebens, und zu der Entwicklung dieser Seite der werdenden Kunstwissenschaft konnte er nichts beitragen. Ihm kommt es, wie den meisten Romantikern, nicht auf Komposition und Stil, sondern ausschließlich auf Gehalt und Idee des Bildes an, ja, sein Kunsturteil ist zum guten Teil durch außerästhetische Faktoren bestimmt. Die christliche Gesinnung, die ein Gemälde in sich trägt und ausstrahlt, ist ihm oft wichtiger als sein rein künstlerischer Wert, die sittliche Wirkung bedeutsamer als die ästhetische. Das ist eine grundsätzliche Gefahr aller dilettantischen Kunstbetrachtung, die eben damals August Wilhelm Schlegel an den kunstkritischen Schriften des Klassizisten Georg Forster scharfsichtig bemerkt hatte.
So kommt es, daß in den „Herzensergießungen“ und auch in den „Phantasien“ kaum je ein Bild wirklich beschrieben wird, und wo es ja einmal geschieht wie in der ausführlichen Schilderung der Pommersfelder Muttergottes in den Reisetagebüchern, da ist alle Angabe des sinnlichen Details der Herausarbeitung der Idee untergeordnet. Wichtiger fast als alle unmittelbare Anschauung ist für ihn die Anregung, die er aus Lehre und Büchern geschöpft hat, in Studien bei dem Göttinger Kunsthistoriker Johann David Fiorillo und aus den alten Quellenwerken zur Geschichte der Künste, die wir oben erwähnten.
Man darf also sagen, daß diese vielleicht bedeutsamste und folgenreichste Leistung frühromantischer Kunstbetrachtung weit mehr von der Idee als von der Erfahrung bestimmt war. Wackenroders Bild vom goldenen Zeitalter der altitalienischen und altdeutschen Malerei ist so wenig real — wir haben es oben angedeutet — wie Winckelmanns Griechentraum, mehr sehnsüchtiges Wunschbild als wirklichkeitsgesättigte Schilderung aus der Fülle der Anschauung.
Der Verzicht auf Beschreibung von Bildinhalt und technischen Einzelheiten ist nach alledem folgerichtig und fast selbstverständlich. „Ein schönes Bild oder Gemälde ist meinem Sinne nach eigentlich gar nicht zu beschreiben“, sagt der Klosterbruder, „denn in dem Augenblicke, da man mehr als ein einziges Wort darüber sagt, fliegt die Einbildung von der Tafel weg und gaukelt für sich allein in den Lüften. Drum haben die alten Chronikenschreiber der Kunst mich sehr weise gedünkt, wenn sie ein Gemälde bloß ein vortreffliches, ein unvergleichliches, ein über alles herrliches nennen; indem es mir unmöglich scheint, mehr davon zu sagen.“
Auch das ist eine Neuentdeckung nicht nur Wackenroders, sondern der ganzen Frühromantik und ihres unmittelbaren Vorgängers Karl Philipp Moritz. Es ist grundsätzlich unmöglich, das Wesentliche eines Werkes der bildenden Kunst in prosaischer Beschreibung wiederzugeben. Beschreiben läßt sich wohl die äußere Schale: Gegenstand, Inhalt und Behandlungsweise; aber der Kern, die Seele einer solchen lebendigen Einheit ist so nicht zu erfassen.
Eines der tiefsten Probleme der deutschen Romantik, ja des menschlichen Seins überhaupt, ist damit berührt: wie ist Mitteilung, Übermittlung, Übersetzung möglich? Diese Frage der Übersetzbarkeit in jedem Sinne: des Gedankens in das Wort und der Mitteilung des Gedankens oder Gefühls von Mensch zu Mensch, der Übersetzung von einer Sprache in die andere, von einer Kunst in die andere — sie ist den Romantikern zum erstenmal brennend und im eigentlichen Sinne frag-würdig geworden. In diesem geistesgeschichtlichen Zusammenhang steht das Problem der Beschreibung von Kunstwerken und der romantische Verzicht auf die Nacherzählung im prosaischen Wort. Ein Kunstwerk kann nur durch ein Kunstwerk wiedergegeben werden. Der in sich geschlossene Organismus eines Gemäldes, einer Statue, eines Gebäudes, ist nur „übersetzbar“ durch ein adäquates Gebilde der Wortkunst, durch den gleichgesetzlichen Organismus einer Dichtung, durch das kleinste und geschlossenste Sprachkunstwerk, durch das lyrische Gedicht. Von der prosaischen Gemäldebeschreibung des 18. Jahrhunderts — selbst Winckelmanns gehämmerte Plastikschilderungen werden ihr verdächtig — geht die Frühromantik zum Gemäldegedicht über, So ist es bei Wackenroder selbst, so bei A. W. Schlegel und der Unzahl späterer Nachfolger. Nicht zufällig wird das strengste und zuchtvollste lyrische Gebilde überhaupt, das Sonett, zur Lieblingsform dieser Art von Kunstdeutung. Die prosaische Beschreibung ist damit in den Kunstschriften der Romantik nicht zu Ende, aber doch in ihrer grundsätzlichen Bedeutung eingeschränkt.
Auch Wackenroder verzweifelt beim Anblick der Madonna zu Pommersfelden daran, die Fülle seines heißen Herzens in Worten auszudrücken: „zerreiße meine Worte, wer das Götterbild sehen kann, und zerschmelze in Wonne, wer es sieht.“ Die Gemäldegedichte der „Herzensergießungen“ verzichten auf alle dingliche Beschreibung und drücken nur in monologischer Rede, ähnlich den Spruchbändern der alten Gemälde, Seelenzustand und Gefühle der dargestellten Personen aus. Maria und das Jesuskind, der kleine Johannes und die Weisen aus dem Morgenlande sprechen in einfältiger Ergriffenheit von den Wundern ihres Herzens.
In diesem durch Anlage und Kunstwillen, Zeitgebundenheit und Lebensenge begrenzten geschichtlichen Raum bewegen sich Wackenroders Schriften. Es ist leicht, ihm nachzurechnen, was alles er nicht sah. Einseitigkeit und Teilblindheit ist ein fast notwendiges Merkmal des Genies, und oft erwachsen aus der Beschränkung die tiefsten Erkenntnisse und die stärksten Anregungen.
Daß er, im Gegensatz zur deutschen Klassik, kein Organ für die Plastik besaß, teilt er mit der ganzen Romantik. Er hat auch mit Ausnahme des einen, ganz undinglichen Aufsatzes über die nie erblickte Peterskirche in Rom keine Architektur beschrieben. Wenn die seit Goethes Erwin-Lobrede und Wilhelm Heinses Schilderungen lebendige, in der Romantik gipfelnde Gotik-Begeisterung in seinen Schriften keinen sichtbaren Ausdruck findet, so liegt das zum Teil darin begründet, daß er die großen deutschen Dome und erst recht die französischen Kathedralen nie gesehen hat und also nirgends aus lebendigem Eindruck schöpfen konnte. Vielleicht auch, daß ihm auf dem Gebiet der Baukunst Vorbildung und Anstoß von außen mehr als sonst fehlten. Die Berührung mit dem wenig älteren und ebenfalls ganz jung gestorbenen Architekten Friedrich Gilly, dem Entdecker der Marienburg, in dessen Werk sich wie bei seinem Schüler Schinkel klassische und romantische Elemente mischen und den Wackenroder mit hoher Begeisterung nennt, war wohl doch zu flüchtig, um nachhaltig zu wirken.
Erstaunlicher mag es dem nicht historisch Denkenden erscheinen, daß Wackenroder an einer anderen Kunst vorüberging, die er allerdings aus lebendigstem Erlebnis kannte: dem fränkischen Barock, der Kunst des süddeutschen Katholizismus. Wackenroder hat Bamberg und Bayreuth gesehen, das Schloß zu Pommersfelden mit dem auch damals berühmten Treppenhaus, das freilich auch seine Reisenotizen „herrlich“ nennen, und Kloster Banz bei Bamberg: das heißt vornehmlich Werke der Barockarchitektenfamilie Dientzenhofer, Er, der norddeutsche Protestant, hat auch die geistige Atmosphäre kennengelernt, in und aus der diese Bauten leben, das katholische Volksleben Süddeutschlands. In seinen Reiseberichten finden wir ausführliche Schilderungen dieser ihm so neuen und sichtlich fremden Welt, etwa der augensinnlichen Buntheit einer Prozession oder eines Hochamts im Bamberger Dom. Es ist müßig, nach katholisierenden Neigungen bei Wackenroder zu suchen oder gar mutmaßen zu wollen, ob er bei längerer Lebensdauer die Schar der romantischen Konvertiten vermehrt haben würde. Die unbefangene, schlichte Frömmigkeit des Klosterbruders ist nicht an konfessionelle Grenzen gebunden, und den „Brief eines jungen deutschen Malers in Rom an seinen Freund in Nürnberg“, eines Jünglings, der ähnlich wie Schillers Mortimer unter dem überwältigenden Eindruck der sinnlichen Pracht und Gewalt des katholischen Gottesdienstes zum Papsttum übertritt, hat wieder der beweglichere Tieck geschrieben. So reich die Anregungen im Frankenlande flossen: das Wesen der Barockarchitektur bleibt Wackenroder ebenso fremd wie die Denkmäler romanischer oder gotischer Plastik, die ihm in Bamberg oder Nürnberg begegnen. Gewissenhaft notieren die Tagebücher wie anderes so auch bautechnische Einzelheiten, aber es bleiben aufgezeichnete „Merkwürdigkeiten“ des Bildungsreisenden, die nicht zum seelischen Erlebnis anverwandelt werden, und der hymnische Ton, den wir aus den „Herzensergießungen“ kennen, klingt in den Selbstzeugnissen fast nur einmal auf, als der Dichter vor dem lieblichen Wunder der Madonna zu Pommersfelden steht, die seine Zeit noch dem geliebten Raffael zuschrieb.
Den Geschichtskundigen wird solches scheinbare Versagen nicht überraschen. Es ist die Blindheit einer ganzen Epoche, eine Tatsache von geistesgeschichtlicher Notwendigkeit. Die Entdeckung der Barockkunst ist ein viel jüngeres Ereignis. Erinnern wir uns, daß noch Jacob Burckhardt, dem niemand Mangel an anschauender Kraft vorwerfen wird, in ihr lange Zeit nichts zu sehen vermochte als einen verwilderten Dialekt der Renaissance. Erst in Burckhardts Spätzeit macht sich eine leise Umwertung bemerkbar, aber die volle kunst- und auch dichtungsgeschichtliche Würdigung — und nicht selten nun Überwertung — des Barocks ist erst eine Tat der letzten Jahrzehnte.
Daß diese süddeutsche, katholische Luft für den Dichter dennoch von größter Bedeutung war, hat Richard Benz gezeigt. Sie lehrte ihn das Verständnis für eine gewachsene und ursprüngliche Kultur, in der noch Leben, Kunst und Religion verschmolzen und eins waren und aus deren Mutterboden die Kunst mit allen Wurzeln Nahrung sog. An der Kunst des Barocks und Rokokos — trotz vereinzelter Worte der Anerkennung und selbst Bewunderung — vorüberzugehen, war Wackenroders Zeitschicksal; dennoch sind die „Herzensergießungen“ auch insofern eine Frucht des süddeutschen Aufenthalts, als sie dies Erlebnis eines geschlossenen kulturellen Ganzen auf die Zeit und die Künstler der italienischen und deutschen Renaissance übertragen.
Endlich erscheint es merkwürdig, daß ein romantisches Herzthema so ganz in diesen Aufsätzen zurücktritt: die Landschaft, die bei den Malern Runge und Friedrich zum Ausdruck ihrer religiösen Gefühle wurde und die aus der romantischen Dichtung, Wissenschaft und Philosophie nicht wegzudenken ist. Wackenroder scheint, ähnlich wie etwa Hoffmann, kein tieferes Naturgefühl besessen zu haben, und erst in Tiecks Roman „Sternbald“ ist von einer symbolischen und religiösen Landschaftsmalerei die Rede.
Die zweite Macht, die das kleine Buch beschwört, ist die Musik. Wackenroder hat eine ziemlich gründliche musikalische Ausbildung genossen. Er wurde von Fasch, dem Begründer der Berliner Singakademie, unterrichtet und hat später auch bei Goethes Altersfreund Zelter Kompositionsstudien getrieben, er verkehrte zusammen mit Tieck in dem musikfrohen Hause des damaligen Berliner Opernkapellmeisters Johann Friedrich Reichardt, der als Liederkomponist namentlich Goethescher Texte bekannt wurde, er hat schließlich in Göttingen bei. dem dortigen akademischen Musikdirektor und Musikhistoriker Johann Nikolaus Forkel, dessen etwas späteres Buch über Johann Sebastian Bach (1802) auch ein Zeugnis romantischen Geistes ist, seine musikgeschichtlichen Kenntnisse erweitert. So darf er uns im alten, guten Sinne als Kenner und Liebhaber gelten.
Auch die Musikanschauung Wackenroders ist wie seine Auffassung der bildenden Kunst bestimmt durch eine antirationalistisch-gefühlshafte Einstellung, die, historisch gesehen, wieder im Gegensatz zu der überwiegend das Handwerkliche und Technische betreffenden Musikkritik vor 1800 steht. Stärker noch als in den Betrachtungen zur bildenden Kunst wird hier ein autobiographisches Element sichtbar. Das schmerzlich-süße Leben des Joseph Berglinger, sein Leiden an der Kunst und für die Kunst, sein zerstörender Zwiespalt und sein früher Tod, ist die Geschichte von Wackenroders eigener Seele und sein eigenes, erahntes Schicksal. Er hat wie sein Held unter dem Generationsgegensatz zum Vater gelitten, und Berglingers Urkonflikt zwischen heiliger Kunst und profaner Weltwirklichkeit ist der seine.
Dies ist der Ausgangspunkt für seine Musikanschauung: auch die Tonkunst ist göttliche Eingebung und heilige Sprache, die, rätselvoll und unerklärlich, das in Worten Unsagbare auszudrücken vermag. Nur sie ist unmittellbare Aussprache des Gefühls. Das menschliche Wort kann die Vorgänge in der Seele nur benennen und über sie reden: die Musik ist die Empfindung selbst, sie allein hat die Kraft, den Strom in den Tiefen des menschlichen Gemüts unmittelbar zu erfassen. „Die Sprache zählt und nennt und beschreibt seine Verwandlungen in fremdem Stoff; — die Tonkunst strömt uns ihn selber vor. Sie greift beherzt in die geheimnisvolle Harfe, schlagt in der dunkeln Welt bestimmte dunkle Wunderzeichen in bestimmter Folge an — und die Saiten unsers Herzens erklingen, und wir verstehen ihren Klang.“
Aber die Musik ist Wackenroder nicht nur Sprache der menschlichen Seele und ihrer Schmerzen und Freuden, sie ist zugleich Ursprache, Urlaut der Natur. „Alle tausendfältigen lieblichen Melodien, welche die mannigfaltigsten Regungen in uns hervorbringen, sind sie nicht aus dem einzigen, wundervollen Dreiklang entsprossen, den die Natur von Ewigkeit her gegründet hat?“ Von dieser Geistermusik der Natur hat auch E. T. A. Hoffmann oft gesprochen, es ist romantischer Glaube, und das musikalische Gegenstück zu Wackenroders Worten ist das Rheingold-Vorspiel des Spätromantikers Richard Wagner, wo alles Leben der Töne aus dem Urlaut des Wassers, dem wogenden Es-dur-Dreiklang des Eingangs, aufsteigt. Die Landschaft hat ihre eigene, geheimnisvolle Stimme, die der begnadete Mensch wecken und erlösen kann, und die Welt fängt an zu singen, wie Eichendorffs Verse es aussprechen, wenn er das Zauberwort kennt. Deutete doch die Romantik selbst die Töne der vom Menschen aus Holz oder Metall, den Stoffen der Natur, geschaffenen Instrumente so als Naturlaut, entbundene und erlöste Stimmen der Schöpfung.
Mehr noch als jeder andere Künstler ist für Wackenroder-Berglinger der Musiker ein von Gott Geheiligter und Berufener und seine Kunst Gottesdienst. Noch nie zuvor war das psychologische Problem des Künstlers so tief erfaßt worden wie in Wackenroders Musikaufsätzen: eine spezifisch romantische Fragestellung. Die überwältigende Wirkung der Tonkunst auf die Seele ist das Hauptthema, das Hören und innerliche Verarbeiten der Tonfluten, das Leben mit und in jener Musik, von der Berglinger sagt, daß sie ihn innerlich erschlaffe und verzehre — das gleiche Geständnis kehrt in Wackenroders Briefen an Tieck wieder —, aber auch, daß sie ihn von der Welt scheide und wie auf Flügeln zum Himmel erhebe. Von dieser überirdischen Macht erzählt das den „Phantasien“ eingefügte „Märchen von einem nackten Heiligen“, der, ein Spiegelbild romantischer Künstlertragik, auf Erden gequält und zerrissen wie Sankt Antonius in seinen Versuchungen, durch die Gewalt der Musik erlöst wird und zum Himmel auffährt.
Eben weil die Musik für Berglinger das Heiligste ist, wird der Widerspruch zwischen ihr und dem menschlichen Alltag sein schmerzlichstes Erlebnis: ein romantisches Thema auch dies, das nachmals von Hoffmann vertieft wurde. Denn Berglingers eigentliches Leid und immer wiederholte Klage ist die Roheit, Gleichgültigkeit und Verständnislosigkeit der Welt, die ihn umgibt — wir denken an Hoffmanns Kapellmeister Kreisler, der in greller Ironie einer Teegesellschaft von Elegants Bachs Goldbergvariationen spielt.
Beim Lob der Musik scheint Wackenroders Seele inniger mitzuschwingen und sich tiefer zu öffnen noch als sonst, so erfüllt und durchseelt seine Betrachtungen über Malerei sein mögen. Ein neues, tief problematisches Bild des Künstlers entsteht hier, das von dem seiner anderen Kunstschriften erstaunlich abweicht. Der Maler, so haben wir gesehen, war in den „Herzensergießungen“ der Gotterfüllte, der im schaffenden Spiegel seiner frommen Seele Welt und All abbildet und zum Kunstwerk verdichtet. Joseph Berglinger dagegen ist Gegenwartskünstler, das heißt: er ist der tief Fragwürdige, der in sich Gespaltene und Zerrissene, krank an der Seele, zerbrechlich und gefährdet, leidvolles Bild von des Dichters eigenem Herzen und zugleich beispielhafter Vertreter jener in sich versunkenen Ichsucht, unter der die Romantiker litten.
So tritt in der tragischen Biographie des Musikers Berglinger zum erstenmal in unserer Dichtung die dunkle und zerstörende Seite des Künstlertums hervor als eine fürchtbar-rätselvolle Macht, die den Menschen, begnadet und verdammt zugleich, schicksalhaft erhebt und zermalmt. Dieser junge Komponist ist nicht mehr der Gottgelassene, dessen vertrauende Seele dem mystischen Einfluß göttlicher Gnade offensteht. Er ist der moderne, sentimentalische Mensch, in dessen Brust zwei Seelen sind, wie das Bibelwort sagt, der „zwischen Himmel und Erde“ Taumelnde, schwermütiger Wanderer zwischen zwei Welten, deren ewig unvereinbarer Gegensatz ihn vernichtet. Noch will Berglingers Kunst nur Lob des Schöpfers sein, und sein letztes und höchstes Werk ist eine Musik zur Leidensgeschichte des Gottmenschen.
Aber auch die Tonkunst vermag die dunklen Gewalten, die aus dem eigenen Innern aufsteigen, nicht mehr zu bändigen. In „furchtbarer Willkür“ strebt sie abwärts zum Irdischen und singt statt Gott Unrast und Qual des Menschenherzens, die gefährdendste und vernichtendste, die menschlichste aller Künste. „Jene wahnsinnige Willkür, womit in der Seele des Menschen Freude und Schmerz, Natur und Erzwungenheit, Unschuld und Wildheit, Scherz und Schauder sich befreunden und oft plötzlich die Hände bieten: — welche Kunst führt auf ihrer Bühne jene Seelenmysterien mit so dunkler, geheimnisreicher ergreifender Bedeutsamkeit auf? Ja, jeden Augenblick schwankt unser Herz bei denselben Tönen, ob die tönende Seele kühn alle Eitelkeiten der Welt verachtet und mit edlem Stolz zum Himmel hinaufstrebt — oder ob sie alle Himmel und Götter verachtet und mit frechem Streben nur einer einzigen irdischen Seligkeit entgegendringt. Und eben diese frevelhafte Unschuld, diese furchtbare, orakelmäßig-zweideutige Dunkelheit, macht die Tonkunst recht eigentlich zu einer Gottheit für menschliche Herzen.“
Noch in einer letzten Hinsicht sind die Berglinger-Aufsätze Selbstbekenntnis und einsame Klage einer Seele, die von sich selbst sagt, sie sei wie eine Aeolsharfe, „in deren Saiten ein fremder, unbekannter Hauch weht und wechselnde Lüfte nach Gefallen herumwühlen.“ Es ist das schamvolle, nur angedeutete Leid der versagenden Schöpferkraft. Der kurze Abgesang nach Berglingers Tod spricht diese Erkenntnis aus. Wie ist es zu erklären, daß der Musiker sich in dem Zwiespalt von Kunst und Wirklichkeit verzehren und aufreiben mußte, daß er an der Welt, die ihn nicht verstand, zugrunde ging und nicht mit der „Unschuld“ und Unbeirrbarkeit eines Raffael, Dürer oder selbst Guido Reni dennoch zu schaffen und zu gestalten vermochte? Wackenroder entgegnet: Das eigentlich Schöpferische des Genies fehlte ihm, er war ein empfindsamer Träumer, Aufnehmender und Nachschaffender mehr denn produktiver Künstler. „Soll ich sagen, daß er vielleicht mehr dazu geschaffen war, Kunst zu genießen als auszüben? — Sind diejenigen vielleicht glücklicher gebildet, in denen die Kunst still und heimlich wie ein verhüllter Genius arbeitet und sie in ihrem Handeln auf Erden nicht stört? Und muß der immer Begeisterte seine hohen Phantasien doch auch vielleicht als einen festen Einschlag kühn und stark in dieses irdische Leben einweben, wenn er ein echter Künstler sein will? — Ja, ist diese unbegreifliche Schöpfungskraft nicht etwa überhaupt ganz etwas anderes und — wie mir jetzt erscheint — etwas noch Wundervolleres, noch Göttlicheres, als die Kraft der Phantasie?“
Es ist Wackenroders persönlichstes Leid, das in diesen leisen Worten lebt. Auch ihm war die Gabe schöpferischer Gestaltung versagt, ein „passives Genie“, mit Jean Paul zu sprechen, eine weibliche Seele des Nachempfindens und Nacherlebens, beschränkt auf den Bereich reproduktiver Fähigkeiten, aber in diesen Grenzen sich sicher bewegend, eine Stimme von unüberhörbarer Eigenart und rührender Reinheit. —
Auch die musikalischen Aufsätze Wackenroders gehen also, ebenso wie die zur Kunst, ausschließlich auf das seelische Erlebnis aus, und hier wie dort fehlt eine kritische Betrachtung oder formale Analyse des Kunsttechnischen, wie sie später Hoffmann und erst recht Robert Schumann bringen. Die Musik als heilige Sprache des menschlichen Gefühls, Glanz, Schmerz und Süßigkeit ihres Genusses, dämonische Gefährdung des Künstlertums, Sündenfall in den Abgrund irdischer Seelenkämpfe und wehmütige Klage versagender Kraft — das ist der Inhalt dieser Seiten. Die Musikbetrachtungen sind noch entwirklichter als die Schriften zur Kunst. Während dort die Namen der großen Maler wie ferne Sternbilder den Umkreis liebender Verehrung bezeichnen, fehlt auch diese geschichtliche Bestimmtheit den musikalischen Schriften ganz. Nur im allgemeinen ist von der großen Kunst und ihren Erfordernissen die Rede. Weder Haydn, noch Mozart, noch Gluck werden genannt, von älteren Musikern zu schweigen, und an der bald einsetzenden Renaissance der Kunst des Johann Sebastian Bach, auf den doch Wackenroder durch seinen Lehrer Forkel hätte hingelenkt werden können und die 1829 in Felix Mendelssohns Aufführung der Matthäuspassion in der Berliner Singakademie gipfelte, hat er keinen Anteil.
Der Toleranzgedanke, der in den Schriften zur bildenden Kunst so hervortrat, gilt in etwa auch für die musikalischen Betrachtungen. Alle Arten und Gattungen der Tonkunst scheinen zunächst Berglinger gleichberechtigt, aber freilich ist ihm selbst die geistliche Musik durch die Würde ihres Gegenstandes die edelste und höchste, „so wie auch in den Künsten der Malerei und Poesie der heilige, gottgeweihte Bezirk dem Menschen in dieser Hinsicht der ehrwürdigste sein muß.“ Darum ist Berglingers letztes Werk eine Passionsmusik, in der er sein junges Leben verströmt und verzehrt wie der sterbende Mozart in seinem Requiem.
Neu und fruchtbar in die Zukunft weisend ist die hohe Wertung der absoluten Musik und ihrer höchsten Form, der Symphonie, die eben damals, durch die Mannheimer Schule vorbereitet, durch Haydn und Mozart ausgebildet und der großen deutschen Musik gewonnen, in Beethoven, dessen erste Symphonie 1799 entstand, ihren klassischromantischen Gipfel erreichte. Wackenroders Aufsatz „Das eigentümliche Wesen der Tonkunst und die Seelenlehre der heutigen Instrumentalmusik“ sieht in der symphonischen Form die Erfüllung der eigentlichen Aufgabe der Musik, Künderin der Seele zu sein, „den letzten höchsten Triumph der Instrumente, . . . worin nicht eine einzelne Empfindung gezeichnet, sondern eine ganze Welt, ein ganzes Drama menschlicher Affekte ausgeströmt ist.“
Ganz persönlich und eigentümlich ist die sprachliche Form, in der dies Evangelium von der Heiligkeit der Kunst verkündet wird, gleich weit entfernt von der hymnischen Kraft in Winckelmanns Plastikschilderungen, von Wilhelm Heinses Glanz und sinnenhafter Unmittelbarkeit und von der besonnenen Klarheit des reifen Goethe. Sie fließt ganz aus den tiefsten Quellen und den innersten Kräften dieser reinen Gestalt und ist von einem zarten Enthusiasmus und einer sanften Glut, die stellenweise an den Wortschatz der alten Mystiker anklingt. Einfalt möchte man den Grundcharakter dieser Sprache nennen, geboren aus jener frommen Kindlichkeit, die auch das Wesen der behandelten Gegenstände ausmacht und also dem Stoff angemessen ist, eine schlichte Ursprünglichkeit, die ein wenig an Matthias Claudius oder an „Heinrich Shillings Jugend“ erinnert. Es ist ein Personalstil, erfüllt und erlebt wie weniges in unserem Schrifttum, ohne je zur Manier zu werden. Gerade die Zerbrechlichkeit der auszusagenden Dinge und die Zartheit der sprachlichen Mittel erhöhen diese Gefahr des Übersteigerns, der Claudius zu oft erlegen ist. Für Wackenroder bestand sie nicht: weil sein Gefühl rein und sein Erlebnis echt war, ist seine Sprache gewachsener Stil, notwendiger Ausdruck eines zugeordneten Gehalts.
Die Wirkung Wackenroders auf seine Zeit war groß und ist uns selbst von seinem erbittertsten Gegner Meyer bezeugt. Unmittelbarer Nachfahr und der erste Schüler, Erbe seiner Gedanken und Testamentsvollstrecker ist der Freund Ludwig Tieck. In seinen Beiträgen zu den „Herzensergießungen“ und den „Phantasien“ führt er die Themen Wackenroders nicht ohne Vergröberung und leise Verfremdung breiter und reicher aus, den heiligen Ernst des Gefühls in berechnete Wirkung verwandelnd. Vor allem der unvollendete Künstlerroman „Franz Sternbalds Wanderungen“ von 1798 ist eine Frucht dieses Bündnisses der beiden, die Erzählung von dem altdeutschen Malerjüngling, einem Schüler Dürers, der von Nürnberg auszieht, Lukas von Leyden besucht und von dort dem ersehnten Süden zuwandert. Es ist das romantische Kernthema, von bedeutsamen Kunstgesprächen durchwebt, poetische Gestaltung des unerfüllten Sehnsuchtstraumes der Freunde. Das nazarenische Ideyll des Eingangs ist noch ganz von Wackenroders Geist durchtränkt, während in der Folge die Darstellung mehr und mehr Tieckisch wird, von einer hastigen Sinnlichkeit, die von der freilich ungleich vitaleren Naturhaftigkeit Heinses beeinflußt scheint.
Wackenroders Idee einer religiösen Kunst ist im Grunde die der ganzen Romantik, um sie kreist Philipp Otto Runges Landschaftsmalerei ebenso wie die Caspar David Friedrichs. Im besonderen Sinne einer christlichkatholischen Kunst wird dieser Grundgedanke in Friedrich Schlegels Kunstschriften aufgenommen. Ihm war der Verfasser der „Herzensergießungen“, wie er dem Bruder schreibt, „der liebste aus dieser ganzen Kunstschule“, dem er „mehr Genie“ zutraut als Tieck. In beiden Nachfolgern, Tieck und Schlegel, geht Wackenroders Saat auf. Der Maler Ludwig Richter erzählt in seinen Lebenserinnerungen, daß die Schriften der drei, die ihm auf der Wanderung nach Rom 1823 in Innsbruck in die Hände fielen, seine Kunst stark bestimmten. Und ebenso ist die Wirkung Wackenroders auf den Begründer der bedeutendsten spätromantischen Sammlung altniederländischer Malerei, Sulpiz Boisserée, bezeugt, der auf dem Gebiet der Sammlertätigkeit die Gedanken des Klosterbruders zum guten Teil verwirklicht.
Eine gewichtige Gegnerschaft allerdings war kaum zu vermeiden: die Weimarer Kunstfreunde, die Stimme des Klassizismus also, die sich, fast gleichzeitig mit den „Herzensergießungen“, 1798 in Goethes Einleitung in die „Propyläen“ noch einmal grundsätzlich ausgesprochen hatte. Sie äußerte sich in manch unwirsch polterndem Wort Goethes und endlich in jenem vielberufenen Manifest von 1817 über „Neudeutsche, religiös-patriotische Kunst“, von Meyer verfaßt, von Goethe gebilligt, aber in der Stärke der Abwehr und dem späten Erscheinen mehr die Nachfahren als den Ursprung treffend, mehr die Goethe unbehaglichen Wirkungen als Wackenroders Gedanken bekämpfend.
Die Schärfe der Weimarer Gegenschrift war vor allem durch die sogenannten Nazarener bestimmt, jene Gruppe romantischer Maler, die sich um 1810 unter der Führung Friedrich Overbecks in Rom zusammenschlossen, um Wackenroders Idee einer aus dem Geiste christlicher Lebensführung erwachsenen Kunst zu verwirklichen. Es war, wie wir sahen, eine vielleicht dem Erlebnis süddeutscher Kultur entsprossene Entdeckung der „Herzensergießungen“, daß Leben, Kunst und Religion wesensmäßig und ursprünglich eins seien, daß die alten Künstler diese der Gegenwart verlorene Einheit noch besessen und aus ihr heraus ihre große Kunst geschaffen hätten. Die „Schilderung, wie die alten deutschen Künstler gelebt haben“ betont den religiösen Untergrund ihrer Kunst und Lebensführung. Diesen Geist christlichen Lebens als Voraussetzung des wahren Kunstwerks wollen die nazarenischen Maler erneuern, und sie knüpfen damit unmittelbar an Wackenroder an. Ihre malerischen Vorbilder aber sind jetzt nicht mehr ausschließlich Raffael und die italienische Hochrenaissance. Während der Klosterbruder ältere Maler nur flüchtig als offenbar angelesenes Bildungsgut genannt hatte, treten jetzt die Präraffaeliten stärker hervor. Wackenroder kannte fast nichts von dieser Frühkunst, aber auf den jungen Overbeck machten Umrißstiche nach Cimabue und anderen starken Eindruck, und aus ihrem Studium entwickelt sich jener „altdeutsche“ Stil einer oft erkünstelten Primitivität, der historisch gesehen eine Frucht Wackenroderscher Anregungen bedeutet, noch einmal ein Ausdruck jener romantischen Sehnsucht rückwärts in ein goldenes Zeitalter frömmer Einfalt und heiliger Frühe.
In der Deutung der Musik ist E. T. A. Hoffmann Wackenroders legitimer Erbe. Sein Kapellmeister Kreisler im „Kater Murr“ ist ein gesteigerter Berglinger, tragisch zerrissen und unerlöst wie jener, am unüberbrückbaren Zwiespalt von Kunst und Leben leidend. Hoffmann hat noch tiefer und bohrender als der sanftere Vorgänger die Problematik romantischen Künstlertums dichterisch dargestellt. In seinen musikalischen Aufsätzen gibt er mehr Fachkritik und behandelt auch kompositionstechnische Einzelheiten. Auch Hoffmann hat über die von Berglinger am höchsten gestellte Kirchenmusik geschrieben und hat, Wackenroders letzte Ansätze aufnehmend, die große symphonische Form verherrlicht. Wenn er, der den Aufstieg Beethovens miterlebt hat, dessen Instrumentalmusik feiert und etwa die Schicksalssymphonie in c-moll deutet, so vollendet er, was der Vorläufer begonnen.
So vielfältig und bedeutsam die Wirkungen sein mögen, die von den „Herzensergießungen“ ausgingen, das Tiefste und Bleibende ist nicht der einzelne Gedanke, sondern der Geist des Ganzen, jener Geist frommer Kindlichkeit, der in manchen zarten Gebilden spätromantisch-biedermeierlicher Kunst und Dichtung weiterwirkt, eine kleine nazarenische Provinz in dem lauten Leben des 19. Jahrhunderts. Ihn fühlen wir im Werk romantischer Malet, in den Bildern und Zeichnungen und auch in den eigenen Lebensberichten Josef Führichs und Ludwig Richters, Er lebt in der Dichtung am reinsten vielleicht in Clemens Brentanos Fragment der „Chronika eines fahrenden Schülers“ oder auch in manchen Seiten Eichendorffs, ja, wir möchten einen Hauch davon noch in Adalbert Stifters Kindergeschichten der „Bunten Steine“ spüren.
Viele Ideen der „Herzensergießungen“ wird unsere Gegenwart nur noch in ihrer historischen Bedingtheit sehen und werten können, wir werden manche sachliche Unzulänglichkeit und auch eine gewisse geistige Enge nicht verkennen, auf die schon Eichendorffs Geschichte der poetischen Literatur Deutschlands sehr deutlich hingewiesen hat. Was uns heute wie vor hundertfünfzig Jahren lebendig anrührt, ist die goldene Echtheit und Tiefe des Gefühls, jener heilige Geist frommer Gläubigkeit, der von jeher in der Kunst alles Neue schuf und alle Wunder wirkte. Zu seinem Träger war, der Frühvollendete vom Schicksal bestimmt, das ist Größe und Grenze seiner Sendung.
Köln, im September 1947.
August Langen.