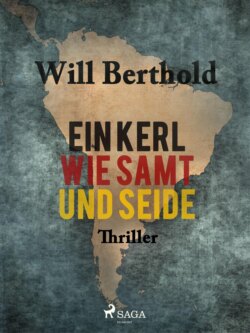Читать книгу Ein Kerl wie Samt und Seide - Will Berthold - Страница 5
1. Teil
ОглавлениеTake Off
Sie nannten den ungeschlachten Master-Sergeant aus Chicago ›Pigskin‹. Schweineschwarte; der übergewichtige Aufseher der Areale 9–12 in Münchens Alabama-Depot – bullig, schlagflüssig, lautstark – glich einem Schlächtergesellen, der sein Handwerk nur ausüben konnte, wenn er betrunken war.
Die Männer, die unter seiner Fuchtel schufteten, zweifelten nicht daran, daß sich Schweineschwarte bald zu Tode gesoffen haben würde, doch bis dahin mußten sie ihn weiterhin über sich ergehen lassen – viele von ihnen durchaus zu Recht, aber manche auch nur als Opfer pauschaler Vergangenheitsbewältigung. Zwei Monate nach der Stunde Null – Anfang Juli 45 – huschte für die Deutschen in ihrem besetzten Land die Zeit dahin wie eine hinkende Ratte.
Seitdem Hitlers Nachfolger Großadmiral Dönitz und die anderen Mitglieder der Reichsregierung am 23. Mai auf dem Passagierschiff Patria bei der Festnahme durch die Engländer die Hosen heruntergelassen hatten wie gemeine Soldaten bei der Schwanzparade, war die deutsche Geschichte in eine Epoche eingetreten, in der gehungert und gelogen, gehängt und gebetet, geträumt und gehurt, geschwiegen und verraten wurde.
Anfang Juli 1945 herrschte in Europa eine Hitzewelle. Schon am frühen Morgen wurden Rekordtemperaturen gemessen. Der Asphalt warf Blasen. Der durstige Master-Sergeant hatte schon am Vormittag seinen üblichen Alkoholpegel weit überschritten; in diesem Stadium war er unberechenbar.
Auch die anderen US-Soldaten wirkten heute verärgert, weil Französinnen in einer Titelgeschichte ihrer Armee-Zeitung Stars and stripes sie übereinstimmend als lausige Liebhaber denunziert hatten. Über vier Millionen US-Soldaten standen noch in Europa, die meisten in Deutschland. Nach der Abkürzung auf ihren Tornistern G(ovemment) I(ssue) ›Regierungs-Ausgabe‹ nannte man sie GIs, und tatsächlich gab der US-Steuerzahler eine Menge für die bestversorgte Armee der Welt aus. Täglich liefen Frachter aus Übersee Bremerhaven an, eine Enklave, die den Waffenbrüdern von den Engländern überlassen worden war. Auf notdürftig geflickten Schienensträngen, vorbei an geborstenen Stellhäusern, rollte pausenlos ein Strom von Zügen durch eine Trümmerlandschaft von Norden nach Süden. Stotternd, ächzend, schwerbewacht, und doch gelegentlich ausgeplündert, erreichten die Wagen schließlich das Alabama- und das benachbarte Indiana-Depot, wo die Güter gestapelt, verwaltet und an die US-Einheiten in Süddeutschland, Oberitalien und Österreich weitergereicht wurden.
Die Belegschaft der gigantischen Nachschubzentrale, ein bunt zusammengewürfelter Haufen von Amerikanern und Polen, Deutschen und Staatenlosen, arbeitete täglich in zwei Schichten, am längsten die Männer, die unter automatischen Arrest‹ fielen; sie wurden jeden Morgen aus dem Internierungslager Moosburg angekarrt. Kreisleiter, Ortsgruppenführer, Denunzianten, Regierungsräte, Schullehrer, Ärzte und Bankangestellte nahmen in Areal 9, einem verrotteten Schuppen des Heereszeugamts, in dem vermutlich schon für den 70er-Krieg die Trompeten von Lunéville verwahrt worden waren, unter Anleitung von Master-Sergeant Pigskin Dosen mit Tomato-Juice aus den Kartons und schichteten sie aufeinander. Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Büchsen Tomatensaft, kleine, große und mittlere, nur Tomatensaft, von früh bis abends, jeden Tag, kujoniert von Schweineschwarte und seiner Gilde.
Kein Wunder, daß sie mit der Zeit nur noch rot sahen.
Die ordinärsten Arbeiten waren den Männern aus den Internierten-Lagern Vorbehalten; daneben gab es auch Facharbeiter, die für einen Schlag Maisbrei, eine Scheibe Spam, ordinärer amerikanischer Büchsenwurst, und zwei Kartoffeln arbeiteten, die sie gratis und ohne Lebensmittelmarken erhielten. Im Gegensatz zu den Internierten schliefen sie zu Hause und die Amis waren zu ihnen etwas freundlicher, solange sie die Magazinarbeiter nicht beim Klauen erwischten.
Unter den Bewachern gab es üble Typen und ganz besonders üble. Es gab natürlich auch menschliche – sogar in der Überzahl –, aber die traten wenig in Erscheinung, wenn Pigskin, der Bulle mit dem schlagflüssigen Gesicht, in der Nähe war.
Ein internierter Oberlehrer, kräftig und mittelgroß, wurde von Hitze und Durst geplagt, er fühlte sich einen Moment lang unbewacht, schnitt einen Karton auf, griff sich eine Dose, bohrte ein Loch hinein und setzte die Büchse an den Mund. Er trank in gierigen Schlucken und merkte nicht, daß er nicht mehr allein war. Die weichen Gummisohlen der Armeestiefel dämpften selbst noch Zwei-Zentner-zwanzig-Lebendgewicht. Der Mundräuber verschluckte sich, hustete, setzte wieder an, bis er merkte, daß sich ihm eine Hand auf die Schulter legte.
Ertappt fuhr er herum und starrte in Pigskins Purple-Face.
»Dirty bastard!« fluchte der Master-Sergeant. Es sah aus, als wollte er den Dieb gleich an Ort und Stelle zusammendreschen, aber dann überlegte er es sich anders und pfiff die ihm unterstellten Magazinarbeiter zusammen, um eine subtilere Methode vorzuführen.
Er reihte auf einem Tisch 15 Dosen mit Tomatensaft nebeneinander, sauber ausgerichtet, penibel abgezählt.
»Go on you crook and drink them all!« forderte Pigskin den Verstörten auf, die Büchsen auszutrinken.
Ob des Befehls, so viel zu trinken wie er wollte, verspürte der Schulmeister im ersten Moment törichte Erleichterung. Der Master-Sergeant öffnete eine Büchse und drückte sie dem Ex-Oberlehrer und Ortsgruppenleiter in die Hand.
»Cheers«, sagte er. Sein aufgedunsenes Gesicht wirkte hämisch; es war durchlaufen von einem Spinnengewebe roter Äderchen. Seine Augen wirkten stumpf und glanzlos, gelbgeränderte Säuferaugen. Seine Zunge leckte die Unterlippe, als der Mann aus dem Internierungslager mit dem Trinken begann, längst nicht mehr so gierig wie zuvor.
Er wollte absetzen, aber sein Peiniger schüttelte den Kopf.
»Be a good sport«, forderte er den Drangsalierten mit perfider Jovialität auf.
»The next one!« befahl er, als der Mann die erste Saftkonserve geschafft hatte.
Seine Arbeitskollegen standen herum. Ihre Gesichter ließen erkennen, daß sie ihm nur zu gerne beim Austrinken der aufgereihten Dosen geholfen hätten, aber Pigskin würde es nie erlauben, deshalb schluckten sie nur trocken mit.
Bei der dritten Büchse ließ der gefeuerte Oberlehrer die erste Mühsal erkennen; bei der vierten schoß ihm der Tomatensaft wieder zu den Nasenlöchern heraus. Er hustete und prustete, während der Master-Sergeant wie zufällig mit seinem Gummiknüppel spielte.
»Go on, son of a bitch!« sagte er, nicht unfreundlich, und der 50jährige mit den nassen Augen, der keinen Durst mehr hatte, mußte weitermachen.
Er schnaufte heftig: »Ich – ich kann nicht mehr«, stöhnte er, »unmöglich –«
»Shut up and drink!« erwiderte Master-Sergeant Pigskin.
Dem Internierten traten die Augen aus den Höhlen, ängstlich, großaufgerissen. Sein Gesicht quoll auf wie Hefeteig, er setzte ab, er würgte. Er stemmte sich gegen den Brechreiz, aber sein Magen war stärker, die rote Brühe schoß über die Speiseröhre wieder nach oben. Ein paar Sekunden hielt sich der Zwangsverpflichtete die Hände vor den Mund.
Dann kotzte er die rote Brühe heraus, auf den Boden, seinem Peiniger vor die Füße.
»Scum of the earth«, tobte der Angetrunkene: »Du Abschaum der Welt.« Seine Lippen platzten auseinander wie eine faule Frucht: »Don’t be a sissy!« Er schwankte auf unsicheren Beinen: »The next one!« befahl er mit meckernder Stimme und wies auf die weiteren elf Büchsen: »That’ll teach you a lesson!«
Der Oberlehrer a. D. war am Ende. Er konnte nicht mehr. Der Master-Sergeant ließ jetzt die falsche Jovialität fallen; er holte die ›Smith and Wesson‹ aus der Tasche, entsicherte sie, fuchtelte mit der Pistole herum, Finger am Druckpunkt.
Hastig griff sich der Internierte die fünfte Dose. Während er zu trinken versuchte, schoß gleichzeitig vom Magen her die Flüssigkeit hoch. Er begriff, daß ihn Schweineschwarte weiterschinden würde, daß er Tomatensaft trinken müßte, und trinken und trinken, bis der ganze Schuppen besudelt wäre.
Sein Entsetzen schlug von einer Sekunde auf die andere in Haß um. Sein Zorn explodierte wie eine Stichflamme.
Der untersetzte, kräftige Mann zog den Kopf an, als er sich mit einem Satz auf Pigskin stürzte und ihn rammte. Der Master-Sergeant fiel um. Der Internierte lag über ihm, entriß ihm die Pistole und kam wieder auf die Beine.
»Du Dreckskerl!« keuchte er und griff nach der ersten Büchse, schleuderte sie, ohne zu treffen, nach dem Amerikaner. »Du Schweinehund!« Die nächste erfaßte den Master-Sergeant am Kinn, die dritte an der Schläfe.
»Mach’ keinen Quatsch!« rief Horst Schöller, einer der Internierten, dem Ex-Oberlehrer zu, aber das Bangen um seinen Kumpel wurde von der Schadenfreude überlagert, und der Mann war auch nicht mehr zu bremsen.
Die anderen standen stumm herum mit hängenden Armen. Einige stahlen sich aus dem Schuppen, um später nicht als Zeugen für eine Steinigung mit Konservenbüchsen belangt zu werden. Andere waren unvorsichtiger: Sonst eher kriecherisch, hatte sich ihre Wut auf Schweineschwarte angehäuft. So verfolgten sie, ohne einzugreifen, wie bei einem von ihnen der Damm gebrochen war.
Immer wieder von Büchsen getroffen, rappelte sich der Master-Sergeant wimmernd hoch. Er war allein. Er hatte keine Chance gegen den Rasenden mit der Pistole. Um Hilfe brüllend, wetzte er aus dem Schuppen, von einem Amokläufer verfolgt.
Der Bulle keuchte und heulte; er flitzte in Richtung West-Ausgang. Niemand kam Schweineschwarte zu Hilfe. Selbst die Polen mit den Blauhelmen gönnten ihm die Abreibung. Dutzende von Zeugen standen herum und beobachteten die Verfolgung amüsiert, als versuchte hier nur ein herausgefressener Bauer zur Volksbelustigung auf der Dorfstraße die entlaufene Sau wieder einzufangen.
Erst als der rabiate Safttrinker im Laufen die ›Smith and Wesson‹ abdrückte, begriff der Master-Sergeant, daß er um sein Leben lief. Der Verfolger fuchtelte mit den Armen. Schwer zu sagen, ob er gezielt feuerte.
Hinter dem nächsten Stapel warf sich Pigskin plötzlich in Dekkung. Der Verfolger sah es zu spät und fiel über ihn. Beide waren ineinander verkeilt, versuchten gleichzeitig nach oben zu kommen. Während des erbitterten Handgemenges richtete sich die Maschinenpistole eines Militär-Polizisten auf den Internierten.
»Nein!« keuchte der genötigte Amokläufer, als er dem Tod in die Mündung sah: »Nein!«
Es war zu spät.
Ein Feuerstoß wuchtete in seinen Körper. Der Mann machte noch rudernde Bewegungen mit den Armen, aber es waren bereits postmortale Zuckungen, auch wenn seine linke Hand die Pistole immer noch festhielt. Aus dem zerfetzten Hemd quoll Blut. Der Stoff saugte sich damit voll, vermengte sich mit den Flecken des Tomato-Juice – zweierlei Rot, doch das dunklere war endgültig.
Der MP rief einen Arzt herbei, obwohl er wußte, daß hier nichts mehr zu machen war; er zuckte die Schultern. Ein klarer Fall von Notwehr. Keiner machte ein Aufhebens davon, einer weniger von den 75000, die von der Besatzungsmacht zur Zeit unter automatischem Arrest gehalten und in Lagern zusammengepfercht wurden.
Die Arbeit im Alabama-Depot ruhte einen Moment. Lagerarbeiter, polnische Hilfspolizisten und GIs standen um den Zusammengeschossenen herum. Sogar die Posten am Westtor waren einen Augenblick lang abgelenkt und sahen den Besucher, der behende aus einem Jeep sprang und an der Außenmauer der Schleißheimer Straße auf sie zukam, erst im letzten Moment, einen großen, schlanken Mann mit lässigen Bewegungen. Er war offensichtlich kein Amerikaner, aber, seltsam unberührt von der Zeit, sah er auch nicht wie ein Deutscher des Jahres 45 aus. Obwohl er eine demobilisierte Wehrmachtshose und eine gefärbte US-Windjacke trug, wirkte er flott, fast adrett. Er hatte braune Augen, die offensichtlich gewohnt waren, in weite Fernen zu sehen, und dunkle Haare. Seine unzeitgemäße Lässigkeit hatte etwas Aufreizendes; irgendwie wirkte der Mann hintergründig und zielstrebig. Viel Energie und viel Verstand.
Er wies einem der beiden Posten die schriftliche Genehmigung der Militär-Regierung vor, das Alabama-Lager zu betreten und hier mit einem Internierten namens Horst Schöller zu sprechen.
»No«, sagte der DP und schüttelte den Kopf. »Off limits.« »Look it through«, forderte ihn der Mann in der Windbluse auf, wies erneut die Autorisierung vor, dabei zog er ein Päckchen Chesterfield aus der Tasche und zündete sich eine Zigarette an, sicher hatte er auch eine Erlaubnis, amerikanische Glimmstäbchen zu besitzen.
Der linke DP – Displaced Persons nannte man die Millionenschar ausländischer Zwangsarbeiter, die nach dem Zusammenbruch nicht mehr in ihre kommunistische Heimat zurückwollten oder konnten – zögerte; er war nicht auf den Kopf gefallen: Wenn ein Deutscher in dieser Zeit in einem Jeep der Besatzungsmacht vorfuhr, ein halbes Päckchen Zigaretten in der Tasche hatte, ihm der Hunger nicht aus den Augen sah und er am Eingang zum US-Sperrgebiet nicht den Rücken krumm machte, dann mußte er wohl verdammt gute Beziehungen zum Military Government haben.
Nach einigem Hin und Her kam ein US-MP und las die Ermächtigung: »To whom it may concern?«
»Mr. Peter Maletta is allowed …«
»Wait a minute«, sagte der Militär-Polizist und rief einen deutschen Dolmetscher herbei.
»Can I help you?« fragte der Interpreter. »Are you German?«
»Ich bin Deutscher«, erwiderte der Besucher und präsentierte sein Permit, das der Dolmetscher mit übertriebener Gründlichkeit las.
»Sie können sich ausweisen?«
Der Reisepaß, den Peter Maletta vorwies, war längst abgelaufen, und doch eine Rarität. Der Dolmetscher betrachtete das Paßbild genau; provisorische Personal-Papiere des Jahres 45 waren im allgemeinen mit Fingerabdrücken unterschrieben.
»Ich komme im Auftrag von –«
»Leider momentan recht ungelegen, Herr Maletta«, unterbrach ihn der Dolmetscher. »Es hat hier gerade einen – einen Zwischenfall gegeben. Solange er nicht geklärt ist, darf niemand das Gelände betreten oder verlassen.« Er betrachtete den Mann in der Windbluse wieder und stellte fest, daß er entschlossen wirkte, wie einer, der auf ein Ziel fixiert ist und kein Mittel auslassen würde, es zu erreichen.
»Dann möchte ich mit Lieutenant-Colonel Williams – oder mit Colonel Rice sprechen.«
»Warum nicht gleich mit General Patton?« spottete der Dolmetscher: »Oder mit dem lieben Gott.«
Er ging in das Wachhäuschen und telefonierte, erschrocken über seine Dreistigkeit, denn zwischen dem lieben Gott und General George S. Patton jr. schien es zur Zeit tatsächlich kaum Unterschiede zu geben.
Maletta mußte zur Seite springen. In forciertem Tempo verließen vier Jeeps hintereinander das Westtor. Die Polen hatten kein Recht, US-Soldaten zu filzen, dafür war die Militär-Polizei zuständig, aber der Sergeant mit der blauen MP-Armbinde, dem weißen Koppel und dem weißen Helm winkte sie lässig durch. In jedem Wagen saß nur der Fahrer; an jedem Wagen waren vier Kanister aufgeschnallt. Keine Frage, daß sie gefüllt waren. Keine Frage, daß sie nach der Rückkehr leer wären, wiewohl die Fahrtstrecke nur ein paar Meilen betragen würde. Das Verfahren war gängig und einleuchtend, ob man es nun fifty-fifty oder halbe-halbe nannte. Die Alabama-Soldaten hatten die altrömische Devise: ›Divide et impera‹ in die Praxis übersetzt: Teile mit der MP und füll’ dir die Tasche.
Der Dolmetscher kam zurück: »At three o’clock«, rief er dem Ungebetenen zu und wies drei Finger vor, als verstünde der Mann ihn sonst nicht.
Peter Maletta nickte. Daß man ihn zweieinhalb Stunden warten ließ, war natürlich eine Schikane, aber sie verärgerte ihn nicht. Er hatte einen langen Weg hinter sich und vermutlich einen noch längeren vor sich, aber keine Hürde würde jemals seinen Hindernislauf aufhalten, eine offene Rechnung mußte saldiert werden.
Er ging auf seinen Jeep zu, um einzusteigen. Dann überlegte er es sich anders und schlenderte mit seinem saloppen, fast ein wenig tänzelnden Gang zu Fuß weiter. Er ging in nördlicher Richtung, in der Art eines Müßiggängers, der sich bei diesem prächtigen Wetter die Beine vertritt, einer, der einen Gönner bei der Militärregierung hat oder ein Schieber ist, oder auch nur ein Mann, dessen Frau mit einem Ami-Offizier schlief, auch wenn er so aussah, als würde er letzteres selbst besorgen.
Die Sonne stand jetzt im Zenit. Sie hing über ganz Deutschland; die Schönwetterbrücke wölbte sich vom Atlantik bis zum Ural. Die Sonne schien in Hamburg wie in Breslau, in Dresden wie in Berlin. Sonne gab es gratis und reichlich; sie verlangte keinen Bezugsschein; man mußte um sie nicht Schlange stehen und man brauchte sich auch nicht nach ihr zu bücken. Der helle Schein spiegelte sich auf den weißen Helmen der Militär-Polizisten, lockte die Alten aus den Ruinenkellern, er flirrte vor den Augen der Sowjetsoldaten, die Radfahren lernten und Uhren klauten. Die Sonne lachte den Menschen hinter Stacheldraht, erhellte trostlose Flüchtlingsbaracken, verklärte die eingefallenen, vergreisten Gesichter unterernährter Großstadtkinder und erreichte auch noch die Zellen von Landsberg mit den Rotjacken, die im Morgengrauen gehängt würden.
Maletta schlenderte an der riesigen Außenmauer des Alabama-Depots zwischen der Schleißheimer und der Knorrstraße entlang, ein Mann, den die Vorstellung von dem schwerbewachten Schlaraffenland innerhalb der Umzäunung nicht überforderte.
Münchens Norden war zum Wilden Westen der bayerischen Landeshauptstadt geworden. In der Nähe überfüllter riesiger Kasernen der Isar-Metropole lagen als erste Station beim Ausgang die 338 Einfamilienhäuschen der Siedlung am hart und die 221 der Kaltherberge, und die 559, nicht selten töchterreichen Familien, waren seit ihrem Einzug daran gewöhnt, an die 20000 Soldaten über sich ergehen zu lassen. Die Uniformen hatten zwar gewechselt, aber die Bedürfnisse waren ebenso gleich geblieben wie die Einschußlöcher am Gasthof Stuka. Schon vor dem Krieg hatte es hier die ersten Toten der deutschen Wiederaufrüstung gegeben: Zehn Soldaten waren bei Wirtshausschlägereien um die Siedlungsmädchen erstochen, erschossen und erschlagen worden, ohne daß die Öffentlichkeit darüber informiert worden wäre.
Stuka war in Kasernennähe das einzige Tanzlokal gewesen, frequentiert von den Fliegern des Horstes Schleißheim, von Soldaten der ›Leibstandarte Adolf Hitler‹ und von Flakartilleristen. Jetzt war die Kneipe der einzige deutsche Stuka, der noch flog, freilich nicht mehr mit Hitlers arischen Prätorianern, sondern vorwiegend mit reinrassigen US-Neger-Soldaten. Es gab wiederum Tote und – neue Einschußlöcher.
Peter Maletta hatte nach einer Stunde fast das ganze Sperrgelände umgangen, war wieder an der Schleißheimer Straße angekommen und fragte sich, wie er weitere 90 Minuten totschlagen könnte. Er blieb einen Moment lang stehen, orientierte sich, überquerte die Straße und ging dann auf den Pulverturm zu; auf dieser Höhe das einzige Gebäude auf der linken Straßenseite.
Er öffnete die Tür der Gaststube.
Der Mief traf ihn wie ein Fausthieb. Der Rauch beizte seine Augen und machte ihn einen Moment lang blind. Der Raum war überfüllt mit Gästen, die sich vor der Sonne drückten. Mit seinen blanken, massiven Holztischen, seinen furnierten Wänden und den Brettern an der Decke, wirkte die Gaststätte wie eine nachgebaute Almhütte. Auf der Wand stand der alberne Sinnspruch:
Auf der alm da gibt’s koa sünd.
Gleich daneben drohte der Provost-Marshall der Militär-Polizei:
Vulgarity will not be tolerated
Es war ein Witz, daß hier, auf dieser Pseudo-Alm, wo man wohl jede Sünde handelte, vor Gewöhnlichkeit gewarnt wurde.
»Getaway!« rief ein gedrungener GI, der an einem Tisch mit grell verschminkten Mädchen saß, dem Mann im militanten Zivil zu.
»Wirf ihn raus, Charly, bevor es Ärger gibt«, sagte die rote Ria zu dem Kellner.
Maletta dachte nicht daran, abzuhauen, und der Kellner, ein fixer Junge in einer schmuddeligen Servierjacke, trat ihm in der Mitte des Raumes entgegen.
»Mann o Mann«, sagte er: »Haste dir wohl verloofen? Wat biste nu’, ’n Selbstmörder oder ’n Schwuler?«
»Weder noch«, erwiderte der Adrette: »Vielleicht ein Landsmann von Ihnen.«
»Hau bloß ab, Mann!« forderte ihn Charly auf. »Hier is’ vielleicht wat los. Und auf Männer sind die hier nicht scharf, auf deutsche schon gar nicht! Gotta sister, Mister?« imitierte er dann die Amis und lieferte seine hausgemachte Übersetzung gleich nach: »Hast’ ’ne Schwester, Bester?«
»Keine Sister, aber Zaster«, entgegnete Maletta.
»Das is’ ’ne Basis«, erwiderte Charly und wies auf den einzigen Tisch, an dem noch ein Stuhl frei war. »Aber ich garantier’ für nischt«, setzte er hinzu.
Maletta griff sich den Stuhl, wiewohl er spüren mußte, daß die gespannte Atmosphäre den Pulverturm jeden Moment in die Luft jagen konnte. Etwa zwanzig weiße GIs saßen auf der linken, ein Dutzend Farbige auf der rechten Seite des Gastraums, zu wenig Neger-Soldaten für die sich anbahnende Schlägerei um die sechs oder sieben deutschen Mädchen, und das waren zu wenig ›Fräuleins‹ für die Weißen wie für die Schwarzen. Vielleicht würden sie auch die Finger von ihren Girlfriends lassen und gemeinsam den Deutschen vertrimmen, der hier nichts zu suchen und wenig zu bieten hatte.
Die rote Ria ließ den Ankömmling nicht aus den Augen, während der gedrungene Ami an ihrer Bluse herumfummelte. Offensichtlich gefielen ihr seine dunklen Augen, die halblangen, dunkelbraunen Haare, sein provozierendes Lächeln und diese Vorzeige-Zähne.
»’n Deutscher«, stellte die fade Blondine neben ihr fest. »Den kannst du vergessen.«
»Er schaut gut aus«, entgegnete die Freundin. »Der läßt bestimmt nichts anbrennen.«
»Quatsch«, konterte eine Brünette, eine Art Busen-Königin: »Der ist längst abgebrannt; deutsche Männer haben jetzt den Arsch tief unten.«
»Trotzdem schaut er gut aus«, versetzte die rote Ria hartnäckig und klopfte dem Ami neben ihr auf die Finger. »Schluß jetzt, Jimmy«, sagte sie.
Nach den derzeitig gültigen ›Army-Regulations‹ hätte Jimmy wegen Übertretung des Fraternisation-Verbots mit Deutschen 65 Dollar Strafe bezahlen müssen. Überall im Kasernengebiet wurde auf Plakaten scharfes Durchgreifen angedroht, fällig bei jedem außerdienstlichen Gespräch mit einem der Besetzten, ob Frau, ob Mann, ob Kind, ob Greis. Die Deutschen waren für die Besetzer Aussätzige, aber die GIs pfiffen auf die Infektion.
Jimmy raunte Ria etwas ins Ohr.
Das Mädchen schüttelte den Kopf: »Nein, Jimmy«, sagte sie dann, »aus Liebe tut’s weh.«
Der alte Nuttenspruch war dem Mann am Nebentisch nicht neu, auch Amerikaner kannte der Mitt-Dreißiger seit langem. In Vorkriegsqualität, er unterschätzte sie nicht. Es war müßig zu fragen, wie sein Leben verlaufen wäre, wenn er anno 1941 in Lima bei seiner US-Freundin geblieben wäre. Sie hatte ihn darum gebeten, hatte geweint, ihn angefleht, nicht wegzufahren, und Maletta hatte tatsächlich gezögert, den Weg angeblicher Vernunft zu beschreiten. Und diese Scheißvernunft hatte es ihm heimgezahlt, mit Wucherzinsen.
»Wat willste denn nun haben?« fragte der Kellner.
»Was hast du zu bieten?«
»Alles, wat du willst. Hier geht’s nach dem Motto: Haste wat, kriegste wat, und nicht nur für den Ranzen und die Gurgel«, prahlte Charly.
Im Pulverturm war alles zu haben, was es sonst nicht mehr gab: Schuhe, Stoffe und sogar Glühbirnen, die nach der jüngsten Anordnung der Stadtverwaltung, um sie vor Diebstahl zu schützen, allabendlich von den Beamten aus der Fassung geschraubt und im Schreibtisch verwahrt werden mußten; sie waren ein begehrter Schwarzmarkt-Artikel. Die Mangelware wurde mit einer Reichsmark pro Watt gehandelt.
Maletta bestellte Coca mit Rum. »Habt ihr auch ein Telefon?« fragte er dann.
»Ham wa, Junge, ham wa.«
Der Gast stand auf, entschlossen Captain Freetown anzurufen, um eventuelle Schwierigkeiten im Alabama-Depot von vornherein auszuschalten. Doch dann setzte er sich wieder, er hatte es sich anders überlegt. Maletta haderte mit sich, weil er einen Gönner so hemmungslos ausnutzte: Er fuhr seinen Jeep, rauchte seine Zigaretten, trank seinen Whisky und saß privat mit an seinem Tisch, obwohl sich Deutsche und Alliierte in dieser Zeit nur dienstlich begegnen und nicht unter einem Dach wohnen durften. Deshalb hauste Maletta auch in der Chauffeur-Wohnung über der Garage der beschlagnahmten Villa in München-Bogenhausen. Damit es keine Schwierigkeiten gäbe, wurde er offiziell als Fahrer des Captains Freetown angestellt, was mitunter dazu führte, daß der Theater-Officer des Military Government of Bavaria zu Fuß ging, während sein Driver in eigener Sache spazierenfuhr.
Eine Zeit-Arabeske wuchs sich zur Besatzungs-Burleske aus und es kotzte Maletta an, die Großzügigkeit dieses Offiziers so auszubeuten; aber wenn er an den Mann dachte, hinter dem er her war und den er finden und vernichten mußte, verloren sich alle Skrupel, und Maletta sagte sich, daß er keine andere Wahl hätte.
Halblaute Musik wurde in den Raum gespült; sie wurde ausgestrahlt von Radio münchen, einem Sender der Militär-Regierung. Sie hatte es schwer, sich gegen den Lärm durchzusetzen. Zeitungen gab es – von Mitteilungsblättern der Militär-Regierung abgesehen – noch nicht.
Die Musik brach ab. Ein Nachrichtensprecher machte nun schon zum dritten Mal darauf aufmerksam, daß Briefmarken mit dem Konterfei Hitlers künftig nicht mehr verwendet werden dürften; bislang hatten Postbenutzer zwangsläufig die Rückseite des Führers ablecken müssen.
»Vorsicht, Pigskin!« rief die rote Ria, als der Master-Sergeant in der Tür stand. »Wieder voll wie eine Haubitze.«
»Oversext and underfuckt«, gab die abgestandene Blondine lebendige Sprachschöpfung von sich.
Charly flitzte dem Bullen entgegen; Schweineschwarte verlangte Schnaps. Der Kellner holte die Pulle aus dem Hosensack und goß ihm den Fusel ein, während der Mann mit dem Zwei-Zentnerzwanzig-Lebendgewicht die farbigen GIs wie ein Plantagenbesitzer seine Sklaven musterte und sich dann suchend und drohend nach einer Gelegenheit unter den ›Fräuleins‹ umsah. Die höfliche deutsche Standard-Anrede war bereits in der ersten Besatzungszeit, in der Mehrzahl gebraucht, zu einem Qualitätsbegriff für Lotter-Liebe geworden. Die Gunst ging nach Brot und nach Cigarettes, Chewinggum, Candies und Chocolates. Menschen in Millionenzahl, die Bertolt Brecht nicht gelesen hatten, überlebten das Überleben nach der Devise: »Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.«
Der Master-Sergeant rollte wie eine Kugel an den Tisch mit den Mädchen. Er sah auf die Uhr, grinste, holte ein unangebrochenes Päckchen Chesterfields aus der Tasche, legte es auf den Tisch, packte noch ein Päckchen Kaugummi dazu und einen Riegel Schokolade. Mit einer Hand mußte sich der Master-Sergeant zwar an einer Stuhllehne festhalten, aber nach dem Ärger in Arsenal 9 hatte er eine Entspannung nötig.
»That’s all for a quicky«, sagte er zu der Schwarzhaarigen mit der Zahnlücke.
»Quicky?« fragte sie ihre prallbusige Begleiterin.
»Ein Schnellfick, dumme Gans«, erklärte die GI-Kundige.
»Let’s go«, sagte Schweineschwarte.
»Der gibt dir noch mehr, wenn du auf Draht bist«, riet die Freundin.
Die Zahnlücke stand auf, stapfte aus dem Raum und Pigskin wankte mit geschulterter MP hinter ihr her, auf die grüne Wiese zu, gleich hinter dem Haus, um hier die Waffe beiseite und seinen Einkauf aufs Kreuz zu legen.
»Wo ein Wille, da ein Gebüsch«, blödelte ihnen die rote Ria nach.
»Da staunste, Landsmann«, sagte Charly grinsend zu Maletta: »Wo gevögelt wird, da fallen Zähne.« Er lachte halblaut: »Biste wirklich aus Berlin, Junge?«
Maletta nickte fahrig und stand auf, er hatte genug vom Fusel, von den Fräuleins und auch von Charly, er zahlte und ging nach draußen. Einen Moment blieb er stehen und sah auf die Wiese hinter dem Haus, auf der sie paarweise herumlagen und es miteinander trieben, offensichtlich so häufig, daß die Kinder längst nicht mehr kiebitzten, es sei denn, daß sie sich heranschlichen, um den Soldaten während ihrer ›Quickies‹ Zigaretten aus der Uniformjacke zu stibitzen.
Die Mädchen des Tages und der Wiese waren kaum hübsch, doch fleißig; die Freier hatten sich ihre Gespielinnen nach Soldatenart schöngesoffen, und wenn sie trotz des schwarzgebrannten Fusels nicht attraktiver geworden waren, wäre es ihnen auch gleichgültig. Es ist keine amerikanische Eigenart, sagte sich Maletta, der ähnliche Szenen in russischen Katen erlebt hatte, in französischen Scheunen und in italienischen Eselställen. Ob Sieger oder Besiegte, irgendwie gleichen die Uniformierten einander. Ob GI oder Landser, es gilt: Soldaten – Kameraden. Und Non-Fraternisation bedeutet noch lange nicht Non-Copulation, weder für diesen Besatzungs-Falstaff noch für die anderen Befreier.
Die 65 Dollar Strafe pro Übertretung waren nur eine Drohung auf dem Papier. Die US-Army hätte spielend Millionen-Beträge kassieren können, wenn die dafür Zuständigen sich nicht selbst an dem riesigen Liebes-Bazar zwischen Bremen, Salzburg und Meran beteiligt hätten, mit ›Quickies‹, Liebesstunden, ganzen Nächten, echten Liebesaffären und bald auch mit Heiratsanträgen. Alles war zu haben, wenn auch durchaus nicht alle bereit waren, die Stiftenköpfe mit geschlossenen Augen und gespreizten Beinen über sich ergehen zu lassen.
Peter Maletta sah auf die Uhr, dann schritt er zügig auf den Westeingang zu, um den zweiten Anlauf ins Alabama-Depot zu nehmen. Es war jetzt 14 Uhr 38, am 3. Juli 1945 – dem Tag, an dem die Amerikaner Sachsen und Thüringen, und die Engländer Teile von Mecklenburg räumten. Magdeburg, Leipzig, Dresden gerieten, gemäß den Beschlüssen von London und Jalta, unter den russischen Soldaten-Stiefel und damit hinter einen Machtbereich, für den der britische Premierminister Winston Churchill den Begriff ›Eiserner Vorhang‹ geprägt hatte.
Der Drei-Sterne-General saß in einer Hängeschaukel unter einer dichtgewachsenen Linde im parkähnlichen Garten einer beschlagnahmten Industriellen-Villa in Solln bei München. Er schlenkerte mit den Beinen, und noch im Schatten glänzte sein Helm, überzogen mit mindestens 17 Goldschichten eines Lacks, der eigens für ihn aus den Staaten eingeflogen werden mußte. George S. Patton besaß drei solcher Helme, von denen zwei jeweils in Behandlung waren. Den Kampfanzug hatte Amerikas Panzer-Held Nummer eins mit ledernen Reithosen und zwei gewaltigen ziselierten Texas-Pistolen vertauscht. Er nannte seine Aufmachung selbst »a little fancy dress« und meinte, daß sie seine Autorität fördern würde. Er hätte in dieser Phantasieuniform ohne weiteres am Rosenmontagszug in Köln teilnehmen können, doch am Rhein, den er im Vorfrühling an der Spitze seiner Truppen beim Lorelei-Felsen mit Bravour übersprungen hatte, war beim Kehraus des Tausendjährigen Reiches an Karneval nicht zu denken.
Der Befehlshaber der 3. US-Armee und Hochkommissar von Bayern war überraschend in Bad Tölz abgefahren und in München eingetroffen. Es gehörte zu seinen Spezialitäten, unerwartet aufzutauchen, um seine Offiziere auf Trab zu halten. Für 15 Uhr hatte er eine Besprechung im Garten der Villa im südlichen Stadtteil Münchens angesetzt, die für Colonel Craig W. Rigby vom Counter Intelligence Corps (CIC) requiriert worden war.
Der Intimus des Generals, ein Spitzenmann des Geheimdienstes, war hochgewachsen. Er hatte ein junges Gesicht und graue, kurzgeschnittene Haare. Er war soeben nach einem Blitzbesuch mit dem Helikopter aus dem neuen Zonengrenzgebiet nach München zurückgeflogen und erst vor einer halben Stunde angekommen.
»It was terrible, George«, berichtete er. »Wirklich zum Knochenkotzen. Ich habe es bei Hof erlebt und dann in der Nähe von Coburg: Weinende Frauen, schreiende Kinder, alte Männer, kurz vor dem Zusammenbrechen. Sie trugen Koffer, Rucksäcke oder zogen ihre gesamte Habe in Handwagen hinter sich her oder schleppten sie auf dem Fahrrad mit. Sie versuchten, mit den US-Einheiten nach Bayern weiterzukommen, und die Angst vor den Russen saß ihnen im Nacken. Unsere Boys mußten brutal gegen sie vorgehen, gegen Leute, mit denen sie sich zum Teil längst angefreundet hatten, oder gegen die eigenen Girlfriends. Du weißt ja, George, daß dieses Fraternisierungs-Verbot hinten und vorne nicht klappt. What a shitty time in which we ’re living.«
»Was für eine beschissene Politik, die wir machen«, erwiderte Patton gereizt. »Die Sowjets rüsten auf, wir rüsten ab. Sie verstärken fortgesetzt ihre Kräfte in Mitteleuropa, wir wollen unsere Leute nach Hause schicken. Unser Land hat 280 Milliarden Dollar für den Sieg ausgegeben – und das fliegt uns jetzt um die Ohren. Stalin spuckt uns bei jeder Gelegenheit ins Gesicht. Wir sind mit dem braunen Halunken fertiggeworden und haben dafür jetzt den roten Schurken am Hals. Roosevelts lieben ›Uncle Joe‹, den neuen Adolf Hitler.«
»Don’t be such a pessimist«, versuchte Colonel Rigby seinen Freund zu bremsen, obgleich er Pattons Meinung weitgehend teilte.
»A pessimist?« konterte der General mit den schmalen Augen, die schlau blinzeln und in der nächsten Sekunde zornig blitzen konnten. »Wir haben den Sowjets den Balkan überlassen, Bulgarien, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien. Wir haben ihnen die Tschechoslowakei und Polen ausgeliefert. Sie haben sich Estland, Lettland und Litauen unter den blutigen Nagel gerissen. Sie stehen in Berlin und in Wien.« Patton hatte einen mächtigen Schädel, eine kräftige Nase und volle Lippen. Wiewohl der ›Lucky Forward‹ des Zweiten Weltkrieges, Amerikas berühmtester General, über einsachtzig groß war, wirkte er stämmig, fast ein wenig korpulent. Offensichtlich war er nicht nur ein Eisenfresser, sondern auch ein Feinschmecker. »Wir sind mit den Japsen noch nicht ganz fertig, da braut sich hier schon eine neue Konfrontation –«
Er sah den GI, der aus dem Haus kam, und brach ab.
Der Soldat grüßte militärisch exakt.
Der CIC-Colonel nahm die Meldung entgegen.
»Just a moment, George«, entschuldigte er sich, ging ins Haus und ließ den Haudegen mit seinem Zorn allein.
Der General war nicht nur verbal mit den von ihm als ›Red Bastards‹ Titulierten aneinandergeraten. Schon während des Frankreich-Feldzugs war er zwischen die Schlagzeilen der Weltpresse geraten, als er festgestellt hatte, daß der Lohn des Sieges über Hitler den Amerikanern und Engländern zufallen müsse. Nach dem großdeutschen Zusammenbruch erfuhr der alte Kavallerie-Offizier, daß die Russen in Österreich die Lipizzaner-Pferde erbeutet hätten. Unverzüglich entführte er in einer Kommando-Aktion seiner Panzer die wertvollen Tiere aus dem sowjetischen Machtbereich nach Piper in der Steiermark. Die berühmten Schimmel der spanischen hofreitschule fielen dem Westen zu.
Patton hatte eine Bilderbuch-Karriere durchlaufen, er war erstmals bei der Landung in Nordafrika aufgetaucht, dann in Sizilien, wo er in zehn Tagen von der Südspitze bis Palermo durchgestoßen war. Dort, im Lazarett Holi, ohrfeigte er GIs, deren Nerven versagten, was einen Milhonen-Aufschrei amerikanischer Mütter auslöste. Patton wurde nach England verbannt, wo er tatenlos und verärgert herumsitzen mußte.
Für die Invasion 1944 erhielt George S. Patton zunächst kein Kommando, er war nur als eine Art Pappkamerad eingesetzt, als Lockvogel für die deutsche Spionage. Er mußte sich bei Paraden und Aufmärschen auf der Insel zeigen, um die Deutschen zu bluffen. Tatsächlich hatte man in der Wolfsschanze angenommen, daß keine Landung in Frankreich bevorstünde, solange der erfolgreichste und bissigste US-General vor Teegesellschaften und Kaffeekränzchen patriotische Reden hielt.
Patton blieb der ›Underdog of Overlord‹, bis es an den alliierten Brückenköpfen kritisch wurde. Dann erst schickte Eisenhower den strafversetzten Rehabilitierten auf den Kontinent, aber unter der Bedingung, bei jedem Tobsuchtsanfall erst bis zehn zu zählen, bevor er explodierte. Doch noch ehe die Strategen auf der Insel bis drei gezählt hatten, war ›Lucky Forward‹, wie ihn seine Soldaten nannten, der Panzerdurchbruch bei Avranches geglückt, der praktisch die Entscheidung in Frankreich vorwegnahm. Patton raste im Siegeszug durch Frankreich, schlug als erster Hitlers verzweifelte Weihnachtsoffensive zurück, war auch als erster US-General auf dem rechten Rheinufer und rollte gleich durch bis Eger und dann weiter im stürmischen Vormarsch nach Prag und am liebsten gleich bis Moskau. Der Haudegen hatte vor allen anderen begriffen, daß ›Uncle Joe‹ Amerikas neuer Feind werden würde.
Vorgesetzte, die noch lange nicht soweit waren – aber bald soweit wären –, pfiffen den Hitzkopf nach Bayern zurück, wo er, vergöttert von seinen Soldaten, gefürchtet bei seinem Oberkommando, wie eine Art Sonnenkönig regierte, freilich mit einem kommunistischen deutschen Entnazifizierungs-Minister, den er befehlsgemäß einsetzen mußte; ein General, der es selbst Pazifisten schwermachte, ihn kritisch zu beurteilen. Die Frage stellte sich freilich, wie ein Panzer-Held, immer an der Spitze, immer da, wo es am mulmigsten ist, ein Amerikaner, dem man eine heimliche Bewunderung deutscher Soldatenleistungen nachsagte, die Besetzten vom Militarismus kurieren sollte.
»Da ist diese newsweek-Reporterin schon wieder, George«, sagte Colonel Rigby, der Gastgeber, nach seiner Rückkehr in den Garten. »Sie behauptet, dein Presse-Offizier hätte ihr versprochen, du würdest dich heute von ihr fotografieren lassen.«
»Dear me«, erwiderte Patton. »Ist sie wenigstens häßlich?«
»Hübsch«, entgegnete der Intelligence-Offizier und sein besonderer Vertrauter. »Bildhübsch, sogar. Eine kühle Neu-Engländerin, an die fünfundzwanzig, genau das, was mir der Arzt verschreiben sollte.«
»Bist du krank, Craig?« fragte der General grinsend.
»Well«, erwiderte der Colonel, »ich denke, daß wir Männer bei den Frauen immer eine Art Patienten sind.«
»Go to hell«, erwiderte der kalifornische Farmersohn – er entstammte einer der reichsten Familien Amerikas – lachend, wippte nach vorne, goß sich einen Bourbon ein. »Cheers«, sagte er, »auf deine angegriffene Gesundheit!«
Vor dem Krieg war Colonel Rigby, Kalifornier wie sein Freund Patton, ein bekannter Anwalt in Los Angeles gewesen; dann war er zu den Männern um General William J. Donovan gestoßen, die das ›Office of Strategie Services‹ (OSS), den ersten Geheimdienst der USA, aufgezogen haben. Den Amerikanern lag zunächst der Untergrund nicht. Sie huldigten damals eher noch einer stilisierten Western-Mentalität, und das hieß: Aus der Hüfte schießen, siegen, oder vom Pferd fallen. Sie verachteten Lüge und Verstellung, die Waffen der unsichtbaren Front, als Weiberkram.
Anfänger wie sie waren, mußten sie zunächst blutiges Lehrgeld bezahlen: In Italien zum Beispiel waren 15 OSS-Agenten ihren Gegnern in die Hände gefallen und ohne Gerichtsurteil erschossen worden, wofür demnächst der dafür verantwortliche deutsche General Anton Dostler von den Siegern füsiliert würde, mit Gerichtsurteil.
»Kann die Lady nun kommen?« fragte der CIC-Mann.
Der General sah auf die Uhr. Er hatte noch zehn Minuten Zeit bis zum Eintreffen seiner Offiziere.
»Wenn sie flink ist«, knurrte Patton, »von mir aus.«
Zwischen ihm und der Presse bestand eine beiderseitige Haßliebe. Patton war nicht nur der gefährlichste, sondern auch der ehrlichste US-General. Er wich keiner Frage aus, er hatte keinerlei Hemmungen, seine Vorgesetzten zu attackieren und sie in der Hitze des Wortgefechts auch einmal ›Armleuchter‹ zu nennen. Seine Formulierungen gingen oft bis an die Grenze und waren mitunter mißverständlich, diplomatische Verbrämung war für diesen Militär sprachlicher Firlefanz. Patton, ein gebildeter Mann, der sich auch in Hexametern ausdrücken konnte, bevorzugte im Umgang mit seinen Soldaten und mit der Presse eine vulgärdrastische Ausdrucksweise.
»Warum ist Ihr Vormarsch steckengeblieben, Patton?« hatte ihn einmal während des Frankreich-Feldzugs der Oberkommandierende Dwight D. Eisenhower in seinem Gefechtsstand angerufen.
»Meine Männer können ihre Koppel und auch ihre Stiefel fressen«, bellte der Draufgänger zurück. »Aber sie können nicht den Treibstoff pissen, den sie brauchen.«
Colonel Rigby forderte den Ordonnanz-Soldaten auf, die Journalistin vorzulassen. Der Hochkommissar mit dem Stimmungstief nutzte die Pause für einen Schluck Bourbon und goß sich gleich noch einmal nach.
»Wieviel gesünder würde ich leben, Craig«, stellte er fest, »wenn es diesen verdammten Whisky nicht gäbe.«
»Der Whisky wird dich nicht schaffen«, versetzte der Freund. »Dich schaffen die Generäle Clay und Eisenhower, oder das War-Departement, oder die Nazis oder die Kommunisten.«
»Vielleicht schafft mich auch keiner«, erwiderte der General grinsend.
»Auch das ist möglich, George, ich setze darauf«, entgegnete der Colonel. »Bei einem Mann wie dir stehen alle Möglichkeiten offen.«
»Hast du Angst um mich, Craig?« fragte Patton.
»Angst nicht«, erwiderte sein Vertrauter. »Aber manchmal Sorge. Kriegshelden verlaufen sich im Frieden wie Bastarde auf einer Familienfeier.« Er brach ab, um nicht auch noch hinzuzufügen, daß es in der Roosevelt-Administration – der Präsident war tot, aber die Polit-Beamten seiner Wahl saßen noch in Spitzenstellungen – eine stattliche Reihe von Männern gäbe, die George S. Patton nicht ausstehen konnten. Und fürchteten. Lucky Forward hatte eine Menge Freunde, aber auch eine Unzahl Feinde, er zog sie auf sich, wie ein Torwart, an dem bisher keiner vorbeigekommen war, die Bälle.
Der Colonel sah den GI, der die newsweek-Reporterin in den Garten geleitete. Er stand höflich auf und ging Judy Tyler ein paar Schritte entgegen.
Die Amerikanerin, eine mittelgroße, hübsche Erscheinung, in der eine Menge Frau steckte, trug eine peinlich saubere olivgrüne Uniform mit dem Aufnäher war-correspondent. In einem Gesicht von pikanter Blässe drängten sich die Sommersprossen in Platznot wie die Orden auf einer russischen Generalsbrust. Die junge Frau stakste selbstsicher auf hohen Stöckeln auf General Patton zu.
Colonel Rigby stellte die 25jährige dem Hochkommissar vor. Patton griff schnell nach den Haltern seiner Schaukel, zog sich daran hoch.
»You ’re welcome«, sagte er lächelnd und musterte die Kriegskorrespondentin, nicht ohne Wohlgefallen. »Ich erwarte in ein paar Minuten meine Offiziere. Können wir es schnell hinter uns bringen, Judy?«
»Nein, General«, erwiderte die Neu-Engländerin. »Ich nehme an, Sie wollen mir nicht Modell für Pfusch stehen.«
»Ich möchte überhaupt nicht Modell stehen«, entgegnete der Drei-Sterne-General. »Sie wollen das.«
»Ich muß Sie in Aktion zeigen, Sir«, versetzte die Reporterin. »Ich kann doch nicht den beweglichsten US-General statisch ablichten.«
Die junge Frau mit dem kastanienroten kurzgeschnittenen Haar, das ihren Kopf umschloß wie eine Kappe, hatte bei dem Rauhbein auf Anhieb den richtigen Ton getroffen.
»Well«, antwortete der Panzer-General schnell entschlossen, »dann knipsen Sie mich eben während der Besprechung.« Er sah, daß Craig dagegen Einspruch erheben wollte und kam ihm zuvor – obwohl General Patton schon oft auf Journalisten hereingefallen war, die Zusagen nicht eingehalten hatten, fragte er: »Ich kann mich doch darauf verlassen, daß alles off the record ist, was Sie hier hören werden.«
»Das garantiere ich Ihnen, Sir«, erwiderte Judy Tyler. »Ich werde kein Wort darüber schreiben.« Sie hatte eine angenehme Stimme und sie sprach ein klares, fast britisches Englisch.
»Alles okay, Craig«, beruhigte der General seinen Intimus. Spott kräuselte seine Lippen: »Du weißt doch, daß ich auf das Wort einer schönen Frau einen hohen Turm baue.«
»Den Turm zu Babel«, knurrte Colonel Rigby.
Die Reporterin lachte, offensichtlich hatte sie auch Humor.
»Would you like a drink, Judy?« fragte Patton.
»Oh yes, General«, erwiderte Judy. »Icewater.«
Die ersten Offiziere, die zu dieser Besprechung befohlen worden waren, traten aus der Villa und blieben stehen, als sie sahen, daß der Chef der 3. Armee noch beschäftigt war. »Come in, Gentlemen!« rief ihnen Patton zu.
»Würden Sie bitte den Helm abnehmen, Sir«, bat die Reporterin.
»Muß das sein?«
Als Judy Tyler nickte, trennte sich der General vorübergehend von seinem goldenen Prunkstück. Da er eine Stirnglatze hatte, zog er automatisch den Kopf in den Nacken, um möglichst viel Grauhaar ins Bild zu bringen. Die Reporterin lächelte; Patton war eitel wie ein Pfau, aber ein Mann mit seinen Meriten konnte sich das Radschlagen leisten.
Das Thema der Besprechung war den Teilnehmern nicht eröffnet worden, aber Captain Freetown, der mittelgroße Theater-Offizier – er galt als Menschenfreund schlechthin – stellte fest, daß alle Befohlenen fließend deutsch sprachen und mittelbar oder unmittelbar oder auch nur am Rande mit der politischen Säuberung befaßt waren, wenn auch nicht so übereifrig wie Captain Wallner vom ›Denazification Policy Board‹. Der Offizier schnitt ein trauriges Dackelgesicht mit tiefen Falten, das sich, als er die Reporterin sah, sofort spannte wie ein Regenschirm, prall und rund vor Erwartung. Er galt als Ladykiller, der bei der Schürzenjagd freilich mehr Eifer aufwies als Erfolg. Aber in Germany fand sich wohl für jeden Officer der Besatzungsmacht ein aufgeschlagenes Bett.
»Diese Reporterin kenn’ ich doch«, meinte Major Zielinsky, Chef der Münchener ›Criminal Investigation Division‹ (CID). »Sie ist ebenso reizvoll wie unnahbar. Ein Pflänzchen ›Rühr mich nicht an‹. Viel Kraft. Und noch mehr Ehrgeiz.«
»Dann lebt der General jetzt wohl gefährlich, Jim«, erwiderte der Theater-Offizier lachend.
»Sie ist seriös, Marc«, entgegnete der Major, der für die Bekämpfung der Kriminalität zuständig war. »Nicht bloß beruflich. Sie ist verheiratet, lebt – hörte ich – aber getrennt. Wohl ziemlich schiefgegangen, die Ehe. Und jetzt müssen alle Männer dafür büßen, daß es einer bei ihr geschafft hatte.«
»Gentlemen«, begann der General, »ich hoffe, daß es Sie nicht verwirrt, wenn Mrs. Tyler während unserer Besprechung weiter an mir herumhantiert.«
Seine Offiziere sahen, daß ihn die Gegenwart einer Journalistin bei einer internen Besprechung nicht störte. Es war leichtfertig, aber ein Mann wie er hielt sich einfach für unangreifbar und schlug alle Warnungen in den Wind.
Die Ressortchefs der Militär-Regierung erwarteten, daß sie einen der gefürchteten Patton-Ausbrüche erleben würden.
Der Dolmetscher erwartete Maletta schon am Postentor; er wurde in das Wachbuch eingetragen und erhielt einen Passierschein, auf dem Betreten und Verlassen des Alabama-Depots mit Minutenangabe registriert werden mußten. Die polnischen Blauhelme wollten ihn filzen, aber der Mann mit der Aufschrift interpreter pfiff sie zurück und geleitete den ungebetenen Gast zu Lieutenant-Colonel Williams ins Storage-Office.
»Beim Verlassen des Geländes kann ich Ihnen die Leibesvisitation leider nicht ersparen«, sagte er. »Wir haben hier verdammt strenge Vorschriften.«
Der Weg ins Hauptgebäude war nicht weit, aber sie liefen Slalom um Berge von Vorrat. Tag und Nacht rollte Zug um Zug in das Nachschub-Camp mit dem eigenen Bahnanschluß. Unvorstellbare Mengen von Gefrierfleich, Mais, Reis, Zucker, Trockenei und Trockenmilch, von gesalzener Butter, von K-Rations, Zigaretten, Seife, Kosmetikas, Nylonstrümpfen, Unterwäsche, Wolldecken und Bettzeug, Uniformen, Schuhen, Pullovern und Mänteln, Haushaltsartikeln, Schokolade, Coca-Cola und Kaugummi, bis hin zu Autoersatzteilen, Werkzeugen, Kraftstoff und Marketenderwaren, wie Feuerzeuge, Füllfederhalter, Zigaretten-Etuis, Armbanduhren, waren hier auf dem Gelände des früheren Heereszeugamts gehortet. Der Überschuß drohte zu bersten. Die Schuppen und Lagerhäuser reichten längst nicht mehr aus. Die Güter mußten zwischen Gebäuden im Freien aufgetürmt werden, oft nur durch Zeltplanen gegen den Regen geschützt, Verderb und Diebstahl preisgegeben.
Es gab alles, mit Ausnahme von Schnaps. Alkoholika konnte man nur in der Post-Exchange, der PX, erwerben, gegen Dollars, auf Rationcards. Bei den GIs waren die Quellen schwarzen Schnapses ebenso gefragt wie die Adressen billiger Mädchen. Viele GIs tranken, bis ihnen schwarz vor den Augen wurde, mitunter für immer, wenn sie durch Methylalkohol erblindet waren. Einige hatten für den Fusel bereits mit dem Leben bezahlen müssen. Das aber konnte die Stiftenköpfe ebensowenig vom Trinken unsauberer Destillate abhalten, wie die ständige Warnung vor Geschlechtskrankheiten von ihren ›Quickies‹.
»Mr. Williams hat ganz wenig Zeit«, sagte der Dolmetscher, als sie auf das Storage-Office zugingen. »Er wird in den nächsten Tagen von Colonel Rice das Kommando über das Depot übernehmen. Sie können sich ja vorstellen, wie es da bei uns zur Zeit zugeht.«
Der Mann in der umgefärbten US-Windjacke nickte gleichgültig.
»Viel Hoffnung kann ich Ihnen nicht machen. Der Herr Oberstleutnant hat eine miserable Laune. Na ja, versuchen Sie Ihr Glück.«
Die Stimmungslage des zukünftigen Hausherrn war schon beim Betreten des häßlichen Hauptgebäudes zu hören. Der Hitze wegen standen alle Türen offen. Man konnte noch bis in den letzten Winkel vernehmen, wie gut neue Besen kehren.
»What a mess, Captain Miller!« tobte Williams. »Ich weiß seit langem, daß hier alle klauen wie die Raben. Die Polen, die Deutschen und auch unsere Boys, aber daß zwei komplette Waggons auf dem Weg nach Italien spurlos verschwinden, ist eine grenzenlose Schweinerei.«
»Die Waggons werden wieder auftauchen«, versuchte der für den Gütertransport zuständige Captain abzuwiegeln.
»Leer natürlich«, schrie der Lieutenant-Colonel; seiner Stimme nach mußte sein Blutdruck gewaltig gestiegen sein. »Setzen Sie sich mit der CID in Verbindung. Versuchen Sie Major Zielinsky an die Strippe zu bekommen. Ich möchte mit ihm sprechen. Er muß sich etwas einfallen lassen, sonst stehlen uns die noch den Stuhl unterm Hintern weg.«
Der Hüter und Verteiler des Armeeguts stand vor einem zweifachen Problem: Einerseits hatte er das US-Eigentum vor Langfingern zu schützen, andererseits wußte er nicht mehr, wo er den Strom der Anlieferungen noch verwahren sollte. Mit einem gewissen Schwund mußte man in einem Arsenal dieser Größe immer rechnen, aber in den letzten Wochen hatte dieser jedes erträgliche Maß überschritten. Täglich meldeten die Supervisors neue Verluste. Hunderte amerikanischer, polnischer, deutscher Bediensteter arbeiteten in einer fast indischen Kastenordnung nebeneinander. Die Parias waren die Internierten mit der anrüchigen Vergangenheit. Deutsche Lagerbeschäftigte konnten es schon zu Vorarbeitern bringen. Polnische DPs in ihren dunklen Uniformen waren ihnen übergeordnet; diese wurden von den Militär-Polizisten in den olivgrünen Uniformen beargwöhnt, denen wiederum ihre Offiziere nicht trauten. Die eine Kaste filzte die andere, und so waren sie mit der Zeit alle miteinander verfilzt.
»Es besteht immer noch Aussicht, Sir, daß die beiden Waggons unversehrt aufgefunden werden«, versuchte Captain Miller den Zorn des neuen Chefs zu glätten. »Im letzten Monat stand einmal ein ganzer Güterzug sieben Tage lang auf einem Nebengleis und nichts war abhanden gekommen.«
»Touch wood«, erwiderte Lieutenant-Colonel Williams und klopfte auf die Holzplatte seines Schreibtisches. »Ich hasse zwar diese Herumschnüffelei«, fuhr er fort, »aber wir müssen so rasch wie möglich ein paar getarnte CID-Agenten in unsere feine Belegschaft einschleusen.«
Mr. Williams war mit der Tochter eines US-Senators verheiratet. Seine Laufbahn müßte steil nach oben führen. Noch in dieser Woche würde er zum Colonel befördert und dadurch den ›Chikken-Rang‹ erreichen, den man so nennt, weil das Rangabzeichen eines US-Obersten einem stilisierten Huhn gleicht. Schließlich mußte man erst Colonel werden, bevor man zum General befördert wurde; daß es Bud C. Williams vor allen anderen schaffen würde, bezweifelte niemand. Es war der Lohn für die Bindung an eine spitzköpfige und spitzfindige, doch auch einflußreiche Frau.
»Listen, Captain«, fuhr die Polterstimme fort, »ich werde diese Polacken austauschen, ausnahmslos, und dann –«
»Das führt leider zu gar nichts, Sir«, unterbrach ihn Captain Miller, »die Blauhelme, die wir hier beschäftigen, sind schon halbwegs satt. Wenn wir sie durch hungrige ersetzen, fressen die nur unsere Vorräte ratzekahl.«
Maletta und der Dolmetscher hatten das Vorzimmer erreicht. Sie saßen einander gegenüber, während sich nur ein paar Meter von ihnen entfernt ein Gewitter entlud, das den Besucher nichts anging.
Der Interpreter schloß behutsam die Tür.
»Son of a bitch!« schrie der Lieutenant-Colonel und riß sie wieder auf. Der gedrungene, untersetzte, kurzbeinige und kurzatmige Chef des Mammut-Arsenals – wegen seines Aussehens nannten ihn die Amerikaner ›Stubby‹ – sah den fremden Zivilisten und fuhr ihn an: »What are you doing here?«
»Maletta, my name«, antwortete der Besucher, griff in die Tasche und wies Papiere vor, auf die das Rotgesicht keinen Blick warf. Das ausgezeichnete Englisch, in dem Maletta dem amtierenden Depotchef erklärte, daß er im Auftrag Captain Freetowns mit dem deutschen Internierten Horst Schöller sprechen müsse, ließ den Dolmetscher aufhorchen und machte den Offizier eine Nuance umgänglicher:
»We are the wrong address«, erwiderte Williams, alias Stubby. »Sie müssen sich an den Chef des Interniertenlagers Moosburg wenden. Wir haben uns diese Burschen von dort nur ausgeliehen.« Er zündete sich eine Zigarette an, ließ dabei den Bittsteller nicht aus den Augen. »Was hat eigentlich der Theater-Offizier der Militär-Regierung mit diesem dirty Nazi zu tun?« fragte er, nicht unlogisch.
»Das Permit ist von Colonel Rigby persönlich unterschrieben«, wich ihm Maletta aus.
»Colonel Rigby vom CIC?« entgegnete Williams, er riß dem Deutschen die Papiere aus der Hand, prüfte die Unterschrift. »Well«, sagte er dann. »Five minutes! Not one more! Lassen Sie den Mann von der MP begleiten«, wandte er sich an den Dolmetscher. »Und achten Sie darauf, daß er die Frist einhält.«
Zum Arsenal 9 bis 12 waren es nur ein paar hundert Meter, aber der baumlange Militär-Polizist mit dem martialischen Gesicht wäre kein Amerikaner gewesen, hätte er sie zu Fuß zurückgelegt. Er gab Maletta einen Wink, in den Jeep einzusteigen.
»Where are you coming from?« fragte Maletta, er wußte, daß die Besatzungssoldaten viel zugänglicher waren, wenn man in ihrer Sprache redete.
»New York City«, erwiderte der Hüne, »Manhattan-South. Do you know New York?«
»Oh yes«, erwiderte Maletta und setzte hinzu, daß er schon vor dem Krieg die aufregendste Stadt der Welt‹ mehrmals besucht hatte.
Innerhalb der Einzäunung gab es 70 Waren-Stapel, für jeden war ein deutscher Vorarbeiter verantwortlich, der im ›Office für Arbeitsverteilung‹ Internierte oder auch Zivilisten anfordern konnte. Die automatisch Arretierten wurden erst seit ein paar Tagen versuchsweise eingesetzt. Sie hatten sich freiwillig gemeldet, sowohl um der Lager-Monotonie hinter Stacheldraht zu entgehen als auch in der Hoffnung, das Schlaraffenland könnte ein paar Brosamen für sie abwerfen. Außerdem durchlöcherte es die Lager-Isolation; es war unvermeidlich, daß die Internierten an ihrem neuen Arbeitsplatz mit deutschen Zivilarbeitern, polnischen und amerikanischen Bewachern zusammenkämen. So sahen sie eine Chance, über kurz oder lang an ihre Angehörigen Kassiber herauszuschmuggeln und mit ihnen in Kontakt zu kommen. Der Kommunikation waren kaum Grenzen gesetzt, auch dann nicht, wenn sie sich statt an die lieben Verwandten an die Alten Kameraden wenden würden, die – untergetaucht – in Freiheit lebten.
Der MP trat die Bremse durch und schob sich den Helm nach hinten, um, im Wagen sitzenbleibend, ein Sonnenbad zu nehmen: »Look around«, forderte er Maletta auf. »Search for your damned Nazi.«
Maletta wandte sich an den deutschen Vorarbeiter.
»Schuppen zwölf«, erwiderte der Mann. »Hier, gleich nebenan.«
Horst Schöller stapelte mit zwei anderen Moosburgern Kartons mit Eipulver, einen über den anderen, bis unter das Dach. Mitunter war eine der Pappschachteln beschädigt und sie bauten sie, um bei Gelegenheit an den Inhalt heranzukommen, so ein, daß sie den Karton auf Anhieb wiederfinden konnten. Da viele Schachteln trotz ihrer wasserdichten Verpackung lädiert waren, würden sie am Abend mit von Eggpowder geblähten Bäuchen in das Camp zurückfahren.
»Laßt den Herrn mal mit Schöller allein«, dirigierte der Vorarbeiter zwei Internierte in den Nachbarschuppen.
Maletta betrachtete den kleinen, farblosen Mann mit den unangenehmen Augen, die unstet wieselten. Horst Schöller hatte seine Arbeit unterbrochen und sich umgedreht; er sah, daß er einem Deutschen gegenüberstand und das unterwürfige Lächeln in seinem Gesicht blendete sich langsam aus.
»Sie sind Horst Schöller«, fragte der Besucher.
»Der bin ich«, erwiderte der frühere Vize-Stabschef der Gauleitung München-Oberbayern.
Er war genau so, wie ihn Lisa, die einst seinetwegen zu Maletta geflüchtet war, beschrieben hatte: Der typische Schrumpfgermane, der nach unten tritt und nach oben buckelt, ein Radfahrer, der, rechtzeitig in den Parteiwagen aufspringend, zwölf Zylinder gefahren war, mit Vollgas. Ein Hoheitsträger mit einem Minderwertigkeitskomplex, der zuletzt in der Partei-Hierarchie so hoch gestanden hatte, daß er in Funktionärskreisen ›der kleine Bormann‹ genannt worden war.
»Ich brauche eine Auskunft von Ihnen«, sagte Maletta, den Mann fixierend.
Schöller hatte keinerlei Ähnlichkeit mit der feinen, kühl distanzierten Lisa; entweder lag ein Erbsprung vor oder sie war ausschließlich ihrer Mutter nachgeraten. Maletta hatte sie in ordinären Situationen erlebt, doch nie war Dreck oder Ungeziefer an Lisa herangekommen. In ihrer Gegenwart hatten selbst verwilderte Frontsoldaten, denen jede Frau recht gewesen wäre, ihre Zoten vergessen, in ihrer Phantasie oder auch im Wehrmachtspuff im verkommensten Winkel der Sowjetunion – aber zu Lisa hatten sie aufgesehen.
»Wer sind Sie?« fragte der Internierte; er war auf der Hut. Wenn einer bis zu ihm durchkam, war er vermutlich ein Schweinehund, der für die Militär-Regierung arbeitete. »Warum wollen Sie mit mir sprechen, Herr – Herr –«
»Wegen Ihrer Tochter«, entgegnete Maletta, der noch immer seinen Namen nicht genannt hatte. »Wegen Lisa.«
»Wer sind Sie?« fragte das vorübergehend auf Abstinenz gesetzte Biergesicht zum zweiten Mal.
»Maletta«, nannte der Besucher seinen Namen: »Peter Maletta.«
Der kleine Bormann versuchte vergeblich, sein Erschrecken zu verbergen: Das hätte nicht einmal ein Schauspieler vermocht, wenn er plötzlich einem Toten gegenüberstände, der ins Leben zurückgekehrt war.
»Schon mal gehört, meinen Namen?« fragte Maletta spöttisch.
»Kann schon sein«, entgegnete Schöller.
Seine Wieselaugen gingen wieder auf die Flucht: »Aber ich erinnere mich nicht daran.«
»Sie sind ein Lügner, Schöller.«
Der Internierte schwieg. Er zeigte Verachtung. Er war verstockt, borniert, ein Mann, der sich nie ändern würde: Seine Zukunft war offensichtlich seine Vergangenheit.
»Ich hab’ vielleicht mal eine Tochter gehabt«, sagte Schöller dann. »Aber ich kenne sie nicht mehr. Sie ist für mich nicht mehr vorhanden – eine –«
»Eine was?« fragte der Besucher.
»Eine Amizone.«
»Was ist das, eine Amizone?«
»Ein Amiflittchen, wenn Sie es genau wissen wollen.«
Der Besucher beherrschte sich nur mühsam. Er spürte, wie ihm der Magensaft über die Speiseröhre hochschoß; mühsam drängte Maletta den Impuls zurück, Schöller anzukotzen.
Im Vorfrühling war Maletta körperlich am Ende gewesen, unfähig zu begreifen, daß er im letzten Moment dem Tod von der Schippe gesprungen war. Er hatte Untergewicht, einen nervösen Schrumpfmagen, Hungerödeme, er litt an Kreislaufstörungen, an einem gefährlichen Erschöpfungszustand. Er war im Lazarett, sorgfältig betreut und fachmännisch behandelt, genesen, und hatte dabei wieder zehn Kilo zugenommen. Alle Medikamente, die man Maletta gab, sprachen an, aber als stärkste Droge erwies sich der Haß; der Haß hatte ihn an der Hand genommen und ins Leben zurückgeleitet.
»Ich möchte wissen, wo sich Ihre Tochter Lisa zur Zeit aufhält oder aufhalten könnte, Schöller«, sagte Maletta mit harter Stimme.
Der Internierte schwieg verbissen.
»Sie sind ein Denunziant, Schöller. Ein Nutznießer. Vermutlich noch etwas viel Schlimmeres. Sie haben einen Freund Ihrer Tochter wegen eines harmlosen Witzes ins Strafbataillon 999 gebracht, wo er gefallen ist. Sie haben den eigenen Schwager nach Dachau schaffen lassen.« Maletta machte eine kurze Pause. »Lebt Ihr Schwager eigentlich noch?« fragte er dann.
Horst Schöller preßte die Lippen aufeinander, bis sie weiß wurden.
»Ich bin nicht zuständig für Sie und Ihre Vergangenheit. Das sind andere, aber«, fuhr der Besucher fort, »ich warne Sie. Machen Sie mich nicht zum Polizisten.«
»Von mir erfahren Sie kein Wort über diese Amihure«, entgegnete sein Gegenüber. »Sie ist tot, für mich gestorben.«
Maletta wußte, daß er von Schöller nur dann mehr erführe, wenn er die Methoden anwendete, mit denen er drangsaliert worden war. Soweit war er nicht. Noch nicht.
Aber der Zorn überflutete ihn.
Blindlings schlug er in den feuerroten Glutball vor seinen Augen.
Er traf Schöller am Kinn. Der Schlag klemmte dessen Zunge zwischen die Schneidezähne.
Der Mann knallte jaulend nach hinten, gegen die Wand aus Trockenei.
Der linke Stapel geriet ins Wanken, fiel zusammen, begrub Schöller unter einem Berg von Pappe, Eipulver und Wachspapier. Ein weiterer Stapel krachte auf ihn. Der kleine Bormann war von Kartons zugedeckt, die sich groteskerweise bewegten. Erst kam seine linke Hand zum Vorschein, dann das gepuderte Gesicht mit den verdrehten Augen.
Der Lärm rief die anderen Internierten und ihre Bewacher herbei.
Auch der Militär-Polizist hatte sein Sonnenbad unterbrochen und stand in der Tür.
Er betrachtete genüßlich das Eipulver-Desaster.
»Let’s go, fellow«, sagte der GI aus Manhattan-South grinsend und klopfte Maletta anerkennend auf die Schulter. »You have got your fun.«
Während Maletta in den Jeep einstieg, pirschte sich einer der Internierten an ihn heran: »Schöller ist ein ganz mieses Stück Scheiße«, sagte er hastig, der Mann mußte das Gespräch im Schuppen belauscht haben. »Seine Tochter wohnt bei der Schwester ihrer Mutter in München-Haidhausen«, raunte er. »Sie heißt Herbst, Anna Herbst. Straße weiß ich nicht, aber –«
»Besten Dank«, rief Maletta, als der Jeep schon angefahren war.
Die Polen nahmen ihm das angebrochene Päckchen mit sieben chesterfields ab, die er in der Tasche hatte. Es war ein geringer Preis für die erste Fährte, die er aufgenommen hatte und verfolgen würde.
Seit der Ankunft des Generals war die von der CIC requirierte Villa in München-Solln hermetisch abgeriegelt. Vor dem Haus stand ein Doppelposten, je zwei Soldaten gingen permanent in entgegengesetzten Richtungen um die hohe Gartenmauer herum. In der weiteren Umgebung des Grundstücks patrouillierten Jeeps der Militär-Polizei.
»Gentlemen, zur Stunde stauen sich 4000 Fahrzeuge unserer 2. Panzerdivision auf der Autobahn von Helmstedt nach Berlin«, hatte General Patton seine Befehlsausgabe eingeleitet. »Die Russen haben unseren von General Clay vorgelegten Durchfahrtsplan über zwei Straßen und drei Bahnlinien abgelehnt. Sie haben bei Helmstedt eine Sperre gegen unseren Konvoi errichtet und die Kolonne in brütender Hitze über zwei Stunden warten lassen.« Er redete sich in Rage: »Das ganze Affentheater erscheint mir typisch für unsere schwachsinnige Politik. Wir räumen freiwillig Sachsen und Thüringen und lassen uns nicht einmal den freien Zugang nach Berlin garantieren. Und gleich hinterher machen wir den nächsten Fehler und übergeben den Sowjets, um überhaupt nach Berlin zu kommen, eine Aufstellung unserer Soldaten und Waffen. Wir setzen unsere Boys einem heillosen Durcheinander aus, kuschen knieweich vor Stalin und liefern diesen ›Red Bastards‹ für künftige Gemeinheiten auch noch einen Präzedenzfall.«
Den meisten Offizieren war anzusehen, daß sie den Zorn ihres Befehlshabers teilten. Bis auf Colonel Rigby und die Majore Zielinsky und Tajana waren sie alle während des Krieges Angehörige der ›Psychological Warfare Division‹ (PWD) gewesen. Den Krieg hatten sie längst gewonnen. Nunmehr dämmerte ihnen, daß sie dabei waren, den Frieden zu verlieren – so sie ihre Haltung zu den unnatürlichen Waffenbrüdern im Osten nicht schleunigst ändern würden. Praktisch war mit dem Sieg über Hitler die amerikanisch-britisch-sowjetische Allianz auseinandergefallen.
Die früheren PWD-Officers waren heute auf mehr als ein halbes Dutzend Geheimdienste verteilt, die zwar für das gleiche Land arbeiteten, doch nicht immer am selben Strang zogen, und über ihre Tätigkeiten oft nichts voneinander wußten. Heer, Marine und Air Force waren eifersüchtig darauf bedacht, sich ihre eigenen Nachrichtendienste zu erhalten. Die OSS-Spezialisten, die Erfahrensten, gehörten eigentlich einer zivilen Organisation an, die allerdings dem Generalstab unterstellt war, der wiederum mit G 2 seine eigene Intelligence-Zentrale unterhielt. Daneben tummelten sich noch CIC und die Beauftragten der ›Special Branch‹, die sich speziell mit der Entnazifizierung befaßten, sowie Dutzende von ›Research Services‹, Horchstationen, die über das ganze Besatzungsgebiet verteilt waren.
Es war ein gezieltes Durcheinander nach dem Motto: Konkurrenz belebt das Geschäft.
Der Dschungel bot auch noch die Möglichkeit, in der einen oder anderen Sache vorzupreschen, ohne daß dadurch die offizielle US-Politik bloßgestellt würde. Ein Mann mit der Autorität Pattons konnte Ehrgeiz und Eigenleben der Geheimdienste zügeln, aber Amerika verfügte nur über einen Patton.
»Wir haben Berlin verschenkt«, wetterte der General. »Weder die Deutschen noch die Russen hätten unsere Panzer aufgehalten. Nur ein blödsinniger Anhalte-Befehl hat uns den Weg versperrt, wir haben uns die Hände selbst gebunden und brauchen uns nicht zu wundern, wenn demnächst Europa kommunistisch wird.«
Es waren 15 Offiziere anwesend, und der General sah an ihren Gesichtern, daß fast alle seinen Ingrimm teilten, am lautesten die First-Lieutenants King und Sears, wegen ihrer ständigen Querelen die ›Trouble-Brothers‹ genannt. Rigby und Peaboddy waren, wie immer, einer Meinung. Captain Spoonwood, dessen großer Kopf auf einem zu langen Hals saß, schnitt ein Pokergesicht. Major Silversmith und Captain Wallner, die als ›Chaos-Boys‹ galten, als Anhänger des Morgenthau-Plans, warteten noch ab; und Captain Freetown, der Theater-Offizier, schien eher mit künftigen Spielplänen beschäftigt zu sein als mit der drohenden amerikanisch-russischen Konfrontation.
»Sie passen schon auf, Judy«, wandte sich der Hochkommissar, sein Thema kurz unterbrechend, der newsweek-Reporterin zu, »daß Sie meine Falten am Hals nicht erwischen. Die sind schließlich mein Privateigentum und gehen die Öffentlichkeit einen Dreck an. Und halten Sie sich bitte an meine linke Gesichtshälfte, wenn’s geht.«
Er beobachtete, wie die War-Korrespondentin ihr Stativ verkürzte und ein Weitwinkel-Objektiv in ihre Kamera einsetzte.
Captain Wallner starrte die junge Frau in der Uniform unentwegt an. Seinem Gesichtsausdruck nach war er – im Gegensatz zu Major Silversmith von der ›Special Investigation Section‹ – mit ganz anderen Vorstellungen befaßt als der Tücke der Russen. Neben ihm saß der schweigsame Major Tajana, Peaboddys rechte Hand; er gab sich penibel, fast pedantisch, konnte aber als früherer OSS-Officer spontan und unkonventionell handeln, im Gegensatz zu Captain Spoonwood, dessen Uniform an ihm herumschlotterte, als hätte er sie sich ausgeliehen und ohne Probe mitgenommen. Dave Spoonwood war fraglos der häßlichste, jedoch sicher auch einer der intelligentesten Offiziere des Military Government.
»Aber unsere Politik beruht doch nun mal auf der Verständigung zwischen den Russen und uns«, sagte Captain Wallner, dessen Augen sich von Judy Tyler endlich freigemacht hatten, halblaut zu Colonel Peaboddy. »Diese Allianz ist schließlich das Herzstück unserer Diplomatie.«
Der General hörte die Worte und griff sie auf: »Indeed, Captain«, erwiderte er süffisant: »Wenn aber diese Allianz nicht klappt, muß die Politik geändert werden. Wie nennt man einen Mann, der sein Herzstück verhätschelt und sich von ihm ständig hintergehen läßt?«
»Einen Waschlappen«, erwiderte Colonel Rigby.
»Richtig, Craig«, versetzte Patton, »ich denke, wir haben uns lange genug von den Sowjets Hörner aufsetzen lassen.« Er hatte das richtige Reizwort gefunden. Die Stimmung war angeheizt, trotzdem riskierte Major Silversmith eine Attacke auf seinen Befehlshaber:
»Sie haben natürlich in vielen Dingen recht, Sir«, begann er vorsichtig – er unterstand direkt OMGUS, dem US-Oberkommando –, »aber ich denke doch, daß die Dinge nicht ganz so einfach liegen.« Trotz der allgemeinen Feindseligkeit, die der Major spürte, fuhr er fort: »Wenn wir mit den Russen brechen, arbeiten wir den deutschen Nazis direkt in die Hände.« Er wich den Augen des Generals nicht aus. »Schließlich versuchen die ja ständig, uns und die Sowjets auseinanderzudividieren.«
»Baloney«, schimpfte Freetown, einem Ausbruch Pattons zuvorkommend. »Bosh. Ist Winston Churchill ein deutscher Nazi?«
»Natürlich nicht, Marc.«
»Wissen Sie, was der britische Premier gestern öffentlich festgestellt hat?« fragte er: »Die Russen werden wie Heuschrecken über ganz Europa herfallen.«
Der geschmeidige Theater-Offizier hatte einen Nagel auf den Kopf getroffen und den meisten Anwesenden aus dem Herzen gesprochen. Er war ein mittelgroßer, gut aussehender Mann mit einem knappen Gesicht und einem offenen Blick, der gute Mensch von nebenan, der noch dazu Grips hatte. Grips und Witz.
»Ich nehme nicht an, Gentlemen«, beendete der General das Hickhack zwischen seinen Offizieren, »daß unter Ihnen einer ist, der mich für einen Nazi hält.« Er wartete, bis sich das Gelächter gelegt hatte. »Das möchte ich vorausschicken, um nicht mißverstanden zu werden. Ich sehe mich gezwungen, festzustellen, daß die Anstrengungen, die wir unter dem Stichwort ›Denazification‹ betreiben, einem Narrentreiben gleichen. Und dieser Nonsens wird uns, wenn wir ihn nicht rechtzeitig abstellen, wie ein Bumerang an den Kopf fliegen. Genau darauf warten unsere Ex-Waffenbrüder schließlich.«
Fast alle aus der Umgebung des Drei-Sterne-Generals standen mit ihren Ansichten hinter Patton, was nichts daran änderte, daß der eine oder andere ihn lieber auf dem Sockel eines Kriegerdenkmals gesehen hätte, denn als allgegenwärtigen Befehlshaber der 3. Armee.
»Wir können natürlich Regierungsräte zu Straßenkehrern machen, und wir tun es ja auch«, fuhr er fort, »wir können aber nicht Straßenkehrer zu Regierungsräten ernennen, aber das tun wir auch, und diesen Wahnsinn möchte ich unverzüglich abstellen. Ich werde künftig nicht mehr dulden, daß sie einen politisch integeren, aber fachlich unqualifizierten Mann auf einen Stuhl setzen, der für ihn einfach ein paar Nummern zu groß ist.«
Judy Tyler, die Reporterin, ging jetzt mit der Handkamera dicht an den General heran, sein Gesicht schien sie mehr zu interessieren als seine Worte.
»Sagen Sie mir, Judy, wenn Sie abdrücken, damit ich rechtzeitig meine Wampe einziehen kann«, sagte der General ungeniert und wandte sich wieder seinen Offizieren zu. »Ich denke, wir haben uns verstanden, Gentlemen?«
»Indeed, Sir«, antwortete Captain Wallner. »Aber wo sollen wir die qualifizierten Leute hernehmen, Sir, wenn wir sie nicht haben?«
»Sie müssen sich eben mehr anstrengen, Captain«, entgegnete der Hochkommissar.
Es war eine etwas billige Feststellung, denn die Officers des Military Government waren ununterbrochen auf der Suche nach Deutschen, die Entnazifizierungslücken schließen könnten. Die Löcher in der deutschen Verwaltung gingen auf Bestimmungen des fernen Washington zurück, auf die noch der ›Morgenthau‹ gefallen war, aus Anordnungen, die vorsahen, alle Parteigenossen aus ihren Stellungen zu entfernen.
Aber die Eisenbahnzüge mußten trotzdem rollen, die zerstörten Brücken wenigstens behelfsmäßig wieder aufgebaut werden. Die öffentlichen Gesundheitsdienste hatten den Ausbruch von Massenseuchen zu verhindern, und die Verwaltung mußte dafür sorgen, daß nicht die deutsche Bevölkerung, Schwarzhändler und Fräuleins ausgenommen, pauschal verhungerte. Die Not an geeigneten Männern war so groß, daß sich das Military Government vorübergehend sogar Beamte aus der Schweiz auslieh; die – noch dazu kostspieligen – Eidgenossen waren natürlich keine Dauerlösung.
Daß Wasser, Strom und Gas jetzt wieder halbwegs funktionierten, war nur einigen örtlichen Befehlshabern – innerhalb der Militär-Regierung ›Landkreis-Könige‹ genannt – zu verdanken, die, stillschweigend die Vorschriften umgehend, PGs weiter beschäftigt hatten, bis ein ›Informer‹ diesen Vorgang höheren Ortes denunzierte, worauf der Mann ersatzlos wieder gefeuert werden mußte. Unter diesen Umständen war es für jede Stadtverwaltung ziemlich aussichtslos, genügend Kräfte zu finden, Männer, die einen sauberen Fragebogen vorweisen konnten und doch etwas von ihrem Fach verstanden.
Es gab sie natürlich, aber diese Leute waren zu alt oder zu gewitzt, um sich in so unsicheren Zeiten auf vage Experimente einzulassen. In einigen Fällen hatten die Amerikaner den einen oder anderen dann doch mit der Androhung überredet, ansonsten einen DP zum Bürgermeister oder Landrat zu ernennen. Seltener gab es Patent-Lösungen wie in der fränkischen Stadt Ansbach, wo ein mit illegalen Ostzonen-Flüchtlingen überladener Lastwagen zusammengebrochen war. Die Militär-Polizei nahm sofort eine Personen-Kontrolle vor und stieß dabei auf einen hohen Ministerialbeamten aus Berlin, der nicht der Partei angehört hatte. Der Mann wurde auf der Stelle zum Bürgermeister befördert.
»Ich denke, Sie haben mich verstanden, Captain Wallner«, sagte der General zu dem Offizier, der offensichtlich mit Pattons neuer Weisung nicht einverstanden war.
»Sir«, entgegnete er, »Vernunft und Vorschriften sind zwei Paar Stiefel. Was Sie nunmehr anordnen – darauf muß ich leider aufmerksam machen – verstößt ganz entschieden gegen die Vorschriften.«
»Vorschriften!« schnaubte der General. »Putzen Sie sich mit Ihren Vorschriften den Arsch ab, und lassen Sie mich in Ruhe mit diesem beschissenen Papiermist.« Er sah zu der Journalistin hin: »Sorry, Judy«, entschuldigte er sich.
»It does’nt matter, General«, erwiderte sie. »Ich lebe lange genug unter Männern.«
Der General nickte lächelnd. »Alles klar, Captain Wallner? Es ist ein Befehl«, setzte er hinzu. »Ich werde jeden von Ihnen decken, der sich in dieser Sache in Widerspruch zu den Bestimmungen setzt.«
»Aber das ist doch nicht etwa ein Freibrief für die Nazis«, schaltete sich Major Silversmith wieder ein.
»Nicht für Nazis«, erwiderte Patton, »weiß Gott nicht. Hier können Sie sich austoben, Captain. Fangen Sie den Gestapo-Müller, den Reichsleiter Bormann, den Gauleiter Koch, die SS-Obergruppenführer Pohl und Heissmeyer oder den Judenmörder Eichmann. Soll ich Ihnen noch weitere Namen aufzählen?«
»Immerhin schnappen wir jeden Tag durchschnittlich siebenhundert Nazis«, erwiderte Silversmith.
»Vermutlich sechshundert zu viel«, konterte Patton. »Und das halbe Reichssicherheitshauptamt läuft noch frei herum. Ich habe mir diese Kerle vorgestern im Interniertenlager angesehen, die ihr zusammengetrieben habt: Es sind nicht die Nazi-Monster, gegen die wir gekämpft haben. Die meisten sind kleine Fische oder windige Scheißer.«
»Wir werden uns mit jedem einzelnen von ihnen befassen«, erwiderte Silversmith.
»Aber schnell, wenn ich bitten darf.«
»Wir tun, was wir können.«
»Wissen Sie eigentlich, daß die Russen längst begonnen haben, auf unserem Besatzungsgebiet deutsche Wissenschaftler zusammenzufangen und in die Sowjetunion zu befördern? Zum Beispiel Raketenforscher von Peenemünde, Ingenieure, die an der Entwicklung des deutschen Düsenjägers und des Turbinen-U-Bootes gearbeitet haben.«
»Sie haben Beweise, Sir?« fragte selbst G2-Colonel Peaboddy überrascht.
»Wir haben sie«, knurrte Rigby, anstelle des Generals, »und sie sind hieb- und stichfest. Niemand kann an ihnen rütteln.«
»Kommen wir zum Schluß«, sagte Patton. »Hier meine Befehle: Erstens: Kein unqualifizierter Deutscher rückt künftig in eine Stellung ein, der er nicht gewachsen ist. Zweitens: Sie verstärken Ihre Anstrengungen, geeignete unbelastete Persönlichkeiten zu finden. Und zum Dritten: Falls Sie keine geeigneten Unbelasteten auftreiben, greifen Sie mit meiner vollen Rückendeckung auf formal Belastete zurück – natürlich nicht auf big or worst Nazis.«
Als Patton seine Offiziere verabschiedete, hatte er erheblich dazu beigetragen, eine Verschwörung, die sich von weit links bis weit rechts gegen ihn angebahnt hatte, voranzutreiben. Zudem hatte er den ersten Schritt in eine Richtung getan, die bald in den Schlagzeilen der Weltpresse als ›Bavarian Scandal‹ Lärm verursachen würde.
Seine gewagt-hemdsärmeligen Äußerungen würden bereits morgen seinem Oberkommandierenden Eisenhower auf den Schreibtisch flattern und bei Stabschef Walter B. Smith die Feststellung provozieren: »His mouth does not always carry out the functions of his brains«, was bedeuten sollte, daß Pattons große Klappe nicht immer seinem Gehirn Rechnung trüge.
Der National-Held blieb weiterhin ein Sorgenkind.
Auch die Sowjets hatten ihn längst im Visier.
Für das Münchener Einwohnermeldeamt war es heute schon zu spät, deshalb fuhr Peter Maletta mit dem Jeep seines Arbeitgebers nach Bogenhausen. In seiner Chauffeurs-Wohnung fand er auf dem Tisch einen Fragebogen der Militär-Regierung; auf einen angehefteten Zettel hatte Captain Freetown geschrieben: »Please, fill in this damned form, Peter.«
Er las das Papier-Monster der Besatzungs-Inquisition durch: 131 Fragen, von den Amerikanern in einer Gesamtauflage von 79 Millionen herausgebracht, mit der Schreibmaschine oder mit Blockbuchstaben ›wahrheitsgemäß‹ auszufüllen; falsche oder fahrlässige Angaben wurden mit drakonischen Strafen bedroht. »Wer hat dich, du schöner Wald«, spottete schon bald das erste von Captain Marc Freetown lizenzierte Kabarett, »abgeholzt zu Fragebogen?«
Man mochte über das Produkt von Neugier und Willkür lachen oder zornig werden oder verzweifeln – nicht wenige drehten aus Angst vor dem Fragebogen den Gashahn auf oder erhängten sich –, für den Normalverbraucher führte kein Weg daran vorbei. Wer nicht arbeitete, erhielt keine Lebensmittelmarken. Wer eine Tätigkeit ausübte oder sich um sie bewarb, mußte sich, ganz gleich für welche Position, dieser Kanonade notwendiger, indiskreter und oft auch indiskutabler Fragen aussetzen.
Wiewohl der Kampf ums Überleben bei der Bevölkerung die Gesetze des Rechts und der Moral gelockert hatte, obwohl marodierende Ausländer-Banden auf dem flachen Land Nacht für Nacht entlegene Gehöfte überfielen und ausplünderten, obwohl falsche Beauftragte der Militär-Regierung immer wieder bei früheren Parteigenossen erschienen, um Radioapparate, Photogeräte, Fahrräder, Schmuck und Uhren zu ›konfiszieren‹, ergingen die weitaus meisten Urteile der Gerichte wegen Fragebogen-Fälschung.
Ein beispielloser Zufall ermöglichte der Militär-Regierung, unwahre oder ungenaue Angaben umgehend zu entlarven: In einer Papiermühle in München waren kurz nach dem Einmarsch nahezu sämtliche Personal-Unterlagen der Partei und ihrer Gliederungen – die Bürokratie ist das Gewissen der Diktatur –, zum Teil schon in riesigen Bottichen aufgeweicht, gefunden, aufgefischt, getrocknet und geordnet worden. Statt zu Papierbrei verarbeitet zu werden, wurden die Unterlagen zur Papierfalle. Die Militär-Regierung verwahrte sie in einem ›Document-Center‹ und nutzte sie so wirkungsvoll, daß künftig kein Bewerber mehr ohne Rückfrage eingestellt werden konnte.
Maletta machte sich an die lästige Arbeit und beantwortete Fragen nach Körpergröße, Gewicht, Farbe der Augen wie der Haare, nach Narben oder anderen besonderen Kennzeichen, wie sie eigentlich in einen polizeilichen Steckbrief gehören. Die Frage Nr. 18: »Aufzählung aller Ihrerseits oder seitens Ihrer Ehefrau oder Ihrer beiden Großeltern innegehabten Adelstitel« erinnerte ihn irgendwie an den ›arischen Nachweis‹, wie ihn früher die Nazis von ihm verlangt hatten.
Maletta schluckte seinen Verdruß über die lästige Arbeit hinunter, vor der ihn bislang der Hausherr, sein Gönner, bewahrt hatte. Sicher würde Captain Freetown Schwierigkeiten bekommen, wenn sein problematischer Fahrer und Nebenbewohner sich nicht den Fragen dieser Zeit stellte. Er gab es auf, sich darüber zu ärgern, daß die Amerikaner zum Beispiel nachträglich ein Wahlgeheimnis verletzten, indem sie wissen wollten, welche Partei er 1932 gewählt hatte.
Keine, trug er in die vorgesehene Rubrik ein, er war zu dieser Zeit erstmals im Ausland gewesen und damals noch als Bordfunker die ›Wanzenstrecke‹ geflogen; so hatte man bei der Lufthansa die Route Berlin-Athen genannt.
Der Befragte beschränkte sich auf das Minimum an Antwort, verzichtete auf Anlagen und brauchte trotzdem zwei Stunden, bis er alle 131 Rubriken ausgefüllt hatte. Ein paar Minuten bevor der Theatre-Officer, von der Befehlsausgabe bei General Patton zurückkehrend, bei ihm auftauchte, war er fertig geworden.
»Fleißarbeit?« fragte Marc Freetown.
»Scheißarbeit«, erwiderte Maletta.
Sie lachten beide.
»Hier«, sagte Maletta und überreichte mit spitzen Fingern den Fragebogen.
»Hast du dir keinen Durchschlag gemacht?«
»Wozu, Marc?« fragte der Dauergast. »Blütenweiß.« Er lachte hämisch. »Zufällig.«
»Nur eine Formsache«, erklärte der Captain. »Noch ein kurzer Besuch im Clearing-Office bei Captain Spoonwood, wo ich dich schon angemeldet habe, und du hast künftig deine Ruhe vor dem Eifer der Besatzungsmacht.«
Freetown faltete den Fragebogen zusammen.
»Hältst du das nun für ein Kunstwerk oder ein Machwerk, Peter?« fragte er.
»Es muß wohl sein«, erwiderte der deutsche Dauergast. »Viele Fragen sind nur zu berechtigt, und trotzdem ist alles zusammen idiotisch – falls du meine Meinung hören willst.«
»Will ich.«
»Da gab es zum Beispiel braune Schreihälse, die brüllten bei jeder Gelegenheit und alle Nachbarn hatten Angst vor ihnen. Als dann der braune Spuk endlich vorbei war, stellte sich heraus, daß sie nicht einmal der ›NS-Volkswohlfahrt‹ oder dem ›Reichskolonialbund‹ angehört hatten. Sie präsentierten auch noch die Ausrede, nur deshalb so geschrien zu haben, um nicht als Nicht-Nazi erkannt zu werden. Capito?«
»Natürlich«, entgegnete der Captain nachdenklich.
»Dann diese Welle der Zwangsparteieintritte 1937. Es kam doch darauf an, welchen Chef du hattest: War er ein Fanatiker, blieb dir kaum was anderes übrig; war er ein Phlegmatiker, bedeutete es noch lange keinen Widerstand, wenn du dich dem Parteieintritt widersetzt hast.«
»Interessante Gesichtspunkte«, sagte der Offizier mit den zwei Silberbalken und wechselte das Thema: »Bist du fündig geworden im Alabama-Depot?« fragte er beiläufig.
»Ich habe diesen üblen Burschen vermöbelt und bin vielleicht auf eine erste Spur gestoßen.«
»Ich weiß«, erwiderte sein Gönner. »Du hast den Internierten Schöller fast mit Eipulver erstickt. Lieutenant-Colonel Williams war empört über deine Eigenmächtigkeit. Ich habe übrigens veranlaßt, daß Schöller ab sofort zusätzlich beschattet wird.«
»Warum das?« fragte der Dauergast, scheinbar begriffsstutzig.
»Es hätte für dich ja wohl auch andere Möglichkeiten gegeben, Lisa Schöller ausfindig zu machen«, erwiderte der Amerikaner mit der hohen Stirn, den dichten Augenbrauen und dem melancholischen Charme. »Vermutlich wolltest du provozieren, daß der Bursche in Panik gerät und eventuelle Hintermänner kontaktiert. Darauf wartest du doch?«
»Vielleicht«, entgegnete Maletta überrascht. »Für einen Theater-Offizier bist du ganz schön ausgekocht.«
»Schließlich bin ich ja ein alter PWD-Mann«, erinnerte der Captain, »und mit dem Theater ist zur Zeit nicht viel los.«
Man sagte dem Captain nach, daß er als Drehbuch-Schreiber in Hollywood keinen übermäßigen Erfolg gehabt, sich aber dann bei der psychologischen Kriegführung enorm bewährt hätte, auch wenn er stets wohlmeinende Menschlichkeit verströmte wie eine Schwester von der Heilsarmee.
Theatre-Officer, ein Job ohne Tätigkeit. Noch waren die meisten Bühnen geschlossen, und in dieser Zeit fanden die Aufführungen ohnedies auf der Straße statt – wenn sich frühere Hoheitsträger nach Zigaretten-Kippen bückten, Erschöpfte am Gehsteig tot zusammenbrachen, Frauen beim Schlangestehen einander in die Haare gerieten oder Schwarzhändler, bei einer Razzia auf Lastwagen getrieben, ihre Zigarettenpäckchen und Schokoladenriegel verstohlen wegwarfen und Polizisten sie dann unverblümt aufhoben und einsteckten: Straßentheater.
»Ich hoffe, ich habe dich mit meiner Maßnahme nicht verwirrt, Peter«, sagte Freetown lächelnd.
»Verwirrt nicht, aber überrascht, Marc.«
Wenn er lachte, sah er Mike ähnlich, seinem jüngeren Bruder, Malettas früherem Freund: Sie hatten sich schon 1938 auf der Blindflugschule der lufthansa in Berlin kennengelernt. Es war Sympathie auf den ersten Blick. Dieselbe Generation, dieselben Interessen, gleiche Mädchen und dieselbe Passion für das Fliegen. Sie waren unzertrennlich, wurden Freunde und begegneten sich nach der Trennung in Berlin später wieder – und nicht zufällig in Südamerika. Mike flog für eine US-Firma, sein deutscher Freund für die Linie mit dem stilisierten Kranich.
1941 riß sie der Krieg auseinander.
Mike Freetown bewies wenig später bei diesigem Wetter als Kommandant einer die US-Bomberpulks anführenden Pfadfinder-Maschine über Germany, was er – nebst vielen anderen Ausländern – bei seinem Blindflugkurs in Berlin gelernt hatte.
Bei einem Tagesangriff auf eine Kugellager-Fabrik traf Mike Freetown dann das Schicksal seiner verheizten Generation: Seine Maschine wurde in Brand geschossen, stürzte ab, und was von der Besatzung übriggeblieben war, ließ sich in einem Schal bergen.
Von der ersten Begegnung abgesehen, hatte Maletta nie mit Marc über Mike gesprochen. Beide zeigten die gleiche Scheu, den Namen des Freundes oder Bruders zu erwähnen.
»Nachdenklich, Peter?« fragte der Captain.
»Ein wenig«, erwiderte sein Gast und verging sich erstmals an einem Tabu. »Ich frage mich zum Beispiel, wie lange ich mich noch bei dir anwanzen kann, nur weil ich einmal mit Mike befreundet war.«
»Das hat doch damit nichts zu tun«, entgegnete der US-Offizier hastig. »Du suchst in meinem Auftrag deine früheren Leute zusammen, die ich dann in den Dienst der US-Truppen-Betreuung stellen werde und –«
»Kalter Kaffee«, unterbrach ihn Maletta, »das glaubst du doch selbst nicht. Erstens ist es fraglich, ob es bei meinem Verein überhaupt Überlebende gibt; falls ja, bleibt offen, ob ich sie finden werde, und wenn doch, in welcher Verfassung.«
»Aber bis du sie findest«, entgegnete der Theatre-Officer lächelnd, »biete ich dir doch eine ausgezeichnete Möglichkeit, sie zu suchen.«
»Das ist aber auch der einzige Grund, warum ich deine Großzügigkeit annehme. Ich hoffe nur, daß ich dir auch einmal einen Stein in den Garten –«
»Das hoffe ich auch«, versetzte Freetown schlicht.
Sie lachten beide.
Mikes Bruder legte den Arm um Malettas Schulter.
»Let’s have a drink«, sagte er. Der Bourbon beendete ungelöste Fragen und Selbstvorwürfe. Der Alkohol würde alle Probleme lösen, wenn auch nur für Stunden. Am Morgen kämen sie wieder und schmeckten dann nach Jack Daniels.
Bestückt mit blanko unterschriebenen US-Bescheinigungen, die er von seinem noblen Förderer im Dutzend erhalten hatte, sprach Maletta am nächsten Morgen beim Einwohneramt an der Ettstraße vor. Einer der neuen Angestellten konnte zwar nicht Englisch, riß sich aber die Beine aus für einen Mann, der so gute Beziehungen zur Besatzungsmacht hatte. Freilich war der gute Wille bei diesem Lückenbüßer der politischen Säuberung größer als sein fachliches Können.
Erst nach einer Stunde erfuhr der Besucher, daß eine Anna Herbst zuletzt in der Breisacher Straße polizeilich gemeldet war. Der Rechercheur fuhr in den Münchener Osten und stellte fest, daß das angegebene Haus eine unbewohnte Ruine war. Maletta war so weit wie zuvor, aber eine Nachbarin berichtete ihm, daß die Ausgebombte in ein Dorf in der Nähe der Stadt Freising evakuiert worden sei.
Am übernächsten Tag stand Peter Maletta vor ihr, einer alten Frau mit erloschenen Augen und einem von der Zeit malträtierten Gesicht. Seinen Namen hatte Anna Herbst vergessen oder nie gehört. Erst als er von Lisa sprach, zeigte sich im Gesicht ihrer Tante eine Spur Leben.
»Mein Gott, das arme Kind«, sagte sie. »Was sie alles mitgemacht hat. Wir haben alle viel mitgemacht. Ich habe alles verloren, mein Mann ist aus Dachau nicht zurückgekommen. Lisa wurde in ein Arbeitslager gesteckt. Vom eigenen Vater, stellen Sie sich das vor. In einer Munitionsfabrik mußte sie Granaten drehen, während der Luftangriffe und –«
»Aber Lisa lebt?« fragte Maletta vorsichtig.
»Gott sei Dank«, erwiderte die alte Frau, die vermutlich weit jünger war, als ihr Gesicht dem Besucher einredete. »Sie hat alles überstanden. Sie hat mich besucht, vor einigen Wochen, und auch versprochen, daß sie bald wiederkommen wird.«
»Wo lebt Lisa?«
»In München, glaub’ ich.«
Schließlich erfuhr der Besucher, daß sich Lisa bei einer deutschsprachigen amerikanischen Zeitung beworben hätte: Ein magerer Anhaltspunkt war immer noch besser als gar kein Hinweis.
»Kann ich etwas für Sie tun, Frau Herbst?« fragte Maletta und dachte an Mehl, an Butter, an Fleisch.
»Für mich kann keiner mehr etwas tun«, antwortete die Alte ohne Vorwurf, um ihm dann, als er schon auf der Treppe war, noch nachzurufen: »Doch, Herr Maletta, Sie können etwas tun! Bitten Sie Lisa, daß sie mich wirklich bald wieder besucht. Sie hat’s ja versprochen.«
Maletta stieg in den Wagen, knallte die Türe zu, startete mit Vollgas, aber seiner Vergangenheit konnte er nicht davonfahren. Auf der Fahrt nach München beruhigte er sich, auch wenn er wußte, daß er Marc wieder einmal um einen Gefallen bitten mußte. Vielleicht arbeitete Lisa bei einem der Mitteilungsblätter, wie sie die örtlichen Militär-Gouverneure von Fall zu Fall herausbrachten. In diesem Fall hätte sie mit Sicherheit einen Fragebogen ausfüllen müssen, bei den in dieser Branche besonders mißtrauischen Amerikanern vielleicht sogar mehrere.
»Ich werde mit ICD sprechen«, sagte Captain Freetown bereitwillig, »mit der ›Information Control Division‹.« Er ging in den Nebenraum und telefonierte. »Sieht nicht schlecht aus«, sagte er, als er wieder zurückkam. »Melde dich heute nachmittag bei Captain Spoonwood im ›Clearing-Office‹, er ist bereit, dir weiterzuhelfen. Bei dieser Gelegenheit kannst du dir gleich – der guten Ordnung halber – deinen Fragebogen absegnen lassen.«
Die Münchener nannten die Tegernseer Landstraße, die zum Hauptquartier der Militär-Regierung führte, die ›Bücklings-Allee‹. Alltäglich zog über sie eine profane Prozession von Bittstellern zu dem riesigen Gebäudekomplex der früheren Reichszeugmeisterei: Bekehrte Sünder und verkehrte Antifaschisten, Denunzianten und Denunzierte, Erpresser und Erpreßte, Schinder und Geschundene, Kriegsgewinnler und Friedenshyänen, arme Wichte und krumme Hunde.
Sie alle wollten etwas von der Militär-Regierung und blieben meistens in einem der vielen Vorzimmer hängen, mußten warten, wurden vertröstet und wieder bestellt, um am nächsten Tag die Prozedur wieder vergeblich über sich ergehen zu lassen. Die Zeit war wie eine Strafe, zu der jeder verurteilt wurde, der in ihr lebte.
Die Riege der Machthaber war so gemischt wie die Heerschar der Supplikanten: Es gab Hochgebildete und Dummköpfe, Fleißige und Faule, Korrekte und Korrupte. Es gab Männer, die es mit der Umerziehung der Besetzten ernst meinten, und andere, die aus blindwütigem Haß am liebsten alle Deutschen zu Nibelungen des Morgenthau-Plans gemacht hätten.
Captain Spoonwood, der Maletta nach umständlichen Sicherheits-Checks und Rückfragen im Clearing-Office empfing, ließ auf den ersten Blick nicht erkennen, zu welcher Kategorie er gehörte. Ein Mann, dem sein Schicksal wie ins Gesicht gestempelt schien: Flucht aus Galizien nach Deutschland. Flucht aus Deutschland in die Staaten. Spoonwood, offensichtlich ein geborener Löffelholz – österreichische Offiziere hatten sich vor dem Ersten Weltkrieg ein Vergnügen daraus gemacht, die jüdische Bevölkerung mit absonderlichen Nachnamen zu benennen –, sprach klares Deutsch ohne englische oder jiddische Wortbrokken. Er wirkte viel zu dienstlich, um freundlich oder unfreundlich zu erscheinen.
»Nehmen Sie Platz, Herr Maletta«, sagte er. »Ich denke, wir werden nicht allzulange brauchen.« Spoonwood glättete den auf seinem Schreibtisch liegenden Fragebogen des Besuchers. Er sah Maletta an, als blickte er durch ihn hindurch: »Ich habe Captain Freetown gebeten, Sie zu mir zu schicken«, erklärte er. »Ich bin schon seit einiger Zeit gespannt auf Sie und –«
»Warum, Captain?« unterbrach ihn Maletta.
»Ich kenne Teile Ihrer Vorgeschichte aus deutschen Akten.« Erstmals zeigte sich in seinem Gesicht der Ansatz eines feinen Lächelns. »Marc könnte daraus spielend ein spannendes Drehbuch für einen Hollywood-Film fertigen.«
»Vorläufig liegt das Copyright noch bei mir«, erwiderte der Besucher gereizt.
»Sure«, räumte der Clearing-Officer ein, »jedenfalls bringt ein Mann wie Sie etwas Würze in diese fad-braune Einheitssauce.« Er griff nach dem Fragebogen und schob ihn dann, als hätte er es sich anders überlegt, wieder beiseite: »Marc sagte mir, daß Sie nach einer gewissen Lisa Schöller suchen.«
Der Examinierte nickte.
»Wir haben sie gefunden«, fuhr der Offizier mit den Ohren, die so weit abstanden, daß man an ihnen Kleiderbügel aufhängen könnte, fort: »Sie wissen, daß es sich dabei um die Tochter eines hohen Nazibonzen handelt.«
»Ich weiß«, versetzte Maletta. Ohne Schärfe fügte er hinzu: »Ich weiß aber auch, daß in Deutschland die Zeit der Sippenhaftung vorbei ist, Sir. Isn’t it?«
»Past and gone«, bestätigte der Captain. In seinem Gesicht, das so häßlich war, daß es auf den Besucher schon wieder faszinierend wirkte, verstärkte sich das dünne Lächeln.
»Wo ist Lisa jetzt?« fragte der Clearing-Kandidat.
»Darüber reden wir später«, wies ihn Spoonwood zurecht. »Wenn wir mit der Clearing-Prozedur fertig sind. Sie sind also in Berlin geboren, 35 Jahre alt. Sie arbeiten zur Zeit als Kraftfahrer beim Theater-Offizier der Militär-Regierung. Ich nehme nicht an, daß das der Abschluß Ihrer beruflichen Karriere ist.«
»Ich auch nicht«, bestätigte der Besucher. »Nachdem Sie meine Akten durchgesehen haben, wissen Sie ja, daß ich Pilot, Oberleutnant der Luftwaffe, Fluglehrer, eine Art Entertainer und zuletzt Todeskandidat mit ein paar Hinrichtungsterminen war.«
Es ging auf 17 Uhr, und es sah nicht so aus, als würde die Unterredung schnell vor sich gehen, obwohl es der Captain gesagt hatte und der Abstand zwischen einem US-Besatzungs-Offizier und einem deutschen Fragebogen-Kandidaten nicht mehr ganz so spürbar war.
Die Hitzewelle hatte angehalten. Die Reifen der Autos blieben in den aufgeweichten Teerdecken der Straßen stecken. Die anhaltende Trockenheit riß die Feldwege auf, auf dem Land betete man in Bittgottesdiensten um Regen. Die Sonne brannte vom Himmel und verwandelte die staubige Erde in einen glühenden Rost.
Die ersten Gäste der Garten-Party in Schleißheim vor München hatten ihre Uniformjacken ausgezogen und waren in den Schatten geflüchtet. Die Ordonnanzen, große, ausgesucht attraktive Negersoldaten, fachmännisch dirigiert von Charly, dem aus der Gaststätte Pulverturm ausgeliehenen Kellner, kamen beim Servieren der Getränke kaum nach, und so weilten die ersten Gäste bereits in einem hochprozentigen Nirwana, noch ehe die letzten angekommen waren.
Bud C. Williams aus Washington D.C. feierte seine Beförderung zum Colonel bei gleichzeitiger Ernennung zum Chef des Alabama- und Indiana-Depots ausgiebig; gestern bei der Amtseinführung durch General Patton im Kreise höherer Chargen, heute umgeben von Bekannten und Freunden des Military Governments of Munich auf einem Gartenfest. Wie immer erging dazu keine persönliche Einladung; es war eine Open-House-Party, zu der jeder erscheinen konnte, der den Gastgeber kannte. Spezielle Aufforderungen erhielten nur Teilnehmer des ›Intimate-Circle‹, der sich meistens erst dann zusammenfand, wenn die anderen bereits gegangen waren.
Die Stimmung war von Anfang an ausgezeichnet. Auf dem Barbecue wurden Steaks und Spareribs vorbereitet und zwischendurch immer wieder erlesene Titbits angeboten. Ganz zuletzt würde dann der Hausherr nur wenige Teilnehmer zu noch ganz anderen Leckerbissen nach oben bitten.
Mit hochrotem Kopf und einer für seine kurzen Beine überraschenden Geschwindigkeit fegte Stubby durch Haus und Garten, als trüge er Rollschuhe an den Füßen. Obwohl am gestrigen Tag mehr offiziell gefeiert wurde, war er gegen Mittag mit einem kapitalen Hangover erwacht, hatte seinen Kater mit einer Prärie-Oyster und drei Bourbons bekämpft und hinterher, um rasch wieder in Fahrt zu kommen, zwei Aufputschpillen geschluckt. Schließlich war er der Gastgeber und verantwortlich für Speisen und Getränke, für Naschwerk, Zigaretten, Nylonstrümpfe und für die kleinen Geschenke, die die Buhlschaft erhalten. Die Girls für den vorgerückten Abend besorgten seine Freunde, denen ihre Dienststellen Kontakte zu blonden oder schwarzen, langbeinigen oder prallbusigen, willigen oder kratzbürstigen Geschöpfen erlaubte; sie arbeiteten als Dolmetscherinnen oder Sekretärinnen, und falls sie wirklich ›Fräuleins‹ waren, dann jedenfalls von der feinsten Sorte.
»Don’t be a party-spoil«, sagte Stubby zu Peaboddy und Freetown, als er bemerkte, daß sich die beiden Amerikaner auf französisch verabschieden wollten. »Ihr könnt doch nicht jetzt schon gehen, wo’s gleich lustig wird.«
»We have still a lot to do, Bud«, entschuldigte sich der Colonel. »Sorry. And thanks again.«
Die beiden ließen sich nicht aufhalten und verließen als erste vorzeitig die Party, wofür sie sich morgen beglückwünschen sollten.
Major Silversmith lag unter einem Kastanienbaum und trank Eiswasser; nur Eiswasser; er wollte sich seine Fitneß bewahren für die Hurly-Burly-Session in der Beletage, die er beim letzten Mal ›Tabunesia‹ betitelt hatte. Er sah auf die Uhr – er mußte sich noch mindestens drei Stunden gedulden und mit Icewater anheizen.
Die Zusammensetzung der Gäste – fast ausschließlich Offiziere – spiegelte die Oligarchie der Besatzungsmacht wider. Ein Männer-Club. Wo immer GIs, Unteroffiziere oder Offiziere zur Geselligkeit zusammenkamen, waren sie unter sich und – wollten es nicht bleiben. Der Männerüberschuß war hier so kraß wie damals bei ihren kalifornischen Vorfahren, denen 1850 ein Dreimaster mit 900 Luxusgeschöpfen aus den feinsten Etablissements von London, Paris, Amsterdam und Marseille angekündigt worden war. Die Männer von San Francisco standen aufgeregt an der Mole, schwenkten die Hüte und reckten die Hälse, als unter Trompetenstößen die ersehnte Fracht ausgeladen wurde; es waren keine 900 Edel-Kokotten, sondern nur 60 strapazierte Straßenmädchen, die alle nach 14 Tagen verheiratet waren, oft zu Stammüttern angesehener Familien avancierend.
Mit der Heiratserlaubnis mußten die GIs in Deutschland vorläufig noch warten. Der britische Feldmarschall Montgomery hatte bis jetzt nur das Verbrüderungs-Verbot mit deutschen Kindern etwas gelockert, aber die Soldaten – ob britische oder amerikanische – wußten, wie sie das ›Cherchez-la femme‹ hinter sich brächten: In ihrem Jargon hieß es »Hello, Blondie«.
Noch waren ihre Frauen in Übersee und durften nur mit Sondergenehmigung in das US-Besatzungsgebiet einreisen. Natürlich liefen sie längst gegen die Trennung Sturm; es war nur noch eine Frage der Zeit, bis sie sich durchgesetzt hätten. Aus dieser Schonfrist, die sie noch hatten, wollten die Uniformierten – nicht alle, aber viele – etwas machen.
Dafür war Stubbys Residenz in einer früheren Offiziers-Siedlung, militärisch bewacht und von Zivilisten geräumt, ein bewährter Schauplatz. Der frischernannte Colonel war beliebt, denn er war auch splendid, er konnte es sein, ohne sich zu übernehmen, denn schon in der Bibel steht: »Dem Ochsen, der da drischt, sollst du das Maul nicht verbinden.«
Für einen Ochsen hielten den Gastgeber übrigens die wenigsten. Sie trauten ihm zu – in Washington wohnte er im Hause seines Schwiegervaters, des bekannten Politikers –, daß er wußte, in welche Richtung der Potomac floß und woher der Wind wehte.
Gerade noch rechtzeitig für seine Celebration waren auch die auf dem Weg nach Italien verschwundenen beiden Waggons nach hektischer Fahndung unversehrt wieder aufgetaucht; im Gegensatz zu den Frachtpapieren hatten sie das Alabama-Depot gar nicht verlassen. Captain Miller, der Transport-Offizier, stand nunmehr wieder bei seinem Chef in großer Gunst und durfte bei dem Gartenfest in der Rolle des Majordomus glänzen.
»This is the way to kill yourself«, sagte Doc MacKinley, der Armee-Arzt im Rang eines Captains, zum Hausherrn und griff sich selbst einen zweistöckigen Scotch. »Sauf nur so weiter, Stubby, dann wirst du nicht einmal so alt wie du aussiehst.«
»Chickenshit«, erwiderte Williams. Ganz Stubby im Glück setzte er hinzu: »In spätestens zwei Jahren bin ich Brigadegeneral, darauf kannst du mit mir wetten, Doc.«
»Eine lange Zeit«, spottete MacKinley. »Bei deinem Whisky-, Zigaretten- und Weiber-Konsum.« Er sah dem Alabama-Chef ins dampfende, schwitzende, durchglühte Gesicht: »Und zu fett bist du auch noch, du mußt ja einen säuischen Blutdruck haben.«
»Bleib’ gefälligst bei deiner Tripperspritze«, erwiderte Stubby, nun doch leicht pikiert.
Doc MacKinley war ein Zyniker, der vor keinem haltmachte, und das konnte sich der 26jährige auch leisten, denn er behandelte – soweit nötig – seine Offiziers-Kameraden heimlich und ohne Eintrag in das Krankenbuch, wenn sie sich einen ›Kavaliersschnupfen‹ geholt hatten. Es kam nicht so oft vor, wie in den Warnungen der Army-Tagesbefehle behauptet wurde, aber doch immer wieder. Niemand hielt sich an das Fraternisierungs-Verbot, am wenigsten die Gonokokken.
Der junge Arzt legte während seiner Militärzeit den Grundstock zu einem raschen Vermögen: Für die Behandlung der Gonorrhöe-Infektion nahm er 50 Dollar, bei Rückfällen 100, alles steuerfrei. Die geschröpften Liebhaber murrten und zahlten, er ersparte ihnen allerlei Peinlichkeiten und Rückfragen, denn der tüchtige Mediziner, der sich nach seiner Rückkehr in die Staaten in Cleveland, Ohio, eine erstklassige Privat-Praxis zulegen wollte, hielt sich streng an die ärztliche Schweigepflicht. Nur die Namen und Adressen der ›Infektionsherde‹ gab der im beschlagnahmten Schwabinger Krankenhaus arbeitende Armee-Arzt unter der Hand an die deutschen Gesundheitsbehörden weiter.
Stubby war schon wieder auf den flinken Beinen, um neue Gäste zu begrüßen. Captain Wallner kam, begleitet von Gesine, der Gauleiterstochter, seiner neuen Dauerfreundin; er trug ein kleines Köfferchen mit Requisiten für Gesines Auftritt, der die einen schon langweilte und andere doch immer wieder zu Gelächter hinriß. Mit seiner Nummer zog der Intelligence-Officer von Party zu Party, heimste den Applaus ein und verschwand dann mit seiner Begleiterin in seinem Quartier, um auch noch den Nutzen zu haben.
Wallner ging der nicht von seiner Seite weichenden Gesine immer einen Schritt voraus; er blieb stehen, sah sich um. Er kannte nicht alle Anwesenden, aber es war auch nicht notwendig, denn gleich würde sie der Alkohol miteinander bekannt machen. Er sah an einem der vielen Gartentische die First-Lieutenants King und Sears und schritt auf die Trouble-Brothers zu, die sich eine hübsche, stupsnasige Dolmetscherin aus der Tegernseer Landstraße mitgebracht hatten. Sie umwarben die Deutsche stumm, jeder für sich, voller Feindseligkeit dem anderen gegenüber.
Iris hatte es aufgegeben, darüber zu lächeln; sie lächelte überhaupt selten, und sie wußte, daß jeder der beiden Oberleutnants übergesprächig würde, so sie mit ihm allein wäre.
Die Musik wurde jetzt lauter; der Verstärker spuckte Melodien aus, wie »You belong to my heart«, oder »Tiger Rag«, oder »Candy« oder »Tea for two«, und immer wieder »You are my sunshine«. Die Sonne ging jedenfalls nicht unter, weder im Garten noch in der Wohnhalle. Der Barbecue wurde in Betrieb genommen. Duftende Wolken zogen bis zu den Wohnvierteln der Deutschen, die am offenen Fenster standen und trocken schluckten.
Die ersten bunten Tupfer mischten sich jetzt in das Olivgrün wie Krokusse auf einer Frühlingswiese; Mädchen, alle jung, keine häßlich, tauchten im Trubel auf; sie sprachen nicht das gewöhnliche Pillow-Englisch, die Kopfkissensprache, und alles, was sie zeigten, vom Nagellack bis zum Lippenstift und den Schuhen, stammte aus dem PX, vor allem die Nylonstrümpfe, die es damals in Europa noch nicht einmal in den Sieger ländern gab: Wer Nylons trug, zeigte an, daß er nach oben strebte.
Seit Millionen von Amerikanern in umgekehrter Kolumbus-Richtung in die Alte Welt zurückgekommen waren, hatten sie zuerst auf der britischen Insel, dann noch weit zwingender in Frankreich und am überzeugendsten in Deutschland eine Entdekkung gemacht: die europäische Frau.
»Like Tahiti«, pflegte First-Lieutenant Pepper, ein junger, windiger Bursche, mit schnalzender Zunge und verdrehten Augen zu bemerken. Zwar war er noch nie auf Tahiti gewesen und würde vermutlich in seinem Leben auch nie dorthin gelangen, aber Träume von der Südsee ließen sich auch auf den sieben oder acht Liegen des Blauen Salons verwirklichen.
Der First-Lieutenant von› Information Control‹ hatte eine miserable dienstliche Beurteilung und war doch unersetzlich als Akquisiteur, als Beschaffer weiblicher Geselligkeit. Er bewies es in diesem Augenblick wieder, als er in einem überladenen Straßenkreuzer Sissy, Betsy, Lilly, Daisy und weitere lächelnde, teils bekannte, teils unbekannte Mädchen apportierte, unter ihnen die weizenblonde Ostpreußin, die ihrer Spezialität wegen in Kennerkreisen nur ›Sandwich‹ genannt wurde, weil sie es immer mit zwei Männern gleichzeitig trieb und dabei gewissermaßen den Belag in der Mitte darstellte. Wenn Stubby an Sandwich dachte, wurde ihm nicht nur der Mund wäßrig.
Wenn er an Alice, die Senatoren-Tochter, seine schmalüppige und scharfzüngige Frau dachte, die den Liebesakt grundsätzlich nur im Dunkeln über sich ergehen ließ und sich danach immer beschmutzt vorkam, wußte Stubby, daß ihm nicht lange Zeit bleiben würde, die Wonnen in Deutschland auszuschöpfen.
Längst waren Gerüchte nach Amerika gedrungen, daß die unverdorbenen Boys aus dem puritanischen und matriarchalischen Land in Germany einer Art Sodom und Gomorrha ausgesetzt wären. Unter diesen Umständen würde Alice Williams alles dransetzen, ihren Gatten bald wieder in das abgestandene, licht- und lustlose Schlafzimmer zurückzubeordern, in dem er – weiß der Teufel wie – drei Töchter gezeugt hatte, die jetzt schon ihrer Mutter ähnelten.
Man mußte die Feste feiern, wie sie fielen, und eine entsprechende Konstitution mitbringen. Stubby nahm sicherheitshalber noch einmal einen großen Schluck Whisky und überprüfte zum vierten Mal die Lautsprecher-Anlage. Lazy rhythm, sanfte Weisen, der Ton macht die Schlafzimmermusik. Mochten die US-Besatzungs-Offiziere aus der Denazification einen Flop machen, sollte die Demontage der deutschen Industrie scheitern und die Umerziehung der Besetzten nicht so gelingen, wie es sich Washington wünschte; etwas würden sie in jedem Fall erhalten: Sexuelle Reparationen.
Bud C. Williams trieb sich in der Nähe der Ostpreußin herum. Sie war einen Meter achtzig groß, herrlich gewachsen. Sie strahlte förmlich vor Sauberkeit und Lebenslust, eine nordische Unheilige, ein lebendes Kunstwerk aus vitalem Material. Vielleicht hatte Teddy-Boy, der Beschaffer, nur angegeben, aber wenn es stimmte, dann wäre es ›like Tahiti‹ wie noch nie, ob Stubby nun die Oberseite oder die Unterseite des Sandwich darstellte.
»Hello, Bud«, rief Silversmith. »Don’t miss James Wallners big one-person-show!«
Der Captain hatte es nicht mehr erwarten können und Gesines Auftritt vorangetrieben. Der Hausherr war auf etwas ganz anderes scharf, aber erfahrungsgemäß heizte die Vorführung der Gauleiterstochter die Gesellschaft immer an.
Gesine, hellblond, blauäugig, vollbusig, war schon umgezogen, sie trug jetzt die weiße Bluse des ›Bundes Deutscher Mädchen‹ (BDM), das schwarze Röckchen, die kurzen weißen Söckchen, die Schuhe mit den Blockabsätzen, das schwarze dreieckige Schultertuch mit dem geflochtenen braunen Lederknoten. Eifrig schraubte ihr Impresario den Wimpel zusammen. Damit der Schaft in das Köfferchen paßte, hatte ihn Wallner in vier Teile zerlegen und mit Schraubgewinden versehen lassen. »Believe me«, versicherte er den Umstehenden. »Der Wimpel ist garantiert echt, 1938 persönlich geweiht vom Reichsjugendführer auf dem Domplatz zu Bamberg – durch Handanfassen.«
Gesine nahm ihn in die linke Hand, stieg auf einen Stuhl, streckte den rechten Arm aus und begann mit heller Stimme zu singen: »Unsere Fahne flattert uns voran.«
Soweit nötig, übersetzte der Captain die Worte ins Englische. »Unsere Fahne ist die neue Zeit …«, sang Gesine weiter.
Er geriet dabei jedesmal in Ekstase, und was sich in seiner Hose tat, spiegelte sich in seinem Gesicht wider. Auf einmal hatte Wallner einen geschwollenen Peniskopf. Seine Körpertemperatur war davon abzulesen wie von einem Fieberthermometer. Und die Quecksilbersäule stieg und stieg.
»Unsere Fahne führt uns in die E – e – wigkeit«, sang Gesine und sah dabei in eine unbestimmte Ferne: »Ja die Fahne ist mehr als der Tod …«
Einige lachten, klatschten, forderten eine Zugabe. Andere verließen angewidert die Wohnhalle. Nur wenige hatten begriffen, daß Gesine den Mann, der sie demütigen wollte, längst beherrschte.
»Crazy«, sagte Doc MacKinley und tippte sich an die Stirn. Er sah nach draußen und stutzte: »Look at him«, wies er auf den G2-Major Tajana: »The proud of Iowa.«
Der Stolz von Iowa war nicht allein; Earl S. Tajana wurde von einer jungen hübschen Frau begleitet, an deren Uniform der Aufnäher angebracht war: war-correspondent. Der Captain mit dem Äskulapstab kannte Judy Tyler noch nicht, aber es war ihm klar, daß seinem Schleichhandel mit Penicillin der Garaus gemacht würde, so eine US-Journalistin sich in den Staaten darüber ausließe. Er stieß Teddy-Boy an.
Der First-Lieutenant handelte nach einer kurzen Schrecksekunde sofort. »Shut up!« schrie er Gesine an. »Getaway!« scheuchte er die anderen Mädchen, bestrebt, sie nach oben zu treiben, noch bevor die newsweek-Reporterin Judy Tyler die Wohnhalle betrat. »Hurry up!« fuhr er Gesine wieder an, weil sie nicht schnell genug reagierte, und fuchtelte mit der Wimpelstange wie mit einem Bratspieß herum, trieb sie und ein paar andere Girls nach oben in den Blauen Salon und schloß ihn ab, als versiegele er die Büchse der Pandora.
»What’s wrong?« fragte der Hausherr schwerfällig; dann sah er, wer gerade sein gastliches Haus betreten hatte, und der erträumte Generalsrang versank im Besatzungssumpf.
»Go on, Stubby«, fuhr der Beschaffer den Colonel an. »Don’t be worried.«
Bud C. Williams sah einen Moment lang aus wie ein Seekranker an der Reling, aber er ging, um das Schlimmste zu verhindern, den neuen Gästen mit Gelatine-Gelenken entgegen.
»How nice to meet you«, begrüßte er die junge Frau, er sprach wie mit vollem Mund.
»Meet the host, Colonel Williams«, stellte ihn Tajana seiner Begleiterin vor. »This ist Judy Tyler from newsweek.«
»What a pleasure«, erwiderte Stubby mit saurer Süßlichkeit und malte sich dabei aus, wie ein Report über eine Münchener Besatzungsidylle mit ›Fräuleins‹ – unter ihnen eine Gauleiterstochter in BDM-Uniform – in Washington aufgenommen werden würde. Der Colonel warf dem Major, den er zum Teufel wünschte, einen anerkennenden Blick zu: »Indeed, very charming«, sagte er, so daß die Neu-Engländerin es hören konnte.
King und Sears erkannten sie, und auch Major Silversmith unterbrach seine Eiswasser-Kur. Major Tajana begrüßte die Anwesenden mit einem Kopfnicken. Der Mittdreißiger war mittelgroß und grauhaarig. Man sagte, Offizier sei er nur im Nebenberuf, weil er sich Zeit lasse, um die Übernahme der elterlichen Maisfarm so lange wie möglich hinauszuschieben; er war Junggeselle und Millionär, dabei rechtschaffen und sittenstreng.
Er suchte einen Platz in der Ecke; die Offiziere, die Judy kannten, kamen, um der Reporterin ihre Aufwartung zu machen und nahmen einen Moment am Tisch Platz. »Ich glaube, wir alle sind Judy zu Dank verpflichtet«, stellte der G2-Major fest. »Sie ist eine herrliche Frau – und kann doch« – er erinnerte an die Besprechung mit General Patton – »schweigen. Jedenfalls hat sie sich an ihr Versprechen gehalten.«
»Und das ist mir schlecht bekommen«, erwiderte sie. »Ich habe dichtgehalten, aber ein anderer Teilnehmer muß geplaudert haben. Jedenfalls bekam ich einen ganz schönen Rüffel von meiner Redaktion.«
»Sind Sie sicher, Judy?« fragte Tajana skeptisch.
»Leider, Major«, entgegnete die Reporterin. »Unter diesen Umständen muß ich mir wirklich überlegen, ob ich mich beim nächsten Mal im Umgang mit der US-Army auf Vertraulichkeit einlassen kann.« Sie nahm ein Glas von dem Tablett, das ihr Charly, der Kellner, entgegenstreckte und sah sich um. »Ist das hier auch off the record?« fragte sie und deutete auf die Mädchen unter den Uniformierten.
»Alles Sekretärinnen und Dolmetscherinnen«, beeilte sich Major Silversmith zu erwidern.
»Und alle proben die Non-Fraternisation?« stellte die Reporterin belustigt fest.
Colonel Williams sah sich als Ranghöchster verpflichtet, in die Bresche zu springen: »Sie wissen ja, Mrs. Tyler«, sagte er mit zwinkernden Augen, »daß man, trotz strenger Verbote, die Böcke auf die Dauer nicht von den Lämmern trennen –«
»Sure«, versicherte die kesse Journalistin, »deshalb stehen ja einige Gentlemen auch so belämmert herum.«
Die Offiziere lachten auf ihre Kosten, und der Hausherr stellte erleichtert fest, daß das Schlimmste zunächst einmal abgewendet war – erleichtert wie ein Taschendieb, der im letzten Moment vor dem Auftauchen des Polizisten die gestohlene Brieftasche losgeworden ist.
Captain Spoonwood machte in der Tegernseer Landstraße Überstunden, obwohl er in dem Fragebogen des Mannes, den er vernahm, keine falschen Angaben witterte; er richtete sich auf, betrachtete sein Gegenüber leicht irritiert, als mache ihm seine Attraktivität die eigentliche Häßlichkeit bewußt.
»Warum haben Sie eigentlich nicht erwähnt, daß Sie politisch verfolgt sind, Herr Maletta?« fragte der Clearing-Officer.
»Bin ich ja gar nicht, oder sollte ich hochstapeln?«
»Sie waren immerhin eingesperrt und zum Tode verurteilt?«
»Meinen Sie, das war politisch?« entgegnete der Berliner.
»Aber doch wohl auch nicht kriminell?«
»Das weiß ich nicht«, antwortete der Vernommene. »Ich – wir – ich meine, was man scherzhaft bei der deutschen Luftwaffe den ›Zirkus Maletta‹ genannt hatte, war im Grunde nichts anderes als eine Überlebensgruppe. Jeder von uns hatte seine Gründe, vor dem Regime in Deckung zu gehen, und die lagen eigentlich bei jedem anders. Aus diesem Zwang heraus haben wir die Flucht nach vorne angetreten.« Er betrachtete den Offizier von der traurigen Gestalt: »Es war, wenn Sie so wollen, Tingeltangel auf Leben und Tod, Sir.«
Maletta stellte fest, daß er nur erzählte, was der Offizier längst wußte. Spoonwood war intelligent, nicht ungefährlich, und er kannte offensichtlich viele Einzelheiten. Das war erstaunlich, denn der Fall Maletta war als ›Geheime Kommandosache‹ (Gekados) behandelt worden.
»Auf der Flucht vor dem eigenen Vater war übrigens damals auch Lisa Schöller zu uns gestoßen. Sie konnte ihn – auch aus persönlichen Gründen – nicht ausstehen und hatte mit ihm gebrochen.«
»Es gibt also bis jetzt mindestens zwei Überlebende des Zirkus Maletta –«
»Zwei, von denen ich weiß«, antwortete der Hauptakteur und brach ab. Seine Backenknochen spannten sich, seine Kiefer mahlten. Seine Augen wirkten einen Moment lang wie von Firnis überzogen. Er dachte an die muntere Dena, an Nadine, an Olga, an Sybille und Fiorella, vor allem aber dachte er an Bruno Plaschke, ohne den er seine Aktion nicht hätte starten können, an seine rechte Hand bei linken Touren. Einen Moment lang sah er das untersetzte Kraftpaket vor sich, einen Burschen, bei dem, von der Körperlänge abgesehen, alles zu groß war: die Füße, die Hände, die Ohren, die Klappe, der Mut.
Man hatte kurzen Prozeß mit Bruno gemacht, ihn in den Dirlewanger-Haufen gesteckt, in die Straf-Brigade der SS, und wenn er nicht im Partisanenkampf sinnlos verheizt worden war, mußte er von den Russen erschlagen, erstochen, erhängt oder bis zum Verhungern eingesperrt worden sein.
»Heute nehme ich an«, kam Maletta wieder in die Gegenwart zurück, »daß der kleine Bormann damals seine Tochter suchen und verfolgen ließ und daß wir diesem Umstand die Nachstellungen einer Kanaille namens Machoff verdankten.« Er sprach den zweisilbigen Namen aus wie einen doppelten Peitschenschlag. »Günter Machoff, Chef einer Abteilung zur besonderen Verwendung im Reichssicherheitshauptamt. Und diese ZbV-Aufträge bedeuteten immer eine entsprechende Gemeinheit.«
»Ich kenne den Ruf des Standartenführers Machoff«, überraschte der Captain den Besucher; er griff in die Schublade, holte ein bereitgelegtes Photo hervor und schob es über den Tisch.
Es zeigte einen Mann mit kurzen, glatten Haaren, kleinen, starren Augen, mit vom Zynismus deformierten Lippen, mit einer vorspringenden Nase, schmal und spitz wie ein feststehendes Messer. »Ist das Ihr Mann, Mr. Maletta?«
»Ja, das ist Machoff.« Der Vernommene sprach, als ließe er Dampf ab: »Ein ausgezeichnetes Photo, übrigens.«
»Es entstand, als der Mann vorübergehend als Bevollmächtigter des Reichsführers-SS dem General Werner von Umbach zugeteilt war.«
»Dem Heldenklau«, ergänzte Maletta.
»Richtig, den haben wir übrigens längst und halten ihn unter Verschluß.«
»Dann hängt ihn schleunigst auf.«
»Das geht nicht so ohne weiteres«, erwiderte der Investigator. »Nicht bei uns. Außerdem ist es eigentlich eine deutsche Angelegenheit. Kannten Sie den Heldenklau näher?«
»Gut genug«, versetzte Maletta. »Ich bin ihm einmal bei einem Alarmstart mit meiner JU52 fast über die Füße gefahren, um meinen Wander-Zirkus in Sicherheit zu bringen. Der Heldenklau war ein seniler Wichtigtuer, der Tausende von armen Hunden auf dem Gewissen hat.«
»Wenn er ein Gewissen hat«, korrigierte ihn der Captain.
Sie sahen sich einen Moment lang an.
»Sie sind also auch hinter Günter Machoff her, Captain Spoonwood?« fragte Maletta.
»Allerdings«, versetzte der Amerikaner. »Ich bin hinter vielen her – aber hinter ihm mit besonderem Eifer. Vielleicht sollten wir uns zusammentun.«
»Vielleicht«, entgegnete der Expilot gedehnt. »Vielleicht aber haben Sie ihn auch längst unter falschem Namen kassiert und wissen es nur noch nicht.«
»Nicht, wenn das Photo wirklich gut ist –«
»Es ist wirklich gut.«
»Wir suchen viele«, stellte der Captain fest, »aber – wie gesagt – an diesem Machoff liegt uns besonders. Ich habe dieses Photo vervielfältigen lassen. Es liegt in jedem unserer Anhaltelager vor. Jeder neu Eingelieferte wird automatisch nicht nur auf das eintätowierte SS-Blutgruppen-Zeichen, sondern auch auf dieses Gesicht überprüft. Sie könnten uns natürlich bei der Fahndung helfen-«
»Ich bin ein Einzelgänger«, erwiderte der Mann, der aus der Hölle kam. »Sie suchen Tausende, ich nur einen einzigen. Beim Military Government gibt es verschiedene, vielleicht divergierende Interessen. Ich«, die Stimme wurde hart und schneidend, »ich habe nur ein Interesse, ein einziges: Ich will den Mann hängen sehen, und zwar ganz schnell. Sagten Sie nicht, Captain, es sei eigentlich eine deutsche Angelegenheit?«
Die Eruption des Hasses war so mächtig, daß es den Clearing-Officer an diesem Hundstag einen Moment fröstelte: »Vielleicht kommen wir doch noch zusammen«, entgegnete er – bereits auf dem Rückzug. »Haben Sie denn eine Vorstellung, wo sich Machoff aufhalten könnte?«
»Aber Captain«, erwiderte Maletta und lächelte schräg – wie in seiner Filou-Zeit. »Nein«, wurde er wieder sachlich, »ich habe keine konkrete Vorstellung, nur die Vermutung, daß sein Untertauchen von langer Hand vorbereitet war.«
»Richtig«, versetzte Spoonwood. »Es gibt drei, eigentlich vier Möglichkeiten. Fangen wir mit der unwahrscheinlichsten an: Die Sowjets haben ihn geschnappt und verheimlichen es uns; sie hätten genügend Gründe, nach ihm zu fahnden, vielleicht könnten sie ihn auch gebrauchen. In den letzten Kriegstagen haben noch einige focke-wulf 200 Deutschland mit unbekanntem Ziel Richtung Spanien verlassen. Außerdem gehen uns noch zwei deutsche U-Boote ab; sie sind bisher in keinem Hafen eingelaufen, aber irgendwann müssen sie ja einmal auftauchen. Machoff könnte sich auch mit neuer Identität in der englischen Besatzungszone aufhalten, auf die wir die Fahndung ausgedehnt haben –«
»– oder in der amerikanischen«, stellte Maletta fest.
»Dann werden wir ihn fassen«, behauptete der Geheimdienstmann. Spott zeigte sich in seinem Lippenspiel: »Entweder Sie – oder ich.«
»Egal wer«, erwiderte der Invalide des Hasses. »Hauptsache: Machoff hängt. Wenn Sie das besorgen, brauche ich mir die Hände nicht blutig zu machen. Ich denke, Captain, Sie nehmen nicht an, daß ich Günter Machoff suche, um ihn laufenzulassen.«
»Das nehme ich wirklich nicht an, Mr. Maletta«, bestätigte der Captain und griff wieder nach dem Fragebogen. »Soweit ist Ihr Lebenslauf ziemlich klar. Alle Fragen sind beantwortet, wenn auch nicht sehr ausführlich. Tja«, fuhr Spoonwood fort, »eigentlich wäre da nur noch ein Punkt. Die Frage Nummer 125. Warum sind Sie im April 1941 von Lima nach Deutschland zurückgekehrt?«
»Ich hatte einen Gestellungsbefehl der deutschen Wehrmacht erhalten.«
»Warum haben Sie ihn nicht in den Papierkorb geworfen?«
»So einfach war das nun wirklich nicht; ich war dem Druck der deutschen Botschaft in Peru ausgesetzt. Außerdem hatte ich Angehörige in Deutschland und mußte befürchten, daß man auf sie zurückgreift.«
»Sie sind also nicht unüberlegt nach Deutschland zurückgereist?«
»Nein. Ich war unschlüssig. Ich hatte in Lima ein Mädchen, Tiny, eine amerikanische Studentin, Tochter eines Öl-Direktors.« Nach einer kurzen Pause setzte Maletta hinzu: »Tiny Rodgers. Sie wollte mich festhalten, und ich wollte auch bei ihr bleiben.«
»Und warum sind Sie dann doch nicht in Lima geblieben?«
»Die lufthansa hatte den Flugbetrieb nach Bolivien eingestellt.«
Spoonwood erhob sich und lief im Raum hin und her, um seine Erregung zu bändigen, sein Adamsapfel fuhr Lift.
Er blieb stehen: »Und Sie hatten damals auch einen amerikanischen Freund?«
»Mehrere«, antwortete Maletta. »Aber besonders einen: Mike Freetown, Marcs jüngeren Bruder.«
Der Captain nickte und setzte zum Tiefschlag an. »Und warum sagen Sie mir nicht«, versetzte der Investigator mit veränderter Stimme, »daß Ihnen Mike geraten hat, nach Deutschland zurückzufahren?«
Maletta schwieg zornig.
»Es war doch so?«
»Sie glauben doch nicht, Captain Spoonwood, daß Mike, ein waschechter Amerikaner, ein Nazi-Sympathisant war?«
»Das nicht, aber ein verdammter Narr – wie viele andere.«
»Sollte ich das Ansehen eines Toten ankratzen, der für eine – Fehleinschätzung weiß Gott bezahlt hat –«
»Es würde für Sie sprechen«, erwiderte der Captain, »und für Ihre Beurteilung.«
»Ich spreche für mich selbst«, erwiderte der Vernommene arrogant.
»Ich weiß, daß Sie nie mit Marc darüber gesprochen haben«, setzte der Clearing-Officer an, »aber Sie sollten etwas wissen, Mr. Maletta: Mike hat sich sehr bald danach Vorwürfe gemacht, daß er Sie, statt zurückzuhalten, auch noch beeinflußt hat, nach Berlin zurückzukehren. Je weiter der Krieg vorrückte, je schlimmer er wurde, desto mehr malträtierten ihn die Selbstvorwürfe. Er wollte, daß Sie es unbedingt erfahren. Er insistierte Marc, und Marc wurde zu einer Art Testamentsvollstrecker. Nunmehr wissen Sie Bescheid«, kam Spoonwood zum Ende: »Deshalb hat Sie Marc so rasch im Lazarett aufgestöbert. Deshalb stellt er Ihnen Möglichkeiten zu Ihrem privaten Rachefeldzug zur Verfügung. Und deshalb habe ich mich einen ganzen Nachmittag bis in den Abend hinein mit Ihnen unterhalten.« Er reichte Maletta die Hand. »Übrigens, Lisa Schöller arbeitet als Sekretärin bei der Münchener zeitung in der Schellingstraße«, verabschiedete er den Besucher. »Sie arbeitet heute bis einundzwanzig Uhr.«
»Danke, Captain.«
»Leider sind wir uns nicht in allem einig«, erwiderte Spoonwood, »aber ich gestehe, daß Sie der erste hier in diesem Office sind, der mir gefallen hat.«
»Dann hoffe ich, daß noch einige nachkommen werden«, antwortete der Berliner. Er hatte es eilig, aber er merkte, daß ihm der Offizier noch etwas sagen wollte und noch mit sich zu kämpfen hatte. Er nickte ihm zu.
Der Clearing-Officer überwand sein Zögern. »Unter Umständen kann demnächst eine Überraschung auf Sie zukommen«, erklärte er dann. »Mehr kann ich Ihnen leider nicht sagen.«
»Eine Überraschung für mich?«
»Ich muß dafür erst die Erlaubnis meiner Vorgesetzten Dienststelle einholen«, antwortete Spoonwood, »aber ich verspreche Ihnen, mich bei Major Tajana dafür einzusetzen.«
Der unklare Sinn dieser Feststellung paßte nicht recht zu dem Clearing-Officer, aber vielleicht war der Mann auch viel mehr. Nicht nur das wurde Maletta klar, als er von der Tegernseer Landstraße nach Schwabing fuhr. Nachdenklich fragte er sich: Wer hat Captain Spoonwood informiert? Was hat er mit Marc Freetown zu tun? Nur von ihm konnte er erfahren haben, was damals in Lima vorgegangen war. Der Mann war für die Tätigkeit eines Fragebogen-Auswerters viel zu hintergründig.
Bislang hatte Maletta angenommen, daß er die Militär-Regierung durch seine privaten Beziehungen ausnützen würde. Jetzt kam er sich vor wie ein lebender Köder-Fisch an der Angel. Er überquerte den Stachus, mußte halten, weil vor ihm eine Straßenbahn aus der Schiene gesprungen war. An den Türen hingen Menschentrauben wie Bienenschwärme. Frauen, Kinder; schon optisch drückte sich im Straßenbild der krasse Frauenüberschuß aus: 1,9 Millionen Deutsche waren gefallen, 1,7 Millionen wurden vermißt – was praktisch auf dasselbe herauskam – 1,6 Millionen waren als Kriegsversehrte zurückgekommen und über elf Millionen deutsche Kriegsgefangene befanden sich beim Zusammenbruch hinter Stacheldraht.
Endlich hatte sich Maletta mit dem Jeep bis zum Obelisk durchgequält. Er kannte sich in München aus, aber München war eine Trümmerlandschaft. Er mußte mehrmals anhalten, um sich in dem Ruinengewirr zu orientieren. Unter den Schutthalden lagen noch Tote, die nie mehr geborgen würden. Oft standen nur noch die rauchgeschwärzten Fassaden; ihre leeren Fensterhöhlen sahen aus wie ausgestochene Augen. Fast 1,5 Millionen Einsätze hatten die alliierten Bombenflugzeuge während des Krieges auf deutsche Städte geflogen. Experten stritten sich, ob die Deutschen 16, 20 oder 30 Jahre brauchen würden, um das Vernichtungswerk abzutragen.
Auf einem riesigen Trümmerhaufen stand ein handgemaltes Schild: Plündern Verboten. Aber hier gab es schon lange nichts mehr zu holen, nicht einmal mehr Brennholz oder Nägel. Wenn sich trotzdem einer als Goldgräber der Schuttberge betätigte, hielt man ihn eher für einen Narren als für einen Dieb. Selbst der Kölner Kardinal Frings zeigte einiges Verständnis und erteilte, als die hungernde Bevölkerung aus der Not heraus Kohlen-Waggons stürmte, eine Art Plünderungs-Dispens. Die Rheinländer sagten seitdem, wenn sie auf Organisationsfahrt gingen: »Geh’n wir fringsen.« Ganz Deutschland ›fringste‹ sich durchs kümmerliche Leben, die Hausfrauen und die Großväter, die Kinder und die Nachbarn, wenn sie auch nicht alle so erfolgreich ›fringsten‹ wie die ›Fräuleins‹.
Maletta hatte die Barer Straße erreicht, überquerte die Gabelsberger- und bog in die Schellingstraße ein – und jetzt fragte er sich nur noch, wie Lisa sein unverhofftes Auftauchen aufnehmen würde.
Maletta überwand den Portier, setzte sich bei einer deutschen Empfangsdame durch, die sich amerikanischer aufführte als sämtliche Amerikaner im Hause zusammen – nicht grundlos verspottete man das Military Government auch als Mistress-Government; schließlich bequemte sie sich doch zu einer Besuchserlaubnis im Vorraum der Redaktion.
Ein paar Minuten später kam Lisa.
Blond, adrett, höflich-distanziert, ein Gesicht, ein Lächeln, das kein Lächeln war. Erst im letzten Moment erkannte sie den Besucher. Es war zu viel für die Sekunde der Wiederbegegnung, aber sie stand es durch.
»Du?« sagte sie ungläubig. Ihre Stimme klang verschüttet. »Du lebst, Peter?«
»Wir leben«, erwiderte Maletta.
Sie stand vor ihm, mit klammen Armen.
Ihre Augen waren naß von ungeweinten Tränen.
Im ersten Moment hatten sie beide eine Entfremdung gespürt, als seien sie sich nicht nach 16 Monaten, sondern erst nach 16 Jahren plötzlich wieder begegnet. Maletta wollte es vor dem Mädchen und Lisa vor dem Mann verbergen, aber beide hatten kein Talent zur Verstellung und zudem kannten sie sich zu gut: Weil sie sich sehr nahe gestanden hatten, waren sie einander fremd geworden. Ihre Vergangenheit war zugewachsen wie ein verwilderter Gartenpfad.
»Verzeih, Peter«, sagte das Mädchen. »Aber dein Auftauchen hat mich einfach aus den Pantinen geworfen. Du kannst dir ja vorstellen, wie sehr ich mich freue, dich zu –« Sie sah auf die Uhr: »Es gibt zwei Möglichkeiten.« Die Blondine mit den klaren Augen und der absoluten Unähnlichkeit mit ihrem Vater sprach wie aufgezogen: »Entweder du holst mich in einer guten Stunde hier ab, oder du wartest inzwischen in der Kantine auf mich.«
»Was meinst du, wie lange ich schon auf dich gewartet habe, Lisa?« sagte der Mann und lächelte, leicht verkrampft. »Weißt du, was aus den anderen geworden ist?«
»Nicht viel«, wehrte Lisa ab. »Wenn du willst, bring’ ich dich in die Kantine«, setzte sie hinzu. Ihre Haltung war bewundernswert, sie wirkte frisch und appetitlich. Ihr flächiges Gesicht, dem die Monate des Wahnsinns nichts hatten anhaben können, wurde von den großen, grünen Augen beherrscht, Im Zirkus Maletta war sie eine Steptänzerin gewesen, aus Hobby, nicht professionell.
Die Münchener Zeitung, bei der Lisa arbeitete, ein deutschsprachiges, von der Militärregierung herausgegebenes Blatt, stand vor ihrer Umbenennung in Neue Zeitung; sie hatte das überbreite Format von ihrem Vorgänger, dem Völkischen Beobachter, übernommen, der offiziellen Zeitung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP). Auf den Redaktionsstühlen, die bis vor zwei Monaten noch stramme Nazis innegehabt hatten, saßen jetzt deutsche Emigranten in US-Uniform und ihre deutschen Helfer in umgeänderter Wehrmachtsmontur. Bis zum Frühling dieses Jahres hatten die braunen Skribenten das Heldentum beschworen und unter Hinweis auf die Wunderwaffen bis zum letzten Tag behauptet, die militärische Lage sei noch zu wenden, wenn alle bis ›zum letzten Atemzug‹ durchhielten; ihren olivgrünen Nachfolgern stellte sich jetzt die Aufgabe, das Ausmaß des Konkurses den Lesern darzustellen und sie trotzdem an einer Massenexplosion der Verzweiflung zu hindern.
»Hier«, sagte Lisa und steckte ihrem Begleiter einen roten Essensbon zu. »Darauf bekommst du ein Abendessen, recht schmackhaft, und ich – ich brauch’s wirklich nicht.«
Es war traurig und rührend zugleich.
Der Mann, der aus dem Dunkel kam, fragte sich, ob er so hungrig aussähe. Physisch gesehen war er satt, aber er hatte den Wahnappetit eines Kannibalen auf einen Mann namens Machoff.
»Bis bald«, sagte Lisa und nickte ihm zu.
Sie hatte sich nicht verändert und wirkte doch ganz anders. Vielleicht lag es auch an ihm, vielleicht hatte er sich verändert. Aber wer könnte den Mühlen der Zeit unversehrt entkommen?
Er sah die Essenmarke an und stellte fest, daß sie an jedem beliebigen Tag verwendbar war. Er schob sie ein, um sie Lisa zurückzugeben, die jetzt vermutlich für ihn hungerte. Er könnte dafür sorgen, daß sie satt würde und sie sich bald wieder so unbefangen gegenüberstünden wie vor einer Steinzeit von 16 Monaten.
In der Schlange vor dem Essenschalter erkannte Peter Maletta den bekannten Poeten, geduldig zwischen einem Rotationsarbeiter und einem Redaktionsboten wartend, einen kleinen Flirt mit einer unwirschen Essenausgeberin riskierend, für die ein Erich Kästner nichts anderes war als einer dieser Hungerleider, die nie den Teller voll genug bekommen. In einer Zeit, da man in Deutschland für eine Ami-Zigarette fast einen Tag lang arbeiten mußte, konnte man für einen Klatsch Gemüse und eine Scheibe Spam den Dichter von zum Beispiel: »Wenn wir den Krieg gewonnen hätten …« als exzellenten Mitarbeiter der Kultur-Redaktion für ein Maisbrot gewinnen.
Gegen 20 Uhr 30 war Lisa wieder in der Kantine erschienen und hatte Maletta mit den Augen gewinkt.
»Hat’s geschmeckt?« fragte sie.
»Ausgezeichnet«, erwiderte er und gab Lisa den Bon zurück. »Das reinste Drei-Sterne-Lokal.«
»Aber«, stotterte sie, »du solltest doch – vielleicht –«
»Ich hab’ keinen Hunger, Lisa, und auch keinen Appetit«, entgegnete er. »Es geht mir gut. Viel zu gut. Manchmal schäme ich mich dafür.«
Sie hatten die Schellingstraße erreicht.
»Bist du schon lange in München?« fragte Lisa.
»Zehn Tage«, erwiderte er.
»Da hast du mich aber schnell gefunden.«
»Ich hatte ja auch nichts anderes zu tun«, behauptete Maletta und deutete auf den Jeep vor dem Haus.
»Du scheinst es wirklich schon wieder weit gebracht zu haben«, sagte Lisa lächelnd und stieg ein.
»Aber ich bin kein Schwarzhändler«, bemerkte er.
Lisa wurde ernsthaft: »Und du bist auch kein Filou mehr?«
»Ich glaub’ nicht«, antwortete Maletta. »Tempi passati.«
»Wie bist du auf mich gestoßen?«
»Über deine Tante, über ICD und über einen Clearing-Officer der Militär-Regierung«, erklärte Maletta und drehte den Zündschlüssel um.
»Wohin?« fragte er und sah Lisa an.
»Schwierig«, erwiderte sie. »Ich wohne mit drei anderen zusammen in einer Keller-Ruine, in der das Wasser steht.«
»Dann zu mir«, entschied Peter. »Da steht kein Wasser.« Er gab keine weiteren Erklärungen und Lisa stellte keine Fragen, auch nicht, als sie durch den gepflegten Vorgarten zu der Wohnung über der Garage gingen. »Zigarette?« fragte er und streckte ihr ein Päckchen Chesterfield hin.
»Danke«, entgegnete Lisa. »Ich hab’ mir inzwischen das Rauchen abgewöhnt.«
»Aber einen Schnaps trinken wir doch zusammen.«
»Auch nicht so gerne«, wehrte sie ab. »Oder haben wir das nötig?«
»Du sicher nicht«, erwiderte Maletta grinsend, »aber vielleicht ich.« Er schenkte sich einen halben Bourbon ein, nippte dann aber nur am Glas. »Ich bin der deutsche Fahrer des US-Captains Freetown«, erklärte er dann. »Wie du siehst, habe ich es ziemlich weit gebracht.«
»Ich auch«, ging sie auf seinen Ton ein. »Ich arbeite jetzt als Sekretärin, und manchmal läßt man mich sogar kleine Nachrichten selbständig formulieren. Nicht viel, aber immerhin.«
»Ganz schöne Karriere für eine gelernte Granatendreherin aus dem Arbeitslager«, erwiderte Maletta.
»Das weißt du?«
»Ich weiß einiges«, antwortete er. »Übrigens habe ich auch deinen Vater aufgespürt.«
»Ich habe keinen Vater mehr«, entgegnete Lisa.
»Das beruht auf Gegenseitigkeit«, versetzte Maletta. »Er hat mir gesagt, daß er seine Tochter nicht mehr kennt.«
»Dann ist ja alles bestens geregelt«, antwortete die junge Frau mit einem unlauteren Lächeln.
Die Ehe ihrer Eltern war zerrüttet gewesen; das kommt häufig vor, und daraus zieht man normalerweise die Konsequenzen, aber der Hoheitsträger und Günstling des NS-Staates hatte gefürchtet, eine Scheidung könnte seine Karriere schädigen – die Moral der Mörder war auch eine Moral der Spießer. Horst Schöller hatte, mit einer anderen Frau zusammenlebend, Lisas herzkranke Mutter bis zuletzt drangsaliert. Nach der Denunziation von Lisas Freund hatte sie sein Haus für immer verlassen und war kurze Zeit später gestorben.
»Könnte ich jetzt vielleicht doch einen kleinen Schnaps haben«, fragte sie.
Maletta goß ihr einen Bourbon ein.
»Du weißt ja schon von damals, daß ich mit dem Vize-Stabschef nie mehr etwas zu tun haben wollte und – zu diesem Zeitpunkt hatte er seine letzte Gemeinheit noch längst nicht abgezogen.«
»Ja«, erwiderte Maletta. »Wir haben oft über ihn gesprochen und du hast mir viel erzählt.« Er sah sie an. »Leider haben wir nie darüber gesprochen, daß er Günter Machoff kannte, und zwar sehr gut.«
»Der Vizechef kannte mehrere Männer vom Reichssicherheitshauptamt«, entgegnete Lisa. »Er war ja selbst auch SS-Sturmbannführer. Von dieser Sorte sind bei uns so viele verkehrt, daß ich die Namen wirklich nicht alle behalten konnte. Machoff war nur einer von vielen. Und ich wußte ja nicht, daß du schon einmal einen Schlagabtausch mit diesem Schwein gehabt hattest.«
»Und ob«, erwiderte Maletta. »In gewisser Hinsicht war ich sogar daran schuld, daß er noch lebte.« Sein Mund platzte auseinander. »Komisch, was?«
»Allerdings«, sagte die Besucherin.
In diesem Moment heulten die Sirenen.
Es war die Vorwarnung für ›Curfew‹, die Sperrstunde. Eine Viertelstunde später würde ein zweites Signal verkünden, daß sich kein Deutscher mehr auf der von der US-Militärpolizei kontrolherten Straße aufhalten dürfe.
»Wenn du willst, fahr’ ich dich schnell nach Hause«, bot Maletta an.
»Das schaffst du nie«, entgegnete Lisa. »Ich wohne ganz weit draußen im Münchener Osten.« Sie sah ihn an: »Du hast dich nicht sehr verändert, Peter.«
»Meinst du?«
Lisa sah ihn an: Immer noch diese Prachtzähne, diese Prachtaugen, diese Prachthände, die gleichermaßen virtuos ein Flugzeug durch den Sturm zwingen oder eine Frau streicheln konnten. Lisa hatte beides erlebt, den Gewitterflug und die Liebesnacht. Peter war ein Mann gewesen und ein Filou, ein Freund und ein Verführer, und dabei ein verdammt guter Liebhaber, wiewohl Lisa wenig Erfahrungen mit Liebhabern gehabt hatte. Er hatte sie mit Geduld, Zärtlichkeit und Finessen in die Zweierbeziehung eingeführt und dabei gleichviel gegeben wie genommen. Ein Kerl wie Samt und Seide – hatte sie ihn einmal liebevoll charakterisiert.
»Du mußt etwas wissen, Peter«, sagte sie, »ich bin mit einem Mann liiert; ich mag ihn und er mag mich.«
Maletta nickte, ohne enttäuscht zu sein.
Die Sirene heulte zum zweiten Mal und das bedeutete, daß Lisa heute über Nacht hier festgehalten wäre.
»So, Kleine«, sagte er, sie erstmals wie früher nennend, »nun folgt der erfreulichere Teil des Abends.« Über Zutaten verfügte er reichlich, und er war ein begabter Amateurkoch. Maletta nahm die Steaks aus dem Kühlschrank und ließ die Pfanne mit Butter langsam warm werden.
»Soll ich dir nicht helfen?« fragte Lisa.
»Nein«, versetzte er. »Prinzessinnen werden verwöhnt.« Er lachte spöttisch: »Auch wenn sie aus einer Munitionsfabrik kommen.«
»Oder aus einem Arbeitslager«, ergänzte Lisa.
Sie waren wieder beim Thema; sie kamen nicht davon los, so sehr sie es auch wollten. Nicht an diesem Abend, vielleicht morgen – vielleicht nie in ihrem Leben.
»Bleib sitzen«, sagte Maletta, als Lisa den Tisch decken wollte. »Hast du diesen Machoff im Hause deines Vaters nur einmal gesehen, oder öfter?«
»Öfter«, antwortete die junge Frau. »Zuletzt so oft, daß ich dachte, der kleine Bormann und Günter Machoff hätten eine Leiche miteinander im Keller. Aber der Vize-Stabschef der Gauleitung München-Oberbayern hatte wohl mit vielen ›Goldfasanen‹ seine Kellerleichen.«
Der Amateurkoch wendete die Steaks. »Paß mal einen Moment auf, daß nichts anbrennt, Lisa«, sagte er. »Ich muß nur mal schnell in den Keller.« Er ging, um eine Flasche Wein zu holen. »Rares Gewächs«, sagte er beim Zurückkommen und las das Etikett vor. »Ein Kabinettwein.«
Er öffnete die flüssige Rarität, roch am Korken, goß einen kleinen Probeschluck ein, kostete die Blume, wie damals in einem der vielen Luftwaffen-Casinos, wo der Chef des Zirkus Maletta mit seiner Truppe stets ein willkommener Gast gewesen war. »Ein wirklich köstlicher Mosel«, stellte er fest, als käme es jetzt darauf an, den unzeitgemäßen Snob zu spielen.
Sie lachten beide, rückten ein wenig näher, ohne sich nahe zu kommen. Die Entfremdung schwand. Sie wirkten nicht mehr verkrampft, auch nicht wie ein Ex-Liebespaar, sondern eher wie Hänsel und Gretel. Sie konnten ein normales Tischgespräch führen über Wichtiges und Belangloses.
»Was ist das für ein Mann, mit dem du zusammen bist?« fragte Maletta beim Abräumen.
»So ziemlich das genaue Gegenteil von dir – bitte nicht böse sein. Er heißt Harry«, erklärte sie, »Zivilamerikaner, dreiunddreißig, ein netter Kerl, nicht sehr aufregend und auch nicht besonders begütert. Aber gemessen an uns Hungerleidern ist zur Zeit wohl jeder Ami ein Nabob.« Lisa lächelte. »Vermutlich gefällt er dir.«
»Auch wenn Harry nur ein halber Krösus ist, verstehe ich nicht ganz, warum du zu viert in einem nassen Keller hausen mußt«, erwiderte er.
»Er auch nicht«, entgegnete die junge Frau lachend. Ihr feines Lächeln wurde wirklicher: »Es ist der ständige Streitpunkt zwischen uns. Du hast ihn auf Anhieb auf den Kopf getroffen.« Sie sah, daß er es nicht als Erklärung hinnahm und fuhr fort: »Wir haben die Wahnsinnsidee, einander zu heiraten, falls es einmal möglich sein wird. Aber bis es soweit ist, muß jeder von uns beiden in seinen eigenen Verhältnissen leben.«
»Das ist absurd, Lisa, und übertrieben«, versetzte Maletta. »Und richtig unklug.«
»Ich will gar nicht klug sein«, entgegnete sie. »Ich möchte zur Ruhe kommen und glücklich werden – falls es auf dieser Erde noch möglich sein sollte.«
»Du bist päpstlicher als der Papst.«
»Keineswegs«, versetzte Lisa. »Ich weiß, was ich tue. Wenn ich mich mit Chocolate, K-Rations und Cigarettes beschenken ließe, würden sich die Gewichte verschieben und kleine Mißverständnisse, Schlampereien und Gewohnheiten einreißen. Auch wenn Harry dagegen Sturm läuft, fühlt er doch, was ich ihm biete: Ich verkaufe mich nicht, er bekommt mich gratis, weil ich ihn mag, und solange ich ihn mag.«
»Einverstanden«, erwiderte Maletta. Er stellte das Radio an. Eine weiche Melodie erfüllte den Raum, und er spürte einen Stich der Erinnerung; er drehte etwas lauter und versuchte, die Kurve elegant zu nehmen, Worte suchend, die er nicht fand. Er ärgerte sich über seine Plumpheit, als er sagte: »Du kannst meine Couch haben, Lisa. Ich werde mir am Fußboden ein Behelfslager richten.«
»Warum?« fragte sie. »Die Couch ist breit genug für uns beide.«
»Und was sagst du morgen Harry?«
»Die Wahrheit«, antwortete die junge Frau. »Wie sie auch aussehen mag.«
»Und du weißt schon, wie sie aussehen wird?«
»Allerdings«, entgegnete sie. »Und du, fürchte ich, auch.«
»Und das glaubt dir dann Harry?«
»Das glaubt er mir«, versicherte Lisa. »Weil ich keine Zigaretten, keine Pralinen und keine Nylonstrümpfe von ihm nehme.«
»Trotzdem«, erwiderte Maletta. »Wenn er dir glaubt, muß er dich sehr liebhaben – oder ein großer Trottel sein.«
»Such’ dir das Bessere aus«, versetzte Lisa. Sie zog ihre Lippen nach. »Dieses Geschenk habe ich übrigens angenommen«, gestand sie, deutete auf das Rouge aus Paris und wirkte dabei einen Moment lang so keck wie früher: »Siehst du, ich bin doch nicht päpstlicher als der Papst.«
Dann lagen sie nebeneinander. Das Radio war ausgeschaltet, das Licht gelöscht. Der Abend brachte eine leichte Abkühlung und sanftes Mondlicht. Die Grillen zirpten, und die Nachtfalter drehten sich im Liebesreigen. Maletta spürte nicht den Zauber einer Sommernacht, und Lisa merkte, daß er an der Frage herumkaute, der sie schon einmal ausgewichen war.
»Schläfst du schon?« fragte er.
»Nein.«
»Wann hast du Machoff zum letzten Mal gesehen. Weißt du das noch?«
»Im April vierundvierzig«, antwortete Lisa. »Es kann auch ein bißchen früher oder auch später gewesen sein.«
»Und Ramloch, sein Mädchen für alles?«
»Dem Hauptsturmführer bin ich nach meiner Verhaftung nur einmal begegnet.«
»Und was weißt du von den anderen?« fragte Maletta weiter: »Von Bruno, Olga, von Sybille, Nadine und –«
»Nicht viel«, wiederholte sich Lisa. »Aber doch einiges«, setzte sie hinzu. »Meistens vom Hörensagen: Wir wurden damals alle verhaftet und mit der Zeit auseinandergerissen, das heißt«, berichtigte sie sich, »Olga kam ihrer Mutter wegen sofort ins Frauen-KZ nach Ravensbrück, Nadine als Zigeunerin ebenfalls.«
»Und?«
»Vielleicht hätte Olga überlebt, aber sie hatte nicht mehr die Kraft dazu. Sie rannte schon bald nach ihrer Einlieferung gegen den elektrischen Drahtzaun und schmorte zu einem Klumpen zusammen.«
»Woher weißt du das?« fuhr Maletta hoch.
»Das hat mir dieser Machoff ein paar Wochen nach meiner Festnahme erzählt.«
»Er ist nach ein paar Wochen noch einmal bei euch im Gefängnis aufgetaucht?«
»Was heißt aufgetaucht«, entgegnete Lisa, »er hat von vornherein seine eigene Giftsuppe gekocht. Oder meinst du«, sagte sie langsam, »ein Schwein seines Kalibers läßt fünf hübsche Mädchen, die in seine Hände gegeben sind, aus den Klauen?«
Lisa hörte, wie schwer der Mann an ihrer Seite atmete und brach einen Moment ab.
»Er hat euch – hat er euch – erpreßt?« fragte Maletta.
Es hörte sich an, als riebe sich seine Zunge an den Zähnen.
»Erpreßt?« wiederholte Lisa, »was für ein schöner Ausdruck. Das nächste Opfer war Sybille«, berichtete sie weiter. »Du weißt ja, sie und Bruno, unser erstes Liebespaar. Aber niemand von uns wußte – auch Bruno nicht –, daß sie ein Kind erwartete und schon im dritten Monat schwanger war.« Lisas Stimme bekam einen schrillen Klang, der nicht zu ihr paßte: »Machoff erpreßte sie. Soll ich aufhören, Peter?«
»Nein«, erwiderte er. »Ich muß alles wissen.« Er sah sie gequält an. »Es muß sein.«
»Gut«, versetzte Lisa. »Aber ich hab’ dich gewarnt.«
Maletta nickte. Sein Speichel schmeckte nach Galle.
»Sybille glaubte sich für Bruno zu opfern«, fuhr Lisa fort. »Sie wurde eine Nacht lang von diesem RSHA-Scheusal vernommen. Sie kam weinend zurück. Verstört. Mit aufgelösten Haaren. Sie konnte tagelang nichts essen. Als die Mithäftlinge sie dazu zwangen, kotzte Sybille die Brocken wieder heraus. Mit kaputtem Magen wurde sie in die Krankenabteilung eingeliefert. Von da an weiß ich nichts mehr von ihr – ich fürchte, sie ist am Ekel gestorben.«
»Und die anderen?« fragte Maletta.
»Die nächste war ich«, sagte Lisa hart, »Machoff hatte meinem Vater versprochen, sich um mich zu kümmern«, sprang Lisa ins kalte Wasser. »Und das hat er dann auch getan.«
Der Mann an ihrer Seite spürte, wie sich sein Nacken versteifte. »Machoff wollte mich in sein dreckiges Bett zerren. Ich spuckte ihn an.« Lisa atmete schwer. Selbst bei dem kärglichen Licht, das ins Zimmer fiel, sah Maletta in ihrem Gesicht, wie in einem Spiegel, daß sie alles noch einmal durchmachte.
»Er lachte nur und wartete, bis ich mich beruhigt hatte. Er fläzte sich in einen Stuhl, zündete sich eine Zigarette an, blies blasiert den Rauch ab, sah mich an, prüfte, ob ich schon reif genug sei für weitere Angebote. Weißt du, Peter, die besten Folterknechte sind bekanntlich die, denen es Spaß macht – das habe ich begriffen in diesen Monaten –«
»Und?« fragte er mit einer Stimme, die überschwappte.
»Machoff sagte mir, daß du in einem geheimen Verfahren zum Tode verurteilt seist und morgen früh hingerichtet würdest. Zwar hatte ich eine solche Nachricht befürchtet, aber die Vorstellung, daß es in ein paar Stunden soweit sein würde und es vielleicht doch noch verhindert werden könnte, danach aber für immer zu spät wäre, machte mich verrückt. Zuerst war ich so entsetzt, daß ich nicht einmal weinen konnte. Dann begann Machoff von einer Möglichkeit zu sprechen, die Hinrichtung auszusetzen. ›Ob sie mich mögen oder nicht, Lisa‹, sagte er, ›ändert nichts daran, daß nur ein Anruf genügt, um die morgige Exekution abzusetzen‹.«
Einen Moment lang fürchtete Peter Maletta, sein Herz stünde still. Seine Zähne bissen sich in die Unterlippe, bis sie platzte und blutete; er spürte es nicht. Er bekam keine Luft mehr und fürchtete, zu ersticken. Langsam wurde er mit dem Anfall fertig.
»Machoff sagte, es sei auch für ihn gewagt, einzugreifen, und ein Risiko erfordere eine Gegenleistung. Dann wurde er konkret und gab mir eine Stunde Zeit zur Entscheidung –«
»Und du hast es getan?« sagte Maletta mit kenternder Stimme: »Du, ausgerechnet du?«
»Ich wollte dich retten«, sagte Lisa leise.
»Mein Gott«, erwiderte er.
Er nahm ihre Hand, preßte sie, bis es schmerzte, aber Lisa gab keinen Laut von sich.
Maletta sprang auf, zündete sich eine Zigarette an. Im Feuerschein des Streichholzes war sein Gesicht glutrot. »Ich zahle es ihm heim«, sagte er. »Ich schwöre: Alles zahle ich ihm heim. Alles, was er dir, mir, Olga, Nadine, Sybille, Dena und Bruno Plaschke angetan hat.«
»Ist das denn noch so wichtig, Peter?« fragte sie. »Wir haben überlebt – und nur das zählt. Wenn wir uns mit der Erinnerung herumschlagen, quält uns Machoff bloß weiter.«
»Vielleicht gelingt es mir wieder einmal, nachts zu schlafen. Womöglich kann ich wieder einmal richtig lachen. Vielleicht schmeckt mir das Essen wieder, und ich brauche nicht mehr den dummen Snob zu spielen. Es kann auch sein, daß mir das Trinken wieder Spaß macht, weil ich dabei nicht mehr die Vergangenheit ertränken muß.« Maletta zog Lisa an sich. »Vielleicht kommt auch einmal wieder die Situation, da ich eine Frau begehre«, sagte er. »Aber zuvor heißt es Tabula rasa. Es ist die Voraussetzung, daß ich wieder atmen, daß ich weiterleben kann.«
»Mach’ von mir aus ihn kaputt«, sagte Lisa, »aber bitte nicht dich.« Sie streichelte seine Stirn. Es war Zärtlichkeit ohne Sinnlichkeit. Sie fuhr mit den Fingern über seinen Mund, spürte die Feuchtigkeit.
»Du weinst doch nicht?« fragte sie.
»Nein«, antwortete Maletta. »Ich weine nicht.«
Er machte Licht, um sich den Mund abzuwischen.
Lisa sah, daß es Blut war.
Sie legten sich wieder hin und versuchten voreinander zu verbergen, daß sie nicht schlafen konnten, sondern die Sekunden, Minuten und Turmuhrschläge zählten.
»The alarm is over«, rief First-Lieutenant Teddy Pepper durch Haus und Garten, als Major Tajana und seine reizvolle und gefährliche Begleiterin Judy enlihch gegangen waren. »The party goes on!« brüllte er weiter. »And now«, verfiel er in ein ulkiges Deutsch: »Ringelpietz mit Anfassen!«
»Schrei’ nicht so laut, Teddy-Boy«, rief Doc MacKinley lachend, »sonst kommen die noch einmal zurück.«
Der Aufreißer schüttelte sich: »Dieser Major Tajana hat uns glatt um zwei Stunden zurückgeworfen.« Er wandte sich dem kurzbeinigen und kurzatmigen Chef des Mammut-Areals zu: »Mach’ die Schotten dicht, Stubby, damit wir nicht noch andere Überraschungen erleben.«
Der First-Lieutenant ging ans Telefon, um weitere ›Tahitianerinnen‹ zu beschaffen. Während er noch verhandelte, kamen die in den Blauen Salon verbannten Gespielinnen im Gänsemarsch nach unten; voran die blonde Sissy, dann die Kurven-Lilly, gefolgt von der flammend roten Betsy und der schüchternen Daisy. Alle überragend Sandwich, blankpoliert, als hätte sie die Zeit des Exils im ersten Stock dazu benutzt, sich ununterbrochen zu schrubben.
Major Silversmith nahm mit den Augen Maß bei der Masuren-Tochter, er schob die Icewater-Karaffe beiseite und kroch unter dem Baumschatten der üppigen Roßkastanie hervor, wie der Drachen, der Jungfrauen verspeist, aber er war kein feuerspeiendes Monster, und das Sandwich schon gar keine Jungfrau, sondern eine für zwei, die so viele Blicke auf sich zog, als wäre sie eine für alle.
Der Hausherr drehte die Lautsprecher auf. Die Neger-Ordonnanzen füllten, ziemlich unnötig, die Gläser nach, und Stubby sah nicht mehr aus wie ein Seekranker an der Reling und auch nicht mehr wie ein gerade noch einmal entkommener Taschendieb. Sein Gesicht war wieder in der Farbe der Baccara-Rose erblüht; der Doc schätzte seinen Blutdruck auf mindestens 200 zu 130, bei ansteigender Tendenz, systolisch wie diastolisch.
Die ersten Paare vollbrachten auf dem Teppich Bocksprünge der Lebenslust. Die Tänze hatten sich geändert wie die Namen der deutschen Mädchen: Man stellte sich nicht mehr zu Marschfox oder langsamem Walzer auf, sondern zu Jitterbug und Bebop. Der American way of Life hatte in Germany schon im ersten Anlauf einen riesigen Brückenkopf gebildet.
Major Silversmith holte sich bei der Aufforderung zum Tanz bei Sandwich eine Abfuhr, ertrug sie aber gelassen und blieb auf der Lauer, ein Rüde im Rudel, der trotz der Hoffnungslosigkeit des Unterfangens treu zu seiner Brunft steht. Doc MacKinley hatte die Szene verfolgt und grinste genüßlich; er ahnte ein Fiasko, denn die kolossale Ostpreußin, dieses weizenblonde Edelgewächs, war zwar vielseitig, doch auch geschmäcklerisch.
Charly dirigierte nicht mehr fachmännisch seine farbigen, wenn auch alliierten Hilfskräfte; er saß im intimen Gespräch mit Captain Miller in einer Sofaecke; es sah aus, als tauschten zwei mit allen Wassern gewaschene Börsenjobber hochkarätige Tips aus und begaunerten sich dabei gegenseitig. Der Findling aus Berlin, glücklich an der Isar gestrandet, hatte es in kurzer Zeit recht weit gebracht. Seine Förderer unter den Alabama-Offizieren waren beim deutschen Wohnungsamt erfolgreich dafür eingetreten, daß Charly das Siedlungshäuschen eines schwerbelasteten Parteigenossen zugesprochen wurde.
Langsam verlagerte sich die Garten-Party in das Innere des Hauses. Wiederum gingen einige Gäste, unter ihnen First-Lieutenant King mit Iris, die er in einem unbewachten Moment seinem Rivalen Sears entführte. Captain Wallner stellte fest, daß seine Begleiterin Gesine auch bei anderen Männern Anklang fand, sogar im Cocktailkleid und ohne BDM-Röckchen. Wenn sie von anderen Offizieren umlagert war, nahm er sie bei der Hand und zog sie einfach weg, zugleich beleidigt wie stolz, mißtrauisch und befriedigt – James Wallner gehörte zu den Verwundeten einer Zeit, die den Teufel im Leib hatte.
Die von Teddy-Boy herbeigerufene Verstärkung erschien. Die männlichen Partygäste zog es an den Eingang wie damals die Männer von San Francisco in die Hafenbucht: Sie stellten mit Befriedigung fest, daß der First-Lieutenant wieder einmal das richtige Gespür gehabt hatte – die Anlandung erfreute, auch wenn sie den Männerüberschuß nicht ausgleichen konnte.
Die Mädchen waren nicht alle käuflich, wenn auch vielleicht zu haben. Daß sie von heldischen Zeiten bedient waren, bedeutete noch nicht, daß sie sich rücksichtslos an die Fettlebe hielten. Sie hatten nur die selbstgestrickten Wollstrümpfe satt und auch die linksgewebten, schwarzgehandelten Baumwollprodukte ›Made in Germany‹. Der Slogan: »Die deutsche Frau raucht nicht«, hing ihnen ebenso zum Hals heraus wie die Holzpantinen, der Muckefuck und der Kunsthonig. Sie wollten keine Panzersperren mehr bauen und auch an keinen Flakgeschützen mehr stehen, und das Himmler-Angebot, dem Führer – zwecks Ausgleich des Blutverlustes – ein Lebensborn-Kind zu schenken, fanden sie so lächerlich wie den Zwicker des zur Hölle gefahrenen Reichsführers SS. Mochte man sie für Amizonen, für Nutznießerinnen der Besatzungszeit halten, jedenfalls waren sie auch Vorbotinnen der Vorurteilslosigkeit, und dabei meist ehrlicher als ihre Eltern.
Die deutsche Frau raucht nicht?
Sie smokte CAMEL, Chesterfield und Luckystrike, als bliese sie den Einpeitschern des braunen Reinheitsgebots den Rauch ins Gesicht, und ihre Männer, Väter und Brüder warteten auf die Kippen.
Doc MacKinley hatte sich bislang eher als Kundenbetreuer, denn als Partyteilnehmer betätigt, aber als er unter den Neuankömmlingen die große Brünette mit den schulterlangen Haaren sah, fühlte er sich angesprochen und schlüpfte aus seiner Zurückhaltung wie ein Fuchs aus der Höhle. Es war keine Zeit zu verlieren, denn sie wurde sofort von anderen Bewunderern umlagert.
Der Militär-Arzt pflügte sich durchs Gewühl, knapp und schnell machte er seinen Waffenbrüdern klar, daß er eine Option ausnützen wolle.
»Hello, pretty girl«, begrüßte er die 20jährige und zog sie zunächst einmal beiseite: »Would you like a drink?« fragte er.
»Oh, yes«, erwiderte die Brünette und musterte ihn nicht ohne Interesse. »Orange-juice with a little bit of gin, please.«
Auf Uniformen verstand sie sich – auf amerikanische wie auf deutsche –, und so stellte sie fest, daß der Flirt-Partner ein Mediziner im Rang eines Captains war.
Sie zündete sich eine Zigarette an, schlug Attacken einiger Bewerber ab, während sie auf MacKinley wartete. Der Doc unterschied sich nicht nur durch Witz und Überheblichkeit von den anderen. Die lange Brünette merkte, daß ihr selbstgeschneidertes Kleid – knielang, ärmellos, nur andeutungsweise dekolletiert – ankam, es konturierte ihre Figur, und die weiße Fallschirmseide ließ nicht erkennen, ob sie deutschen oder alliierten Ursprungs gewesen war.
»Thanks for waiting«, sagte der von der Bar zurückkehrende MacKinley.
»Thanks for the drink«, bedankte sich die Brünette.
»My name is Henry«, stellte er sich vor.
»And I am Angel«, entgegnete sie.
»A fallen angel?« fragte der Doc. »Ein gefallener Engel?«
Sie lachten beide.
Dann wurde sie ernsthaft. »Be careful«, versetzte sie. »Ich bin zwar lustig, aber das bringt noch gar nichts. Was sind Sie für ein Arzt?« fragte sie dann.
»Chirurg«, erwiderte er. »Mögen Sie Ärzte?«
»Solange sie mich nicht behandeln«, antwortete Angel und lachte über sein verdutztes Gesicht. »Meine Mutter behauptete immer: ›Der Arzt im Haus ersetzt den Kurpfuschern«
MacKinley sah, wie sich First-Lieutenant Pepper auffällig in ihrer Nähe herumtrieb und immer wieder hersah, wie ein kleiner Köter, der sich an den größeren Hund nicht heranwagt, aber ihn auch nicht aus den Augen läßt. Der Zuchtmeister unzüchtiger Spiele hatte begonnen, Stubbys Südsee-Insulanerinnen zu rekrutieren und dabei über Angel offensichtlich anders disponiert als der Penicillin-Distributor.
»To hell with you, Teddy-Boy«, sagte MacKinley mit herzlicher Verachtung. »Listen: Angel is my date. Any doubts?«
»You egoist«, maulte der Liebes-Manager.
Nach seinem unwilligen Abgang pickte er rasch zwei andere Gespielinnen auf und zog sie über die freitragende Treppe nach oben. Die Beletage bestand aus einem großen Salon, zwei Schlafgemächern und zwei Badezimmern. In allen fünf Räumen standen die Türen offen, war das Licht moduliert und die Musik gedämpft.
Die Kulisse des künstlichen Paradieses stand. Sowie sie mit Adams und Evas bevölkert wäre, würde der Kellner Charly die Treppe bewachen und den Körperreigen vor ungebetenen Mitwirkenden schützen.
Major Silversmith hatte sich als erster nach oben gestohlen, stumm und nüchtern wie ein Trappisten-Mönch, wenn auch nicht so enthaltsam. Colonel Williams, der Hausherr, putzte sich im Badezimmer die Zähne, zum dritten Mal schon, aus Verlegenheit, nicht aus Reinlichkeit. Wenn Stubby bei den verbotenen Spielen auch voll bei der Sache war, hatte er doch davor und danach Hemmungen – ein nur zeitweilig unsauberer Puritaner.
Teddy-Boy schleppte Sissy und Daisy an. Dann kam das Sandwich und führte an der linken Hand First-Lieutenant Sears und auf der anderen Seite Freddy Sillitoe, den Captain der Militär-Polizei, der sich zur Zeit außer Dienst fühlte. Sie segelte wie eine stolze Fregatta mit zwei kleinen Begleitschiffen in die Arena erfüllbarer Träume.
Im Blauen Salon stand es jetzt sechs zu vier. Pepper flitzte noch einmal nach unten, um das Defizit auszugleichen. Es ging nicht so schnell. Die Erwartungsbangen fürchteten schon, dieses Mal mit schiefer Schlachtordnung in das Matratzengefecht ziehen zu müssen, aber auf Teddy-Boy war wenigstens halbwegs Verlaß; er hatte noch eine Glutäugige, wenn auch zweite Wahl, aufgetrieben. »Angel ist nicht loszueisen«, raunte er dem Gastgeber zu. »Der lousy Doc hat sie einfach einkassiert. Nichts zu machen.«
Charly bezog auf der Treppe Posten.
First-Lieutenant Pepper begann die Spielregeln zu erklären: »Bottle-Poker«, sagte er mit angehobener Stimme. »Flaschen-Poker.«
Die Mitspieler setzten sich in berechneter Zwanglosigkeit auf die bereitgelegten Kissen am Boden.
»Probelauf«, startete er das Spiel und setzte eine leere Weinflasche mit einer Rechtsdrehung in Schwung. »Auf wen der Flaschenhals zielt, der muß ein Kleidungsstück ablegen. Wenn der Wurf ungenau ist, wird wiederholt. Der Verlierer darf dann die Flasche drehen. Everything okay?« fragte er. »I am starting now.«
Der Hals der leeren Flasche deutete auf das Sandwich; die Weizenblonde schleuderte lässig ihren linken Schuh in die Mitte, griff dann nach der Flasche, drehte sie und erzielte, unter dem Gelächter aller, ein Selbsttor. Sie entledigte sich ihres rechten Schuhs. Interessanter würde es für die Umsitzenden erst, wenn die Ostpreußin beim nächsten Mal die Strapse ihrer hauchfeinen Nylons lösen müßte.
Es ging munter weiter. Der Sinn des Spiels war, daß möglichst rasch, möglichst alle, möglichst nackt herumsaßen. Wie ein Ritter vor dem Turnier seine Rüstung anlegt, muß ein Matratzen-Matador vor dem Match sich seiner Kleidung entledigen. Und die Bottle kreiselte und drehte sich rechtsherum bei dem linken Spiel, das Teddy-Boy in einem anderen Kreis mit dem Satz charakterisierte: »Eine leere Bottle dreht sich um die vollen Flaschen.«
Stubby, den Hausherrn, erwischte es als nächsten; er zog schwitzend und keuchend seine Uniformjacke aus. Das brandneue Chicken-Emblem auf den Schulterstücken geriet wie zufällig unter einen hohen Stöckelabsatz. Der vierte Wurf war strittig und mußte wiederholt werden.
Es ging munter weiter. Einmal zierte sich eines der Mädchen und mußte von der Gruppe zur Räson gebracht werden. Auch keiner der Männer war darauf erpicht, sich als erster im Adams-Look zu zeigen.
Nach fünfzehn Minuten war Captain Miller – der Alabama-Transport-Offizier – der endgültigen Entblätterung nahe gekommen, saßen Lilly und Daisy barbusig in der Runde und trug das Sandwich längst keine Nylons mehr.
»Hurry up!« fuhr Pepper den langsamen First-Lieutenant Sears an: »Don’t be worried, Greenhorn.«
Kurze Zeit später war Miller am Ziel und schied aus. Sissy war die nächste. Die Entblätterung ging jetzt schneller vor sich. Ausgerechnet das Sandwich kam ganz langsam voran – wie eine ausgekochte Stripperin, die den Knalleffekt hinauszieht.
Colonel Williams, dessen hochrotes Gesicht selbst im Halbdunkel glühte, trug nur noch olivgrüne Army-Unterhosen. Als er sie ausziehen mußte, sah es aus, als häutete er sich selbst. Er drehte sich verlegen in Richtung Sandwich. Seine Zunge stotterte stumm über die Unterlippe. Er schob sich näher an die Ostpreußin heran. Sears wäre ihr lieber gewesen, aber sie wußte, was sie dem Gastgeber schuldete.
Erst als Major Silversmith, der immer noch einen Socken trug, sich auf der anderen Seite an Sandwich heranmachen wollte, rief sie: »No, no, no – half of Munich can fuck me, but not this bloody screwdriver.«
Die Runde lachte auf Kosten Dave Silversmiths. Der vulgäre Ausspruch sollte wenig später zum geflügelten Wort der Besatzungs-Bürokratie werden.
»Boring game«, beendete Teddy-Boy den Flaschen-Poker. »I have a better idea, a splendid one.«
Seine blendende Idee war selbst für den Gastgeber überraschend: Die männlichen Mitspieler mußten den Blauen Salon verlassen und im Badezimmer duschen; sie hätten, wie Pepper grinsend feststellte, eine Abkühlung auch dringend nötig.
Die Mädchen okkupierten inzwischen die Liegen.
Eine blieb leer.
»Und das ist die Niete«, erklärte Teddy-Boy. »Ich lösche das Licht, verlasse den Raum, und die Girls nehmen Platz. Jeder muß sehen, wie er im Dunkeln zurechtkommt. Wer mogelt, wird vom Spiel ausgeschlossen. Any questions?«
Aber er würgte alle Fragen ab, sah auf die Uhr und löschte demonstrativ das Licht. »Ich zähle bis drei«, sagte er dann, ging auf den Gang und löschte auch hier das Licht. Nur noch spärlicher Mondschein versilberte den Blauen Salon.
»One – two – three!« gab er das Startsignal.
Der erste Durchgang war ein voller Erfolg, zumal der Playmaster freiwillig die Niete gezogen hatte.
»Stop«, rief Pepper nach zehn Minuten ins Getümmel. »Ich erkläre jetzt den Ablauf der zweiten Runde.«
Unten in der Wohnhalle ging es inzwischen eher dezent als wild zu. Einige Paare tanzten cheek bei cheek oder saßen nebeneinander in tiefen Clubsesseln, hielten sich an den Händen, waren froh, daß sie einander hatten und keine dritten brauchten. Nicht alle wußten, was sich oben abspielte, aber die meisten ahnten es. Einige, die man sogar unter Stubbys Günstlinge aufgenommen hätte, wollten das paradiesische Spiel als Adam und Eva und nicht als ganze Bodengruppe erleben.
»I like Angel«, sagte Doc MacKinley zu seiner Halberoberung.
Er saß mit ihr an der Bar, streichelte ihre Haare, bewunderte ihre Augen, ihre Stirne, ihren Mund – bewunderte eigentlich alles in dieser Moonlight-Mood, er zog sie an sich.
Seine Hände gingen auf Entdeckung, mehr tastend als fordernd, genau wie sie es mochte.
Sie küßten sich.
»I love Angels«, sagte er, als sie sich freimachte.
»Angels?« fragte die Brünette.
»One Angel alone«, versetzte der Doc.
Sie standen auf und tanzten sich in die Zweisamkeit. Links herum, Wechselschritt. Mitunter blieben sie stehen, lehnten sich aneinander. Sie hatten keinen Blick mehr für die anderen und schon gar kein Gefühl für die Zeit. Ihre Hände wurden kühner, bewußter; sie wurden reif füreinander.
»Where do we go?« fragte MacKinley, »zu dir oder zu mir?«
»Zu mir geht es nicht«, antwortete Angel, »und zu dir will ich nicht.«
»Warum?«
»Maybe education«, entgegnete sie und lächelte wie die Sphinx von Mittersendling. »Maybe experience. Vielleicht eroberst du mich eines Tages«, sagte sie anzüglich, »aber bestimmt nicht am ersten Abend.«
Es war eine Antwort – auch wenn sie ihn vertröstete –, wie der junge Arzt sie mochte. Und das letzte Wort wäre ja noch nicht gesprochen. Sie traktierten einander weiter mit Zärtlichkeiten, bis kurz nach Mitternacht ein schriller Mädchenschrei durch das Haus gellte.
Alle Anwesenden hörten ihn und sagten später übereinstimmend, sie hätten gleich gespürt, daß im ersten Stock etwas Furchtbares vorgefallen sein mußte.
»Sorry, Angel«, entschuldigte sich MacKinley und machte sich von dem Mädchen los.
Als Arzt war er gewohnt, Erste Hilfe zu leisten. Er hastete nach oben. Auf der Treppe stieß er Charly beiseite, dann fiel er fluchend über einen Kleiderberg, rappelte sich wieder hoch, suchte und fand den Lichtschalter.
Die Paare im Blauen Salon fuhren flatternd auseinander wie Hühner, in deren Stall ein Iltis eindringt.
»Was ist los?« fragte der Arzt First-Lieutenant Pepper.
»Er rührt sich nicht mehr«, sagte eines der Mädchen mit weinerlicher Stimme.
Der Mediziner starrte auf die Liege, auf der Colonel Williams lag, nackt bis auf seinen Ehering.
Während sich der Doc über den Hausherrn beugte, begannen sich die ersten so verstohlen anzuziehen, wie sie sich ausgezogen hatten, nur viel zielstrebiger.
MacKinley fühlte Stubbys Puls, hob seine Augenlider, versuchte eine Mund-zu-Mund-Beatmung. Dann richtete er sich auf, zuckte die Schultern, betrachtete die Mädchen mit den verschwitzten, zerzausten Haaren und ihre verstörten Galane, die nichts mehr mit ihnen im Sinn hatten.
»Shit«, sagte der Doc. »Stubby is dead. Tot«, wiederholte der Captain mit dem Äskulapstab. »Daran ist nicht zu rütteln. Fragt sich nur, ob er an einem Herzschlag gestorben oder vergiftet worden ist.« Er sah, daß sich Silversmith davonmachen wollte. »Alle bleiben hier«, ordnete er an. »Auch Sie, Major. Und keiner rührt hier bis zum Eintreffen der CID etwas an!«
MacKinley ging nach unten und belebte telefonisch einen schläfrigen Wachhabenden in der Zentrale der ›Criminal Investigation Division‹. Er ließ sich die Privatnummer des Chefs geben und riß Jim Zielinsky aus dem ersten Schlaf.
»Immer Colonel Williams«, brummelte der Major benommen: »Sind wieder Eisenbahn-Waggons verschwunden, die dann –« Mitten im Satz erfaßte er, daß der neue Chef des Alabama- und Indiana-Depots unter dubiosen Umständen gestorben war. »Give me ten minutes«, sagte er und hängte auf.
Zielinsky schaffte es in 13 Minuten nach Schleißheim zu kommen. Er traf fast gleichzeitig mit den anderen CID-Leuten ein: ein grauer Mann mit eisgrauen Augen, fast unförmig groß, ein unbequemer Typ, der Major Silversmith nicht vergessen würde, daß er von ihm einmal als ›Prolet in Uniform‹ betitelt worden war.
Während des ersten Augenscheins fragte der Major nichts und sagte auch nichts. Er war vor dem Krieg Assistent der Mordkommission in Philadelphia gewesen und hatte sich in Frankreich als Tapferkeitsoffizier aus dem Mannschaftsstand emporgeboxt. Wenn die Beteiligten bisher noch nicht realisiert hatten, was auf sie zukommen würde, so machten sie sich spätestens jetzt klar, daß Colonel Bud C. Williams einen handfesten Skandal hinterlassen hatte.
»So – nun bist du an der Reihe, Henry«, sagte Zielinsky zu MacKinley, »was hast du festgestellt?«
»Keine Schußverletzung. Herzversagen, womöglich aus natürlicher Ursache – oder nach Einnahme von Gift. Klarheit kann nur die Obduktion ergeben.«
»Natürliche Ursache ist gut«, erwiderte Zielinsky mit sattem Hohn. »Alle, die hier im Raum sind, waren dabei, als Williams gestorben ist?« wandte sich der Investigator an die Umherstehenden. »Es fehlt keiner?«
»Keiner«, bestätigte der Arzt. »Ich war natürlich nicht im Raum, als es geschah«, setzte er hinzu. »Ich habe mich unten aufgehalten und bin erst nach oben gejagt, als ich den Schrei hörte.«
»Du bist den ganzen Abend unten gewesen?« vergewisserte sich der CID-Major. MacKinley nickte.
»Schwein gehabt«, stellte Zielinsky trocken fest.
Seine Leute arbeiteten lautlos. Sie packten vorsichtig das Glas mit der Restflüssigkeit ein. Während der Major den fünf Mädchen eröffnete, daß sie vorläufig festgenommen seien, wurde der Tote für die gerichtsmedizinische Untersuchung abgeholt.
»Ich fasse also zusammen«, sagte der CID-Chef dann. »Ihr habt euch hier richtig schweinisch ausgetobt. Jeder mit jedem – und einer hat dabei ins Gras gebissen.« Sein schieflippiges Gesicht entblößte unregelmäßige Zähne. »Und das war dummerweise Colonel Bud C. Williams. Und wie ich seine Witwe, die Tochter des Senators, einschätze, wird sie jetzt auf einem Staatsbegräbnis auf dem Heldenfriedhof von Arlington bestehen.« Sein Lächeln war noch kälter als seine Stimme: »Und dabei ist Stubby hier im Lotterbett hopsgegangen – mit einer deutschen Schlampe im Arm.« Er schüttelte den Kopf. »Und das waren Sie!« fuhr er die weinende Kurven-Lilly an: »Name? Geburtsdatum? Adresse? Machen Sie schnell!« drängte er.
Major Zielinsky brauchte nicht zu betonen, daß die zu Vernehmenden noch eine lange Nacht vor sich hatten. Er würde den Skandal auf großer Flamme garen und umrühren; er war genau der richtige Koch für diese trübe Brühe.
Die Spanne zwischen Mitternacht und Tagesanbruch wurde auch zwei Menschen lang, denen früher gemeinsame Nächte immer zu kurz erschienen waren. Erst gegen zwei Uhr stellte Peter Maletta fest, daß Lisa eingeschlummert war. Behutsam löste er sich vom Lager, ging in die Küche, um zu rauchen. Er dachte darüber nach, was Lisa zu ihm gesagt hatte, aber er wurde dabei nur ein Wiederkäuer des Ekels, er wußte, daß er sich Emotionen erst leisten konnte, wenn er Machoff gestellt hätte.
Maletta ging ins Bad, duschte sich, darauf bedacht, seinen Schlafgast nicht zu stören. Als er zurückkam, war Lisa wach; die ersten Silberstreifen standen schon am Horizont. Die Vögel waren längst erwacht. Der Himmel färbte sich blau.
»Schlaf doch weiter«, bat er.
»Ich kann nicht, Peter«, erwiderte sie leise. »Du kannst es doch auch nicht.«
»Versuch’s trotzdem, Lisa«, wiederholte er und ging in den Garten.
Die Grillen hatten aufgehört mit ihrem Zirpen, dafür flöteten jetzt die Amseln und jubilierten die Lerchen. Für sie galt keine Sperrstunde, und sie trugen auch keine Trauer. Die Vögel waren frei – und viele Menschen vogelfrei.
Der unfreiwillige Frühaufsteher setzte sich auf eine Steinbank und saß die Zeit ab, Wache schiebend für seinen Haß; er fragte sich, wieviel davon ein Mann aushalten könne. Ab und zu patrouillierte eine MP-Streife vorbei und verschwand dann in langsamer Fahrt in Richtung Prinzregentenplatz, der ganz in der Nähe lag.
Hier, im Haus Nummer 16, hatten Adolf Hitler und Eva Braun gewohnt, was die Münchner vielleicht schon vergessen hätten, wären sie nicht durch die Entnazifizierungs-Posse des gestrigen Tages daran erinnert worden: Ein Beamter der Vollstreckungsstelle – ein Neuling ersetzte einen gefeuerten Parteigenossen – wurde von einem anderen Ersatz-Beamten in Hitlers Privatwohnung geschickt, um 996 Reichsmark Rückstände für Gas und Strom zu pfänden. Der Beauftragte stellte fest, daß die Schuldner nicht anwesend waren, hörte sich im Haus um und schrieb dann in sein Protokoll: »Da ich erfahre, daß die Obgenannten in Berlin umgekommen sein sollen, konnte die Schuld nicht beigetrieben werden.«
Der Zwischenfall wurde zum Tagesgespräch; einen Moment lang lächelte man an der Isar, und ein Mann hatte treffend bewiesen, daß er politisch wirklich unbelastet war. Die Schuld war tatsächlich nicht beizutreiben.
Maletta ging ins Haus zurück. Lisa war bereits im Bad gewesen und hatte Kaffeewasser aufgesetzt. Sie nickte ihm zu – ihrem Lächeln war ein Schuß Angostura beigemischt; die Bitternis machte es weh und wund, doch auch tapfer.
»Warte einen Moment, Peter«, sagte sie und verschwand noch einmal im Badezimmer; sie kam mit einer Fingerspitze voll Creme zurück, stellte sich vor ihm auf die Zehenspitzen und rieb damit seine Wunde an der offenen Unterlippe ein.
»Sonst kriegst du eine Infektion«, erklärte sie.
Maletta ließ sie gewähren. Die Infektion hatte er längst. Er sah Lisa zu, wie sie den Kaffee aufgoß. Kaffee war das richtige um sechs Uhr morgens nach einer schlaflosen Nacht. Das Mädchen wußte, daß er wieder mit dem alten Thema anfangen würde und hatte Angst davor; sie wollte vergessen, Peter wollte rächen.
»Sag mal«, begann er, »du hast davon gesprochen, daß du auch Richard Ramloch einmal gesehen hast.«
»Ja«, bestätigte sie. »Zwischen zwei Vernehmungen.« Lisa sah seine Aufforderung, weiterzusprechen. »Der Hauptsturmführer war zwar auch ein Schwein, aber gemessen an Machoff geradezu ein Glücksferkel. Er hat uns eigentlich in Ruhe gelassen.«
»Eigentlich?«
»Mich wenigstens«, antwortete Lisa. »Willst du denn unablässig in diesen Geschichten herumbohren?«
»So lange, bis sie bereinigt sind«, entgegnete er. »Ich bin mit Captain Freetown, der dieses Haus bewohnt, irgendwie befreundet. Er bietet mir die Möglichkeit, nach verschollenen Mitgliedern des Zirkus Maletta zu suchen. Eine derzeit phantastische Chance – ich werde sie in jedem Fall nutzen. Vielleicht geht es einer von euch schlecht, und ich kann helfen oder –«
»Oder du erfährst etwas über Machoff«, erwiderte Lisa und lächelte, diesmal ohne den Tropfen Bittersubstanz. Peter war wie er war, und vielleicht mußte er auch so sein.
Sie setzten sich am Tisch zusammen und memorierten Namen, Adressen, Einzelheiten. Es kam nicht viel heraus, zumal sich damals alle, außer Maletta und Bruno Plaschke, aus Tarnungsgründen falsche Identitäten zugelegt hatten. Einige der Mädchen stammten aus heutigen Vertreibungsgebieten und zwei sogar aus dem Ausland. Die Post funktionierte erst seit ein paar Tagen wieder – falls sie funktionierte, Briefe waren offen am Schalter abzugeben, und es mußte vermerkt sein, ob sie privat oder geschäftlich wären. Aber wie soll man schreiben, wenn man die Adresse des Empfängers nicht kennt?
Die deutsche Zivilbevölkerung hatte einen Interims-Ausweis erhalten und durfte sich nur im näheren Umkreis ihres Wohnorts bewegen. Reisen in den Nachbarort bedurften bereits einer Sondergenehmigung, und für eine solche stemmte man sich – so man nicht zufällig Peter Maletta hieß – tagelang in der Tegernseer Landstraße die Beine in den Leib.
Sie gingen die Notizen noch einmal durch. »Ziemlich mager, die Ausbeute«, stellte er fest. »Vielleicht fällt dir später noch etwas ein.« Er gab Lisa Captain Freetowns Telefonnummer. »Für den Notfall«, erklärte der Berliner. »Sonst rufe ich dich in deiner Redaktion an. Und das nächste Mal bringst du bitte Harry mit.«
»Einverstanden«, erwiderte das Mädchen.
»Noch etwas: Im Hause des – des stellvertretenden Stabschefs«, er übernahm automatisch die Bezeichnung Lisas für ihren Vater, »gab es doch sicher Personal. Könnte nicht jemand Einzelheiten der Verhandlungen zwischen ihm und Machoff aufgeschnappt haben?«
»Kaum«, versetzte Lisa. »Sie haben immer hinter verschlossenen Türen miteinander gesprochen. Höchstens«, setzte sie nachdenklich hinzu, »die alte Martha, unser betagtes Hausmädchen. Ich hatte immer das Gefühl, sie stünde mehr auf der Seite meiner Mutter und damit auch auf meiner. Aber sie war viel zu eingeschüchtert, um offen Partei zu ergreifen – und außerdem auch noch schwerhörig.«
»Was ist aus Martha geworden?« fragte er rasch.
»Das kann ich vielleicht feststellen«, versetzte Lisa und griff nach ihrer Handtasche. »Ja, das werde ich tun, und zwar so rasch wie möglich.«
Maletta fuhr Lisa mit einem Umweg über den Münchener Osten zur Redaktion in der Schellingstraße. »Auf bald«, verabschiedete sie sich, ging auf das Pförtnerhäuschen zu, drehte sich noch einmal um und winkte zurück.
»Vergiß nicht, dich bei deiner Tante zu melden«, rief ihr Maletta nach.
Lisa nickte und stieß, nach ihrem Hausausweis suchend, auf das Päckchen lucky strike, das ihr Peter in die Handtasche geschmuggelt haben mußte. Zwar war Lisa Nichtraucherin, aber die Zigaretten-Währung war die zur Zeit einzig gültige.