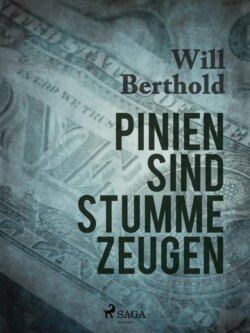Читать книгу Pinien sind stumme Zeugen - Will Berthold - Страница 4
I.
ОглавлениеDie erste Nachricht kommt aus der Schweiz. Die Fünf-Zeilen-Meldung aus Bern verliert sich fast in einem Stapel Routine-Notizen, die täglich aus Europa beim amerikanischen Geheimdienst eingehen, wie aus der Gießkanne verteilt, anscheinend nach dem Woolworth-Prinzip: Die Masse macht’s. Schließlich müssen die mit hohem Dollar-Etat ausgerüsteten Agenten des Außendienstes nachweisen, daß sie nicht schlafen, wenn sie der ständig drohenden Abberufung entgehen wollen.
So jedenfalls urteilt man im ersten Moment in der Zentrale. Zunächst wittert keiner der Akteure in der Etappe der unsichtbaren Front, daß aus dem Dunkel, schleichend und würgend, die größte Bedrohung Amerikas seit dem Zweiten Weltkrieg auf sie zukommen wird.
Dem aufmerksamen Kassierer einer Züricher Großbank waren beim täglichen Kassenabschluß zwei Fünfzig-Dollar-Scheine mit gleicher Numerierung aufgefallen. Sein spontaner Verdacht, eine der beiden Noten sei falsch, bestätigte sich nicht, denn sie glichen auch bei genauer Betrachtung einander wie eineiige Zwillinge. Bankleute wissen, daß es kein Falsifikat gibt, das sie nicht entlarven könnten. Es mußte sich – so unwahrscheinlich es schien – um ein Versehen der US-Notenbank handeln. Die Entdekker hatten sich unverzüglich und unter Wahrung strenger Diskretion (davon leben schließlich die Schweizer Banken) an die Wirtschaftsabteilung der amerikanischen Botschaft in Bern gewandt.
Der ungewöhnliche Zwischenfall reißt niemanden vom Stuhl in der Zentrale der erst ein Jahr alten Central Intelligence Agency (CIA), die nunmehr weltweit verantwortlich für Spionage, Gegenspionage, Subversion, Sabotage und Desinformation und zur Zeit noch zum Teil Untermieter in Washingtons Pentagon ist. In den ersten beiden Abteilungen, von denen die Meldung ausgewertet wird, löst sie mehr Kopfschütteln als Entsetzen aus. Obwohl sie von Frank Gellert stammt, einem der fähigsten Agenten des Außendienstes, beurteilt man sie mehr als Kuriosität denn als Alarmsignal.
Diese Fehleinschätzung ändert sich schlagartig, als sie James A. Partaker vorgelegt wird, dem CIA-Vice-Director und Generalstabschef des Hauses. Der große hagere Mann mit dem faltigen Gesicht, den Falkenaugen, dem unbekannten Privatleben und dem schier grenzenlosen Gedächtnis, wittert sofort eine kolossale Gefahr.
Man hält ihn für die graue Eminenz des Untergrund-Vereins; er gilt als schroff, überlegen, nicht selten auch als verletzend. Er ist keiner der ausgedienten Offiziere, die man nach lächerlichen Gehversuchen im Spionage-Dschungel von seiten der Militärdienststellen als gescheiterte Veteranen an die Agency abzuschieben versucht. Hinter ihrem Rücken nennt man diese zunehmend kaltgestellten Aufpasser ›Dinosaurier‹, und für einen Mann wie Partaker gehören vorzeitliche Ungetüme ins naturkundliche Museum statt in einen effizienten Geheimdienst.
Der Vice war während des Zweiten Weltkriegs Mitglied der engsten Donovan-Crew gewesen, der legendären Mannschaft des ersten US-Untergrund-Generals, die mit mehr Verwegenheit als Erfahrung hinter und zwischen den feindlichen Linien operiert hatte. Diese Vergangenheit hängt an dem Vice-Director wie ein Geruch, macht ihn dominant und hintergründig. Er hat keinen hohen Militär als Fürsprecher, er vertritt keine Waffengattung, ihn schirmt auch kein einflußreicher Senator gegen Widersacher im eigenen Headquarters ab. Seine Rückendeckung ist ausschließlich die Unersetzlichkeit. Partaker gilt als knallharter Profi, kalt wie der Henker und tödlich wie ein Kobrabiß. Kolporteure, die diese Charakterisierung verbreiten, wissen, daß sie übertreiben; ohnedies haben den Vice-Chef nur Dilettanten und Dinosaurier zu fürchten.
Partaker ruft die Telefonzentrale an und verlangt eine Blitzverbindung mit Bern, einer der wichtigsten Auslandsresidenturen. Während des Krieges war die Schweiz die große Spionagedrehscheibe Europas gewesen, aber auch danach erweist sich Helvetia noch immer als ein Vielliebchen der Agenten. Ungeduldig tritt der Enddreißiger ans Fenster, sieht auf die Straße, sein Blick streift achtlos Passanten, die gehetzt in klimatisierte Räume flüchten. Der späte Oktobertag zeigt sich der US-Bundeshauptstadt von der übelsten Seite: drückende Schwüle, plötzliche Regengüsse, warm wie Spülwasser, dann wieder stechende Sonne.
Das Wechselbad entspricht durchaus der politischen Großwetterlage.
Drei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg hat soeben ein Untersuchungsausschuß des US-Kongresses festgestellt, daß während und nach den Konferenzen von Casablanca und Jalta Washingtons Regierungsapparat von Sowjetagenten unterwandert worden war. Diese Spione Stalins, den der viermal hintereinander gewählte US-Präsident als ›Uncle Joe‹ zu verharmlosen und zu verniedlichen pflegte, hatten die Weichen für das Zukunftsdebakel gestellt. Seitdem die Amerikaner über diese Enthüllung bestürzt sind, fällt nicht nur Vogeldreck auf das schon zu Lebzeiten errichtete Monument des großen Franklin Delano Roosevelt. Zunehmend verbreitet sich die Erkenntnis, daß sein Entgegenkommen gegenüber dem roten Zaren die Welt in eine brisante Ost-West-Auseinandersetzung geführt hat.
Das Telefon schlägt an.
»Bern«, meldet die Zentrale.
In der Schweiz ist jetzt sieben Uhr Ortszeit, aber Frank Gellert ist so rasch in der Leitung, als hätte er die ganze Nacht neben dem Telefon gesessen.
»What a mess«, poltert der Anrufer statt einer Morgenbegrüßung los. »Hast du geschlafen, Frankie, oder was ist mit dir los?«
»Sorry, Mr. Partaker«, erwidert der Gerügte. »Dieser Wichtigtuer von Wirtschaftsattaché gab die Meldung an das Headquarters weiter, bevor er mich informierte. Inzwischen hab’ ich ihm das Maul gestopft.«
»Was ist das für ein Mann?«
»Kein schlechter«, erwidert der CIA-Agent, »aber ein Diplomat und kein Profi.«
»Shit! Blas ihm Pfeffer in den Arsch!« Der CIA-Gewaltige spricht Fraktur. »Sag ihm, daß er seinen letzten Ausflug ins schöne Berner Oberland hinter sich hat, sollte auch nur das geringste durchsickern.« Nach kurzer Pause hat er sich beruhigt. »Wer von unseren Leuten weiß noch Bescheid?«
»Niemand«, versichert Gellert. »Der Kassierer der Nobis-Bank wandte sich an seinen Direktor und dieser an den Diplomaten, der dann mich einschaltete; leider war, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt die Post schon abgegangen.«
»Sind inzwischen weitere Duplikate aufgetaucht?«
»Nein«, entgegnet der Mann aus Bern. »Noch nicht. Die Bankleute und ich fahnden natürlich fieberhaft, wir müssen dabei aber verdammt vorsichtig vorgehen und …«
»All right«, unterbricht ihn der Vice-Director. »Du machst das schon richtig, Frankie. Ich verlasse mich auf dich.«
»Thank you, Sir«, antwortet Gellert. »Ich habe noch keine Gewißheit, wer das Duplikat in Umlauf gebracht haben könnte, aber«, – er zögert kurz –, »vielleicht einen Anhaltspunkt. Womöglich wurde der suspekte Fünfzig-Dollar-Schein in der Außenstelle der Nobis-Bank in Lugano einbezahlt. Gelegentlich kommen italienische Nonnen über die nahe Grenze und deponieren Gelder, die sie – wie sie behaupten – von amerikanischen Verwandten und Förderern als Unterstützung erhalten.«
»Und darunter sind echt wirkende Blüten?« fragt Partaker.
»Es könnte so sein«, erwidert Frank Gellert ausgedehnt. »Ich hab’ jedenfalls sofort auf Italien als Herkunftsland getippt.«
»Und was fällt dir zu Italien ein, Frankie?«
»Well«, erwidert der Top-Agent vorsichtig, »eine ganze Menge – ich fürchte, das gleiche wie Ihnen, Sir.« Nach kurzer Pause setzt er hinzu: »Ich hab’ die beiden Fünfzig-Dollar-Noten sofort aus dem Verkehr gezogen und die Banker garantiert zum Schweigen gebracht.«
Der Vice-Director lächelt unwillkürlich über Gellerts Formulierung, die nur bedeuten kann, daß er die Leute unter Druck gesetzt oder bestochen hat.
»Die beiden Scheine sind an Sie unterwegs«, fährt der Mann der CIA-Außenstelle fort. »Der Kurier müßte heute noch in Washington eintreffen und Ihnen persönlich die Post übergeben.«
»Bestens.« Partaker zögert kurz. »Sehen Sie eine Parallele zu den gefälschten englischen Banknoten während der letzten Kriegsjahre?«
»Daran hab’ ich ja sofort gedacht«, erwidert der Mann aus Bern.
»Wo war seinerzeit die Fälscherwerkstatt untergebracht?«
»Zunächst … in einem Camp bei Oranienburg, nördlich von Berlin.«
»In der heutigen Sowjetzone«, stellt Partaker fest. »Könnten die Russen auch hier eine faule Erbschaft angetreten haben?«
»Das ist nicht auszuschließen«, entgegnet Gellert vorsichtig. »Eine Möglichkeit. Aber es gibt noch weitere, und eine ist schweinischer als die andere.«
»Gut, Frankie, bleib am Ball! Absolute Priorität! Du hast jede Unterstützung – und dichte diesen Shit ab, das ist momentan das wichtigste.«
Noch kocht das Desaster auf kleiner Flamme, aber wenn es ein Testversuch für Dollarblüten via Schweiz gibt, dann würde der Markt schon in Kürze mit Falschgeld überschwemmt sein. Partaker neigt nicht zur Panik, aber er verfügt über den sechsten Sinn der fünften Kolonne. Schon jetzt liegt die Front der CIA im Osten. Amerika hat gegen Hitler gesiegt und dabei die Sowjetunion groß gemacht. Die Amerikaner zahlten die Kosten; die Russen machten die Beute. Polen, zum Beispiel, die tschechoslowakische Republik, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Litauen, Estland, Lettland und das nördliche Ostpreußen. In Finnland ist der Sowjeteinfluß übermächtig. In Griechenland kämpfen kommunistische Aufständische, unterstützt von roten Anrainern, um die Macht. In Deutschland haben die Russen den alliierten Kontrollrat verlassen und Berlin blockiert. Die Zivilbevölkerung in den Westsektoren und die alliierten Truppen müssen notdürftig über eine Luftbrücke versorgt werden. Riesig ist die Kriegsgefahr, aber während sich in den USA der Präsidentenwahlkampf dem Höhepunkt nähert, ist das mächtige Land fast handlungsunfähig.
Ein Wechsel im Weißen Haus wird allgemein erwartet. Alle Voraussagen deuten auf einen überwältigenden Sieg des Republikaners Thomas E. Dewey gegen den demokratischen Präsidenten Harry S. Truman aus Missouri hin. Selbst seine Freunde und Anhänger würden bei einem Galopprennen eher auf ein dreibeiniges Pferd setzen als auf den automatisch zur Nummer Eins aufgerückten Roosevelt-Nachfolger. Wer immer hinter den dubiosen Dollar-Duplikaten steckt, hat jedenfalls den richtigen Zeitpunkt gewählt für einen Anschlag auf die amerikanische Währung.
Zwei Stunden nach diesem Telefongespräch landet in einer Militärmaschine ein erschöpfter Kurier aus Bern. Er fährt ins Pentagon und ist offensichtlich erleichtert, den Vice-Director Partaker anzutreffen, um ihm einen versiegelten Brief zu übergeben. Der Umschlag enthält zwei Fünfzig-Dollar-Scheine ohne Begleittext; Banknoten mit dem Bild des berühmten US-Generals Grant.
Partaker kann sich die Mühe sparen, sie gründlich zu untersuchen; er verläßt sich auf die Feststellung Frank Gellerts und noch mehr auf die Aussagen schweizerischer Bankexperten. Trotzdem ist eine eigene Laboruntersuchung unerläßlich. Der Vice-Director besorgt sich fünf weitere Fünfzig-Dollar-Noten, mischt die sieben Scheine wie ein Kartenspiel, läßt sie von Spezialisten auf ihre Echtheit prüfen.
Er verfolgt, wie sie unter der Quarzlampe Schein für Schein untersuchen, beobachtet die chemischen Papiertests, den Farb- und Druckvergleich, die Überprüfung von mehr als dreißig Raffinessen, die es unmöglich machen, Dollar-Falsifikate in Umlauf zu bringen, ohne daß die Fälschung – zumindest von Fachleuten – sofort erkannt wird.
»Alle sieben Scheine sind echt«, stellt der Laborleiter nach gründlicher Untersuchung fest. »Das steht außer Frage. Ich kann Sie wirklich beruhigen«, setzt er hinzu, ohne zu ahnen, wie beunruhigend diese Mitteilung für den Vicechef sein muß. »Warum sind Ihnen diese Banknoten eigentlich verdächtig erschienen?«
»I don’t know«, knurrt Partaker. »Vielleicht habe ich geträumt – oder ich werde alt.« Die Grimasse seines zerklüfteten Gesichts soll ein Lächeln sein. »Sagen Sie es bloß nicht weiter, Mann! Es wird sich früh genug herumsprechen.«
Seine Hoffnung, daß keinem der Experten die Nummerngleichheit zweier Scheine auffalle, ist aufgegangen. Partaker nimmt sich vor, seinen Helfern bei Gelegenheit dafür die Leviten zu lesen, in der jetzigen Situation kann er sich zu dieser Nachlässigkeit allerdings beglückwünschen. Selbst im eigenen Haus will er so wenige Mitwisser wie möglich haben.
Am späten Nachmittag ruft ihn Gellert aus Bern noch einmal an. Partaker weiß sofort, was das zu bedeuten hat. Vier weitere Doppelscheine wurden inzwischen gefunden und sichergestellt. Die Wechselstelle liegt wiederum bei einer Außenstelle der Nobis-Bank im Tessin, diesmal in Locarno. »Mit weiteren Funden ist zu rechnen«, schließt der Agent seine explosive Mitteilung. »Es stinkt ganz gewaltig.«
Der CIA-Gewaltige muß sofort handeln. Zunächst unterrichtet er den CIA-Präsidenten über die drohende Blüten-Invasion und zieht offiziell den Fall an sich. Er erhält Vollmacht, unverzüglich Bundesbank und Bundespolizei in die Ermittlungen einzuschalten, falls es notwendig erscheint. Das Federal Bureau of Investigation (FBI) und CIA ziehen am gleichen Strick, doch häufig an verschiedenen Enden. Insofern ist es ein Glücksfall, daß der Leiter des Falschgelddezernats beim FBI, Craig Ginty, ein Gefährte aus alter Donovan-Zeit ist. Ihm kann Partaker vertrauen; zudem wurde Craig von der Bundespolizei vorübergehend an eine Sonderkommission der US-Army ausgeliehen, die feststellen sollte, ob von der Falschgeld-Affäre der Briten auch die amerikanische Währung betroffen sei.
Das kleine italienische Lokal in Georgetown, Ecke 31. und Dumberton Street, ein intimer Familienbetrieb mit vorzüglicher Küche, hat erst vor drei Wochen eröffnet und ist, zum Glück für die Gäste, die hier verwöhnt werden, noch wenig bekannt. James Partaker hat einen Tisch in der Nische reservieren lassen und betritt als erster das Lokal, zwei Minuten vor der verabredeten Zeit. Pünktlich, wie es in diesem Metier Pflicht ist, erscheint sein untersetzter Gast mit dem schütteren Haar und dem runden Gesicht. Ohne lange Begrüßung nimmt er Platz. »Ich hoffe, du hast mich nicht eingeladen«, sagt er beim Hinsetzen, »um einen neuerlichen Abwerbungsversuch zur CIA zu unternehmen, Skinny.«
»Das hab’ ich aufgegeben, Craig. Aber ich erinnere mich, daß wir alte Freunde sind.«
»Kumpane und Komplizen«, schränkt Ginty ein und lächelt mit seinem Faunsgesicht.
»Aber wir sind nicht schlecht miteinander gefahren, oder?« versetzt der CIA-Vice.
Der FBI-Mann nickt zustimmend.
»Wir sollten uns wirklich öfter sehen, Craig …«
»Nichts dagegen«, erwidert der Pausbäckige. »Aber seit wann hast du soviel Zeit?«
»Wir brauchen uns diesbezüglich nichts vorzuwerfen«, erwidert der Gastgeber. »Aber das muß sich künftig ändern. Ich hab’ durch Zufall dieses Lokal entdeckt, und ich kenne deine Vorliebe für italienische Spezialitäten.« Er lächelt süffisant. »Ich will dir unbedingt diese ausgezeichneten Cannelloni auf sizilianisch vorführen, gefüllt mit delikater Geflügelleber, raffiniert gewürzt. Ich wette, du hast noch nie bessere gegessen.«
»Danke, Skinny«, entgegnet der Freund, ein Vielfraß und doch ein Feinschmecker, auch wenn er fürchten muß, daß sich Partakers Delikatessen hinterher wieder auf den Magen schlagen.
Wenn ein FBI-Mitglied und ein CIA-Mann an einem Tisch sitzen, kann man meistens davon ausgehen, daß einer den anderen hereinlegen will. Die Bundespolizei ist bei bestimmten Verbrechen für das Gebiet der Vereinigten Staaten zuständig, der Geheimdienst für das gesamte Ausland. Überschneidungen sind unvermeidbar, Kompetenzgerangel ist an der Tagesordnung. Das FBI hält sich zugute – nicht ganz zu Unrecht – daß es 23 Jahre älter ist als die Agency, in der alle bisherigen US-Geheimdienste unter einen Hut gebracht wurden.
Solcherlei Schwierigkeiten gibt es zwischen Partaker und Ginty nicht. Der CIA-Mann hatte seinen Kumpel während des Zweiten Weltkriegs in Jugoslawien durch einen verzweifelten Fallschirmeinsatz herausgeholt, als serbische Cetnici begonnen hatten, ihn zu Tode zu foltern. Ein knappes Jahr später konnte sich der heutige FBI-Spezialist dafür revanchieren, als er den total erschöpften und zum Skelett abgemagerten Partaker aus einer Falle in Oberitalien befreite. Seitdem hat der CIA-Vice den Spitznamen Skinny, der Hautige, aber nur ganz wenige Vertraute dürfen ihn so nennen.
Der Padrone serviert die Cannelloni selbst; sie halten, was der Gastgeber versprochen hat. Dazu gibt es einen rubinroten, mindestens drei Jahre alten Chianti vecchio, eine Rarität in einem Land, in dem weit mehr Whisky getrunken wird als Rotwein.
»Als Hauptgericht habe ich noch herrliche Kalbsmedaillons in Vernaccia mit Reistörtchen in Norcia-Trüffeln geordert«, verheißt der Gastgeber.
»Slow down«, erwidert Ginty lachend, »so weit sind wir noch nicht.« Er verlangt zum Entzücken des Padrone in italienischer Sprache noch eine halbe Portion Cannelloni, ißt mit verklärtem Gesicht und schnalzt anerkennend nach jedem Schluck Chianti.
Partaker verfolgt belustigt, wie er den alten Gefährten genau in die Stimmungslage versetzt, die er beim Dessert zerstören muß. Im Rahmen der Nachrichten bringt das Radio halblaut eine Wahlkampfübertragung. Wieder schlägt Harry S. Truman, der kleine Mann im Weißen Haus, nach allen Seiten wild um sich, weder mit Beleidigungen noch Kraftausdrücken sparend, trifft er auch unter die Gürtellinie, wenn er gegen seinen Rivalen Thomas Dewey loszieht.
»Give them the hell, Harry« schreien rasende Parteigänger, aber alle Vorzeichen deuten darauf hin, daß ihm eher der Gegenkandidat die Hölle heiß machen wird.
»Truman hat keine Chance«, stellt der FBI-Dezernent zwischen Vorgericht und Hauptgang fest. »Eigentlich schade. Er machte gar keine so schlechte Figur, als er den politischen Schutt seines Vorgängers auf die Seite räumen mußte.«
»Richtig«, bestätigt Partaker. »Dabei war er von Roosevelt von allen wichtigen Entscheidungen ausgeschlossen gewesen. Truman wußte nicht einmal etwas über das ›Manhattan-Projekt‹.«
»Was ihn nicht hinderte, die Atombombe dann gegen die Japaner einzusetzen«, erwidert Ginty und fährt sich mit der Hand durch die schütteren Haare.
»Um – wie er erklärte – durch ein rasch herbeigeführtes Kriegsende das Leben zahlloser Amerikaner und Japaner zu schonen«, stellt der CIA-Vice fest.
»Politiker und Militärs berufen sich immer auf die Menschlichkeit«, versetzt Ginty mit vollem Mund und faulem Lächeln, »wenn sie befehlen, im Hunterttausend zu töten.« Einen Moment lang droht seine gute Laune zu kippen, aber die Medaillons sind im Anmarsch, und der Wirt bestätigt, daß ihm der Chianti vecchio so schnell nicht ausgehen wird.
Zwischendurch kommt Partaker behutsam zur Sache: »Hatte man dich nicht nach dem Krieg vorübergehend vom FBI als Flaschgeldspezialist an eine Sonderkommission der US-Army in Europa ausgeliehen?«
»Zusammen mit Herbie Miller. Weißt du, daß er vor ein paar Monaten tödlich verunglückt ist?«
»Ich hab’ davon gehört …«
»Es war damals eine irrsinnige Geschichte …« Partaker braucht den Freund nicht zu nötigen; er spricht bereitwillig über das Abenteuer seines Lebens. »Die letzten Kriegstage waren angebrochen. Unsere Panzerspitzen hatten bereits Salzburg erreicht und stießen in Richtung Steiermark vor. Nur die Staus auf den Straßen hielten sie vorübergehend noch auf. Von der anderen Seite kamen die Russen. Die ›Festung Alpenland‹, ohnedies nur ein Bluff, war bis auf ein paar Quadratkilometer im Ausseer Land zusammengeschrumpft.« Er inhalierte eine Zigarette, ohne sie anzuzünden. »Der Sieg war gelaufen, da geschah etwas völlig Verrücktes: Der letzte Rest des Dritten Reiches war auf einmal mit britischen Pfundnoten aller Nennwerte übersät, die, wie Manna vom Himmel gefallen waren. An der Oberfläche des Toplitzsees standen sie dicht wie Seerosen: Fünf, zehn, fünfzig, hundert, fünfhundert und tausend Pfund Sterling Scheine. Britische Banknoten trieben die Enns hinab, den Russen und der Donau entgegen. Es verbreitete sich das Gerücht, daß es sich um ausgelagerte Devisen-Bestände der Deutschen Reichsbank handele; und nun wurde Fischen zum Volkssport: Kinder sprangen ins kalte Wasser, Hausfrauen warteten mit Eimern an den Ufern. Die Schatzsucher standen oft schon in den nächsten Ortschaften bereit, bevor das Strandgut herangetrieben wurde. Die Gier explodierte, Hunger, Not, Zukunftsangst und Vergangenheitsscham waren vergessen. Kinder, Frauen, Greise füllten sich die Taschen, als könnten sie sich mit den erbeuteten Scheinen in Siegerwährung von allem freikaufen. Auch Soldaten der Roten Armee betätigten sich als Goldgräber, wurden zu Kapitalisten, Habenichtse als Millionäre für zwei, drei Tage …«
»Und das waren alles Blüten?«
»Klar, aber nicht zu unterscheiden von echten Pfundscheinen. Die Briten wußten das seit längerem; sie hatten sehnlichst auf das Kriegsende gewartet, um das schon seit Monaten gedruckte neue Geld auszugeben und den Währungsspuk dadurch zu beenden.«
»Wann haben uns die Engländer über diese Schweinerei informiert?« fragt Partaker.
»Eigentlich überhaupt nicht«, erwidert der FBI-Spezialist. »Genaugenommen haben wir sie auf den Blütenregen zwischen Salzkammergut und Steiermark aufmerksam gemacht«, erinnert sich Ginty. »›Unternehmen Bernhard‹ hatten die Nazis die großangelegte Fälschungsaktion genannt: Englische Pfundnoten hatten als ebenso fälschungssicher gegolten wie unsere Greenbacks. Auf einmal stellte sich heraus, daß von Italien aus via Schweiz und über andere neutrale Länder Millionen wenn nicht Milliarden Pfundblüten aller Größenordnungen vertrieben wurden, ohne daß einer die Fälschung erkannt hätte.«
»Wieso das?« fragt Partaker, als wüßte er es nicht.
»Sie waren nicht von gewöhnlichen Falschmünzern hergestellt worden, sondern von sorgfältig ausgebildeten, mit allen technischen Mitteln unterstützten Staatsfälschern. Jedenfalls hat sich dieser kriminelle Schachzug für die Insel als gefährlicher erwiesen als der V-Waffen-Beschuß.«
»Die Engländer hatten also bis Kriegsende dichtgehalten?«
»Und wie«, antwortet der Falschgeldexperte. »Darum waren wir Amerikaner ja so sauer auf sie, denn durch ihr Schweigen hatten sie auch unsere Währung gefährdet.« Sein Zorn scheint sich bis jetzt noch nicht gelegt zu haben. »Die deutschen Falschgeldagenten hatten die Blüten von einem Schloß in Südtirol aus über die Schweiz und andere neutrale Länder in Umlauf gebracht und damit ihre Auslandsspionage und Waffenkäufe finanziert. Von Versicherungsmathematikern waren die Seriennummern sorgfältig vorausberechnet worden. Vermutlich wären die Fälschungen von den Engländern noch lange nicht entdeckt worden, wenn ihre Auftraggeber nicht aus Geldgier auch Makulatur an den Mann gebracht hätten, die natürlich bald auffiel.«
»Und warum haben die Tommies nicht sofort gehandelt?«
»Die Bank of England war in einer Zwangslage; sie mußte dichthalten und zähneknirschend für das Falschgeld geradestehen, um einen Zusammenbruch der britischen Währung zu vermeiden. Unter äußerster Geheimhaltung waren neue Banknoten entworfen und gedruckt worden. Unmittelbar nach Kriegsende verfielen schlagartig alle englischen Banknoten bis auf die noch benötigten Fünf-Pfund-Scheine. Alle anderen Pfundnoten wurden ausgetauscht; wer am Schalter erschien, um das neue Geld einzuwechseln, mußte eine gründliche Untersuchung über die Herkunft der alten Pfundnoten über sich ergehen lassen.«
»Gleichzeitig wurde eine US-Sonderkommission gebildet um festzustellen, ob die Deutschen auch Dollarnoten gefälscht hatten, stimmt’s?«
»That’s right«, bestätigt Ginty. Er verstummt, als der Kellner an den Tisch kommt und eine spezielle Tiramisù als Nachtisch anbietet. Partaker winkt ab; seinem Gast fällt die Entscheidung schwer, aber da ihm der Rotwein mundet, verzichtet er auf die Süßspeise und ordert Bel Paese und etwas Mascapone. »Tatsächlich hatte das Reichssicherheitshauptamt (RSHA) nach der Kriegserklärung Hitlers an Amerika im Dezember 41 den Befehl ausgegeben, sofort und mit höchster Beschleunigung nach dem Muster der Pfundnoten US-Dollar-Blüten herzustellen. Die Fälscher wurden eingearbeitet; die Erfahrungen kamen ihnen zugute. Trotzdem brauchten sie bis kurz vor Kriegsende, um Lardos«, – der FBI-Gewaltige benutzt den Ganovenausdruck für gefälschte Dollarscheine –, »zu fertigen, die selbst Fachleute nicht von echten Greenbacks unterscheiden konnten. Zum Glück war es zu spät; die Flaschgeldlawine kam nicht mehr ins Rollen.«
»Bist du sicher, Craig?«
»Die Sonderkommission hat sehr gründlich gearbeitet. Während und nach der Untersuchung ist nicht eine einzige Dollar-Blüte aufgetaucht.«
»Und die Druckstöcke, und das Papier, die Pressen …?«
»… wurden von den Deutschen in den letzten Kriegstagen beseitigt oder vernichtet.«
»Und die Fälscher?«
»Die liefen schnellstens auseinander – in ihre Heimatländer zurück.«
»Auch in die Länder des Ostblocks?« fragt Partaker.
»Auch das. Die meisten hatten sich bereits auf die Sokken gemacht, bevor wir von dieser Falschgeldaffäre überhaupt etwas erfuhren. Soweit wie möglich haben wir sie auch wieder eingesammelt und vernommen.«
Partaker nickt: »Wie penibel seid ihr vorgegangen?«
»Es wurde nichts versäumt. Was überhaupt möglich war, geschah. Inzwischen sind fast drei Jahre vergangen, und noch immer sind diese Nazi-Lardos nicht aufgetaucht. Vielleicht war es gar nicht so falsch, den Fall ad acta zu legen.«
»Oder doch«, erwidert der CIA-Vice, nunmehr bereit, einen unbekömmlichen Nachtisch zu servieren. Die Gäste im Lokal sind weit genug vom Tisch entfernt und mit kulinarischen Finessen beschäftigt; Partaker entnimmt seiner Brieftasche zwei Fünfzig-Dollar-Duplikate. »Sieh dir das an, Craig«, sagte er. »Sorry, wenn es sich dir auf den Magen schlägt …«
Der Feinschmecker und Falschgeldbekämpfer betrachtet die Banknoten zuerst verständnislos, dann verändert sich schlagartig sein rundes Gesicht; es wirkt auf einmal kantig. Der Haut spannt sich über die Backenknochen. Der FBI-Falschgelddezernent zieht eine Lupe aus der Tasche. »Dear me«, murmelte er betroffen, wendet die Scheine und untersucht die Rückseite: »Deine Delikatessen sind doch immer vergiftet. Wo hast du diese Fünfziger her, Skinny?«
»Aus der Schweiz«, antwortet er. »Vermutlich kommen sie aus Italien.«
»Wieviel wurden sichergestellt?« fragt er hastig.
»Seit heute nachmittag sind es fünf; aber ich fürchte, sie werden sich bald wie Filzläuse vermehren.« Sein Gesicht zuckt stumm. »Vielleicht habt ihr doch nicht gründlich genug ermittelt«, sagt Partaker; es klingt, als hätte er Sand zwischen den Zähnen.
»Chickenshit!« flucht Ginty.
»Wer hat eigentlich die Sonderkommission damals geleitet?« fragte der CIA-Vice dann.
»CIC-Captain Robert S. Steel.«
»Wo ist er jetzt?«
»Soviel ich weiß, noch immer bei der US-Army in Germany. Der Mann ist erste Wahl«, behauptet Ginty. »Einer, der sein Fach versteht; er hat vor seiner Einberufung zur Armee als junger Anwalt für die US-Bundespolizei gearbeitet zur vollsten Zufriedenheit auch hier.«
»Und sonst?«
»Was meinst du damit?«
»Irgendwie hat doch jeder Mensch Schwächen.«
»Na ja«, sagt der FBI-Spezialist nach einigem Nachdenken. »Bob Steel trank gelegentlich ein bißchen viel; er war überhaupt kein Freund von Traurigkeit und hinter den Mädchen her wie der Windhund hinter dem falschen Hasen. Aber das kannst du mir glauben, Skinny, wenn es darauf ankommt, ist er trocken wie ’ne alte Jungfer und konzentriert wie ein Profiboxer. Er ist auch alles anderes als ein Pedant. Verstehst du, wenn er mit den Dienstregeln nicht weiterkommt, dann pfeift er eben darauf und findet sich zurecht.«
»Du meinst, Vorschriften stören ihn nicht?« fragt Partaker.
»So wenig wie dich und mich«, versetzt der Falschgelddezernent der Bundespolizei mit seinem faunischen Grinsen.
»Also ein Mann, der sich auf allen Wegen zurechtfindet?«
»Weiß Gott.« Ginty nickt. »Zuerst, als der Armee die Angst vor Lardos aus Deutschland noch im Nacken saß, konnte Steel schalten und walten, wie er wollte; das hat er auch reichlich genutzt.«
»Für sich?«
»Für seine Arbeit«, entgegnet der FBI-Spezialist.
»Kommt ein Mann nicht automatisch in Gefahr, wenn er unbeschränkt Vertrauensspesen erhält und wenn durch seine Hände Millionen – vielleicht noch mehr – gehen?«
»Ich habe niemals festgestellt, daß etwas zwischen seinen Fingern hängengeblieben wäre.«
»Du hast drauf geachtet?«
»Ich war sein Helfer, nicht sein Aufpasser«, versetzt der FBI-Mann gereizt. »Aber ein Kriminalist, der etwas taugt, ist immer auf dem Quivive. Und was hätte Steel mit ein paar Millionen Pfundblüten, die zwei, drei Tage später außer Gültigkeit gesetzt wurden, am Ende der Welt anfangen sollen?«
»Das klingt einleuchtend«, entgegnet Partaker und setzt wie entschuldigend hinzu: »Wenn ich an einen Fall gehe, fange ich meistens bei Adam und Eva an.«
»Nach sieben Monaten wurde die Sonderkommission gegen unseren Protest aufgelöst«, fährt Ginty fort. »Man hat mich in die Staaten zurückgeholt. Bis zu diesem Zeitpunkt, dafür verbürge ich mich, arbeitete Steel bravourös.«
»Warum ließ man euch nicht weitermachen?«
»Shit army«, erwidert der Mann, der dabei gewesen war. »Ein Anfall von Sparsamkeit. Militärs sind keine Fachleute. Sie werden sofort ungeduldig, wenn es nicht schnell genug geht. Du weißt doch wie sie sind, Skinny: Zielen, Finger am Abzug, ratsch! bum! Und der Fall ist erledigt. Und ein CIC-Captain kann gegen einen Generalentschluß wenig ausrichten – und Dollar-Lardos waren ja auch nicht gefunden worden. Steel wies energisch auf die begründete Vermutung hin, daß die Dollar-Druckstöcke und das wasserdicht verpackte Papier im Toplitzsee lägen und von jedem dort herausgeholt werden könnten. Das kannst du in den Akten nachlesen. Im Pentagon. Verwahrt unter Geheimverschluß, Sonderstufe I, und das heißt, daß man sie nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verteidigungsministers einsehen kann.«
Sie nehmen noch einen Kaffee. Partaker zahlt, dann fahren beide ins Pentagon, der CIA-Vice am Steuer. Dichter Regen prasselt gegen die Windschutzscheibe, fegt die Straßen leer, treibt die Passanten in ihre Häuser, die, falls nicht rechtzeitig Abhilfe geschaffen wird, ihre Dollars mit spitzen Fingern anfassen werden: echt oder falsch? Das wäre die Frage.
1948 hat Amerika noch Goldwährung; die Staatsbank garantiert, daß der Nennwert jederzeit in das Edelmetall umgetauscht werden kann. Wenn plötzlich weit mehr Papier im Umlauf ist als Gold in Fort Knox vorhanden, droht dem reichsten Land der Welt ein Kollaps, ein zweiter Schwarzer Freitag mit Panik, Konkursen, Bankpleiten, Selbstmorden und Arbeitslosigkeit.
Der Wagen hat das berühmte Fünfeck erreicht, die späten Besucher hasten stumm über den Gang.
»Moment«, entschuldigt sich der CIA-Vice bei Ginty und gibt in seinem Vorzimmer Anweisung, den CIC-Captain Steel ausfindig zu machen und alles auszugraben, was über ihn und seine Lebensweise zu erfahren ist; dann läßt er den Verteidigungsminister suchen. Obwohl der Politiker immer erreichbar sein muß, gelingt es nicht auf Anhieb, ihn zu finden.
Partaker fläzt sich in seinen Sessel, legt die Beine auf den Schreibtisch und übt sich in Geduld. Endlich erreicht ihn die Nachricht, daß der Secretary of Defence auf einer der zahlreichen Washingtoner Partys aufgestöbert wurde.
Partaker und Ginty erscheinen als ungeladene Gäste in unpassender Kleidung; sie werden in die Bibliothek komplimentiert.
»Wie denn«, staunt der Ex-General nach der Begrüßung, »FBI und CIA Arm in Arm?«
»Wir müssen das Dossier der Steel-Kommission einsehen, und zwar gemeinsam«, schießt Partaker los.
»Warum?«
»Das kann ich Ihnen erst hinterher erklären, Sir«, erwidert Partaker. »Die Sache ist unumgänglich und brandeilig.«
»Nicht so schnell«, entgegnet der hohe Politiker. »Nun haben Sie mir schon den Abend verdorben, da können Sie auch ein bißchen deutlicher werden.«
»Vielleicht nur blinder Alarm, Sir«, beschwichtigt ihn der CIA-Vice, wiewohl längst Feuer unter dem Dach ist. »Wenn nicht, erhalten Sie als erster die Hiobsbotschaft.«
Auch der Aktenraum ist Tag und Nacht besetzt. Ein griesgrämiger Colonel prüft die Unterschrift gleich dreimal, schüttelt den Kopf. »Keines dieser Dossiers darf den Raum verlassen«, sagt er. »Ich stelle Ihnen zwei Schreibtische hinein und einen Posten vor die Tür.«
»Von mir aus zwei«, brummelt Partaker und wird Minuten später mit einem Berg Akten konfrontiert. »Heavens«, ächzt er. »Wo fangen wir an?«
»Mit dem Schlußbericht«, erwidert Ginty. »Wir werden nicht darum herumkommen, uns durch den ganzen Teig hindurchzufressen, aber ich pick’ dir zunächst mal die Rosinen heraus.« Er schlägt Steels Zusammenfassung auf, überfliegt den Text: »Also«, beginnt er, »Himmlers Reichssicherheitshauptamt hatte bereits vor dem Krieg eine hervorragende Fälscherzentrale unterhalten. Die ersten Falsifikate waren Pässe, Visa, Urkunden und Schriftstükke. Dabei wurde ein angeblicher Briefwechsel des Sowjetmarschalls Tuchatschewkij in Berlin hergestellt, auf den Stalin voll hereinfiel. Tausende sowjetischer Offiziere wurden liquidiert, etwa zehn Prozent des ganzen Führungskaders der Sowjetunion kaltgestellt, gerade noch rechtzeitig vor dem Überfall Hitlers auf Rußland.« Craig Ginty blickt einen Moment von den Akten auf. »Die Leute müssen ihr krummes Handwerk verstanden haben.«
»Weiter«, drängt Partaker.
»Anfang 1939 haben sie eine Crew von Papiergeld-Spezialisten aufgestellt, teils einschlägig vorbestrafte Häftlinge, aber auch Bankfachleute, Chemiker, Wissenschaftler, Papieringenieure, die zwar in Klausur arbeiten mußten, aber in Freiheit blieben. Insgesamt etwa zweihundert Mann. Diese Mannschaft benötigte, unterstützt mit allen Hilfsmitteln, über vier Jahre, um perfekte Scheine zu liefern. Die Schwierigkeiten waren ungeheuerlich. Mit den Gravuren, der Schrift, der Farbe und den Klischees sowie den drucktechnischen Raffinessen kamen die Falsifikateure schließlich zurecht, aber das Papier blieb ein unlösbares Problem. Seine Grundsubstanz, Hadern genannt, eine spezielle Art von Lumpen, war in Deutschland weder aufzutreiben und deshalb auch nicht nachzumachen. Erst als man diese Hadern unter größter Geheimhaltung aus der Türkei einführte, kam man weiter. Nun blühte das Geschäft dermaßen, daß Himmler schon davon träumte, Abermillionen von Pfundnoten über der Insel abzuwerfen, um die Briten wirtschaftlich zu ruinieren.« Ginty lächelt schief. »Das scheiterte zum Glück schon daran, daß zu diesem Zeitpunkt deutsche Flugzeuge wenig Chancen hatten, heil über den Kanal zu kommen. Aber die Leute von Oranienburg, in der Nähe von Sachsenhausen, druckten nach unseren Feststellungen dreihundertfünfzig Serien mit je hunderttausend Einzelnummern zwischen Fünf- und Tausend-Pfund-Noten. Diese Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, weil uns die Tommies nicht alles auf die Nase gebunden haben. Angeblich sind die beiden höchsten Nennwerte nicht mehr in Umlauf gekommen.« Er unterbricht seine Erklärungen. »Ist doch klar, Skinny – wir kommen nicht darum herum, den US-Präsidenten zu informieren.«
»Welchen?« fragt Partaker. »Truman in dieser Woche – oder Dewey in der nächsten?«
»Wenn’s sein muß, beide«, entgegnet Ginty. »Kein Aufschub möglich – kein normaler Krimineller könnte solche Lardos herstellen.«
»Da bist du ganz sicher, Craig?«
»Absolut. Ich bin absolut davon überzeugt, daß es sich bei diesen Lardos um eine Nazierbschaft handelt. Jeder Fälscher macht bestimmte Fehler, läßt dadurch seine Handschrift erkennen. Die Handschrift dieser Falschmünzer ist, wie seinerzeit bei den Pfundnoten, daß ihnen keinerlei Abweichungen unterlaufen. Gut, Skinny, daß du dich sofort an mich gewandt hast.« Sein Lächeln verunglückt. »Du hättest dir die Cannelloni sparen können, so gut sie waren. Aber ich hab’ so eine Vorahnung, daß sie mir bald wieder hochkommen.«
»Bedauerlich«, erwidert der CIA-Gewaltige ohne Bedauern.
Er verfolgt stumm, wie Ginty die nächsten Seiten des Schlußberichts überfliegt und dabei mehrmals mit dem Kopf nickt, als erinnere er sich jetzt wieder der Einzelheiten.
»Ich fasse zusammen, Skinny«, sagt er dann. »Kurz vor Kriegsende – die Russen näherten sich bereits Berlin – wurde aus Sicherheitsgründen die gesamte Fälschergruppe von Sachsenhausen nach Redl-Zipf bei Vöcklabruck in Oberösterreich verlegt, um dort so lange wie möglich weiterzuarbeiten. In einer stillgelegten Brauerei ließ sich die Abschottung der einzelnen Abteilungen nicht mehr so exakt einhalten wie in einem KZ; es gab Kontakte mit Geldkurieren und anderen RSHA-Besuchern. Die Häftlinge wußten oder ahnten, daß sie vor dem Anrücken der Amerikaner erschossen werden sollten. Auch ihre Bewacher hatten jeden Grund, die Zukunft zu fürchten. So saßen also Todfeinde in gemeinsamer Angst in einem Boot.
Die Machtzentrale des Dritten Reiches, das Reichssicherheitshauptamt, war von der Berliner Prinz-Albrecht-Straße in die eineinhalb Zimmer eines umgebauten Kuhstalls des Prinzen Hohenlohe in Altaussee geschrumpft. Sie bestand aus dem SS-Obergruppenführer Kaltenbrunner, einem Telefon und einer Mätresse. Aber die Befehle des mächtigsten Mannes nach Himmler wurden noch immer weitgehend befolgt. Er beorderte den SS-Sturmbannführer Müller-Malbach zu sich, beauftragte ihn, die Falschgeldfabrik in Redl-Zipf zu schließen. Maschinen und Blüten zu vernichten und alle Spuren des ›Unternehmens Bernhard‹ zu beseitigen. Der SS-Major erschien am Schauplatz, präsentierte seine Sondergenehmigung, ließ die Pressen zerstören und Druckstöcke, Papier sowie die beträchtlichen Geldreserven auf sieben Lastwagen verladen. Die erste Panne passierte noch in Redl-Zipf, als die Blüten zweiter Wahl verbrannt werden sollten: Der Wind trieb sie über die Felder, und die Bauern hatten eine seltsame Frühjahrsbestellung …«
Partaker hört konzentriert zu. Er zügelt seine Ungeduld, schneller kann man ihm die Zusammenhänge nicht erläutern.
»Die Kolonne rollt in Richtung Toplitzsee, um dort die brisante Fracht zu versenken. Am Steilufer der Enns blieb der erste Laster mit gebrochener Achse liegen. Bevor Bewacher und Häftlinge in verschiedene Richtung auseinanderstoben, warfen sie noch gemeinsam die Kisten mit der Blütenpracht in den Fluß, der Hochwasser führte. Die Behälter zerschellten am felsigen Ufer, und so kam die erste wunderbare Pfundvermehrung zustande. Die Hauptkolonne war inzwischen weitergerollt. Wann immer sie hielt, gingen abwechselnd Bewacher und Häftlinge stiften; fuhr der SS-Major an der Spitze, folgte ihm die Kolonne in den berstenden Straßen nicht; bildete er das Schlußlicht, türmten die vorderen um die Wette. Schließlich hatte er nur noch drei Lastwagen, aber nur zwei erreichten am Ende den Toplitzsee, und ihre Fracht wurde dort, wie Zeugen beobachteten, auf Grund gesetzt. Die Fahrt der anderen vier Laster konnten wir so nach und nach rekonstruieren: Alle waren in Seen oder Flüssen gelandet …«
»Was ist aus diesem Sturmbannführer Müller-Malbach geworden?«
»Den haben wir geschnappt und bis zum Geht-nicht-Mehr ausgepreßt. Übrigens suchten ihn auch die Russen oder Polen.«
»Wurde er ausgeliefert?« fragt Partaker erregt.
»Das weiß ich nicht«, erwidert Ginty.
»Das hätte uns noch gefehlt«, entgegnet der CIA-Vice.
Er steht auf, läuft erregt im Raum auf und ab wie in einem Käfig. Dann legen die beiden eine kurze Pause ein, gehen in Partakers Büro zurück, trinken Kaffee und stellen fest, daß die CIA-Leute verblüffend rasch gearbeitet hatten.
Auf einmal ist auch Worthmiller, der persönliche Referent, zur Stelle, wiewohl er heute frei hat. Er ist jung, ehrgeizig, auf dem Sprung wie ein Jagdhund, der sich das Hecheln abgewöhnt hat, einer der neuen Leute, die sich der Drahtzieher der unsichtbaren Front herangezogen hat.
»Der Personalakt Captain Steels liegt vor«, schießt Partakers Referent los. »Der Mann ist 34, kommt aus Tucson in Arizona, ist aber in New York aufgewachsen. Sein Großvater, ein Österreicher, wanderte um die Jahrhundertwende nach Amerika ein. Steels Vater war ein gefragter Architekt, seine Mutter ist geborene Schweizerin. Die Eltern sind früh gestorben und haben ihrem Sohn ein beträchtliches Vermögen hinterlassen …«
»Was heißt das?« unterbricht ihn Partaker unwirsch. »Ich will wissen, wieviel es war, genau auf Dollar und Cent, Worthmiller!«
»50 000 Dollar in Wertpapieren, etwa 30 000 Dollar in bar und Grundstücke und Immobilien im Wert von mindestens 200 000 Dollar.« Der Gerügte wirft die Informationen aus wie ein Automat die Münzen.
Partaker nickt befriedigt, weniger weil Captain Steel betucht ist, sondern weil seine Leute so präzise recherchiert haben.
»Steel arbeitete zunächst als junger Anwalt in New York, wurde dann zur Armee eingezogen und wegen besonderer Tapferkeit vorzeitig zum Offizier befördert. Er war an dem Handstreich auf die Brücke von Remagen beteiligt und erhielt dafür den ›Silverstar‹.«
»Weiter!« drängt der CIA-Vice.
»Er spricht hervorragend Deutsch und Italienisch; deshalb wurde er aus der Kampfgruppe herausgezogen und dem CIC-Geheimdienst der Armee zugeteilt. Als damals die Pfundnoten auftauchten, avancierte er sofort zum Leiter einer Sonderkommission …«
»Und wo ist der Mann jetzt?«
»In Urlaub«, entgegnete Worthmiller, »und zwar in der Schweiz, Zürich, Hotel ›Zum Storchen‹. Er wird von dort nach New York fliegen, um offiziell – unter Beförderung zum Major – aus der US-Army entlassen zu werden.«
»Sorgen Sie dafür, daß dieser Akt nicht in New York, sondern in Washington stattfindet«, ordnet der CIA-Vice an. »Und sehen Sie zu, daß der Minister of Defence die Zeremonie nach Möglichkeit mit einigen anderen Offizieren persönlich vornimmt – und daß wir zu einem anschließenden Lunch eingeladen werden.«
»Respekt, Skinny«, sagt der FBI-Dezernent anerkennend. »Du hast wirklich noch nichts verlernt.«
Bevor sie in den Aktenraum zurückkehren, ruft Partaker seinen Mann in Bern an und reißt ihn aus dem Schlaf: »Listen, Frank«, sagt er, »Im Hotel ›Zum Storchen‹ in Zürich ist CIC-Captain Steel – vom Headquarters in Frankfurt – abgestiegen.«
»Den kenne ich«, erwidert Gellert rasch. »Der Mann ist – er ist …«
»Spitze«, unterbricht ihn der CIA-Vice unwillig. »Dann weißt du auch, daß du verdammt vorsichtig sein mußt. Ich möchte, daß du Steel nicht aus den Augen läßt. Er darf es unter keinen Umständen merken; ich will nicht, daß man ihn verärgert. Also, denk dir aus, wie du das anstellst, Frank!«
»Was wollen Sie eigentlich von ihm, Sir?«
»Fragen stelle ich«, erwidert Partaker arrogant und legt auf.
Der Posten steht immer noch vor dem Dokumentenraum; einen Moment lang sieht der CIA-Vice an der endlosen Aktenreihe entlang und schüttelt ungläubig den Kopf.
»Jedenfalls siehst du, daß wir nicht geschlafen haben«, stellt Ginty fest, greift wieder nach dem Schlußbericht und erklärt Zusammenhänge. Weder in dieser noch in den nächsten Nächten ist an Schlaf zu denken.
Der Passagier kommt aus Zürich, ein US-Offizier, der wie ein Zivilist wirkt und mehr einem Europäer als einem Amerikaner gleicht. Jedenfalls hat er sich auf dem Kontinent vorzüglich akklimatisiert; er trägt einen tadellos geschnittenen Sportsakko zur Hose mit scharfen Bügelfalten. Die Haare sind länger, als sie die Yankees sonst tragen.
Der Reisende wirkt nicht wie ein Stutzer, doch wie ein Mann, der auf sein Äußeres bedacht ist. Von London aus will er mit der ›Super Constellation‹ nach New York weiterfliegen. Die Reise mit der Viermotorigen wird sich bis morgen hinziehen, aber ein künftiger Globetrotter muß sich daran gewöhnen, viel Zeit zu haben. Der Flug über den Atlantik von der Alten in die Neue Welt ist zwar kein Abenteuer mehr, aber durch die Zwischenlandungen noch immer umständlich und zeitraubend.
»Thank you, Mr. Steel«, sagt die Uniformierte am Abfertigungsschalter der Fluglinie höflich und schiebt dem Überseereisenden das Ticket wieder zu. »Have a good flight.«
Der Mann im sportiven Reisedreß nickt lächelnd, geht durch den Zoll und dann sofort an die kleine Bar. Für den Kaffee ist es zu spät, für den Whisky noch zu früh, doch in solchen Fällen entscheidet sich der Captain der US-Army meistens für einen Bourbon, einen doppelten. Leber und Geldbörse gestatten ihm das ohne weiteres, und künftig wird nicht schon am frühen Morgen ein mißtrauischer Colonel nach einer möglichen Alkoholfahne schnuppern. Der Demobilisierte ist entschlossen, sich jetzt auf die Fahne der Lebenslust einschwören zu lassen.
Er stellt sein Bordcase ab, läßt es aber nicht aus den Augen, so, als enthielte es ein wertvolles Mitbringsel für Mrs. Steel – doch eine solche gibt es nicht. Die elegante Flugtasche birgt nur Geld, Dollars, allerdings in ungewöhnlicher Menge.
Der Mann, der jetzt über die Bodentreppe geht, ist einen Meter achtzig groß, hat ein schmales intelligentes Gesicht, das einmal geordnet werden müßte, eine hohe Stirn, selbstsichere Augen und Geld wie Heu. Er ist bester Laune, denn er sieht seine Zukunft mit Annehmlichkeiten aller Art tapeziert. Er lächelt fröhlich wie der Junge auf der Zahnpastareklame. Eigentlich ist Robert S. Steel noch immer Offizier der US-Army und müßte auf einem dichtbesetzten Truppen-Transporter die Heimreise antreten, aber er hatte noch ein paar Wochen Urlaub gut und sich entschlossen, auf eigene Kosten und in ziviler Gelassenheit in die Staaten zurückzufliegen. Fünf Jahre Militärzeit sind schließlich genug; die Uniform wird er nur noch ein einziges Mal anlegen: bei seiner offiziellen Verabschiedung.
Der Heimkehrer verstaut sein Handgepäck vorsichtig, als enthielte es blattfeines Porzellan. Dann überfliegt er lustlos die Schlagzeilen der ›New York Times‹. Professor George Gallup, der Erfinder und Papst der Demoskopie – er verkauft seine Vorhersagen an 162 Zeitungen –, prophezeit als Ausgang der US-Präsidentenwahl eine vernichtende Niederlage für Harry S. Truman. Der Ex-Captain zeigt für diese Prognose nur mäßiges Interesse. Zwar gab es in seinem Leben einmal einen Zeitpunkt, zu dem er überlegte, ob er nicht in der Demokratischen Partei eine Karriere anstreben sollte; inzwischen aber hält er Politik für eine Disziplin von Selbstdarstellern, Illusionisten, Lügnern und Gauklern. Für die Kunst des möglichen Profits. Es hindert ihn aber nicht daran, die Rivalen Truman und Dewey gleichermaßen zu schätzen; den amtierenden Präsidenten, weil er den Augiasstall seines Vorgängers rasch gesäubert, Dewey, weil er sich als Generalstaatsanwalt beim Kampf gegen die Mafia besonders ausgezeichnet hatte, und das zu einer Zeit, in der FBI-Chef Hoover noch immer behauptete, in Amerika gäbe es kein organisiertes Verbrechen; dabei lagen in den obskuren Vierteln New Yorks die Leichen erschossener Gangster auf den Straßen herum wie Müll.
Die Meldung, die er auf der nächsten Seite unter ›Vermischtes‹ findet, amüsiert ihn: Im Vergnügungspark der schwedischen Stadt Göteborg, einem bevorzugten Tummelplatz für Liebespaare, waren nach Abschluß der Sommersaison bei der Herbstreinigung einige hundert Eheringe gefunden und nicht abgeholt worden. Schwerenöter, nicht treu wie Gold, verfügen meistens über genügend Geld, um sich neue Eheringe anzuschaffen. Meistens gilt: Wer arm ist, bleibt auch treu.
Zwei Reihen vor ihm schlichtet die Stewardeß den Streit um einen Fensterplatz. Sie hat eine angenehme Stimme, stammt offensichtlich aus New England. Steel beugt sich nach vorn, bekommt aber nicht viel von ihr zu sehen, nur schmale Fesseln und prächtig gewachsene lange Beine in dunkelblauen Nylons. Diesmal kann er nichts dafür, doch sonst ist sein erster Blick auf Frauen und Mädchen oft peinlich beinlich. Er möchte die ganze Bordfee inspizieren, aber sie ist noch immer beschäftigt und es ist mehr von ihr zu hören als zu sehen. Als sie sich Steel schließlich zuwendet, macht er sich klar, daß er ihre Beine mindestens fünf Minuten länger kennt als ihr Gesicht, das ihn keineswegs enttäuscht. Es wird von brünetten Haaren umrahmt. Die Hochgewachsene hat helle Augen und lustige Grübchen und ist perfekt zurechtgemacht.
Laut Namensschild heißt sie Copperfield.
»Where are you from?« fragt der Passagier die Stewardeß.
»From Boston.«
Steel hat richtig getippt, die Stewardeß ist eine Neuengländerin. Sie bietet ihm wahlweise Bonbons oder Chewing-gum an und stellt dabei fest, daß sich der Passagier noch nicht angegurtet hat.
»Kann ich Ihnen behilflich sein, Sir?« fragt sie und beugt sich über ihn.
Der Passagier lächelt und holt mit geübter Hand das Versäumte nach. »Jederzeit«, sagt er dann anzüglich, »aber nicht beim Anschnallen.«
Die himmelblaue Helferin erfaßt die Zweideutigkeit, wirkt aber keine Spur verlegen. Sie zeigt auch nicht das gefrorene Allerweltslächeln, mit dem sie laut Dienstvorschrift zumindest alle First-Class-Passagiere zu beglücken hat. Entweder ist sie abgehärtet, oder sie hat Sympathie für ihn. Steel ist sich da ganz sicher; bei Frauen ist er kein heuriger Hase. Er gehört zu den Privilegierten seines Geschlechts, die weniger Mühe haben, ihre Gespielinnen in das gastliche Bett zu bekommen, als sie hinterher wieder loszuwerden. Als Captain hat er im Nachkriegsdeutschland gelebt wie Gott in Frankreich. Einer seiner Chefs hatte ihn einmal als Stationsvorsteher eines Verladebahnhofs bezeichnet: Jedenfalls waren seine Züge immer pünktlich abgefahren.
Er lehnt sich zurück, starrt auf die Piste. Vielleicht ist er auch nur zu sehr von seiner Besatzungszeit in Germany verwöhnt. Er war das letzte Mal vor eineinhalb Jahren in den Staaten gewesen und hatte bei der ›Hallo-Fräulein-Masche‹ gewaltig zurückstecken müssen. Die Prüderie ist drüben so verbreitet wie Coca-Cola oder Cornflakes. Selbst Filme, die das lasterhafte Hollywood produziert, zeigen nie zwei Unverheiratete in einem Bett. Die Moral der Heuchler zwingt ein riesiges Land zu Ersatzbefriedigung oder Duckmäuserei.
Die Viermotorige jagt über die Startbahn, hebt ab, bohrt ihre Schnauze zielstrebig nach oben, geht mit mächtigem Gedröhn auf Kurs. Über London hängt der Schlechtwetterdunst wie eine Glocke; doch in 1200 Meter Höhe durchstößt die ›Super Constellation‹ die Waschküche. Wie in einem Zaubertrick wölbt sich ringsum der blaue Himmel wie ein riesiges Zelt. Fast gleichzeitig verkündet der Flugkapitän über Bordlautsprecher: »Ladies und Gentlemen, ich kann Ihnen die erfreuliche Mitteilung machen, daß die Schönwetterbrücke voraussichtlich bis New York anhält.«
Kurz vor dem Bord-Lunch bietet die Stewardeß Erfrischungen an: »What would you like, Mr. Steel?« fragt sie den Passagier mit den provokanten Augen. »Coke, Tea, Orange-Juice?«
Er schüttelt wie entsetzt den Kopf. »Two Bourbons, please«, ordert er an. »Einen für Sie und einen für mich.«
»Das ist leider nicht möglich«, entgegnet sie höflich. »Sie wissen doch, daß ich im Dienst nichts trinken darf.«
»Und was dürfen Sie nach Dienst?«
»Ausschlafen«, versetzt die Bordfee. »Zwei Tage lang.«
»In Boston?«
»Nein, in New York.«
»Bei einer so hübschen Neuengländerin eine schiere Zeitverschwendung«, fährt der Passagier etwas plump fort. »Würde eine Nacht für den Schönheitsschlaf nicht auch genügen?«
»Vielleicht«, erwidert Miß Copperfield, »aber ich bin am Ziel der Reise immer ziemlich erschöpft.«
»Ich werde eine ganze Woche in New York bleiben«, erklärt der Passagier. »Sähen Sie eine Chance, daß wir uns an Ihrem zweiten freien Tag treffen?«
»Sorry«, entgegnet die Stewardeß. »Ich will meinen Job nicht verlieren; auf Verabredungen mit Passagieren steht fristlose Entlassung.«
»Bringen Sie mir bitte trotzdem zwei Drinks«, beendet er das Smalltalk.
Der Ex-Captain ist über die Abfuhr nicht verärgert; für ihn ist sie auch nicht endgültig. Bis Bew York hat er noch viel Zeit zur Fortsetzung seines Flirts. Das First-Class-Abteil im vorderen Teil der ›Super Constellation‹ ist nur mäßig besetzt, so daß fast alle Fluggäste einen Fensterplatz haben. Gelegentlich kommen Gespräche auf und versanden bald wieder. Erst jetzt begegnet der Heimkehrer dem Blick einer adretten Mitreisenden, von der er bisher nur die dunklen Haare gesehen hatte.
Sie sitzt in der gleichen Reihe auf der anderen Seite.
Auch ihr Lächeln deutet der Mittdreißiger richtig.
»Lachen Sie mich aus?« fragt er spontan.
»Ich lächle Sie an«, erwidert sie. »Ihre Annäherungsversuche bei unserer hübschen Stewardeß sind auf einem langweiligen Flug von geradezu unschätzbarem Unterhaltungswert.«
»Freut mich für Sie«, erwidert er in gekonnter Selbstironie. »Sie meinen, ich rutsche dabei aus?«
»Ich fürchte es.«
»Sie genießen es«, stellte er klar.
»Das auch«, bestätigt die Schwarzhaarige mit dem Madonnenscheitel und den rehbraunen Augen in dem sündteuren Pariser Reisekostüm; sie ist höchstens 27, vielleicht auch jünger, jedenfalls eine Verführerin wie aus dem Bilderbuch.
Sie lachen beide. Steel erhebt sich.
»Dürfte ich mich an Ihrer Seite niederlassen?« fragt er dann.
»Das werden Sie hübsch bleiben lassen«, versetzt sie und garniert die Abweisung mit einem Lächeln. »Ich rieche Ihre Bourbon-Fahne bis hierher.«
»Heavens«, erwidert der Heimkehrer. »Sie sind ja schlimmer als Colonel Highsmith – doch auch jünger und schöner und überhaupt …« Das dritte Lob läßt er offen, während er auf die Mitreisende zugeht, um sich neben sie zu setzen. »Steel«, stellt er sich vor.
»Mrs. Sandler«, erwidert sie. »Meine Freundinnen nennen mich Gipsy.«
»Dann hoffe ich, Sie auch bald so nennen zu dürfen, Mrs. Sandler«, entgegnet er.
»Und Sie meinen, Sie schaffen das bis New York?«
»Ich meine gar nichts«, antwortet der Passagier.
»Sie versuchen es höchstens.«
»Allerdings.«
»Sie wechseln ziemlich schnell das Ziel Ihrer Aufmerksamkeit.«
»Ich bin ein einsamer Heimkehrer«, erwidert er. »Vielleicht kann ich mich verbessern. Wissen Sie, Mrs. Sandler, die Zeit, die man für ein hübsches Mädchen aufbringt, läßt einen womöglich eine schöne Frau versäumen.«
»Mein Gott, Sie reden wie ein Ölscheich, der die Damen zu Bauchtänzerinnen macht.«
»Bauchtänzerinnen wären mir zu fett«, entgegnet der Mann, nun ganz in seinem Element. »Ich schätze Ladies, die eine so gute Figur haben wie Sie …«
»Und Miß Copperfield«, ergänzt sie.
»Und Miß Copperfield«, erwidert der Ex-Captain tapfer.
»Dann würde ich an Ihrer Stelle den unterbrochenen Flirt fortsetzen.«
»Jetzt sitze ich an Ihrer Seite, Mrs. Sandler.«
»Das wird Ihnen nur nichts einbringen«, weist ihn seine Nachbarin zurecht. »Bei der hübschen Bordfee übrigens auch nicht.«
»Warum?«
»Nur Narren flirten während des Flugs mit Stewardessen«, entgegnet sie. »Sie glauben doch nicht im Ernst, daß diese Mädchen ohne Grenzen am Ziel noch auf irgend etwas Lust haben. Stundenlang Kinder wickeln, Kotztüten wegbringen, zweideutige Angebote männlicher Mitreisender abschlagen, während eines Sturmflugs trotz eigener Ängste die in Panik geratenen Passagiere beruhigen – und dabei noch lächeln. Schöner Traumberuf! Und dann sitzen sie in einem Nest am Ende der Welt in einer Wellblechbaracke bei 45 Grad im Schatten, den es nicht gibt, und dürfen zur Belohnung mit dem Flugkapitän schlafen, der natürlich verheiratet ist.«
»Sie wissen aber verdammt gut Bescheid.«
»Kunststück«, entgegnet sie. »Schließlich war ich einmal Stewardeß, bevor ich Mr. Sandler kennenlernte. Auf dem Flug natürlich. Er roch genauso nach Bourbon wie Sie. Er war Alkoholiker …«
»Und was tun Sie jetzt?« fragt Steel.
»In erster Linie lebe ich von der Scheidungs-Apanage.«
»Sehen Sie – Alkoholiker haben auch ihr Gutes …«
»Außerdem arbeite ich noch in der Werbebranche – schon wegen der Reisen ins Ausland: Frankreich, Italien, Schweiz, und wenn es mit dem Aufstieg so weitergeht, bald auch Westdeutschland.«
»Entschuldigen Sie meine Schnoddrigkeit, Mrs. Sandler!« erwidert der zivile Offizier. »Ich hab’ vielleicht doch einen Bourbon zuviel getrunken. Fünf Jahre US-Army«, setzt er als Milderungsgrund hinzu. »Geben Sie mir eine Chance, und ich bleibe ganz nüchtern.«
»Chance zu was?«
»Ihnen meine Enthaltsamkeit vorzuführen.«
»Bitte«, entgegnet die schwarze Madonna, »versuchen Sie Ihr Glück.« Sie nimmt sich eine Zigarette; er gibt ihr beflissen Feuer. »Wo werden Sie in New York wohnen?« fragt sie ihn wie beiläufig.
»Im ›PIaza‹-Hotel«, erwidert er. »Die Alternative wäre eine Kaserne. Ich werde nämlich erst in ein paar Tagen aus der US-Army verabschiedet. Und wo beziehen Sie Quartier?«
»Im ›Plaza‹«, versetzt sie lachend. »Ich steige immer im ›Plaza‹ ab, wenn ich in New York bin.«
Sie trinken eine Flasche Champagner auf den glücklichen Zufall.
Nach der ersten Zwischenlandung sagt er Gipsy zu der schönen Mitreisenden.
»Was werden Sie als Zivilist anfangen, Bob?« fragt sie ihn.
»Da hab’ ich mir noch keine Gedanken gemacht. Jedenfalls leben: Golf und Tennis spielen, reisen, Geld ausgeben und …«
»Sie müssen ja der reinste Nabob sein«, unterbricht sie ihn lachend.
»Vielleicht geh’ ich auch in die Luft und werde Sportpilot«, ergänzt er sein Programm. »Schnelle Autos und …«
»Schöne Frauen.« Die dunkle Attraktion gibt ihm das Stichwort.
»Wenn Sie wollen«, entgegnet Steel und sieht ihr fest in die Augen, »können Sie mein Singular werden.«
»Sie lacht lauthals. »Der Schampus bekommt Ihnen nicht«, stellt Mrs. Sandler fest. »In diesem Zustand versprechen Sie wohl alles, wie?«
Die nächsten Stunden verbringen sie abwechselnd flirtend und schlafend.
Sichtlich ermüdet erreichen Sie New York und fahren mit einem gemeinsamen Taxi ins ›Plaza‹.
Beide haben Zimmer vorbestellt.
Sie erhalten die Schlüssel, gehen rasch auseinander.
Morgen ist auch noch ein Tag, und für diesen haben sie sich um fünf Uhr p. m. in der Bar verabredet.
Die Brandmeldung des Geheimdienstes erreicht den amerikanischen Präsidenten zur Unzeit, Ende Oktober, zwei Tage vor der Schlußveranstaltung seines Wahlkampfs in New York. Als der Politiker erfährt, daß unter Umständen dem Dollar der Kollaps droht, läßt er seinen Sonderzug stehen und fliegt am späten Abend heimlich nach Washington zurück, um sich mit den Übermittlern der Hiobsbotschaft zu treffen.
Kein Kaiserwetter für den Präsidenten; Regengüsse, Nebelwände und Sturmböen empfangen ihn auf dem Stützpunkt der Air Force. In einer solchen Nacht bleiben in der Bundeshauptstadt, deren breite Prunkstraßen mit den Marmorfassaden fast nahtlos in Slumviertel münden, sogar die Reporter und die Einbrecher zu Hause. Und das gibt dem Ankömmling eine Chance, unbemerkt nach New York zurückzufliegen.
Die Teilnehmer der Geheimbesprechung, Spitzenleute der FBI-Bundespolizei, des CIA-Geheimdienstes und der US-Notenbank, werden sorgfältig gegen die Öffentlichkeit abgeschirmt und durch verschiedene Eingänge in das Weiße Haus geschleust.
Kurz hintereinander betreten der Gouverneur der Notenbank, der wortkarge Finanzminister, gefolgt von dem glattarroganten Edgar Hoover, dem allmächtigen FBI-Chef seit 24 Jahren, und zuletzt, wie in ihrem Windschatten, CIA-Direktor Hillenkoeter das Oval Office und dramatisieren durch ihre Anwesenheit bei der Top-Secret-Besprechung den Ernst der Lage.
»Just a moment, Gentlemen, please«, entschuldigt der Stabschef des Weißen Hauses die Abwesenheit des Hausherrn. »Mister President telefoniert noch mit General Clay in Frankfurt.«
James Partaker nickt ungeduldig; wiewohl das Zusammentreffen in erster Linie auf seine Veranlassung zustande gekommen ist, hält er es für eine notwendige Zeitverschwendung. Die Abwehr der Katastrophe duldet keinen Aufschub, keinen Tag, keine Stunde. Die FBI-Leute und CIA-Agenten, durch eine Ausnahmesituation auf Schulterschluß gebracht, benötigen Sondervollmachten, wie sie nur der US-Präsident erteilen kann, und auch das nur unter der Hand. Das Peinliche ist nur, daß solche Abmachungen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit demnächst mit Amerikas neugewählter Nummer Eins wiederholt werden müssen, denn der 31. US-Präsident – nach dem plötzlichen Tod Roosevelts ohne Wahl in das höchste Amt gekommen – hat kaum eine Chance, im Weißen Haus zu bleiben.
Die Versammelten empfangen den Präsidenten stehend im Oval Room, einen erschöpften Mann mit einem Dutzendgesicht und rotgeränderten Augen hinter einer Einfach-Brille; es ist der Preis für eine 50 000-Kilometer-Reise mit 255 Wahlkundgebungen nebst unvermeidlichen Dauer-Shakehands.
Der Eintretende nickt den Anwesenden zu. Amerikanische Staatsmänner pflegen das Gespräch mit einem Witzwort zu eröffnen: »Ich würde Ihnen gern die Hand drükken, aber sie ist geschwollen vom Wahlkampf«, stellt er fest. »Gott bewahre Sie davor, eines Tages für das Weiße Haus zu kandidieren.«
Die Anwesenden lachen gequält. Humor ist Glückssache, und außerdem ist ihnen nicht nach Späßen zumute – dem Präsidenten übrigens auch nicht; er fordert seine Gäste mit einer Handbewegung auf, Platz zu nehmen. Er schafft es nicht, von einem Übel in das andere umzusteigen; er muß sich erst noch Luft machen.
»Ich wurde gerade wieder darauf aufmerksam gemacht«, sagt er abschweifend, »daß die Russen mühelos unsere Luftbrücke nach Berlin während des Winters zum Einsturz bringen können, wenn sie durch einen Wellensalat den Funkverkehr stören«, beginnt er. »In dieser Jahreszeit sind unsere Versorgungsflugzeuge auf Blindflug angewiesen.«
»Ich weiß«, antwortet Admiral Hillenkoeter. »Aber das werden die Sowjets nicht wagen – vielleicht erinnern sie sich noch an die Hiroshima-Bombe …«
»Vielleicht haben sie die Atombombe bald selbst«, versetzt Harry S. Truman verbittert. »Einige Anzeichen deuten darauf hin.«
Keiner der Anwesenden spricht aus, was alle denken: Die völlige Abschnürung Berlins würde Krieg bedeuten – oder Unterwerfung unter Stalins Erpressungspolitik.
»Indeed – wir haben Sorgen genug.« Der Präsident gestattet sich ein kurzes Abgleiten in die Wehleidigkeit. »Die Russen haben sich ganz Osteuropa unter den Nagel gerissen und ihre Westgrenze um vier Fünftel näher nach Mitteleuropa geschoben. Die Berlin-Krise nähert sich dem Siedepunkt. China geht uns verloren. In Korea braut sich eine Schweinerei zusammen. In Nahost tobt ein Krieg gegen das von uns unterstützte Israel – und jetzt behaupten Sie, daß unter Umständen unser prächtiger Dollar, die Leitwährung der Welt, ins Wackeln geraten könnte …«
»Nicht unter Umständen, Mister President.« Der Gouverneur der Notenbank geht sofort zum Angriff über. »Sondern mit Sicherheit.«
In seiner hemdsärmeligen, gelegentlich auch gewöhnlichen Art versucht der Politiker aus Missouri abzuwiegeln. »Auch wenn die Scheiße am Dampfen ist, wird sie sich schon wieder abkühlen«, stellt er fest. »Don’t be such a pessimist«, wendet er sich an den Geldmann, der aussieht, als sei er geschlagen worden. »Sie meinen also«, lenkt Amerikas Nummer Eins wieder ein, »daß der Mann auf der Straße nicht in der Lage ist, diese Dollarfälschungen zu erkennen?«
»Weder Mr. Everybody«, entgegnet der Gouverneur, »noch der Experte; selbst unter der Quarzlampe nicht und noch nicht einmal im Labor. Ich muß Ihnen nun deutlich vor Augen führen, was das bedeutet.« Er entnimmt seiner Brieftasche zwei Fünfzig-Dollar-Noten und breitet sie vor dem Staatschef aus. »Bitte betrachten Sie sich die Scheine genau, und sagen Sie mir dann, welcher von beiden gefälscht ist.«
Der Präsident nimmt sich Zeit. Er schiebt die Brille hoch, vergleicht Zentimeter für Zentimeter wie ein hartnäckiger Rätselfreund, der die Abweichung auf dem Vexierbild unbedingt finden will. Er sucht und sucht. James Partaker beobachtet, wie Truman die Banknote wendet und von neuem beginnt, die Rückseite abzutasten. Ein Mann, der nicht aufgibt, auch wenn er natürlich weiß, daß sich die Fachleute nicht geirrt haben.
Truman hatte in seiner Karriere als Laufbursche, Zeitungspacker, Buchhalter und Eisenbahnkontrolleur gearbeitet, war im Ersten Weltkrieg Artillerie-Offizier geworden, hatte nach seiner Entlassung aus der US-Army zunächst die elterliche Farm bewirtschaftet, war dann nach zwei kümmerlichen Geschäftsjahren mit einer Kurzwarenhandlung an der 12. Straße von Kansas-City in Konkurs gegangen, hatte aber, bevor er sich entschloß, Politiker zu werden, den letzten Dollar abgestottert.
Würde jetzt unter seiner Regierungszeit ein Staatskonkurs gebaut, gäbe es keine Rückzahlung.
»Leider haben wir jeden Grund zur Schwarzseherei, Mister President«, wirft der Finanzminister ein. »Unsere Banknoten werden nach einem ausgeklügelten Verfahren hergestellt. Mindestens drei Dutzend Raffinessen stellen für Fälscher die Fallen auf; es ist noch keinem gelungen, eine auch nur mehr als flüchtige Ähnlichkeit mit den echten Greenbacks herzustellen. Sie wissen, Mister President, wie Experten sind. Fünf von ihnen vertreten meistens sechs Meinungen; doch hier sind – oder besser waren – sich alle Sachverständigen einig, daß es unmöglich ist, Dollarnoten zu fälschen.«
»Bis jetzt«, erwidert der Präsident sarkastisch. »Nunmehr aber sind falsche Greenbacks im Umlauf. Vermutlich haben Sie diese nur an der gleichlautenden Numerierung erkannt.«
»So ist es, Mister President.«
»Und das kann kein technisches Versehen sein?«
»Ausgeschlossen«, erwidert der Gouverneur der Notenbank. »Jeder Fehldruck wird von uns sorgfältig registriert und vernichtet. Wir führen Buch über jedes Gramm Papier in den Staatsdruckereien. Wir arbeiten mit Doppelsicherung und Dreifachkontrolle. Wir können jede Panne ausschließen – schließlich hat es auch noch keine gegeben.«
»Vielleicht bis jetzt«, erwidert der Regierungschef. »Ein technischer Fallout oder menschliches Versagen lassen sich bei aller Wachsamkeit wohl niemals restlos ausschließen.«
»Ich bleibe dabei«, sagt der Staatsbanker. »Irrtum ausgeschlossen. Ich muß noch etwas Furchtbares feststellen: Wer Fünfzig-Dollar-Noten so perfekt nachahmt, kann praktisch alle US-Werte fälschen. Bekanntlich zeigen Fünfzig-Dollar-Scheine das Bildnis General Grants. Setzen Sie Benjamin Franklins Konterfei auf die Note, sind es schon hundert Dollar, und das Clevelands tausend …«
»Und ein Madison fünftausend«, unterbricht ihn der Präsident ungehalten. »Ein Chase zehntausend und ein Wilson hunderttausend Dollar«, schnauft er verärgert. »Dear me, herrliche Aussichten! Wie viele dieser Dollarblüten sind schätzungsweise im Umlauf?«
»Das kann ich noch nicht sagen«, versetzt der Gouverneur. »Wir haben vor zehn Tagen den ersten Hinweis erhalten. Wir müssen bei unseren Nachforschungen äußerst behutsam vorgehen, um keine Panik auszulösen.«
»Halten Sie es für möglich, daß die Blüten schon vor längerer Zeit in Umlauf gebracht wurden?«
»Möglich – wir wissen es nicht.«
»Was wissen wir überhaupt?« giftet der Staatschef.
»Daß der gesamte Geldverkehr zusammenbricht, wenn wir die Geldfälscher nicht schleunigst zur Strecke bringen.«
Es bleibt still. Die Teilnehmer mit den betretenen Gesichtern leisten keinen Widerspruch.
»Es ist so«, schaltet sich erstmals FBI-Chef Hoover in das Gespräch. »Ein Anteil von 0,05 Prozent Falschgeld nimmt man in allen Ländern hin wie die Minimalverschmutzung in einem Hallenbad. Diese Fälschungen sind mehr oder weniger plump. Ich möchte sagen, wer sich Blüten andrehen läßt, ist selber schuld. Sie werden eingezogen, der unfreiwillige Verteiler hat den Schaden und paßt das nächste Mal besser auf. Falsifikate hatten bisher keine Chance. Spätestens am nächsten Bankschalter oder Postbüro werden sie erkannt und aus dem Verkehr gezogen. Beim Auftauchen neuer Blüten warnen wir natürlich die Öffentlichkeit, weisen auf Abweichungen in der Gravur oder in der Farbe oder im Papier hin. Der Fälscher macht immer den gleichen Fehler; wir kennen ihn also bereits, bevor wir wissen, wie er heißt. Hier stehen wir vor einer schrecklichen Fatalität: Die Fälscher arbeiten fehlerlos. Das hat es noch nie gegeben, und es könnte, wenn wir es nicht abstellen, den Staatsnotstand auslösen.«
»Well, eine verdammte Geschichte«, erwidert der Präsident. »Selbstverständlich erhalten Sie von mir jede Unterstützung. Sie hätten mich deswegen«, setzt er mit leisem Tadel hinzu, »nicht aus dem Wahlkampf reißen müssen. Wie gesagt: Ich stehe voll hinter Ihnen, aber ich muß doch feststellen: Es ist Ihr Job, diese Falschmünzer zu kassieren, nicht der meine.«
Es ist einer der Tiefschläge à la Truman, aber die Zuhörer zeigen Nehmerqualität und nicken zustimmend; sie hatten schon oft Gelegenheit, den gesunden Menschenverstand des Präsidenten zu bewundern.
»Auch auf die Gefahr hin, mir Ihren Zorn vollends zuzuziehen, Mister President«, lenkt der CIA-Director die Aufmerksamkeit auf sich, »muß ich feststellen: Hier handelt es sich um keine der üblichen kriminellen Fälscherbanden. Wir müssen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen politischen Hintergrund vermuten und …«
»Wie kommen Sie darauf?« unterbricht ihn Truman.
»Mr. Hoover und ich haben Mr. Partaker und seinen FBI-Kollegen Ginty gebeten, anhand aller Unterlagen und zugänglichen Informationen diesen Fall zu analysieren.« Er betrachtet den Präsidenten fragend. »Schießen Sie los, James«, sagt er, als Truman nickt.
»Ich möchte Mr. Hoovers treffliche Ausführungen noch in einem Punkt ergänzen«, beginnt Hillenkoeters Hausgenie. »Nicht nur der US-Dollar, sondern auch das britische Pfund galten als absolut fälschungssichere Banknoten. Doch den Nazis war seinerzeit das Unmögliche gelungen: In jahrelanger Arbeit bildeten sie im Camp Oranienburg nördlich von Berlin ein erstklassiges Fälscherteam von Druckspezialisten, Papieringenieuren, Chemographen und so weiter aus, das nach mehrjährigen Versuchen in der Lage war, absolut identische Pfundnoten herzustellen und in großer Menge zu verbreiten. Die Falschgeldlawine war für Großbritannien eine tödliche Bedrohung. England hat sie vor der Öffentlichkeit – auch vor uns, ihren Verbündeten – verheimlicht und mußte nach dem Krieg für Milliardenverluste geradestehen. Die Briten waren gezwungen, alle Geldscheine – bis auf die Fünf-Pfund-Note – aus dem Verkehr zu ziehen und durch neue zu ersetzen …«
»Das ist bekannt«, wirft der Präsident ein. »Und die Nazis haben wir doch zum Teufel gejagt.«
»Nicht alle«, entgegnete Partaker, »und, soweit wir ihn nicht sicherstellen konnten, schon gar nicht ihren Nachlaß. Zum größten Teil haben ihn die Russen erbeutet, zum anderen die Partisanen in Italien, Frankreich und Jugoslawien. Auch Zufallsfinder oder besonders schlaue Hitler-Aktivisten haben davon profitiert, die an ihre Zukunft dachten und den Schatz auf die Seite schafften.« Partaker nimmt einen Schluck Wasser. »Wir wissen mit Sicherheit«, fährt er fort, »daß nach dem Kriegseintritt Amerikas der Befehl an das ›Unternehmen Bernhard‹ (unter diesem Decknamen lief Himmlers Falschgeld-Aktion) ergangen war, auch Dollars zu fälschen. Wir wissen weiter, daß nach großen Schwierigkeiten erstklassige Greenback-Blüten kurz vor Kriegsende fertiggestellt waren, doch durch den plötzlichen Zusammenbruch kamen sie wohl nicht mehr in den Verkehr. Gegen Ende des Krieges wurde das Fälscherteam nach Süden in die ›Festung Alpenland‹ evakuiert; aber Oranienburg liegt in der heutigen Sowjetzone, und Sie können sich darauf verlassen, Mister President, daß die Russen das zum Teil unzerstörte Barackenlager genau untersucht haben.«
»Sie meinen, die Sowjets stecken hinter diesen Blüten?«
»Ich meine gar nichts, Mister President«, entgegnet der Experte. »Ich möchte Ihnen nur die Möglichkeiten aufzählen, die sich aus diesen unumstößlichen Tatsachen ergeben können: erstens also die Russen, die bei der weltweiten Auseinandersetzung zwischen Kommunismus und Kapitalismus ein Motiv hätten, unsere Währung zu ruinieren.
Zum zweiten könnten die Häftlingsfälscher selbst – soeben wurden vier von ihnen in Paris verhaftet – Klischees und Papier auf die Seite gebracht haben und nun auf eigene Faust und zum eigenen Nutzen das tun, wozu der Nazi-Staat sie seinerzeit gezwungen hatte.
Der Vertrieb der Blüten lief über Norditalien. Hier waren die Partisanen sehr aktiv, und die stärkste Gruppe stellten die Kommunisten. Wie wir alle wissen, verfügt die Partita Communista über schier unbegrenzte Geldmittel. Niemand kann sagen, ob sie aus dem Mussolini-Goldschatz stammen, ober ob sich die Genossen zu späten Erben von Oranienburg gemacht haben und sich – vielleicht sogar ohne Wissen der Sowjets – die Taschen füllen.« Partaker sieht, wie gebannt ihm seine Zuhörer, einschließlich des Präsidenten folgen: Er hat sie mit seinen Schlüssen und Vermutungen überfahren.
Wie hilfesuchend sieht sich der Präsident nach Craig Ginty um, nickt ihm zu.
»Ich kann mich diesen Ausführungen nur voll anschließen«, stellt der FBI-Experte fest. »Ich kenne das ›Unternehmen Bernhard‹ aus eigenen Recherchen und aus den Akten. Mr. Partaker und ich haben uns durch einen Berg von dreißig Dossiers gegraben. Was James hier vorbringt, entspricht voll meiner Meinung.«
»Fahren Sie fort, Mr. Partaker«, fordert ihn Harry S. Truman auf.
»Eine mindestens genauso logische Möglichkeit ist kaum weniger gefährlich. Ich nehme an, es ist in diesem Kreis bekannt, daß wir während des Krieges die Hilfe der Mafia in Anspruch genommen haben, und zwar nicht nur bei den Gewerkschaften im Hafen von New York, sondern auch bei der Landung in Sizilien und den Feldzügen in Unteritalien. Wir haben die verhafteten Mafiosi auf der Halbinsel Farignana befreit und als Bürgermeister und Verwaltungschefs eingesetzt. Die Verbindungs-Offiziere waren Dagos: Amerikaner italienischer Abstammung. Einige von ihnen haben sich so mit ihren Landsleuten eingelassen, daß wir mitunter nicht mehr wußten, waren sie für die US-Army oder für die ›Ehrenwerte Gesellschaft tätig. Schließlich führte das dazu, daß wir sicherheitshalber US-Geheimdienstleute italienischer Abstammung aus dem Verkehr ziehen mußten, was in einigen Fällen ebenso unumgänglich wie in anderen eine schreiende Ungerechtigkeit war. Unter den Abgelösten gab es viel Empörung, und vielleicht ist der eine oder andere jetzt erst zur Mafia abgesprungen – und arbeitet womöglich nun für sie als Falschgeld-Manager.« Der Referent nimmt einen Schluck aus dem vor ihm stehenden Wasserglas und fährt fort:
»Im Nachkriegs-Italien waren die Mafia und die Partisanen am besten organisiert. Wiewohl sie einander oft bekämpften, waren sie mitunter nicht voneinander zu unterscheiden. Es ist keineswegs auszuschließen, daß das ›Unternehmen Bernhard‹ heute von den ›amici degli amici‹ fortgeführt wird; dabei hätte sie über ihre Cosa-Nostra-Ableger in den USA eine einmalige Vertriebs-Möglichkeit. Ich will es kurz machen, Gentlemen«, faßt Partaker noch einmal zusammen. »Die Wahrscheinlichkeiten drei und vier wären bedenkenlose Schatzfinder oder auch die untergetauchten Nazis, die jetzt, da man ihnen nicht mehr so auf die Finger sieht, ihre Schäfchen aus dem trockenen hervorholen. Welche Personengruppe die Falsifikate verbreitet, kann ich nicht sagen, aber absolut sicher bin ich, daß es sich bei den Dollarblüten um sogenannte Himmler-Noten handelt.«
»Aber wir hatten doch in dieser Sache ermittelt«, wirft Präsident Truman ein, der nicht mehr erschöpft wirkt. »Wie weit reichen die Fakten, und wo beginnen die Vermutungen?«
»Die Endstation des Fälschertrupps war das Ausseer Land in Österreich. Nachweisbar wurden einige Lastwagenfuhren mit Falschgeld, Klischees und anderen Unterlagen in den stillen Toplitzsee gekippt, ein verwunschenes Binnengewässer von zwei Kilometern Länge und 450 Metern Breite. Die Tiefe, die dieses Strandgut birgt, ist ungewöhnlich und reicht bis 106 Meter hinab. Der örtliche CIC-Resident rief Spezialisten zu Hilfe; sie bildeten eine Sonderkommission, die monatelang und mit allen möglichen Mitteln Hitlers Schlammeimer entleerte. Man stieß dabei nur auf riesige Mengen gefälschter Pfundnoten, aber auf keine einzige Dollarblüte und konnte ausschließen, daß solche während des Krieges noch vertrieben wurden.«
»Und danach?«
»Das wissen die Götter, wenn sie’s wissen.«
»Wer ist für diesen Pfusch verantwortlich?« fragt der Hausherr zornig.
»Die Untersuchungen leitete ClC-Captain Steel ein, fachlich ein hervorragender Mann.«
»Er ist wirklich ein Experte«, schaltet sich Edgar Hoover ein. »Steel war vor der Einberufung zur Armee beim FBI als Falschgeldspezialist tätig. Wir schickten ihm auf seinen Wunsch für seine Sonderkommission zwei Spezialisten als Verstärkung – einer davon war Mr. Ginty.«
»Und warum ist dann nicht mehr herausgekommen?«
»Weil die Sonderkommission gegen mehrfachen und heftigen Protest von Captain Steel aufgelöst wurde und alle Tauchversuche im Toplitzsee – auf seinem Grund vermutete man die Dollar-Klischees – abgebrochen werden mußten.«
»Das war wohl ein gottverdammter Nonsense – inzwischen haben sie wahrscheinlich andere gehoben.«
»Mag sein, Mister President«, erwidert Partaker, »aber das Militär denkt ja mitunter in schlichteren Kategorien.«
Einigen Teilnehmern der Geheimbesprechung war anzusehen, daß sie über die provokanten Worte des CIA-Vice in Weißglut gerieten; andere grinsten schadenfroh hinter vorgehaltener Hand. Bevor die Meinungen aufeinanderprallten, resümierte Amerikas Nummer eins:
»Wenn ich Sie recht verstanden habe, Mr. Partaker, dann kennen Sie die Quelle dieser Fälschungen, nicht jedoch die Leute, die sie angezapft haben.« Truman wartete die Bestätigung nicht erst ab. »Es kann sich bei ihnen um vorsätzliche Betrüger handeln«, fuhr er fort, »um unehrliche Finder oder um politische Attentäter. Es können Deutsche sein oder Russen, Italiener oder aber auch Gangster, die sich zu einem internationalen Syndikat zusammengeschlossen haben …«
»Richtig, Mister President«, entgegnet der CIA-Vice.
»Unter diesen Umständen wird uns wohl nichts anderes übrigbleiben, als da wieder zu beginnen, wo wir damals dummerweise aufgehört haben.«
»That’s right, Mister President.«
»Gut. Ich denke, daß Sie und Craig Ginty genau die richtigen Leute sind, um die Ermittlungen zu führen. Blitzschnell bitte und unter absoluter Geheimhaltung. Ich lasse Ihnen freie Hand bei Ihrer Investigation. Sie unterstehen mir direkt. Sie erhalten Geldmittel in unbeschränkter Menge, die Sie freilich später abrechnen müssen. Alle Geheimakten sind Ihnen in dieser Sache zugänglich zu machen.«
»Einverstanden«, sagen nacheinander Edgar Hoover und CIA-Direktor Hellenkoeter.
»Noch etwas?«
»Ja, Mister President. Es könnte notwendig werden, Vorschriften, vielleicht sogar Gesetze zu umgehen«, erwidert Partaker.
»Tun Sie, was Sie wollen«, erwidert Harry S. Truman erregt, »nur erledigen Sie den Fall, bevor er sich zur Katastrophe ausweitet.« Er nickt den Anwesenden zu. »Ich werde jeden von Ihnen decken, der bei der Verfolgung dieses Verbrechens in den Verdacht gerät, zu weit gegangen zu sein.«
Als sich die Versammelten trennen, bedauert Partaker, der eigentlich lieber den Fachmann Dewey auf dem Präsidentenstuhl sähe, daß die Tage des Pragmatikers aus dem Mittelwesten offensichtlich gezählt sind. Fast drei Viertel aller Kommentatoren sprechen bereits von Dewey als dem neuen Präsidenten, und ›Life‹ hat bereits mit dem Andruck des Umschlags begonnen, von dessen Frontseite der republikanische Gegenkandidat – und Gouverneur von New York – als Sieger lächelt.
Robert S. Steel steht am Fenster seines Apartments im ›Plaza‹-Hotel, das dem Central Park schräg gegenüber liegt. In der ersten Abenddämmerung ziehen die Menschen paarweise in Manhattans riesige Lunge wie in die Arche Noah, je zwei von jeder Tiergattung auf der Flucht vor der großen Sintflut. Er beobachtet, wie sie stehenbleiben, sich umarmen, einander küssen und dann beim Weitergehen Liebesschwüre ablegen, die sie am nächsten Morgen vielleicht schon vergessen haben.
Seine Müdigkeit ist auf einmal wie weggeblasen. Er schilt sich einen Toren, er bräuchte nur über den Gang zu Mrs. Gipsy Sandler zu gehen, um eine möglicherweise offene Zimmertüre einzurennen; aber als Routinier weiß er nur zu gut, daß ein Mann bei einer Frau, die er gerade kennengelernt hat, durch scheinbare Zurückhaltung am raschesten vorankommt. Jedenfalls brachten das dem bisherigen CIC-Captain Verstand und Erfahrung bei; doch wenn sich Adams verdammter Trieb rührt, wird sein Epigone leicht zum Amokläufer.
Steel bekämpft reizvolle Impressionen um die schwarze Madonna unter der Dusche. Das macht ihn nur noch munterer, die Versuchung läßt sich nicht wegschwemmen. Vorübergehend spürt er die Zeitverschiebung überhaupt nicht mehr. Dann denkt er wieder geordneter, auf einmal fällt ihm ein, daß zwölf ›Madisons‹-Dollar-Noten à fünftausend Greenbacks im Hotelsafe besser aufgehoben sind als unter seinem Kopfkissen. Er zieht sich an, geht nach unten, mietet ein Schließfach im Tresorraum, bringt im Metallbehältnis einen dicken braunen Umschlag unter.
Dann betritt er die Bar, um doch noch einen Schlummertrunk zu nehmen. Aus einem werden drei; dabei kommt Steel, wie er meint, die splendide Idee: Am hoteleigenen Blumenstand erwirbt er einen riesigen Strauß dunkelroter Baccaras. Er wird ihn vor die Tür legen, die Werbedame anrufen und sie bitten, die Rosen in eine Vase zu stecken. Vielleicht gibt ihm dabei das Telefongespräch eine Chance, schon heute zu erreichen, worauf er sich sonst bis morgen – oder vielleicht sogar bis übermorgen – gedulden müßte. Wenn er erst einmal einen Brückenkopf besitzt, fällt rasch die ganze Festung.
Der Ex-Captain fährt mit dem Lift zur dritten Etage hinauf, geht den langen Gang entlang auf der Suche nach dem Zimmer Nummer 331. Kurz bevor er das Ziel erreicht, öffnet sich die Tür, aber nicht die Madonna in Schwarz kommt heraus, sondern ein etwa vierzigjähriger Mann, mittelgroß und mittelgrau, so in Eile, daß er achtlos an dem Rosenkavalier vorbeihastet.
Im ersten Zorn möchte der Heimkehrer sich die Baccaras um die Ohren schlagen. Dann macht er sich klar, daß der Mann gegangen und nicht gekommen ist. Er deponiert den Strauß vor Zimmer 331, geht vier Türen zurück in sein eigenes Apartment und ruft seinen Reiseflirt an: »I dislike to disturb you, Gipsy«, beginnt er vorsichtig. »Aber ich möchte verhindern, daß die Rosen vor Ihrer Tür verwelken.«
Sie begreift ihn sofort. »Just a moment«, erwidert sie und geht vermutlich an die Tür. »Sie Verschwender«, sagt sie nach ihrer Rückkehr. »Thank you very much. Ich hab’ noch nie in meinem Leben einen so schönen Blumenstrauß bekommen.«
»Auch nicht von Mr. Sandler?«
»Nicht einmal zur Hochzeit.«
»Auch nicht von dem Mann in Mittelgrau, der eben aus Ihrem Apartment kam?«
Gipsy Sandlers Stimme klingt ein wenig verärgert. »Was geht Sie das eigentlich an?« fragt sie. »Steh’ ich unter Kuratel, oder haben Sie den Hoteldetektiv auf mich angesetzt?«
»Natürlich nicht«, entgegnet Steel. »Meine Rosen und mein Nebenbuhler wären beinahe zusammengestoßen.«
Sie schweigt einen Moment lang. »Ich sagte doch schon«, antwortet sie dann wieder mit ihrer gewöhnlichen Stimme, »daß ich für die Werbefirma ›Myers & Niggel‹ arbeite – und das war der Promotion Director.«
»Ein ziemlich neugieriger Bursche.«
»Er wollte sofort einen Überblick über die Resultate meines Europa-Trips erhalten.« Nach kurzer Pause setzt sie hinzu: »Es steht ja auch ziemlich viel Geld auf dem Spiel.«
»Na ja, wie ein Liebhaber sah er nicht gerade aus«, erwidert der Anrufer versöhnt.
»Wie sieht denn ein Liebhaber aus?« greift die Umworbene seine Entgleisung auf. »Etwa wie Sie?«
»Geben Sie mir eine Chance, Gipsy!«
»Sie hatten sie den ganzen Tag über«, erwidert sie lachend. »Und wenn Sie mich jetzt in Ruhe lassen, bekommen Sie sie morgen wieder.«
»Besten Dank im voraus«, erwidert er. »Aber könnten wir noch einen Night-cup zusammen nehmen, und ich erkläre Ihnen dabei, was – was Sie mir bedeuten?«
»In meinem Zimmer? Neben meinem Bett? Und Mut müssen Sie sich auch noch antrinken? Nein, Bob, daraus wird nichts. Ich bin ein Mädchen aus Philadelphia im Staate Pennsylvania. Wissen Sie, wie unser Wappenspruch lautet: ›Freiheit, Unabhängigkeit und Tugend‹.« Sie läßt ihm keine Zeit, etwas zu erwidern. »Tugend«, wiederholt sie. »Gute Nacht, Bob«, setzt sie hinzu und legt auf.
Es war eher eine Holzhammernarkose als ein Schlummertrunk. Mit einem verschwommenen Eindruck von seiner reizvoll-aufreizenden Reisebegleiterin schläft der Abwehroffizier a. D. ein. Schließlich kippt sein Bewußtsein weg. Er schläft traumlos durch und erholt sich von Zeitverschiebung und Flugstrapazen.
Am Morgen erhebt sich Steel gähnend, schiebt die Vorhänge zurück, und wie befriedigt stellt er fest, daß die Liebespaare aus dem Central Park längst nach Hause gegangen sind. Vielleicht wird er heute abend mit Gipsy dort promenieren; aber die Kür kommt nach der Pflicht. Jetzt braucht der Ex-Captain einen klaren Kopf für seine Geldgeschäfte, und davon versteht er etwas, beruflich wie privat. Er meldet sich für elf Uhr beim Vizedirektor seiner Bank an. Dann entnimmt er dem Schließfach den braunen Umschlag, verstaut ihn vorsichtig in seinem Bordease, geht durch die Halle des ›Plaza‹, und dabei entdeckt er Mrs. Sandler in einer Nische.
Sie winkt ihm zu; am Morgen ist sie offensichtlich entgegenkommender als am Abend. Er tritt an ihren Tisch.
»Schon auf den Beinen?« fragt er überrascht. »Darf ich mich zu Ihnen setzen?«
»Seit wann so förmlich?« erwidert sie. »Nochmals herzlichen Dank für die Rosen.«
»Nochmals Entschuldigung für die Störung«, entgegnet er.
Sie lächelt ihm zu, ihre Augen flirren. Ihr Haar zeigt einen pikanten Blauschimmer. Ihr Blick fällt auf das Bordcase. »Wohl Ihr ständiger Begleiter«, stellt sie lachend fest. »Haben Sie die Tasche mit Brillanten gefüllt?«
»Mit gestohlenen«, versetzt Steel.
Er winkt den Ober herbei, bestellt das Frühstück. »Natürlich nicht«, erklärt er dann. »Geld – ich habe Ihnen doch erzählt, daß meine Mutter Schweizerin war. Ich habe ein Grundstück in der Innenstadt von Zürich geerbt und verkauft. Der Einfachheit halber habe ich den Erlös gleich mitgenommen.«
»In bar?«
»Ja – das spart Spesen und Zeit.«
»Nicht gerade ungefährlich – viel?« fragt Gipsy.
»Ich bin Gefahr gewohnt, ich war Soldat, Offizier – ein Kriegsheld, wenn Sie so wollen«, antwortet Steel selbstironisch. »Sechzigtausend«, erklärt er nach kurzem Zögern. »Sie werden mich schon nicht überfallen.«
»Sie müssen verrückt sein«, erwidert Gipsy. »Und da haben Sie noch die Nerven, mit mir zu flirten.« Sie gießt ihm Kaffee ein. »Ich jedenfalls würde völlig durchdrehen, wenn ich soviel Geld bei mir hätte.«
»Gewohnheitssache«, erwidert Steel. »Ich hab’ schon über ganz andere Summen verfügt.« Er erhebt sich. »Sie müssen mich jetzt bitte entschuldigen, Gipsy«, verabschiedet er sich. »Wir sehen uns um fünf Uhr p. m. – ich freue mich schon darauf.«
»Warum so früh?« fragt sie.
»Warum so spät?« kontert er.
Sie lachen beide. Er nickt ihr zu, schultert seine Tasche, geht zur Rezeption. Da er formell immer noch der Armee angehört, muß er auch im Urlaub ständig erreichbar bleiben. Steel hinterläßt im Hotel, daß er am Nachmittag wieder im ›Plaza‹ sein wird. Die Zeitangabe ist nicht ganz korrekt, aber bis dahin wird schon kein Krieg ausbrechen.
Der Hotelgast geht in Richtung Lexington Avenue. Nach fünf Jahren ist er nach Hause zurückgekehrt, aber am ersten Tag fühlt er sich wie in einem fremden Land: keine Ruinen, fast keine Bein –, Arm- oder Doppelamputierten, keine Menschen, die auf eine weggeworfene Zigarettenkippe warten, keine Häuser, deren Dächer mit Zeltplanen abgedeckt sind – das von vielen erwartete deutsche Wirtschaftswunder steht noch im Startloch. In Germany herrscht Not statt Überfluß. Hier aber rasen die Straßenkreuzer mit den Haifischflossen im ständigen Wettrennen zur nächsten Ampel; dazwischen Fußgänger, die vorwärtshasten, als hätten sie sich alle verspätet.
Robert S. Steel ist zu Hause, aber nicht daheim. Arizona, das heißeste Land der Vereinigten Staaten, das wie kein anderes die Fingerabdrücke der Schöpfung trägt, läßt ihn kalt, ist kaum mehr als eine herrliche Ansichtskarte mit schroffen Bergspitzen, bizarren Felsgraten, mit glühender Wüste, mit Indianern, Sonderlingen, Lassowerfern und Lungenschwindsüchtigen. Sein einziger Bruder fiel auf einer Pazifikinsel im Nahkampf mit den Japanern; seine Mutter erlag kurze Zeit später der Angina pectoris. Sein Vater, nach New York gezogen, hatte sich in Arbeit und Whisky gestürzt – immer mehr Bourbon und immer weniger Aufträge. Auf einer Heimfahrt prallte er frontal gegen einen Baum; es wurde nie ganz geklärt, ob der Alkohol oder die Lebensmüdigkeit das gewaltsame Ende verursacht hatte.
Zu diesem Zeitpunkt war der einzige Überlebende der Familie gerade über den Rhein gestürmt. Der Krieg hatte ihm nicht viel Zeit zu Trauer und Besinnung gelassen. Kurz danach wurde Steel zum Leiter der Sonderkommission befördert, die das ›Unternehmen Bernhard‹ untersuchte. Er hatte eine Aufgabe, Macht und Abenteuer.
Endlich heimgekehrt, spürt er in einer überfüllten, aus den Nähten platzenden Stadt seit langem erstmals wieder die innere Leere; einige entfernte Verwandte nähmen ihm diese Empfindung auch nicht. Er geht in die nächste Pinte, um etwas dagegen zu tun, aber er hält sich nicht lange auf. Steel pflegt auch dann pünktlich zu sein, wenn er sein Bewußtsein mit Promille wattiert hat. Lautsprecher rufen zur letzten Wahlrede von Präsident Truman; ein Wagen nach dem anderen, die Durchsagen jagen sich wie ein Echo. Der Demobilisierte schüttelt den Kopf; Trumans Mut in der Höhle des Löwen ist beachtlich. Sein Rivale Dewey, schon zum zweitenmal gewählter Gouverneur des Staates New York, hatte in der Mitte der dreißiger Jahre als Generalstaatsanwalt mit Verve, Ungestüm und harten Bandagen die Mafia zerschlagen – von deren Existenz die US-Bürger erst zu dieser Zeit erfuhren. Hier kämpft David gegen Goliath, aber das eine ist biblische Geschichte und das andere ein moderner Massenwahlkampf.
Der Heimkehrer sieht auf die Uhr und zahlt. Der CIC-Offizier ist gewohnt, seine Umgebung im Blick zu haben, bewußt oder unbewußt. Was seine Netzhaut erfaßt, speichert sein Gedächtnis, auch Nebensächlichkeiten, die er später abrufen kann. Schließlich war er Abwehroffizier der US-Army und laut Beurteilung einer der besten. Das ist Robert S. Steel so gut wie immer: Er erhielt die Platzziffer eins beim juristischen Examen seines Jahrgangs an der New York University. Man überreichte ihm als erstem Rekruten seines Regiments das Offizierspatent. Er schnappte sich die hübschesten Mädchen und durchlief die schnellste Karriere. Einer, der sich in jedem Sattel zurechtfindet und zwei gegensätzliche Voraussetzungen für den Erfolg mitbringt: Härte und Flexibilität.
Kurz bevor Steel die Bank erreicht, stehen auf einmal alle Autos still. Veteranen des Zweiten Weltkriegs blockieren die Fahrbahn. Es ist eine Großdemonstration. Die demobilisierten Soldaten führen Schilder mit: ›Wir warten auf den Dank des Vaterlands‹, ›Gebt uns endlich Arbeit!«, ›Wir haben für euch gekämpft, jetzt laßt ihr uns im Stich‹, ›Fünf Kinder und kein Job‹. Nicht wenige, die Arbeit oder eine bessere Versorgung verlangen, sind auch in den USA einarmig oder einbeinig. Auch bei Siegernationen gibt es Verlierer, so wie auf der anderen Seite keineswegs alle Geschlagene sind. In jedem Krieg fallen viele und profitieren etliche.
Am ersten Tag bedrängt Amerika den Heimkehrer mehr, als es ihn beglückt; aber New York ist nicht Amerika, und dem ersten wird ein zweiter Tag folgen. Ohnedies ist er entschlossen, künftig da zu leben, wo es ihm Freude macht, und die Voraussetzungen dafür bringt er mit.
Er betritt die Schalterhalle der Chase-Manhattan-Filiale und wird vom Kassierer sofort als Stammkunde erkannt.
»Mr. Sillitoe erwartet Sie schon in seinem Büro, Mr. Steel«, begrüßt ihn der aufmerksame Bankbeamte, öffnet die hölzerne Barriere und gibt den Weg in die erste Etage frei.
Der Mann, der ihn empfängt, ist gekleidet wie ein Bestattungsunternehmer an seinem freien Tag. »Coming home?« begrüßt er den Kunden und geht ihm entgegen. »Willkommen in der Heimat. Ich hoffe, Sie werden sich rasch wieder einleben.« Mr. Sillitoe achtet sorgfältig darauf, erst nach dem Besucher Platz zu nehmen. Er wirkt beflissen, fast devot, aber er ist ein mit allen Wassern gewaschener Profi, vertraut mit den Finten und Schlichen seines Gewerbes. »Ihre Wertanlagen wachsen und gedeihen, Mr. Steel«, erklärt er. »Sie haben wirklich eine glückliche Hand in Geldgeschäften, aber das wird Ihnen Ihr Börsenmakler schon gesagt haben.«
»Ich war noch gar nicht bei ihm.« Übergangslos setzt er hinzu: »Ich habe der Einfachheit halber aus Zürich ziemlich viel Bargeld mitgebracht; ich wollte es unten in der Schalterhalle nicht einzahlen.«
»Ich erledige das für Sie«, erwidert der Bankbeamte.
Steel schiebt ihm das dicke Kuvert zu. »Zählen Sie bitte nach«, fordert er ihn auf. »Es sollten sechzigtausend Dollar sein.«
Obwohl Sillitoe weiß, daß der Betrag bis auf den letzten Cent stimmen wird, geht er die zwölf ›Madisons‹ zweimal durch. Pedanterie ist das Gewissen des Bankbeamten. »Was soll mit dem Geld geschehen?«
»Legen Sie es zunächst aufs Girokonto«, ordnet der Heimkehrer an. »Ich weiß noch nicht, was ich beruflich anfangen soll. Jedenfalls werde ich flüssige Mittel brauchen.«
»Wollen Sie wieder als Jurist tätig werden?«
»Möglicherweise«, erwidert der Demobilisierte. »In jedem Fall lasse ich mir Zeit damit.«
»Das würde ich an Ihrer Stelle auch tun«, versetzt Mr. Sillitoe.
Als wäre er bei einer Schweizer Bank in die Schule gegangen, stellt der Beamte keine Frage nach der Herkunft des Geldes. Die meisten Besatzungssoldaten kehren aus Europa als an Liebeserfahrung reiche Habenichtse zurück. Doch einige der Have-Nots haben bewiesen, daß man auch in einer Trümmerlandschaft noch nach Gold graben kann. Mr. Sillitoe und seine Kollegen stellen keine Fragen (eine Bank ist ein Erwerbsunternehmen und kein Beichtstuhl), und wenn sie sich als neugierig zeigten, gingen die Kunden in eine andere Geld-Kirche.
Auf dem Rückweg zum Hotel vermeint Steel, einem Übergewichtigen mit Knollennase und Sommersprossen heute schon zum zweiten Mal zu begegnen. Das mag Zufall sein oder auch nicht. Irgendwie fühlt sich Steel beobachtet, aber wer sollte ein Interesse an einem Ex-Captain haben, der seine Bücher in Germany sorgfältig abgeschlossen hat?
Er bleibt stehen und läßt den Dicken passieren, sieht ihm nach, bis er im Gewühl verschwunden ist.
Der Portier übergibt dem Gast eine Message: Colonel Wringler bittet um Rückruf. »Soll ich gleich verbinden, Mr. Steel, oder wollen Sie den Anruf in Ihrem Apartment entgegennehmen?«
»Oben«, ordert der Heimkehrer, wenig begeistert über ein Gespräch mit dem Colonel, der im Regiment seit vielen Jahren als eine Art uniformierter Frühstücksdirektor wirkt; im Krieg kann das lebenserhaltend sein, aber im Frieden ist es ein lächerlicher Job, wenn auch mit einem hohen Rang. Aber die Armee wird er ja nun bald hinter sich haben.
»Hallo, Steel!« schmettert der Mann mit der Trompetenstimme. »Wir sind alle stolz auf Sie.« Der aufgeregte Wichtigtuer muß vor Begeisterung nach Luft schnappen. »Sie sind zum Rapport befohlen. Ins Pentagon. Morgen. Der Verteidigungsminister will Sie persönlich aus der Armee verabschieden. Eine ganz große Ehre ist das, wonderful …«
»Morgen schon?« unterbricht Steel ihn mehr überrascht als erfreut.
»Eine Militärmaschine bringt Sie in die Bundeshauptstadt. Ich fliege natürlich mit, als offizieller Vertreter unserer Division. So was lasse ich mir nicht entgehen. Anschließend sind Sie zu einem kleinen Lunch gebeten. Am Abend sind wir wieder zurück. It will be a great moment in your life …«
»Ja«, erwidert der Heimkehrer schwächlich. »Wirklich ein großer Augenblick.«
»Ich will Ihnen etwas verraten, Steel.« Der Colonel versucht, seine Begeisterung anzuheizen. »Aber Ihr Ehrenwort, daß Sie die Klappe halten!«
»All right«, entgegnet der Ex-Captain.
»Sie werden befördert und als Major aus der Army entlassen.«
»Ach nein«, erwidert Robert S. Steel und setzt hintergründig hinzu: »Hat denn die Armee etwas an mir gutzumachen?«
»Immer noch der alte«, sabbert Colonel Wringler. »Wie gesagt, wir sind alle stolz auf Sie. Ich schicke Ihnen morgen um neun Uhr einen Wagen. Sie erscheinen in Ausgehuniform mit allen Orden und Ehrenzeichen. Congratulations, Bob, and have a good day«, sagt er, gütig wie der Erzengel Michael, der einer armen Seele an der Himmelspforte begegnet.
Irgendwie – vielleicht ist es auch sein sechster Sinn – hat Steel sogar mit der späten Beförderung gerechnet. Er ist nicht dagegen, und seiner zivilen Reputation kann es nur nutzen, wiewohl er auf seine zivile Reputation eigentlich pfeift. Früher, als er sich als Untergeordneter mit Stabsoffizieren herumschlagen mußte, die von Falschgeldbekämpfung nichts verstanden, aber streng auf Subordination achteten, wäre es weit nützlicher und notwendiger gewesen. Vielleicht stellt die Ehrung in Washington nur eine Art subtiler Rache dieser Barrashengste dar. So oder so, Steel wird sich auf die Visitenkarte ›Major a. D.‹ drucken lassen, ob er nun künftig als Anwalt arbeitet oder als Businessman oder sich entschließt, den Rest seines erwartungsgemäß noch längeren Lebens als Globetrotter zuzubringen – gut macht sich der überflüssige Titel immer, gegebenenfalls noch beim Nachruf am offenen Grab.
Er erledigt Besorgungen und Einkäufe. Die Knollennase ist nicht mehr zu sehen. Auch kein anderes Gesicht taucht zum zweiten oder dritten Mal auf.
New York gefällt dem Mann aus Arizona am Nachmittag schon viel besser als am Morgen. Es wimmelt von hübschen Mädchen aller Hautfarben mit dem unnachahmlichen Gang, zu dem Boulevards erziehen. Die Versuchung multipliziert sich, und ein Mann, sagt sich Steel, ist eigentlich ein armer Teufel, weil er von einer Gelegenheit in die andere Verlegenheit stolpert. Warum hat der Ölkönig Ibn Saud zum Beispiel mehr als fünfhundert Frauen, da ihn schon fünf überfordern müßten oder drei oder vielleicht sogar eine einzige, wenn sie ein Vulkan ist. Er erreicht das ›Plaza‹; es wird Zeit, sich ganz auf Mrs. Gipsy Sandler einzustellen. Ob sie wirklich einmal Stewardeß war und sich dabei ihren Geschiedenen angelte, einen reichen Trunkenbold? Es mag stimmen oder auch nicht – alle Frauen schwindeln ein wenig und die wahrheitsliebenden womöglich am meisten. Für einen Mann wie ihn ist die Legitimation einer Frau ihr Aussehen und in dieser Hinsicht hat die Werbedame aus Philadelphia wohl fast bei allen Männern freien Durchlaß.
Steel täuscht sich nicht: Der Mann mit Stirnglatze in der Lederjacke stolpert ihm fast über die Beine. Er sieht ihn jetzt zum dritten Mal. Falls der Bursche ihn tatsächlich beschatten soll, ist er ein Stümper. Unsinn, rügt sich der Abwehroffizier selbst, entschlossen, sich nicht länger mit Taggespenstern herumzuschlagen. Er geht ins Hotel, fährt in sein Apartment hinauf. Er betrachtet sich im Spiegel. Steel ist weder unzufrieden noch uneitel. Er rasiert sich zum zweiten Mal, wozu er sich nur bei der Vorbereitung erhoffter Premieren zwingt.
Als das Telefon läutet, nimmt er mit eingeseiftem Gesicht den Hörer ab.
»Ich hab’ mich verspätet, Bob«, sagt Mrs. Sandler mit ihrer moussierenden Stimme. »Geben Sie mir noch eine halbe Stunde?«
»Ungern«, erwidert er, »und ungeduldig. Ich werde unten auf Sie warten, Gipsy.«
Eine kapriziöse Frau ist selten pünktlich. Mrs. Sandler benötigt fast eine Stunde. Als sie dann auftaucht in ihrem knallroten Chiffonkleid mit dem geschickt geschnittenen Dekolleté, das ein wenig von dem preisgibt, was es zu verhüllen scheint, macht sie sogar in der Nobelherberge Furore, und das heißt etwas in New York. Sie zeigt nicht sehr viel Haut, doch genug, um Appetit auf den ganzen Körper zu machen. Die meisten Männer in der Halle müssen den gleichen Geschmack haben, denn sie starren Gipsy an, zum Ärger ihrer Begleiterinnen, getreu der Gewohnheit: Man ist Mann. Die Bewunderte scheint gewachsen zu sein. Sie geht sicher auf Schuhen mit den höchsten Absätzen, die Robert S. Steel je gesehen hat; ihre schicke Garderobe trägt sie wie selbstverständlich, in erster Linie führt sie sich vor.
Der Mann, der sie erwartet, erhebt sich, geht ihr entgegen, rückt ihr den Sessel zurecht, begegnet furchtlos den Blicken der Umsitzenden, die ihn am liebsten mit den Augen töten würden. »Im Harem sitzen heulend die Eunuchen«, zitiert er einen Kalauer, den er in Deutschland aufgeschnappt hat. »Die Lieblingsfrau des Sultans ist entfloh’n.«
»What did you say?« fragt Gipsy und nimmt Platz.
»It’s really not that important«, erwidert er lächelnd. »Only a German saying. Sie sehen so gut aus, Gipsy, daß Sie mich neidisch auf mich selber machen. Mußten Sie Überstunden bei ›Myers & Niggel‹ machen?« fragt er dann.
»Die Besprechung hat sich in die Länge gezogen«, berichtet die Vielbeachtete. »Aber alles in allem war sie recht erfreulich. Ich will Sie nicht mit diesen fachlichen Dingen langweilen, Bob, aber an jedem Werbeetat verdienen wir fünfzehn Prozent, müssen allerdings die Spesen selbst tragen. Das Europageschäft ist groß im Kommen. ›Myers & Niggeb war eine der ersten Firmen, die das begriffen haben; die anderen machen es uns nach, aber wir haben die Nase vorn.«
Steel nickt, wiewohl er ihr nicht richtig zuhört. Sein Blick gleitet von dem schnurgeraden Scheitel abwärts zur Nase, dem Kinn, verfängt sich zwangsläufig in ihrem Dekolleté.
»Attention, Bob!« sagt Mrs. Sandler lachend. »Ihre Augen sind in den Schacht gefallen.«
»Aber da liegen sie gut, verdammt gut«, erwidert er, keine Spur zerknirscht. »Ich muß zugeben, Sie verstehen wirklich viel von Produktwerbung, Gipsy.«
»Danke«, erwidert sie. »Am liebsten hätten mich ›Myers & Niggeb gleich nach Europa zurückgeschickt. Diesmal nach Rom; wir vertreten in Europa bereits »General Motors‹, ›Coca-Cola‹, ›Du Pont‹ und etliche andere Firmen. Die Geschäfte würden explodieren, wenn es uns gelänge, sie in beiden Richtungen zu führen, zum Beispiel mit ›Fiat‹ oder großen Weinfirmen oder bekannten Schuhdesignern. Wissen Sie übrigens, daß die Italiener führend in der Schuhmode sind?«
»Ich weiß es nicht«, entgegnet Steel lachend, »aber ich sehe es an Ihren Füßen.« Es gibt ihm einen Vorwand, ihre Beine ausgiebig zu betrachten. »Schlechte Aussichten für uns, was? Kaum haben wir uns kennengelernt, fliegen Sie schon wieder aus.«
»Ich bin viel unterwegs, Bob, aber niemals aus der Welt. In Rom wohne ich im ›Excelsior‹, in Paris im ›Ritz‹ und in London im ›Claridge‹ …«
»Vornehm geht die Welt zugrunde«, blödelt der Lover in spe.
»Meine Firma besteht darauf«, erklärt die Dunkelhaarige. »Aus Repräsentationsgründen. Wir stehen jetzt an dritter oder vierter Stelle im Umsatz und …«
»Schon gut«, wehrt der Mann aus Arizona weitere Feststellungen ab. »Ich wollte Ihnen gerade einen Trip in meine Heimat zum Grand Canyon vorschlagen.«
»Vielleicht können wir ihn eines Tages nachholen«, entgegnet Gipsy und sieht ihn lächelnd an. »Haben Sie Heimweh, oder wollen Sie sich als Cowboy im Sattel vorführen?«
»Wenn Sie wollen, als Messerwerfer, Lassoschwinger oder auch als Feuerschlucker«, versetzt er.
»Sorry«, erwidert sie. »Ich rede immer nur von mir. Wie ist es Ihnen am ersten Tag ergangen?«
Der zivile Captain wartet, bis der Ober die beiden Highballs abgestellt hat. Dann hebt er das Glas. »Cheers, Gipsy!« sagt er. »Auf uns – und auf meinen Abgang bei der US-Army.«
»So schnell?«
»Ich werde morgen offiziell verabschiedet. Vom Verteidigungsminister persönlich. In Washington.«
»Gratuliere, Captain!«
»Major, bitte«, erwidert er spöttisch renommierend: »Ehre, wem Ehre gebührt.«
»Marvellous, Bob«, versetzt die schwarze Madonna. »Bottons up, Major!«
Sie vertreten sich die Beine, schlendern downtown bis zum Broadway und nehmen im Prominententreff bei ›Sardi’s› einen weiteren Cocktail, fahren dann mit dem Taxi nach Chinatown. Beide sind ein bißchen beschwipst und lachen, weil ihnen beim Essen der Reis immer wieder von den ungewohnten Stäbchen fällt.
»Man ißt länger und wird nicht dick davon«, sagt Gipsy lachend: »Deshalb komme ich so gern hierher.«
Steel legt den Arm um sie und küßt sie mitten im Lokal. Ein paar Umsitzende reagieren verärgert, andere belustigt. New York ist nicht Paris, aber die Toleranz wird sich ausbreiten, zumindest zwischen Hudson und East River, dem ›Big Apple‹ in den jeder gern bisse.
»Du muß morgen vermutlich schon bald aus den Federn?« fragt die schwarze Madonna.
»Ich bin ein Steher …«
»Auch ein Aufsteher?«
»Wer sich erheben will, muß zuerst einmal stürzen«, erwidert er anzüglich. »Ich möchte stürzen – und zwar in deine Arme.«
Nach einem kurzen Abstecher in einen Jazzkeller in Greenwich Village fahren sie zum Hotel zurück und nehmen im hauseigenen ›Trader Vic’s‹ den unwiderruflich letzten Drink. Einen Moment lang erinnert sich Robert S. Steel an seine Militärzeit, wo er als Infanterist vor dem Sturmangriff Schnaps tankte; aber er trägt keine Stiefel, sondern elegante Slippers, und seine Attacke wird nicht feldmarschmäßig ausgeführt.
Er erhebt sich höflich und bittet seine Dame um den nächsten Tanz.
Sie bewegen sich zum erstenmal gemeinsam rhythmisch; es klappt auf Anhieb. Er führt gut und aggressiv, dabei sieht er sie voll an. Linksdrehung. Er beugt sich über sie. Rechtsdrehung. Ihre Nähe macht ihn heiß und wild. Wechselschritt. Ihre dicht aneinandergedrängten Körper gehen auf Distanz und prallen dann wieder zusammen – zwei Stichflammen vereinigen sich zu einem Großbrand.
»Wie kommen wir jetzt weiter, Gipsy?« raunt er ihr ins Ohr.
»Deine Sache«, entgegnet sie.
»Alles erlaubt?« fragt er.
»Was gefällt.«
»Und was gefällt?«
»Das …«, versetzt die schwarze Madonna, » … solltest du selbst herausbekommen. Aber vergiß nicht, daß du morgen dem Kriegsminister Aug in Aug …«
»Kuß um Kuß«, erwidert er. »Eine ganze Nacht lang.« Er beugt sich zu ihr hinab, und sie wächst ihm entgegen.
»Übernimm dich nicht«, raunt ihm Gipsy zu.
»Laß dich überraschen«, entgegnet er. »Zu dir – oder zu mir?«
»Wie wär’s dir denn lieber?« Sie geht auf Steels Ton ein.
»Am liebsten wäre es mir sofort.«
»Du bist mir ein schöner Verführer«, entgegnet Gipsy.
Sie gehen zum Tisch zurück. Steel zeichnet die Rechnung ab. Der Lift schnellt sie nach oben, und aus dem Apartment Nummer 331, dessen Schwelle Bob, der Eroberer überschreitet, kommt heute kein Promotions-Direktor. Zwei, die sich anziehend finden, beginnen einander auszuziehen, zuerst langsam und kundig, dann ungestüm und ungeschickt.
Eng umschlungen, außer Atem, kippen sie auf das französische Bett, um wie Kannibalen übereinander herzufallen, wieder und noch, am Rande der Besinnung.
Was James A. Partaker, der eigentliche Macher bei der Agency, vom ersten Moment an befürchtet hat, tritt schlagartig ein. An mehreren Plätzen der USA werden Dollar-Duplikate geortet: in New York, Las Vegas, Miami und Los Angeles. Neben den bereits ausgemachten Fünfzig-Dollar-Blüten tauchen erstmals Greenbacks mit dem Nennwert Hundert und dem Bildnis des 1790 verstorbenen Staatsmanns und Puritaners Benjamin Franklin auf. Dieser Vielbegabte hatte einst auch den Blitzableiter erfunden.
Es erscheint dem Drahtzieher der Agency wie schierer Hohn, denn er und seine Männer sind nunmehr schutzlos dem Währungssturm ausgesetzt.
Die heimliche Hoffnung, der Täter sei ein unehrlicher Finder, der seine Zufallsbeute so nach und nach an den Mann bringe und damit aufhöre, wenn seine Bestände zu Ende seien, hat sich zerschlagen. Aus dem gleichzeitigen Vertrieb der Lardos an vier verschiedenen Orten muß geschlossen werden, daß eine Bande von Professionellen – Kriminellen oder Politischen – die Verteilung organisiert. Es ist zu befürchten, daß nach den ersten Testversuchen in der Schweiz die Falschmünzer jetzt eine Lardo-Lawine lostreten, die immer größer und unaufhaltsamer wird.
Vergrößern sie den Kreis der Mitwisser, was sich auf die Dauer nicht vermeiden läßt, gefährden sie die Geheimhaltung. Schweigen sie über die horrende Gefahr, könnten sie mitschuldig werden an einer bodenlosen Falschgeldaffäre. Computer, die eine Überwachung des Geldverkehrs erleichtern würden, stecken noch in den Kinderschuhen. Immerhin kann man ihre Vorläufer, riesige Hollerithmaschinen, zur Registrierung der Geldscheinnummern einsetzen.
Zunächst einmal verstärkt die Aufsichtsbehörde der Banken die Routinekontrollen der Barbestände, wobei die Beauftragten meistens den eigentlichen Zweck des Besuches gar nicht kennen. Sie registrieren einfach die Nummern von Geldscheinen; werden übereinstimmende Nummern an anderer Stelle notiert, weiß man, daß es sich um eine echte und um eine falsche Dollarnote handelt. Falls die Rechercheure allzu häufig bei den Banken auftauchen, zünden sie Unruhe und lösen Gerüchte aus. Gerede aber kann in einer Branche, die das Gras wachsen hört, tödlich sein.
Während die gemischte Kommission der Agency der US-Bundespolizei noch Gelassenheit vortäuscht, geraten die Mitglieder des Zentralen Bankrats, der obersten Geldbehörde der USA, außer Rand und Band. Dieses Instrument regelt den Geldumlauf, sorgt durch Verknappung oder mengenmäßige Anpassung dafür, daß die Währung stabil und resistent gegen Inflations-Tendenzen bleibt. Tauchen nunmehr von echten Noten nicht zu unterscheidende Dollarblüten auf, muß die Steuerung versagen und die Wirtschaft in ein Chaos treiben. Da Greenbacks die Leitwährung der westlichen Welt sind, zögen sie auch die Mark, das Pfund, den Franc, den Gulden, die Lira und weitere Währungen mit in den Strudel. Das könnte im schlimmsten Fall eine Moneten-Dämmerung bedeuten, die die westliche Wirtschaft ruinieren würde, ohne daß der Osten auch nur einen Schuß abfeuern müßte.
Schwarzer Freitag ante portas.
Craig Ginty untersucht die Verbindungen der fünf großen ›Cosa-Nostra‹-Familien New Yorks zur sizilianischen Mafia, von der sie abstammen. Er stellt zu seinem Entsetzen fest, daß fast alle Mafia-Häuptlinge, die Generalstaatsanwalt Dewey einst hinter Schloß und Riegel gebracht hatte, als Folge des Zweiten Weltkrieges wieder auf freiem Fuß sind.
Als ehemaligen OSS-Mitgliedern ist den beiden Experten bekannt, daß die US-Marine-Abwehr mit den Gangstern zusammengearbeitet hat. Nachdem Hitler den USA den Krieg erklärt hatte, waren in rascher Folge in amerikanischen Gewässern von deutschen U-Booten neunzig Schiffe versenkt worden. Damals kannte man die Reichweite der modernsten Unterwasserschiffe noch nicht, deshalb hatte die US-Marine in erster Panik angenommen, die Unterwasserschiffe würden von Saboteuren an entlegenen Küstenorten mit Brennstoff und Proviant versorgt.
Dieser Verdacht war unsinnig gewesen, Tatsache aber blieb, daß der New Yorker Hafen von Agenten und Spionen unterwandert und von der kriminellen Hafenarbeiter-Gewerkschaft beherrscht wurde. Beim III. Marine-Distrikt kamen schlau-bedenkenlose Abwehroffiziere auf den verzweifelten Gedanken, sich mit den Mafiosi zusammenzutun, um den Hafenbetrieb zu befrieden und das Auslaufen der Frachter künftig geheimzuhalten.
Der Boß der Bosse, Charles ›Lucky‹ Luciano saß seit neun Jahren im Gefängnis von Great Meadow wegen Zuhälterei eine Strafe von dreißig bis fünfzig Jahren ab. Auf einmal verwandelte sich seine Zelle in ein Boudoir ›patriotischer‹ Gangster, deren jeder mindestens ein halbes Dutzend Morde auf dem Schuldkonto hatte: Horror-Gestalten aus einem Gruselfilm wie Frank Costello, ›Little Man‹ Meyer-Lansky, Josef ›Socks‹ Lanza, Mikey Lascari und Willi Moretti gingen ein und aus und besprachen, wie man der bedrohten Marine helfen und gleichzeitig die eigenen krummen Geschäfte fördern könnte.
Beides gelang; aber die große Stunde des Obergangsters kam, als sich Churchills Forderung durchsetzte, ›Schläge gegen den weichen Unterleib Europas‹ zu führen. Die Amerikaner waren wenig begeistert, einen Kriegsschauplatz nach Italien zu verlegen; sie wollten bei der Invasion in Frankreich gewissermaßen auf der Dirittissima nach Deutschland vorstoßen – doch so weit waren sie noch nicht. Sie ließen sich auf das Abenteuer am italienischen Stiefel ein, und das hieß: zunächst Landung in Sizilien, einer Insel, die seit Jahrhunderten von der Mafia beherrscht wurde.
Benito Mussolini gehörte zu den Todfeinden des Geheimbundes, den er mit original faschistischen Methoden bekämpfte, indem er wahllos Schuldige wie Unschuldige zusammenfangen, erschießen, foltern oder deportieren ließ.
Gestützt auf die guten Erfahrungen mit New York, fragten sich die blauen Abwehroffiziere, ob Luciano nicht auch bei der Invasion in Italien wertvolle Hilfsdienste leisten könnte. Bald zogen sich Fäden vom Staatsgefängnis Great Meadow bis nach Sizilien. Die Mafiosi, die dort überlebt hatten und im Untergrund auf ihre Chance warteten, waren auf Lucianos Fürsprache hin sofort bereit, den Anglo-Amerikanern zu helfen und dabei wiederum Geschäfte in die eigene Tasche zu machen.
Sie spionierten die Befestigungsanlagen und die Stärke der Abwehrkräfte aus. Besonders erfolgreich jedoch waren sie dabei, die Masse der ohnedies wenig kriegsbegeisterten italienischen Soldaten anzusprechen und zum Überlaufen oder Desertieren zu bewegen. Daß General George Patton bereits zehn Tage nach der Landung in Sizilien Palermo, die heimliche Mafia-Hauptstadt, erobert hatte, verdankte er nicht nur seiner aggressiven Tüchtigkeit, sondern auch Verbrechern, mit denen er sonst nichts zu tun haben wollte. Bei der nächsten Landung in Salerno leistete die Mafia wiederum blutsparende Dienste.
Luciano triumphierte, wenn auch – vorläufig noch – hinter Gittern.
Selbst hier blieb er noch die kriminelle Nummer Eins. Den Namen ›Lucky‹ (der Glückliche) führte er seit 1929, als er, mehr tot als lebendig, in einem Lagerhaus in Staten Island mit zahlreichen Stichwunden, zerschnittener Kehle, als blutiger Klumpen am Balken hing und kaum noch zappelte. Seine Folterer und Mörder – rivalisierende Gangster – hatten Luciano für tot gehalten und sich entfernt. Mit unglaublicher Energie war es dem Malträtierten dann gelungen, seine Finger aus den Fesseln zu ziehen, vom Balken zu Boden zu plumpsen und sich den durchgebluteten Leukoplastknebel vom Mund zu reißen.
Seine Wunden verheilten, und sein Aufstieg bei der Cosa Nostra war programmiert. Luciano beendete die Gangsterkriege und rückte bei den ›Freunden der Freunde‹ zum ›Boß der Bosse‹ auf. Er hatte ein Imperium für Bordelle, Schutzgebühren, Spielhöllen, Falschgeldverbreitung, illegale Wettbüros und Rauschgift; er teilte und herrschte, bis er 1936 ausgeschaltet wurde. Lucky Luciano war erledigt. Das Urteil sah vor, daß er bei guter Führung frühestens im Jahre 1976 ein erstes Gesuch auf vorzeitige Haftentlassung einreichen dürfe.
Überraschend wurde der ›eleganteste Gangster der dreißiger Jahre‹ am 2. Februar 1946 von dem gleichen Gouverneur Thomas E. Dewey begnadigt und nach Italien abgeschoben, der ihn einst als Generalstaatsanwalt gejagt und überführt hatte. Seitdem lebte der Obergangster mit den kleinen Augen, den leicht abstehenden Ohren, dem fleischigen Mund und der niedrigen Stirn in Neapel unter den Augen der Polizei. Aber was sagt das schon in einem Land, das zumindest in seinen südlichen Regionen von Mafia und Camorra beherrscht wird?
Sicher ist, daß Luciano die Verbindung zu seinen alten Ganovenfreunden längst wieder aufgenommen hat und ein reger Meinungs –, Waren- und Menschen-Austausch zwischen Napoli und New York herrscht. Noch immer trägt Lucky seidene Morgenmäntel, noch immer leistet er sich Affären mit Frauen, noch immer handelt er mit Rauschgift. Eine amerikanische Zeitung beschreibt den Gangster-Anführer als ›schlau und raubgierig, von einer wilden Grausamkeit. Wie eine todbringende Kobra schlängelt sich dieser müdäugige Schläger um die Unterwelt der Ostküste und preßt unbarmherzig das verderbte Geld aus ihr heraus. Dabei ist er die Freude der Buchmacher, das Entzücken der Straßensänger, ein Dracula in der Maske eines gutmütigen Lebemannes.‹
Die Beziehung Mafia-Abwehr ist noch immer ein Staatsgeheimnis; noch ahnt die amerikanische Öffentlichkeit nichts von dem wahnwitzigen Zusammenspiel. Der kraushaarige FBI-Fahnder Craig Ginty kann, trotz aller Vollmachten, nicht in das Dickicht der damaligen Verstrickung eindringen: Wo immer er anklopft, bleiben die Türen verschlossen und die Dossiers ungeöffnet, davon abgesehen, daß der für den New Yorker Hafen zuständige III. Marine-Distrikt die Akten längst beseitigt hat. Wenn Ginty Gesprächspartner unter Druck setzt oder ihnen Strafmaßnahmen ankündigt, erreicht er nicht mehr als ein Kopfschütteln oder Gegendrohungen.
Was gilt schon die Vollmacht eines Präsidenten, der in den nächsten Tagen abgewählt werden wird?
Die Strapazen der Überstunden sind Ginty und Partaker in die Gesichter gestempelt; wenig Schlaf, wenig Hoffnung, viel Kaffee und Leerlauf. Es ist typisch, daß sich die beiden schon morgens um sechs Uhr in der improvisierten Dienststelle treffen, die sie im Pentagon eingerichtet haben. Jeder arbeitet auf seinem Gebiet: Der CIA-Vice überwacht die Auslandsfahndung, der FBI-Experte ist für die Investigation auf dem Boden der USA zuständig. Bei dem Vertrauensverhältnis, das zwischen den beiden herrscht, gibt es weder Überschneidungen noch Grenzen; gemeinsam aber ist auch die Erfolglosigkeit.
Die Erkundung in der Sowjetunion hat die ›Organisation Gehlen‹ übernommen, Hitlers frühere Wehrmachtsabteilung Fremde Heere Ost. Sie ist zum überwiegenden Teil den Amerikanern, die keinerlei Nachrichtendienste in Rußland unterhielten, beim Zusammenbruch als Beute zugefallen. Die Skrupel, die man anfänglich im Pentagon gegenüber einem persönlich schillernden und politisch kompromittierten Untergrundgeneral hatte, nahmen im gleichen Maße ab, als die Pullacher Spione bei der Rußlandaufklärung Erfolge vorweisen konnten. Reinhard Gehlen, ein notorischer Kommunistenfresser, dem man keinerlei Entgegenkommen der Sowjetunion gegenüber nachsagen kann, ist eher skeptisch, was eine russische Urheberschaft der Dollar-Fälschungen betrifft. Wollten die Sowjets zu diesem Mittel greifen, dann würden sie die Ausführung vermutlich einem ihrer Satellitenstaaten überlassen. Außerdem seien sie in Fragen der Wirtschaft weit verläßlicher als in politischen: viel Theorie – wenig Wolle.
»Es wird in Kreisen, die es wissen könnten, bereits gemunkelt, daß bei der Freilassung Lucianos damals dreihunderttausend Dollar den Besitzer gewechselt haben. Vielleicht kommen deshalb bald Milliarden falscher Dollars auf uns zu. Wenn wir die ›Marine-Blockade‹ nicht durchbrechen können, ist es so gut wie ausgeschlossen, auf der Mafiaspur auch nur einen Schritt weiterzukommen.«
»Ihr habt doch sicher eure Leute in die fünf New Yorker Familien eingeschleust …«
»Zwei sind gerade ermordet worden«, erwidert Ginty. »Einer in dieser, der andere in der vergangenen Woche. Zwar gilt auch bei der Cosa Nostra die ›Omértà‹, das Gesetz des Schweigens, aber nicht so total wie bei der sizilianischen Mafia; aber wer redet, wird auch hier ausgelöscht. Wenn sich unsere Spitzel zu weit vorwagen, landen sie, einzementiert in einem Faß, auf dem Grund des Hudson oder des East River. Gehen sie nicht nahe genug an die Akteure heran, erfahren sie nichts.«
»Reg dich nicht auf, Craig!« besänftigt ihn Partaker, selbst beunruhigt. »Noch haben wir ja keinerlei Beweise, daß die Mafia hinter diesen Lardos steckt.«
»Welch ein Trost!« versetzt der appetitlose Feinschmekker hämisch. »Wollen wir nicht endlich Bob Steel zu Hilfe rufen?«
»Er ist bereits gestern in New York gelandet und im ›Plaza‹ abgestiegen. Voraussichtlich wirst du ihn heute mittag noch in Empfang nehmen. Es ist nur noch etwas abzuklären …«
»Lächerlich«, erwidert der Falschgelddezernent. »Uns steht das Wasser bis zum Hals, und du vertrödelst die Zeit mit überflüssigen Überprüfungen.«
»So überflüssig auch wieder nicht«, versetzt Partaker. »Ich schließe mich gern deiner Meinung über die Redlichkeit Steels an. Aber nun denk doch einmal nach, Craig: Ihr habt seinerzeit in Bad Aussee auf einen Schlag dreiundzwanzig sargähnliche Kisten mit einundzwanzig Millionen Pfundnoten sichergestellt – später noch weitere Summen –, aber nicht einen einzigen Dollar.«
»Facts sind nun einmal facts.«
»Könnte nicht ein Mitglied der Kommission die Lardos gefunden und zum eigenen Gebrauch auf die Seite gebracht haben?«
»Das halte ich für ausgeschlossen …«
»Zum Beispiel der Chef selbst? Wie ich den Akten entnehme, hat sich Steel alle wichtigen Vernehmungen persönlich Vorbehalten.«
»Das tust du doch auch, James, wenn’s darauf ankommt«, kontert Ginty.
»Das tut in einem solchen Fall jeder, der etwas von seinem Handwerk versteht«, räumt der CIA-Gewaltige ein. »Aber nicht jeder führt in seinem Reisegepäck sechzigtausend Dollars im Nennwert von je fünftausend Greenbacks mit sich …«
»Du meinst, Steel hat einen Koffer voll Geld bei sich gehabt?«
»Zwölf Madisons, soeben einbezahlt bei einer Filiale der ›Chase Manhattan« in New York.«
»Und das waren Lardos?« fragt Ginty heftig.
»Mal den Teufel nicht an die Wand!« dämpft der Partner seinen Unmut. »Bis jetzt haben wir es ja nur mit gefälschten Fünfzig- und Hundert-Dollar-Noten zu tun. Aber du mußt doch zugeben, daß es ziemlich ungewöhnlich ist, wenn ein kleiner Captain mit soviel Geld über den Atlantik fliegt.«
»Ich hab’ dir ja gesagt, daß Bob ein höchst ungewöhnlicher Mann ist.«
»Aber bevor ich deinem Old Fellow Vollmachten anvertraue, vor denen mir selbst schwindlig wird, sehe ich ihn mir mindestens dreimal an«, erklärt der CIA-Vice. »Heute mittag haben wir ihn hier. Ob meine letzte Kontrollmaßnahme bis dahin abgeschlossen ist oder nicht – ausquetschen werden wir ihn in jedem Fall.«
Bankgeheimnisse, zumal schweizerische, sind zwar vor der Steuerfahndung dicht, aber ein Geheimdienst, der in einem solchen Fall nicht hintenherum die Indiskretion schafft, taugt nichts. Kurz nach Mitternacht Ortszeit meldet sich der CIA-Außen-Agent Gellert telefonisch aus Zürich: »Ich hab’s, Sir«, sagt er. »Unser Mann hat tatsächlich eine mütterliche Erbschaft gemacht, als Teilhaber einer Erbengemeinschaft, und zwar schon vor einem halben Jahr. Das Geld verwahrte er auf einem Konto der ›Nobis‹-Bank in Zürich. Ein Bankbeamter hat sich deshalb genau an diesen Vorgang erinnert, weil unser Mann unbedingt die Summe in Form von zwölf Madisons ausbezahlt haben wollte und die Bank einige Schwierigkeiten hatte, so große Scheine in Zürich aufzutreiben.«
»Laß dich vergolden, Frankie«, schließt Partaker das Gespräch.
Captain Robert S. Steel, in wenigen Stunden Major Steel, hat die letzten Bedenken des CIA-Gewaltigen zerstreut.
Der Tag, in den die Hitze der Nacht mündet, ist noch jung und kühl. Bob Steel fröstelt einen Moment, als er sich nackt aus den Armen der Schlafenden löst und auf seine Armbanduhr sieht: sieben Uhr dreißig, New Yorker Zeit, zu früh noch, um aufzustehen, zu spät eigentlich, um Gipsy aufzuwecken und anzuheizen. Ein Spalt in der Fensterjalousie malt Längsstreifen in ihr Gesicht, Licht und Schatten – sie ist ohnedies eine Frau mit Atmosphäre. Die Haare der schwarzen Madonna sind zerwühlt, ihr Gesicht wirkt glatt und sanft wie die Oberfläche eines Bergsees bei Windstille.
Schon während des Flugs hatten die beiden einander eingeheizt und gespürt, daß einer zum Brandstifter des anderen werden könnte, und so war der Mittdreißiger auf einen nächtlichen Ausbruch der Sinnlichkeit gefaßt gewesen. Trotzdem wurde er dann doch von den Eruptionen eines Vulkans überrumpelt. Steel mochte Frauen; Frauen waren sein Fall, nicht selten auch sein Sündenfall. Er schätzte die Abwechslung, aber über der Nachfolgerin vergaß er selten die Vorgängerin. Jetzt, da er im Katalog seiner Vergangenheit blättert, tut er sich schwer damit, eine ebenbürtige Matratzen-Matadorin zu finden.
Er lotet die Schlafende aus; sein Blick wird zum Nimmersatt. Ist er bereits verliebt? So genau kann er es nicht analysieren. Bislang ist er immer mit Bravour in Affären hineingestolpert, um sich schon bald mit Fraktur wieder herauszuwinden – ein Blessierter der Gewohnheit. Irgendwie spürt Steel, aufgewühlt wie beglückt, daß ihm diese Frau aus Philadelphia womöglich mehr bedeuten könnte als seine bisherigen Eintagsliebchen.
»Schuft!« sagt sie. »Du vergleichst mich bereits mit anderen …«
»Du bist doch unvergleichlich«, entgegnet er. »Seit wann unterschätzt du dich?«
»Wir müssen verrückt sein«, plaudert Gipsy, noch etwas schlaftrunken. »Du genauso wie ich.«
»Verrückt aufeinander, Mrs. Sandler.«
»Nenn mich nicht Mrs. Sandler«, versetzt die schwarze Madonna und gähnt. »Nenn mich deine Partnerin, Gespielin, Geliebte oder ganz einfach deine Reisebekannte mit dem nervösen Unterleib …«
»Am Morgen auch?« fragt Steel und zieht sie an sich.
Gipsy macht sich steif. »Nein, nicht schon wieder«, wehrt sie ihn ab. »Kannst du nicht einmal ernsthaft sein? Außerdem mußt du doch nach Washington …«
»Das Pentagon ist weit, doch du bist nah«, entgegnet er, bereits leicht außer Atem. »Und wenn wir nicht so lange herumreden, sondern zur Tat …«
»Ich bin gegen Quickies«, versetzt sie. »Vor allem am Morgen – nein, überhaupt bin ich dagegen.«
»Ich auch«, versichert Steel, »aber nicht wenn Not am Mann ist. Weißt du, daß sich Tiger alle zwölf Minuten miteinander paaren – drei Tage lang?«
»Du Bestie!« entgegnet Gipsy. Sie gähnt demonstrativ. »Mußt du denn um diese Zeit schon so munter sein?«
»Ich bin Frühaufsteher«, erklärt er.
»Ich dachte, du seist ein Nachtmensch.«
»Beides«, erwidert Steel. »Ich brauche nicht viel Schlaf, und der frühe Tagesbeginn ist eigentlich die einzig bewiesene Art, sein Leben wirklich zu verlängern.«
»Eine gräßliche Philosophie, Bob«, entgegnet Gipsy.
Sie schnellt hoch und stürzt sich auf ihn.
Steel fängt sie auf.
Der Funke springt sofort über, wird zum Lauffeuer auf der Haut. Ihre Körper foltern und mögen sich. Das Karussell dreht sich im wilden Morgentaumel, zwei, die sich ineinander verkrallt haben, wirbeln herum: Washington, der Flug, die Beförderung, der Kriegsminister – nichts kann das Karussell anhalten. Und Colonel Wringler, der uniformierte Frühstücksdirektor, der ihn vom ›Plaza‹ abholen wird, soll warten.
Sie liegen erschöpft in den Kissen.
Bob Steel sieht wieder auf die Uhr. Inzwischen ist es wirklich Zeit, aber er verlängert noch einmal um ein paar Minuten, nicht nur weil er eine Schnaufpause nötig hat.
Sie liegen nebeneinander, ihre Herzen schlagen wieder ruhig, keiner sagt ein Wort.
In Mrs. Sandlers Apartment klingelt das Telefon. Laut, aufdringlich.
»Laß«, sagt Gipsy.
Als Bob Anstalten macht, abzuheben, nimmt sie ihm den Hörer aus der Hand. »Nein, jetzt nicht«, wehrt die Werbedame einen Anrufer verärgert ab. »Auf keinen Fall. Ich verbitte mir künftig wirklich jede Störung um diese Zeit. Ich ruf später zurück – wenn ich ausgeschlafen habe.«
Sie legt den Hörer auf, teils verlegen, teils wütend.
»Schon wieder der Promotion-Direktor deiner Scheißfirma?« fragt der Liebhaber ironisch.
»Wirklich ein aufdringlicher Mensch«, behauptet Gipsy, »wenn auch ein großzügiger.«
»Trage ich vielleicht schon ein Geweih?«
»In diesem Fall würde er es tragen«, entgegnet die dunkle Schönheit, nicht unlogisch.
Sie lachen beide.
Endgültig ist der Demobilisierte in Zeitnot. Er springt unter die Dusche, trocknet sich ab, schlüpft in den Anzug von gestern, hastet in sein Apartment zurück, zieht die Uniform an, wie er annimmt, heute zum letzten Mal im Leben. Er begutachtet sich im Spiegel. Eigentlich ist das maßgeschneiderte olivgrüne Tuch genauso ungebügelt wie sein Gesicht.
Colonel Wringler wartet schon seit dreizehn Minuten in der Halle. Mit hochrotem Kopf kommt er Steel entgegen, versucht schnaubend Verständnis für die Verspätung vorzutäuschen.
»Sorry, Sir«, sagt der Erwartete, »aber Sie wissen ja, die Indianer greifen immer im Morgengrauen an …«
»Macht gar nichts«, quittiert der Wichtigtuer die seltsame Entschuldigung. »Aber das Flugzeug – wissen Sie, eine Kuriermaschine – wartet nicht eine Minute. Es wäre doch peinlich, sie zu versäumen und den Minister zu versetzen.«
»Weiß Gott«, entgegnet der Gerügte und grinst.
Der Fahrer jagt durch Manhattan, als wäre der Gerichtsvollzieher hinter ihm her. Sie erreichen die Zubringermaschine sogar noch ein paar Minuten zu früh; sie startet auf die Minute pünktlich. Glatter Flug. Glatte Landung. Dann eine Überraschung am Ziel: Am Fuß der Bodentreppe steht Craig Ginty und winkt schon von weitem.
Die beiden umarmen einander erfreut und spröde.
»Die Bundespolizei hat dich nicht vergessen, Bob«, erklärt Craig dann, als sie in den Hubschrauber umsteigen, der sie in das Pentagon bringt. »Präsident Hoover persönlich hat mich als offiziellen FBI-Vertreter zu deinem Ehrentag abgestellt.«
»Besser dich als einen anderen«, spöttelt Steel, offensichtlich ganz der alte. »Freut mich, dich zu sehen. Du bist ja jetzt ein ganz hohes Tier bei der Bundespolizei.«
»Ich bin die Treppe hinaufgefallen«, bestätigt Ginty. »Ich leite das Ressort Falschgeldbekämpfung.«
»Congratulations«, entgegnet der Gast. »Meine alte Abteilung.« Der alte Kumpel wirkt zerfahren, Unruhe plissiert sein Gesicht. Ein Vielfraß, der wie ein Magenkranker wirkt. »Sorgen?« fragt ihn der Ankömmling.
Craig nickt stumm.
»Mit der Familie?«
»Das auch«, antwortet der FBI-Experte mit einem unechten Lachen. »Meine Frau droht ständig, sich scheiden zu lassen, weil sie mich nie zu sehen bekommt.«
»Also berufliche Schwierigkeiten?«
»Sagen wir einmal: Probleme«, erwidert Ginty.
Sein Blick fällt auf Colonel Wringler.
Bob Steel erfaßt, daß der Freund und Helfer von einst vor einem Dritten nicht weitersprechen wird.
Der Verteidigungsminister läßt sich nicht anmerken, daß er in Eile ist; er gestaltet die Feierstunde bündig und würdig. Außer Robert S. Steel werden ein General und ein Colonel geehrt. Der Politiker zeichnet mit knappen Worten ihre Verdienste auf. Auf einmal nimmt sich auch James A. Partaker, vielbeschäftigter Spiritus rector der Agency, Zeit, an der Veranstaltung teilzunehmen.
Wiewohl der CIC-Captain als Abwehroffizier in gewisser Hinsicht der obersten Spionage-Institution der USA untersteht, erscheint Steel die Anwesenheit der grauen CIA-Eminenz nun doch ein bißchen zuviel der Ehre. Er beginnt sich zu fragen – mehr belustigt als besorgt – was dahinter stecken könnte. Sein Verdacht, er sei in New York beobachtet worden, scheint doch kein Hirngespinst gewesen zu sein. Jedenfalls hat er begriffen, daß Washington etwas von ihm will.
Händedruck. Überreichung der Beförderungsurkunde. Einladung zum Mittagessen. Zwei Ordonnanzen nieten ihm die Muscheln der Stabsoffiziere auf die Schulterstükke seiner Uniformjacke, und der Mann aus Arizona fragt sich, ob ihm das Mittagessen deshalb besser munden würde.
Es wird in dem kleinen hervorragenden Gäste-Kasino aufgetragen, und es ist vorzüglich und vernünftig: Salate, Steaks, Gemüse, Fruchtsaft – aber der frischgebackene Major ahnt, daß ihm der Hauptgang erst nach dem Dessert serviert werden wird.
Es beginnt mit Avancen, die ihm dieser brandgefährliche Partaker nach der offiziellen Verabschiedung von den anderen in seinem Office beim Kaffee macht. »Ich will Ihnen mal was sagen, Major Steel. Ich habe versucht, mit Hilfe Craigs in zwei Tagen Ihre gesammelten Werke zu überfliegen, dreißig Dossiers also. Das ist natürlich unmöglich, aber ich kann Ihnen jetzt schon zu Ihrer hervorragenden Arbeit gratulieren.«
»Danke, Sir …«
»Es war eine Verantwortungslosigkeit ohnegleichen, daß man Ihre Sonderkommission vorzeitig auflöste.«
»Ich hab’ wiederholt und energisch dagegen protestiert, Sir.«
»Das weiß ich«, erwidert der CIA-Vice. »Es ist auch bekannt, daß Sie sich unter Umgehung des Dienstweges an General Clay persönlich um Hilfe gewandt haben und nur deshalb mit einem Rüffel davongekommen sind, weil man Sie noch dringend benötigte. Besonders gefiel mir an Ihrer Arbeitsmethode, daß Sie sich nie von Vorschriften aufhalten ließen, wenn Sie in Fahrt waren.«
»Wenn Sie das so sehen, Sir«, kontert Major Steel mit deutlicher Schadenfreude, »hätte man mich eigentlich heute gleich zum General befördern müssen.«
»Wenn du auf die Uniform keinen Wert legst«, greift Ginty ein, »dann kannst du es werden. Einer mit drei Sternen. Heute noch.«
»Besten Dank, Craig«, begegnet Steel der unverständlichen Verheißung. »Aber meine militärische Laufbahn ist beendet – ich hab’ andere Pläne.«
»Bedauerlich.« Partaker übernimmt wieder seinen Part. »Das Angebot, das wir Ihnen unterbreiten werden, können Sie gar nicht ablehnen.« Einer Antwort seines Gastes zuvorkommend, setzt er hinzu: »Ich muß Ihnen jetzt das Staatsgeheimnis Nummer Eins anvertrauen: Die Befürchtungen, die Sie seinerzeit hatten, diese Nazi-Bande könnte mit den Dollarnoten das gleiche veranstalten wie mit den Pfundscheinen, ist eingetreten. Hier«, sagt er und entnimmt seiner Brieftasche zwei Hunderter Greenbacks als Demonstrationsobjekte: »Sehen Sie sich zuerst die Nummern an …«
Ein Experte wie Steel weiß selbst bei flüchtiger Untersuchung, woran Fälschungen zu erkennen sind. Er betrachtet beide Seiten der zwei Banknoten und nickt grimmig mit dem Kopf, fletscht die Zähne.
»Überrascht, Major Steel?«
»Ganz und gar nicht«, entgegnet der Beförderte mit entsetzter Genugtuung. »Ich hab’ immer damit gerechnet. Es steht in den Akten, daß bereits unter den Nazis Greenbacks in Millionenhöhe gefälscht und nicht mehr in den Umlauf gebracht wurden.«
»Sie nehmen also an, daß es sich bei den Herstellern dieser Produkte um die Falsifikateure des KZ Sachsenhausen bei Oranienburg handelt?«
»Um sie oder auch deren Nachfolger«, erklärt Steel ohne Zögern. »Unternehmen Bernhard‹, zweite Auflage. Eine dritte Möglichkeit schließe ich aus. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, daß man die Druckplatten, Blüten, Pressen und was sonst zur Ausrüstung von Falschmünzern gehört, nicht einfach auf dem Grund des Toplitzsees liegenlassen kann. Nach unseren höchst penibel geführten Ermittlungen wurden sowohl die fertigen Scheine wie die Geräte zu ihrer Herstellung in dem stillen Gewässer versenkt.« Er unterbricht sich und fragt: »Wo sind diese Lardos eigentlich aufgetaucht?«
»Zuerst in der Schweiz, vermutlich via Italien. Dann in New York und in drei weiteren Großstädten der USA«, erklärt Partaker. »Aber kehren wir noch einmal an den Toplitzsee zurück«, fährt er dann fort. »Sie haben die Fahrt der sieben Lastautos von der Fälscherwerkstatt in Redl-Zipf bis an den Bergsee minutiös rekonstruiert. Vier von ihnen sind auf der Strecke geblieben. Sie haben in jedem Fall genau ermitteln können, daß die Ladungen in Enns und Traunsee gekippt, weggeschwemmt und später – soweit möglich – wieder eingesammelt wurden …«
»Und das«, unterstreicht Craig Ginty die Fahndungsleistung, »obwohl sich auf wenigen Quadratkilometern fünfzigtausend Flüchtlinge zusammendrängten, das ganze Fallobst der Festung Alpenland.«
»Nur drei schwere Lastwagen erreichten also den Toplitzsee«, berichtet Steel weiter. »Unter größten Schwierigkeiten. Dieser Schlammeimer des Dritten Reiches ist zwölf Kilometer von Bad Aussee entfernt. Er liegt siebenhundert Meter über dem Meeresspiegel. Es dunkelte bereits, als der Rest-Konvoi ankam. Das Ufer des Bergsees kann von Landfahrzeugen nur von der Ortschaft Gössel aus an der nordwestlichen Ecke angefahren werden. Man kommt nicht ganz an den See heran. Einer der SS-Männer, Hauptscharführer Öhlschläger, organisierte ein Motorboot. Die Begleiter der Fahrzeuge luden ihre Fracht ab. Die Scheinwerfer der Autos waren trotz der Verdunkelung voll aufgedreht, so daß keiner verschwinden oder etwas mitgehen lassen konnte. Kiste für Kiste wurde auf das Motorboot geladen. Öhlschläger fuhr zur Mitte des Sees und warf die Fracht ab, wo er die tiefste Stelle vermutete.
Er mußte mit dem Boot vier- oder fünfmal hin- und herfahren. Die Spurenbeseitiger waren die ganze Nacht auf den Beinen, bevor sie am Morgen auseinanderliefen. Den Leiter der Aktion, Sturmbannführer Müller-Malbach, haben wir dann ganz schnell geschnappt und noch schneller zum Reden gebracht; er ist ein übler Kriegsverbrecher und persönlich ein Schwächling, aber was immer diese Kanaille ausgesagt hatte, wurde später durch unsere Ermittlungen bestätigt.«
»Wie ging es mit diesem Müller-Malbach dann weiter?«
»Die Polen hatten ein Auslieferungsgesuch an die US-Besatzungsmacht gestellt. Ich konnte im letzten Moment verhindern, daß ihnen der Mann übergeben wurde. Nicht weil ich es ihm versprochen hatte, sondern weil ich mir einen wichtigen Zeugen für alle Fälle aufheben wollte. Ich übergab ihn der Kriegsverbrecher-Kommission, und diese erhob Anklage vor einem Militärgericht. Müller-Malbach wurde zum Tode verurteilt und trägt seitdem in der Strafanstalt Landsberg die Rotjacke. Insgeheim habe ich bei General Clay durchgesetzt, daß seine Hinrichtung immer wieder aufgeschoben wurde – bis jetzt jedenfalls.«
»Lassen Sie sich umarmen, Bob«, lobt Partaker. »Umsichtiger als Sie kann man nicht sein. Und was ist aus diesem Öhlschläger geworden?«
»Ich habe ihn auf die Fahndungsliste der Kriegsverbrecher-Kommission gesetzt. Was weiter mit ihm geschah, weiß ich nicht; er war aber wirklich eine ziemlich untergeordnete Figur. Nach dem Namensgeber des Unternehmens, Bernhard Krüger, haben wir die Fahndung mit allen Mitteln betrieben; der Mann blieb ein Gespenst ohne Fleisch und Knochen, vermutlich ein erfundener Deckname. Entweder hat es den Burschen gar nicht gegeben, oder er heißt ganz anders. Auffällig war nur, daß von ihm immer als von dem ›Major‹ Krüger gesprochen wurde. Ein Major bei der SS war aber ein Sturmbannführer und legte – damals – auch großen Wert auf diesen Rang. Wie gesagt, wichtige Posten standen noch offen, als meine Sonderkommission aufgelöst wurde, Sir.«
»Nennen Sie mich doch James, Bob, oder …« Partaker zerlegt das Gesicht in zahllose Fältchen. » … oder Skinny – das erlaube ich wirklich nur ganz wenigen.«
»Heavens – das nenn’ ich aber eine Blitzkarriere, Bob«, albert Ginty, wiewohl ihm nicht danach zumute ist.
»Ich habe wochenlang Tauchversuche im Toplitzsee vornehmen lassen«, fährt der CIC-Offizier fort. »Leider ohne jeden Erfolg. Der See ist tief und tückisch, auf Grund gibt es gefährliche Schlinggewächse, und mit unseren ziemlich behelfsmäßigen Geräten kamen wir einfach nicht voran. Auch nicht eigens angeforderte US-Pioniere. Natürlich erregten unsere Bemühungen bei der Zivilbevölkerung enormes Aufsehen. Es sprach sich herum, daß auf Grund des Bergsees angeblich der Goldbestand des Dritten Reiches läge. Als wir unsere Versuche einstellen mußten, auf Befehl natürlich, wurde das Tauchen in dieser Gegend zu einem Volkssport. Die Behörden hatten es zwar verboten, aber Sommerfrischler versuchten ihr Glück, und sei es nur von einem Faltboot aus. Die Zeitungen wärmten die Story von dem versenkten Nibelungenschatz immer wieder auf. Inzwischen sind fast drei Jahre vergangen. Es gibt nunmehr weit modernere Ortungs- und Tauchgeräte, als ich sie seinerzeit einsetzen konnte. Das bewies zum Beispiel eine deutsche Illustrierte, die mit behördlicher Erlaubnis unter den Augen der Polizei ein paar Kisten mit Pfund-Blüten an die Oberfläche beförderte. Es liegen auch Raketen einer benachbarten Versuchsanstalt auf Grund, und in der Nähe wurde in einem Bergstollen eine Sammlung geraubter Kunstwerke sichergestellt. Und die Schatzsucher sind immer noch am Werk und vermehren sich wie Ungeziefer. Drei dieser privaten Froschmänner sind bereits ertrunken. Außerdem ist es in dieser Gegend zu zwei ungeklärten Mordfällen gekommen.«
»Woher wissen Sie das alles, Bob?«
»Kurz vor meinem Abflug in die USA war ich noch einmal in Bad Aussee«, berichtet der Major. »Den örtlichen Polizeichef hatte ich seinerzeit noch selbst eingesetzt. Er ist ein Vertrauensmann – und verläßlich«, erklärt Steel.
»Sie haben also die Recherchen nie ganz aufgegeben, Bob?«
»Überlegungen nie«, erwidert der Mann in der Majors-Uniform. »Ich bin Kriminalist und Jurist, und ich leiste mir – wenn Sie so wollen – einen gewissen Berufsstolz. Pfusch geht mir einfach gegen den Strich, auch wenn man mich dazu zwingen will.«
»Dieser Müller-Malbach war eine Hauptfigur in der Abteilung VI b der Fälscherzentrale im Reichssicherheitshauptamt«, fährt der CIA-Vice fort. »Haben Sie nie daran gedacht, daß einer der Typen in dieser Abteilung die Dollarfälschung für seine private Zukunftssicherung genutzt haben könnte?«
»Und ob, Sir … ich meine, James«, verbessert sich Steel. »Ich stand in einem ständigen Informationsaustausch mit der Kriegsverbrecher-Kommission, die eine eigene Fahndungs-Crew für die RSHA-Leute eingerichtet hatte.«
»Nehmen wir einmal an – es ist nur eine Theorie es hätte eine zweite Ausweichstelle wie Redl-Zipf gegeben. Oder einer dieser Schreibtischtäter in der Fälscherzentrale hätte in Sachsenhausen eine zweite Garnitur Dollars oder Pressen oder Klischees auf die Seite gebracht?«
»Das wäre äußerst schwierig gewesen«, erwidert Steel. »Diese Leute ließen einander nicht aus den Augen. Die alten Kameraden waren auch mißtrauische Kameraden.«
»Well«, erwidert Partaker, »aber was unwahrscheinlich ist, ist noch lange nicht unmöglich.«
»Sicher, Sir«, entgegnet der Berichterstatter wenig überzeugt. »Vielleicht kann man diese Prinz-Albrecht-Straße-Mentalität nur begreifen, wenn man sich intensiv mit ihr befaßt hat. Eigentlich ist sie außerhalb jeder Logik. Die Chargen dieser Institution erhielten spätestens im Januar 45 falsche Ausweispapiere, echte Devisen und für alle Fälle Zyankali-Ampullen – alles Vorbereitungen zum Absprung. Trotzdem riskierten sie Kopf und Kragen, wenn sie auch untereinander am Endsieg zweifelten.«
»Well, Bob, das nehme ich Ihnen ab. Ich hab’ übrigens mit diesen Leuten auch meine Erfahrungen gemacht.« Der CIA-Vice tauscht mit Ginty einen Verschwörerblick. Sie brauchen nicht auf ihre Vergangenheit zurückzukommen. Ein Mann wie Steel kennt die Rolle, die Partaker und Ginty im Zweiten Weltkrieg gespielt hatten.
Der Gast sieht auf seine Armbanduhr. »Wie komme ich eigentlich nach New York zurück?«
»Heute überhaupt nicht«, entgegnet der CIA-Gewaltige. »Wir brauchen Sie dringend. Das sehen Sie doch ein, Bob!«
»Ungern«, erwidert Steel. »Ich habe in New York eine Verabredung.«
»In meinem Vorzimmer steht ein Telefon«, kontert Partaker trocken.
Sein Zwangsgast weiß, daß es für ihn kein Entrinnen gibt.
Heute nicht und morgen nicht. Vielleicht gibt es für ihn überhaupt keinen Ausstieg. Sie drillen ihn wie einen Fisch an der Schnur – aber der erfolgreichste und gefährlichste Angler ist er selbst.
Nebenan ruft Robert S. Steel das ›Plaza‹-Hotel in New York an und verlangt Mrs. Sandler.
»Just a moment, Sir«, erwidert die Telefonistin. Es klingelt lange in Gipsys Apartment, aber sie meldet sich nicht. »Das verstehe ich nicht«, schaltet sich die Telefonistin wieder ein. »Mrs. Sandler muß in ihrem Apartment sein.«
Als den Anrufer bereits eifersüchtige Impressionen überfallen, meldet sich Gipsy, leicht außer Atem: »Du hast mich aus der Badewanne geholt, Bob«, sagt sie lachend. »Jetzt mache ich den Teppich tropfnaß. Wie fühlst du dich als Major?«
»Am wohlsten fühle ich mich bei dir«, erwidert er.
»Sag das noch mal«, entgegnet sie. »So etwas hört eine Frau gern.«
»Aber was ich dir jetzt sage, hörst du vielleicht nicht so gern, Gipsy: Ich komme heute nicht mehr nach New York zurück. Vielleicht werde ich auch noch morgen hier festgehalten.«
»Schade«, erwidert sie. »Aber morgen muß ich ohnedies nach Detroit. Unsere Firma macht für ›General Motors‹ eine große Präsentation – du weißt doch, das ist …«
»Shit ist das«, versetzt der Anrufer grob. »Königskinder kommen nun einmal nicht zusammen.«
»Erstens waren wir schon zusammen«, erinnert ihn die Lady mit den gescheitelten blauschwarzen Haaren, »und zweitens schaffen wir das schon wieder.«
»Eines Tages«, erwidert er bedauernd. »Wenn nicht mehr in diesem Jahr, dann vielleicht im nächsten.«
»Nein, nein«, entgegnet sie. »Wir werden uns sehr bald Wiedersehen.«
»Wann und wo?« drängt er. »Du mußt doch nach Rom.«