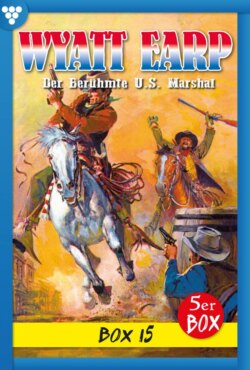Читать книгу Wyatt Earp Box 15 – Western - William Mark D. - Страница 6
ОглавлениеEiner der schwärzesten Tage von Santa Fé hatte begonnen…
Drei Männer ritten von Norden her in die breite, sandige Mainstreet ein.
Der Mann in der Mitte ritt eine Fuchsstute. Er war ein mittelgroßer Mann, schlank, hager, etwa vierzig Jahre alt, mit dunklem, glatt anliegendem Haar. Sein Gesicht war scharfgeschnitten, mit einer spitzen Nase, braunen stechenden Augen und einem kleinen, fast lippenlosen Mund. Zwei tiefe, harte Falten zogen sich fast von den Augen her um den tiefgekerbten Mund herum bis zum Kinn.
Es war kein angenehmes Gesicht: Unduldsamkeit, Trotz, Herrschsucht und Brutalität waren für den Menschenkenner darin zu finden.
Es war Jack Duncer, der in den Middleweststaaten besser unter dem Namen Oregon Jack bekannt war.
Der aus Ontario in Oregon stammende Mann hatte einen Namen, dessen Düsternis sich seinem Gesicht anpaßte. Schon mit siebzehn Jahren hatte er einen Menschen niedergeschossen, floh, wurde in Huston gefaßt und floh wieder. Seitdem war sein Leben eine einzige Flucht gewesen. Er war ein gefürchteter Bankräuber, der bisher immer allein aufgetaucht war.
Heute ritt er nicht allein.
Rechts neben ihm saß ein breiter, vierschrötiger Mann im Sattel eines Grauschimmels. Er hatte ein hölzernes Gesicht, dessen untere Hälfte fast ganz aus dem Kinn zu bestehen schien. Tief unter dem wulstigen Jochbein lagen die kleinen grauen Augen in ihren Höhlen, halbverdeckt von buschigen hellen Brauen. Weit vorragend die Backenknochen, kurz und hochstehend die Nase. Breit und wuchtig der Mund. Die Stirn war kurz und fliehend.
Dieser Mann war Roy Abbot, der wegen mehrfachen Totschlags und Raubmordes in Oregon, Idaho und Utah steckbrieflich gesucht wurde.
Der dritte Reiter saß auf einem braunen Wallach. Er war ein mittelgroßer Mann mit quadratischem Schädel, ständig offenstehendem Mund und Augenbögen, die dicht an die Nase herantraten und den Eindruck erweckten, daß der Mann verwundert die Stirn hochzöge. Er war sicher eine Woche lang nicht dazu gekommen, ein Rasiermesser in die Nähe seines Stoppelbartes zu bringen, und unterschied sich eigentlich nur in diesem Punkt wesentlich von den anderen.
Percy Clowsterfield konnte auf eine ebenso deftige Vergangenheit zurückblicken wie Duncer und Abbot, mit dem Unterschied allerdings, daß ihn niemand kannte und er von niemandem gesucht wurde, eben weil ihn niemand kannte.
Alle drei trugen zwei Revolver im Halfter, graue Hemden, kurze ärmellose Westen und Levishosen. Oregon Jack hatte einen hellgrauen Hut, der ziemlich neu sein mußte. Abbots Hut war braun und hatte eine Krempe, die an einigen Stellen so tief herunterhing, daß ganze Gesichtspartien dadurch verdeckt wurden.
Clowsterfield machte auch hier eine Ausnahme: Er trug einen Zylinderhut, um den er ein schwarzes Tuch gebunden hatte, das hinten herunterhing. Das war zwar keine Seltenheit im Westen, aber dem spiddeligen Mann stand gerade diese Maskerade besonders scheußlich.
Woher der dünne Clowsterfield kam, wußte niemand. Nicht einmal seine beiden Kumpane wußten es.
Oregon Jack hatte die beiden in Colorado, oben in Aurora, der Vorstadt Denvers, am Spieltisch kennengelernt.
Jack geriet in eine Schlägerei, als ihn Abbot mit einigen handfesten Faustschlägen befreite.
Duncer hatte falsch gespielt.
An der Tür stand Clowsterfield und hielt grinsend die Hand auf.
»Ich habe Ihr Pferd schon gesattelt – und jeder, der hier raus will, um zu sehen, wie Ihr Rücken aussieht, dem geht’s wie – dem da!«
Klatsch, hieb er seinen Revolverlauf einem Mann über den Schädel, der mit Duncer gespielt hatte und jetzt wütend heranstürmen wollte.
So hatten Oregon Jack, der alte Einzelgänger, plötzlich ein paar »Kameraden« bekommen. Da er zu dem Entschluß gekommen war, daß man solche Leute immer gebrauchen konnte, nahm er sie mit.
Gleich im Süden von Denver, in Englewood, räumten sie im Morgengrauen eine kleine Bank aus.
Niemand erkannte sie, obgleich sie nicht maskiert waren.
In Colorado Springs wiederholten sie den Coup, da die Bank in Englewood wohl gerade pleite gemacht hatte. Aber auch in Colorado Springs hatten sie kein Glück, denn der Sheriff hatte einen unerhört scharfen Deputy namens Edward Masterson (ein Bruder des bekannten Bat Masterson, der bei Wyatt Earp in Dodge City ja Chief-Deputy war). Ed Masterson heizte ihnen so nachhaltig ein, daß sie abdampften. Sie schworen ihm zwar Rache, aber jetzt zeigte Clowsterfield seine Sonderklasse. Er hatte gemeint:
»Man kann einem Sheriff im ersten Zorn gern Rache schwören, aber man darf nicht so dumm sein, auf ihr bestehen zu wollen.«
Vielleicht war das sein Geheimnis oder eines seiner Geheimnisse. Denn sowohl Duncer als auch Abbot waren immer wieder mit dem Gesetz persönlich in Konflikt geraten. Daher kannten sie auch die Namen der beiden, ihre Gesichter und vieles mehr.
Von einem Verbrecher namens Clowsterfield, der um kein Grad besser war als die beiden, wußte kein Sheriff der Staaten etwas.
Von Colorado Springs aus wanderten sie sich südwestlich in das Alamosa County.
In Alamosa selbst riskierten sie einen Überfall auf die Wells Fargo-Station.
Bei dieser Gelegenheit gab es eine Schießerei, bei der ein Wells Fargo-Mann getötet wurde.
Jetzt waren sie Mörder.
Wer den Mann getötet hatte, ist nie geklärt worden. Höchstwahrscheinlich war es Duncer, der immer zuerst den Colt in der Hand hatte.
Auch hier gab’s keine Beute. Mit leeren Taschen zogen die drei Verbrecher weiter südlich und kamen bei San Antonio an die Grenze New Mexicos.
Sie waren keineswegs von ihren Mißerfolgen beeindruckt. Hier und da ergaunerte Duncer mit Falschspiel doch immer noch Geld genug, daß sie leben konnten.
Aber damit waren die Tramps nicht zufrieden.
Sie wollten besser leben.
Viel besser.
Unweit von der Grenze stießen sie auf einen Trupp von sieben Staatenreitern, die an der Grenze Colorados Patrouille ritten.
Der Anführer des kleinen Trupps hielt sie an und fragte sie nach ihrem Namen und ihrem Ziel.
Nach dem »Woher« fragt man ja heute noch niemanden in Amerika.
Sie gaben falsche Namen an, und als Ziel nannte Duncer Tucumary, eine Stadt im Quay County. Das war ihm gerade eingefallen. Daheim, neben seinem Elternhaus in Ontario, wohnte ein Geräteschmied, der aus Tucumary im Quay County stammte.
Die Staatenreiter ließen sie weiterreiten. Sie hatten keinen Grund, sie aufzuhalten.
In Colorado gab es noch keinen Steckbrief gegen Duncer und Abbot.
Hätten sie gewußt, wer da ihren Weg passierte, wäre das, was kurz darauf geschah, niemals geschehen.
Oregon Jack ritt mit seinen Kumpanen nach Süden.
Lockend lag Santa Fé vor ihnen. Die große Stadt, die auf jeden, der sie zum erstenmal besuchte, einen unerhört lebendigen, farbigen und turbulenten Eindruck machte.
»Wir reisen nach Santa Fé!« hatte Duncer entschieden.
Da weder Abbot noch Clowsterfield etwas dagegen hatten, ritten sie nach Santa Fé.
Das heißt, Clowsterfield war nicht gerade begeistert von dem Gedanken, ausgerechnet die große Stadt aufzusuchen.
Was konnte einem da nicht alles über den Weg laufen? Leute, die einen vielleicht doch kannten, Menschen, denen man irgendwann oder irgendwo einmal auf einsamer Strecke den Geldbeutel geleert hatte, Trader, Rancher und zahllose andere Menschen. Und dazu kam, daß die Stadt ganz sicher keinen lahmen Sheriff hatte.
»Vor Jahren war sogar einer der Earps Sheriff in Santa Fé«, meinte Abbot, der schon mit Morgan Earp zusammengerannt war. Er hatte ein Riesenglück gehabt, daß der damalige Sheriff von Santa Fé gerade einem Raubmörder auf der Spur war. So konnten die Stadt und er sich nicht eingehender mit dem Bulldoggen-Mann Abbot beschäftigen.
Abbot hatte sich dann auch rasch aus dem Staub gemacht, als er gehört hatte, daß dieser Morgan Earp seinem berühmten Bruder Wyatt in Härte und Wachsamkeit in nichts nachstünde.
Oregon Jack war noch nicht in Santa Fé gewesen; er war überhaupt noch nicht so weit in den Süden gekommen.
*
Als sie die Stadt erreichten, war es früher Morgen. Sie waren die ganze Nacht hindurch geritten und hatten am Vortage sieben Stunden im Schatten einer hohen Kakteengruppe geschlafen.
Als sie das erste Haus passierten, fragte Abbot: »Woher weißt du, daß dieser Earp nicht mehr hier ist, Jack?«
Duncer wandte den Kopf nicht zur Seite; er tat es nie, wenn er mit den anderen sprach. Dies gehörte mit zu den Dingen, die er sich ausgedacht hatte, um seine Führerrolle bei den anderen zu behaupten.
»Er ist nicht mehr in Santa Fé!«
»Aber wer kann das so genau wissen. Wann warst du zum letztenmal hier? Vor einem Jahr, einem halben Jahr? Vor drei Monaten? Das kann sich doch jeden Tag ändern. Die Earps haben einen großen Namen und werden gesucht als Sheriffs. Morgan kann längst wieder hier sein. Hätten wir uns nicht vorsichtshalber erkundigen sollen?«
»Nein. Aber du kannst ja ins Office reiten und nachfragen!« giftete Duncer. »Sag mal, weshalb hast du eigentlich solche Angst vor ihm? Ich denke, du wirst in New Mex nicht gesucht.«
»Werde ich auch nicht. Aber ich habe ihn damals gesehen. Ich sage dir, der Kerl ist scharf wie ein Wolf. Damals hatte er zu meinem Glück Lattenberger im Auge. Ich hatte nämlich in einer Schenke am Stadtrand eine kleine Meinungsverschiedenheit mit einem feisten Kerl… und dann gab’s ein paar Reden und Widerreden, und dann lag er am Boden.«
»Na und?« entgegnete der gewissenlose und gefühlskalte Mann aus Oregon. »Ein Toter mehr oder weniger, das spielt doch hier keine Rolle. Und über Morgan Earp kannst du beruhigt sein: Er wurde im Frühjahr unten in Tombstone von den Clantons erschossen.«
Damit war das Thema erledigt und die Bahn also frei.
Duncer hatte es auf die Santa Fé Bank abgesehen, von der er in einer Schenke in Ortiz oben an der Grenze gehört hatte. Ohne ein weiteres Wort zu sagen, ritt er deshalb die Mainstreet hinunter, und plötzlich sprangen ihm von der Fassade eines großen Steinhauses die Worte »Santa Fé Bank« ins Auge.
Er führte seinen Fuchs an den Zügelholmen und rutschte aus dem Sattel.
Als er Clowsterfield die Zügelleinen zugeworfen hatte, zischelte der ihm zu:
»Steig wieder auf, Jack.«
Ohne etwas zu fragen, nahm Oregon Jack den linken Hinterhuf seiner Stute hoch und tat, als wolle er das Hufeisen prüfen.
Dann nahm er die Zügel von Clowsterfield wieder und zog sich in den Sattel.
Erst jetzt, als sie weiterritten, fragte er, ohne den Blick zu wenden:
»Was war los?«
»Der Sheriff stand in der Bank«, meinte Clowsterfield, seinen Bart kratzend. »Ich nehme an, daß du kein Interesse hattest, ihn gleich zu begrüßen.«
Sie ritten weiter.
Vor der »Fegefeuer-Bar«, hielt Duncer wieder an.
»Richtig«, krächzte Abbot. »Ich bin halb verdurstet.«
»Wir brauchen keinen Whisky«, gab Duncer kühl zurück. »Wir brauchen Geld, verstehst du.«
Sie betraten den Vorbau.
Ehe sie die Tür aufstießen, sah Clowsterfield sich noch einmal um.
»Alles in Ordnung?« fragte Duncer.
»Yeah.«
Sie betraten den Schankraum.
Nur ein alter, gebeugter Mann stand an der Theke und setzte gerade mit zittriger Hand sein Bierglas an die Lippen.
»Verschwinde!« fauchte Duncer ihn an.
Der Mann kroch sofort davon.
Abbot hielt ihn auf. »Erst zahlen!«
Der Greis griff in die Tasche und warf ein Geldstück auf die Theke.
Clowsterfield fing es geschickt auf und ließ es mit einem Taschenspielertrick verschwinden.
Der Alte zog davon; er war zu alt in diesem Land geworden, als daß er den Sheriff gerufen hätte. Er ging nach Hause.
Hätte er den Sheriff geholt, wäre vielleicht ein Unglück vermieden worden.
Vielleicht!
Es war niemand hinter der Theke.
Abbot zog sich eine Whiskyflasche heran und setzte sie an den Hals.
So etwas liebte Duncer gar nicht.
»Du hast Manieren wie ein Kuhtreiber, Mensch!«
Abbot grinste und stellte die Flasche weg.
Da wurde hinten die Tür zur Küche geöffnet.
Eine junge Frau kam herein, bei deren Anblick die drei Banditen die Augen sperrangelweit aufsperrten.
Es war eine Frau von vielleicht dreiundzwanzig Jahren, groß und prachtvoll gewachsen. Ihr Gesicht war bronzebraun getönt, mandelförmig geschnitten die dunklen, langbewimperten Augen. Die Nase war gerade und der Mund dunkelrot und gutgeformt.
Die Frau war eine so schreiende Schönheit, daß die drei Desperados sekundenlang wie angenagelt dastanden und sie anstarrten.
Jenny Black, die Saloonerin der »Fegefeuer-Bar«, lächelte und zeigte dabei eine Doppelreihe schneeweißer Zähne.
Abbot schluckte, dann stieß er heiser hervor.
»Das kann doch nicht wahr sein!«
Clowsterfield rieb sich das Kinn und prustete die Luft geräuschvoll durch die Nase aus.
Jack Duncer hatte sich rasch wieder gefangen und versuchte, den Eindruck, den die schöne Frau auch auf ihn gemacht hatte, zu überspielen, indem er mit rauher Stimme fragte:
»Wem gehört der Laden?«
Jenny Black zog die geschwungene linke Braue hoch und stemmte die schlanken Hände in die Hüften.
»Haben Sie die Absicht, ihn zu kaufen, Mister?«
Die Augen des Banditen wurden schmal wie Zündhölzer.
»Ist das eine Antwort auf meine Frage?«
»Ich habe keine Frage gehört«, entgegnete die Frau.
»He, das Luder hat Haare auf den Zähnen«, schnarrte Clowsterfield.
Duncer sah ein, daß er der Frau gegenüber einen anderen Ton anschlagen müßte; sie gehörte zu der selbstbewußten Sorte.
»Es gibt Leute, die bilden sich auf äußere Schönheit so viel ein, daß sie nicht merken, wie dumm sie sind.«
»Sieh einer an«, schoß ihm die Antwort der Wirtin sofort entgegen. »Ich hätte Sie gar nicht für so eitel gehalten, daß Sie sich einbilden, auch noch schön zu sein.«
Duncer wurde flammendrot vor Zorn.
Clowsterfield lachte girrend los.
Abbot hatte nicht kapiert.
Jenny stützte sich auf den Thekenrand.
»Trinken wollen Sie wohl nichts?«
Duncer schüttelte den Kopf. Er war wütend darüber, daß auch die kränkende Tour bei der Saloonerin nicht ankam. Und dennoch mußte er einige Fragen stellen.
»Well, Sie sind eine kluge und schöne Frau«, sagte er in mühsam beherrschtem Zorn. »Ich bin es leider gewohnt, mit den Leuten in den Schenken rauh zu reden. Ich konnte ja nicht wissen, daß Sie anders sind.«
»Bin ich anders? Ist mir neu.«
Er hätte sie ohrfeigen mögen.
Da sagte sie vermittelnd: »Was hatten Sie denn auf dem Herzen, Mister?«
»Ich hätte gern gewußt, ob Sie die Eigentümerin der Schenke sind.«
»Noch ja!«
»Kann ich einen Augenblick mit Ihrem Mann sprechen?«
»Dann müssen Sie sich hinauf auf den Boot Hill bemühen«, entgegnete sie mit belegter Stimme.
»Ach, der Ärmste ist schon gestorben?« Clowsterfield rieb sich das Kinn.
»Gestorben? Nein, er wurde hier draußen auf der Straße von Banditen erschossen.«
»Wie bedauerlich«, meinte Abbot.
»So was soll’s geben«, gab Clowsterfield seinen Senf dazu.
Duncer sog die Luft tief ein.
»Well, geben Sie mir einen Brandy.«
»Seit wann trinkst du denn…«
Duncer schoß Abbot einen warnenden Blick zu.
Aber die Frau erklärte lächelnd, während sie die Flasche heranholte:
»Seit er sich vorgenommen hat, ein Gentleman zu sein.«
Die beiden anderen bekamen einen Whisky.
Duncer zündete sich einen Zigarillo an. Dann stützte er sich mit der Linken auf die Theke.
»Sie haben also keinen Job für mich?«
»Ach – einen Job suchen Sie?«
»Ich bin Keeper.«
»Tut mir leid. Ich mache das selbst.«
»Und die Hausarbeit?«
»Wollen Sie etwa kochen?«
»Das nicht gerade, aber wer hält denn den Hof zum Beispiel auf Schwung?«
»Ich brauche niemanden«, sagte sie noch einmal.
»Die Bedauernswerte macht alles allein«, belferte Clowsterfield. »So was soll’s geben.«
»Ist es eine Schande?« fragte Jenny verärgert.
»Nicht unbedingt.« Duncer nahm den Kopf herum und sprach an dem Zigarillo vorbei. »Aber sehen Sie, so eine Frau allein in einem ganzen Haus, in einer Schenke, das ist doch…«
»Santa Fé ist eben eine andere Stadt«, krächzte Abbot. »Hier sind nicht nur die Frauen schöner als anderwärts, hier leisten sie auch mehr.«
Duncer hätte seinem Kumpanen für seine Quasselei einen Fußtritt versetzen können.
»Well, wenn Sie also gar niemanden brauchen«, sagte er dann näselnd, »ist es auch nicht zu ändern.«
»Tut mir leid«, entgegnete Jenny. »Noch einen Brandy?«
»Nein, danke.«
Abbot aber schob sein Glas noch einmal auf die Whiskyflasche zu.
»Dreimal gekittet hält besser.«
»Sie haben doch erst einen?«
Clowsterfield setzte seinen Absatz auf die Zehen Abbots. Grinsend sah er ihn an.
»Du hattest doch erst einen. Also, bitte, ich meinte ja auch doppelt genäht hält besser.«
»Ein Tisch hat vier Beine. Ein guter Vater hat fünf Söhne, ein richtiger Schooner sechs Spriegel… Ich kenne die Litanei, Mister, ich höre sie jeden Abend ein paarmal.«
Abbot zog die Stirn in tiefe Falten.
Aber Clowsterfield meinte, während er sich mit dem Bowiemesser den Schmutz geräuschvoll unter den Fingernägeln wegkratzte.
»Ein Publikum muß bei Ihnen verkehren, fürchterlich!«
Jenny strich sich eine widerspenstige Locke aus dem Gesicht. Sie hatte die drei Fremden sofort richtig eingeschätzt: Tramps. Allerdings reichte die Skala der Tramps vom Landstreicher bis zum Mörder. Und leider konnte man niemanden den Grad ansehen, in den er einzustufen war.
Leute wie diese hier mußte man mit einem rauhen, männlichen Ton behandeln. Jenny hatte es seit ihrer Kindheit von ihrem Vater, dem Gründer der »Fegefeuer-Bar« gelernt. Allerdings war sie aus weicherem Holz geschnitzt, als ihr lieb sein konnte. Sie hatte ein mitleidiges, empfindsames Herz, war gutmütig und entgegenkommend. All das war aber hinter dieser Theke mehr als unangebracht. Immer wieder mußte sie sich zu dem rauhen, heiseren Ton zwingen, mit dem allein sie hier die Position halten konnte, sonst wäre sie längst untergegangen. Und lebte sie nicht mitten in der Mainstreet dieser verhältnismäßig großen Stadt, wäre sie längst erledigt gewesen.
Aber mitten in der Stadt konnten die Gäste sich nicht so leicht alles herausnehmen, was sie sich herausgenommen hätten, wären sie einer solchen Frau in einer Schenke am Stadtrand oder auch nur in einer Gasse begegnet.
Die gutherzige Jenny Black war seit fünf Jahren der glücklichste Mensch der Welt. Der Traum ihres Lebens war in Erfüllung gegangen. Was sie nie zu hoffen gewagt hätte, war eingetreten. Der Mann, den sie seit mehreren Jahren heimlich anbetete, hatte ihr versprochen, wiederzukommen und zu bleiben.
Dieser Mann hieß Wyatt Earp. Es war der berühmte Marshal von Dodge City, oben in Kansas. Auch er verehrte die junge Frau seit Jahren, ohne je ein Wort davon über seine Lippen gebracht zu haben. Dann heiratete sie nach dem Tode ihres Vaters einen Mann, der mehr als dreißig Jahre älter war als sie, weil sie glaubte, es tun zu müssen. Es war ein Freund des Vaters gewesen, der nach dessen Tod bei ihr in der Schenke half. Da Gerede in der Stadt aufkam, heirateten sie – und waren sich doch darüber einig, daß diese Heirat nur auf dem Papier zu bestehen hatte – und für die Leute. Der väterliche Freund hatte ihr versprochen: Wenn ein Mann kommt, den du wirklich heiraten willst, Kind, sagst du es mir. Er wurde im Kampf mit Desperados auf der Mainstreet an der Seite des Sheriffs Morgan Earp erschossen.
Immer wieder fand Wyatt Earp den Weg hierher, immer wieder suchte er ihn direkt, leitete jeden Ritt wenn irgendmöglich über die Stadt Santa Fé und kehrte doch nie in der »Fegefeuer-Bar« ein. Bis vor einer Woche. Da kam er plötzlich… und als er ging, hatte er gesagt: »Ich komme wieder Jenny…«
Diese Worte hatten die junge Frau überglücklich gemacht.
Ihr Leben würde endlich einen Sinn bekommen.
Sie lag oft bis in den grauenden Morgen hinein wach in ihrem Bett oben in der kleinen, schrägwandigen Schlafkammer und träumte von der Zukunft.
Aber es gab keine Zukunft mehr für die hübsche Jennifer Black.
Ihr Leben sollte nur noch wenige Minuten dauern.
Der Mann, der es auslöschen würde, stand schon vor ihr.
Jackson Daniel Duncer, genannt Oregon Jack! Der steckbrieflich in drei Staaten der Union gesuchte Raubmörder von Ontario.
In diesem Augenblick allerdings ahnte auch er sicherlich nicht, daß er dieses blühende, strahlende Frauenleben da vernichten würde.
»Lohnt sich so ein kleiner Laden überhaupt?«
»Kommt darauf an«, antwortete sie ausweichend.
»Aha. Gestern war Sonntag, da geht’s natürlich, aber heute – leer.«
»Macht nichts. Ich muß mich auch einmal ausruhen.«
»Eben. Und dabei wollen wir Sie nicht weiter stören.«
Duncer stieß sich von der Theke ab, nahm den hellen, viereckigen Zigarillo aus dem linken Mundwinkel, schnipste die Asche ab und schob ihn wieder an seinen Platz.
»Also –«
Jenny blickte ihm in die Augen.
»Es macht für diesen Gentleman einen halben Dollar. Für diesen fünfundsiebzig Cents und für Sie vierzig Cents.«
Abbot warf klingend ein paar Goldstücke aufs Thekenblech.
Clowsterfield grinste. »Die Show war mir das schon wert. Für den Fusel hätte ich sonst Schadenersatz verlangt.«
Auch er warf seine Zeche aufs Thekenblech.
Jenny sah Duncer an.
Der Verbrecher kämpfte rasend vor Zorn über sich selbst, gegen die Verwirrung an, den der Blick der Frau in ihm auslöste.
Noch nie hatte ein Mensch ihn zwingen können, den Blick zu senken.
Diese Frau konnte es.
Er blickte auf seine staubigen Stiefel und sagte, was er sich vorgenommen hatte zu sagen:
»Es wäre unnütze Arbeit, wenn auch ich Geld aus der Tasche nähme, um es in ihre Kasse zu geben.«
»Weshalb?« kam es spröde von den Lippen der Frau.
»Weil diese Kasse in einer Minute doch mein Eigentum sein wird.«
Alle Farbe wich aus dem Gesicht der Frau.
»Es ist kein Geld in der Lade«, brachte sie heiser über die Lippen.
»Gestern war Sonntag. Und auf der Bank waren Sie noch nicht, die hat eben erst aufgemacht.«
»Wie Sie das wissen.«
»Ich weiß es. Das genügt. – Und nun gib acht, sammetäugige Katze: Du holst jetzt ganz brav und völlig lautlos die Kasse auf die Theke und schiebst sie mir hin. Dann wird dieser nette Gentleman dir dein Mäulchen mit seinem Taschentuch stopfen, während dich der andere bindet.«
Jenny stand reglos da.
»Bandit!« brach es aus ihrer Kehle.
Duncer lachte. »Das ändert nichts an der Sache, Sweety. Also, wenn das geschehen ist, bringt dich der Gentleman aus dem Schankraum…«
»Wohin?« stieß Jenny atemlos hervor. Eine geisterhafte Blässe hatte ihr Gesicht überzogen.
»Das wirst du alles erfahren.«
»Das werden Sie nicht tun!«
»Doch, Sweety! Und sprich nicht so laut! Du siehst, dieser unrasierte Mensch da hantiert schon ganz nervös mit seinem Messer herum.«
»Es ist nichts in der Kasse. Zwei oder drei Dollar Wechselgeld und die paar Cents, die der alte Mann vorhin hiergelassen hat…«, stammelte sie.
»Das wird sich alles herausstellen.«
Mit aller Beherrschung fragte sie leise: »Werden Sie mich auch fesseln – wenn wirklich nichts in der Kasse ist, außer den paar Bucks?«
Duncer lachte schmutzig. »Du fragst zuviel, Sweety.«
Abbot schluckte. »Wir werden uns doch so einen Braten nicht entgehen lassen. Ich habe schon lange keine Frau mehr geküßt, und eine wie dich habe ich nicht einmal gesehen…«
Ein Würgen stieg der Frau in die Kehle. Unter der Theke lag das Schrotgewehr.
Aber niemals bekam sie die Waffe hoch. Die Männer hatten sechs Revolver, mit denen sie bestimmt umgehen konnten.
»Tom!« Der gellende Schrei schnitt durch das Haus.
Die Tür vom Flur flog auf, und ein riesiger weißhaariger Neger stürmte herein.
Die drei Banditen hatte ihre Revolver in den Händen.
»Oregon Jack!« entfuhr es dem Schwarzen.
Clowsterfield spie seinen Priem dem Neger entgegen.
»Hol’s der Satan, diese schwarze Bestie kennt dich!«
»Halt’s Maul!« zischte Duncer.
Abbot krächzte. »Ich schlag ihn nieder!«
Er stürmte auf den Schwarzen zu, hatte sich aber in ihm verrechnet.
Der Neger war ein erprobter Faustkämpfer, wenn er auch schon hoch in den Fünfzigern war.
Mit einem geschickten Sidestep wich er zur Seite und hämmerte dem anstürmenden Verbrecher einen krachenden Haken in die Magengrube.
Abbot knickte mit einem gurgelnden Laut wie ein Taschenmesser in sich zusammen.
Mit einem Fußtritt beförderte der Schwarze den Revolver aus der Faust des hageren Clowsterfield.
Da zuckte Jenny herum, weil sie im Gesicht Duncers etwas zu sehen glaubte, das sie genau kannte: Der Mann war zum Mord entschlossen! Er würde den Neger erschießen.
Sie zuckte nieder und umklammerte die Schrotflinte. Das Gewehr war ungeladen. Niemals hätte die Frau in ihrer Schenke um sich geschossen. Aber sie kannte die Macht, die der Anblick eines Gewehres selbst auf einen angetrunkenen Menschen hatte.
Dieser Tramp da würde Tom niederknallen, sie mußte ihn aufhalten. Gedankenschnell riß sie das Gewehr hoch.
Da brüllte ihr auch schon der Schuß entgegen.
Mitten ins Herz getroffen, brach sie zusammen.
Tom hatte sich sofort mit dem Schuß hinter die Theke geworfen und über seine Herrin gebeugt.
Entgeistert starrte er in ihr Gesicht.
»Madam…«, stammelte er. Seine Lippen bebten, und seine alten Augen füllten sich mit Tränen.
»Madam… Jenny.«
Mit zitternder Hand strich er ihr das Haar aus dem Gesicht.
Da sah er das Gewehr neben ihr am Boden liegen. Er riß es an sich, prüfte die Ladung und sprang hoch.
Der Schankraum war leer.
»Warte! Warte…, du Hund! Tom holt dich ein! Tom holt dich ein!«
Er sprang auf und stürmte hinaus.
Auf dem Vorbau stieß er mit zwei jungen Cowboys zusammen.
»He, schwarzer Halunke!«
Der eine holte zum Schlag aus, bekam aber einen Rechtshänder ans Kinn, der ihn umriß.
Dafür warf der andere Cowboy den Neger nieder und zog den Colt.
Die drei Banditen sprengten soeben mit vorgeworfenen Zügeln davon.
Tom trat dem Kuhtreiber den Revolver aus der Faust.
Der Mann warf sich mit einem Wutschrei auf den Schwarzen. Es war ein starker, etwa fünfundzwanzigjähriger Bursche. Aber Zorn und Verzweiflung schienen die Kräfte des Schwarzen verdreifacht zu haben. Er hämmerte einen knackenden Schlag gegen den Schädel des Cowboys, schleuderte den Benommenen von sich gegen die Hauswand und sprang auf. Taumelnd stürzte er vom Vorbau und riß das Gewehr hoch.
Sheriff Baxter war drüben aus der Bank gekommen. Er hatte das Ende des Kampfes beobachtet und rannte vorwärts. Als er sah, wie der Schwarze mit dem Gewehr auf die Straße stürmte, blieb er stehen und zog den Colt.
»He, Tom! Bist du verrückt geworden! Laß sofort die Flinte fallen!«
»Die Mörder…!« stammelte der Schwarze sich verhaspelnd. »Da…, sie… sind geflüchtet… Oregon Jack!«
Baxter kam auf ihn zu.
»Das Gewehr runter, Mann! Bist du denn des Teufels! Hier am hellichten Tag betrunken mit einem Schrotgewehr auf die Straße zu rennen und zwei Männer niederzuschlagen! Ich werde dich sofort ins Jail stecken! Seit wann säufst du denn überhaupt, he? Ich dachte, du wärest Quäker, du scheinheiliger Halunke! Ich werde Miß Black ein Licht über dich aufstecken!«
»Sie ist doch…«
»Du hältst deinen Mund! Vorwärts! Sofort gibst du das Gewehr her!«
Der Neger war zu erregt, als daß er noch ein klares Wort hätte sprechen können.
Da kam der erste Cowboy, der dem Rechtshänder des schwarzen Riesen zum Opfer gefallen war, auf die Straße gerannt und trat Tom von hinten gegen die Beine.
Der Sheriff hechtete ihm entgegen und packte ihn am Kragen.
»Wir sind hier in Santa Fé und nicht auf dem Weidecamp, Mister! Solche Späße unterbleiben hier!«
Der Tumult war aber noch nicht zu Ende. Während dieser Aktion war der andere Cowpuncher herangekommen und rang in stummer Verbissenheit mit einem Messer auf den Schwarzen ein.
Tom wehrte den Stoß ab, bekam aber dann doch einen schmerzhaften Stich in den linken Oberarm.
»Zurück…, es war ein Irrtum!« schrie er dem Wütenden entgegen.
Der aber drang erneut auf ihn ein.
Der Schwarze duckte den Stich ab, riß einen rechten Haken an den Schädel des Cowboys und warf sich dann über den Stürzenden, um ihm das Messer zu entwinden.
Dieser Szene mißverstanden sofort einige Kameraden der beiden Cowboys, kamen von der anderen Straßenseite hergerannt und warfen sich über den Neger.
Mit wilden, heiseren Wutschreien warf sie der Sheriff auseinander, packte den ersten am Kragen und riß ihn zurück. Ebenso den zweiten. Und der dritte hieb auf ihn ein, sah plötzlich den Stern und hob erschrocken die Hände. Zu spät, der Uppercut war schon unterwegs und schickte ihn schlafen.
Sheriff Baxter schrie mit seiner Donnerstimme:
»Auseinander! Laßt ihn los! Weg von ihm! Ihr Höllenhunde! Da – nimmt das! Und du den, jawohl den! Was, das reicht nicht? Dann friß den! So! Au!« Er bekam selbst einen harten Wischer eines um sich schlagenden Weidereiters zu spüren, der nicht wußte, wer ihn da zurückzog. »Was denn, du stinkiger Rinderschwanzzähler teilst hier Backhander an den Sheriff von Santa Fé aus? Na, warte!«
Baxter war ein harter Kämpfer und brach sich bald eine Gasse in das Knäuel der Cowboys.
Ein kleiner schwarzer Junge mit blinkenden Knopfaugen war durch die Schenke auf den Vorbau gestürzt und hatte gesehen, wie sich die Cowboys auf den Neger, seinen Vater, stürzten.
Er warf die Arme hoch und schrie:
»Hilfe! Hilfe! Sie fallen den Sheriff an! Hilfe! Helft doch dem Sheriff, ihr Feiglinge! Ihr Kriecher, ihr Schufte!«
Der Blacksmith drüben stampfte aus seiner Werkstatt.
»Was ist denn hier los?!« brüllte er.
»Die Cowboys schlagen sich mit dem Sheriff!« schrie der kleine Sam, der Todesängste um seinen Vater ausstand und geschickt den Helfer auf den jetzt tatsächlich bedrängten Gesetzesmann aufmerksam machte, denn für einen Farbigen würde hier kaum einer einen Finger krümmen.
Die Cowboys hatten gar nicht bemerkt, wer sie da durcheinanderwirbelte. Sie droschen auf Baxter ein.
Da kam der bärenstarke Schmied dazu und brach eine gewaltige Bresche.
Er sah den Schwarzen am Boden liegen.
»Wo ist denn der Sheriff?« brüllte er mit Tenorstimme.
»Hier, Joe! Hier, mach Luft!« keuchte Baxter. »Hau sie zu Hufeisen! Mach schnell!«
Der Schmied machte ihm Luft.
Und jetzt wurde auch der kleine Barbier, der gerade den Mayor rasierte, auf das Getümmel aufmerksam. Er hatte es nicht hören können, da sich im Korridor seine sieben Kinder laut stritten.
Ruhig legte er das Messer zur Seite und erklärte dem Kunden:
»Moment, Mayor, es geht gleich weiter. Ich muß nur schnell… Damned, das ist doch Baxter… Na, wartet!«
Der kleine feiste Mann stürmte auf die Straße und hechtete in das Knäuel der Kämpfenden hinein. Er bekam Faustschläge, Fußtritte, Knüffe und Stöße – und brach sich doch Bahn zu dem Sheriff.
»Ich bin hier, Baxter! Drauf!«
Jetzt kamen auch die anderen Männer, der Schreiner Fenner, der riesige Butcher Longley und dann war einer der Deputies des Sheriffs da.
Baxter sah ihn kommen.
»Endlich, Mann, wo hast du denn geschlafen! Ran, mach Kleinholz aus den Boys!«
Die Cowboys hatten nun doch den kürzeren gezogen. So hart sie auch waren, es gab die große Dresche.
Bis Baxter so weit die Übersicht gewann, daß er seinen Colt zog und einen Schuß in die Luft abfeuerte.
»Auseinander!« brüllte er. »Auseinander!«
Ein herkulisch gebauter Cowboy, schon aus mehreren Gesichtswunden blutend, raufte sich noch mit dem Schmied, bekam die schwielige Faust des Gegners ans Kinn, schwankte zurück, schluckte den Schlag und wollte wieder vorwärts auf den Gegner zustürmen. Da zog der Sheriff ihm den Revolverlauf über den Schopf.
»Leg dich! Yeah! Pause! Für alle! Für alle – habe ich gesagt!« Er riß einen kleinen, wieselflinken Burschen, der seinen Gegner, den Butcher, mit einem Haken anspringen wollte, am Halstuch zurück.
Der Barbier hatte einen jungen Cowboy niedergewalzt und hieb ihm – klatsch, klatsch! – eine ganze Serie von Ohrfeigen ins Gesicht. »Ich werde dir elendem Stier schon zeigen, wie man sich hier in der Stadt zu benehmen hat!«
»Aufhören!« brüllte Baxter noch einmal. »Auch du, Jeff! Zum Donnerwetter…«
Der dicke Barbier war schließlich noch der einzige, der Ohrfeigen austeilte.
»Jeff!« schrie Baxter mit sich überschlagender Stimme. »Zum Teufel noch mal. Es ist Schluß, habe ich gesagt!«
Der Barbier blickte auf. Seine Nase blutete, seine Oberlippe auch, seine Halsschleife war aufgerissen und sein weißes Hemd am Hals und am Oberärmel zerfetzt.
»Was sagst du, Jim?« Immer noch hielt er den Cowboy am Boden.
Baxter schrie so, daß er sich tief vorbeugen mußte.
»Schluß! Schluß, habe ich gesagt!«
»Ach so, Schluß! Well, dann kannst du aufstehen, Jonny!«
Der rotgeohrfeigte Bursche rappelte sich hoch. »Ich heiße nicht Jonny!« knurrte er.
»Schadet nichts, und weil ich dich anscheinend zu lange geohrfeigt habe, kannst du dich gleich gratis bei mir rasieren lassen!«
Der Cowboy grinste schief. »All right!«
Baxter rieb sich den Schweiß von der Stirn und starrte auf den Neger, der regungslos am Boden lag.
»Doc! Verdammt, wo ist der Doc!«
Ein hochgewachsener Mann mit angegrautem Haar, blutiger Unterlippe und herausgerissenem Rockärmel tippte ihm auf die Schulter.
»Hier…, ich bin hier, Jim.«
»Was denn, Sie haben auch mitgemacht? Wenn ich gewußt hätte, daß ich so schnell Verstärkung bekommen hätte, wäre mein Hemd jetzt nicht zerfetzt. Ich hätte mir bestimmt Zeit gelassen.«
Der Arzt schob einen rothaarigen Cowboy beiseite.
»Wie heißen Sie?« fragte er plötzlich, vor ihm stehenbleibend.
Der etwa fünfundvierzigjährige Mann hielt sich die Hand vor den Mund und krächzte dabei kaum vernehmlich:
»Joe… Walker!«
»Was haben Sie denn?«
»Einen losen… Zahn!«
»Selbst rausreißen! Wer ist der Vormann?«
»Ich, Doc.«
»So sehen Sie auch aus. Gehen Sie mal zur Seite, damit ich mir den Mann da unten mal ansehen kann. He, das ist ja der alte Tom!«
Er wandte den Neger auf den Rücken.
Aus zahllosen Wunden blutend, lag der Schwarze da.
Es war plötzlich sehr still auf der Mainstreet geworden.
»Whisky!« rief der Arzt.
Der kleine Sam rannte in den Schankraum und riß die Flasche an sich. Er hatte dabei nicht hinter die Theke sehen können und deshalb seine Herrin nicht bemerkt.
Nach dem ersten Schluck kam der alte Hausknecht der »Fegefeuer-Bar« wieder zu sich, richtete sich auf und starrte die Männer an.
»Doc…, was ist los?«
»Ich dachte, Sie könnten uns das sagen!« knurrte der Sheriff.
Der Neger richtete sich auf. Schwankend stand er da und sah sich um.
Als die beiden Cowboys, die vorhin gegen ihn gerannt waren, feststellten, daß er nicht etwa tot und auch nicht schwer verletzt war, brüllten sie los:
»Der Schuft hat uns angegriffen!«
»Mit einer Schrotflinte!«
»Ruhe!« donnerte der Sheriff dazwischen.
Schrotflinte! Dieses Wort brachte den Schwarzen die Erinnerung voll zurück.
»Die Banditen… Sheriff! Miß Black! Sie haben sie niedergeschossen! Oregon Jack!«
»Was faselt der da?« knurrte Baxter.
»Vielleicht braucht er noch einen Drink«, meinte der Arzt ablenkend, denn er hatte Mitleid mit dem ziemlich übel zugerichteten Schwarzen.
Die Flasche war leer.
»Sam! Hol eine neue!« gebot der Sheriff dem Jungen.
Der blickte seinen Vater an.
Tom nickte.
Da erst sprintete der Kleine los.
Und plötzlich zerriß ein gellender Schrei aus einer Kinderkehle die Luft.
Der alte Tom tigerte los, warf die vor ihm stehenen Männer wie Spielzeuge zur Seite und stürmte auf den Vorbau.
Der Sheriff und der Arzt folgten ihm sofort.
Der kleine Sam stand mit kalkweißem Gesicht, die gespreizten Hände weit von sich gestreckt, neben der Theke.
»Vater! Sie… bewegt sich nicht mehr! Sie ist tot…«, stammelte der Junge mit erstickender Stimme.
Sheriff Baxter rannte um die Theke herum.
»Doc!«
»Ich bin ja da!«
»Hierher! Schneller, kommen Sie…«
»Gehen Sie doch zur Seite, Baxter. Ich kann ja nichts sehen. Was…«
Der Sheriff schob sich zurück. Und mit entsetzten Augen starrte Doc Norton auf die Frau.
Er brauchte nicht niederzuknien, um sie zu untersuchen. Mit der Linken auf der Thekenkante und der Rechten auf das unterste Flaschenbord gestützt, stand er da und blickte fassungslos auf das wächserne Gesicht der Frau.
»Tot…«, kam es tonlos von seinen Lippen.
Baxter wagte keinen Blick mehr auf die Frau zu werfen und stieß den Kopf vor.
»Was sagen Sie da, Doc? Das ist doch unmöglich.«
Norton nickte langsam, und jetzt erst bückte er sich mit einer hölzernen Bewegung.
Er wußte ja, daß es sinnlos war.
»Sie ist erschossen worden«, sagte er rauh.
Die Saloonerin der »Fegefeuer-Bar« war tot!
*
Die Männer waren hereingekommen, standen dichtgedrängt nebeneinander und horchten nach vorn. Alle, die vorhin noch gegeneinander gekämpft hatten, standen da mit gezogenen Hüten.
Das konnte doch nicht sein, was der Arzt da eben gesagt hatte!
Jenny Black, die schöne, blutvolle, strahlende Jenny Black sollte tot sein?
Baxter wandte sich um.
Seine Hände zitterten. Nicht, weil ihn der Tod eines Menschen so erschütterte, nein, es war da ein anderer Grund: Er hatte ihr zweimal einen Antrag gemacht, aber sie hatte abgelehnt, freundlich, in ihrer netten Art. Er hatte sie trotzdem weiter angebetet. Und jetzt lag sie da hinter der schäbigen Theke in ihrem Blut!
Unfaßbar! Es wollte nicht in seinen Eisenschädel hinein.
Der rothaarige Cowboy drängte sich vor und stand hinter dem Arzt.
Auch er war seiner Stimme kaum mächtig.
»Das sollen doch nicht etwa meine ›Boys‹ gewesen sein?«
Er fuhr herum.
In seinen grünen Augen loderte ein wildes Feuer.
»Kid!«
Ein Mann mit eingeschlagener Sattelnase, aufgeworfenen Lippen und weit vorgeschobenem Kinn kam heran. Auch er hatte den Hut in der Hand.
»Warst du etwa hier in der Schenke?«
Der Cowboy Kid, der als »Wild Kid« im ganzen County bekannt war, zuckte zusammen.
»Ich? Was willst du damit sagen, Joe?« stieß er heiser hervor.
»Ich habe dich nur gefragt, ob du hier in der Schenke warst!« schrie der Vormann drohend, beide Hände hatte er seitlich auf die Theke gestützt, und es sah aus, als wollte er sich jeden Augenblick nach vorn auf den anderen schnellen.
»Nein!« rief da ein älterer Cowboy von hinten. »Er war die ganze Zeit bei mir und Dan!«
Der Vormann ließ den Kopf sinken. »Gott sei Dank.«
Dann nahm er den Kopf wieder hoch und sah den Sheriff an, wobei er mit fester Stimme erklärte:
»Von unseren Leuten war es keiner, Sheriff!«
»So?« sagte Baxter abweisend.
Da schob sich der Neger heran.
»Ich habe es doch gesagt, Mister Baxter.«
»Was?«
»Ich war doch dabei…«
»Wobei?«
Der Arzt packte den Arm des Schwarzen.
»Beruhigen Sie sich doch, Tom. Und sprechen Sie endlich vernünftig.«
»Mein Vater ist gerade an der Tür umgefallen, ich habe ihm einen Hocker geholt«, rief der kleine Sam weinend.
»Eine Ohnmacht«, sagte Norton. »Aber jetzt sind Sie doch bei Sinnen. Reden Sie endlich!«
»Ich sagte es doch…«, keuchte der Neger. »Er hat sie niedergestreckt, mit dem Colt.«
»Wer?« Es war ein einziger Schrei aus einem Dutzend heiserer Männerkehlen.
»Oregon Jack!«
Der Sheriff schüttelte den Kopf, als müsse er einen Spuk verscheuchen.
»He, das hat er doch auf der Straße schon gesagt«, glaubte der Arzt sich zu erinnern.
Baxter schob sich vor den schwarzen Hünen.
»Tom, jetzt sage es mir einmal ganz langsam, aber doch schnell genug, damit ich nicht überschnappe: Was ist hier geschehen? Wer soll das gewesen sein?« Er sprach den Schwarzen an, wie man ein verstocktes Kind ansprach.
»Ich weiß es nicht… genau«, ächzte der alte Mann. »Ich hörte den Schrei…«
»Welchen Schrei?« unterbrach ihn der Sheriff.
»Von Miß Black! Dann rannte ich aus dem Hof durch den Korridor hierher. Sie stand hinter der Theke. Und die drei Mänenr standen da, wo Sie jetzt stehen. Einer von ihnen war Oregon Jack…«
»Kennst du denn Oregon Jack?«
»Ja.«
»Woher?«
»Ich habe ihn vor fünf Jahren in Saldup City gesehen, als er eine Schießerei mit einem Hilfs-Sheriff hatte.«
»Weiter. Er soll also dabei gewesen sein.«
»Er war dabei, Mister Baxter! Hier stand er. Da warf sich einer der Männer, ein großer, kräftiger Mensch mit massigem Schädel, breiter Brust und schweren Fäusten auf mich. Ich habe ihn abgefangen…«
»Du hast ihn…«
»Ja, ich steppte zur Seite und schlug ihm einen Haken in die Magengrube. Er knickte zusammen und preßte beide Hände vor den Bauch. Da wollte Oregon Jack schießen auf mich. Miß Jenny ließ sich im gleichen Moment hinter der Theke fallen, wo dieses Gewehr immer liegt. Um… mich zu retten…, tat sie das…«
Die Stimme des Schwarzen erstickte. Ein Weinkrampf schüttelte den hünenhaften Körper des Mannes.
»Sie… wollte mich retten…, ich weiß es…, kam hoch mit dem Gewehr, und der Revolver zuckte zu ihr herüber. Jack schoß sofort. Und sie fiel nach hinten. Ich hatte ja keine Waffe, sprang zu ihr. Als ich… mit dem Gewehr hochkam, war die Schenke leer! Ich rannte hinaus…, prallte da mit den beiden Cowboys zusammen und… ich weiß nicht genau, was dann weiter passierte.«
»Das wissen wir«, sagte einer der beiden. »Und es tut uns leid.«
»Was denn?« knurrte der Schwarze. »Ihr konntet doch nichts dafür.«
Baxter rieb die Fäuste gegeneinander.
»Oregon Jack! Sollte das möglich sein? Und zwei Kerle bei ihm? Fast nicht zu glauben! Der Halunke ist sonst immer nur allein.« Er sprach es wie zu sich selbst in die jetzt eingetretene Stille hinein. Dann warf
er den Kopf hoch. »Wer kommt mit?!«
»Wir!« rief der rothaarige Vormann. »Holt die Gäule, Boys! In drei Minuten seid ihr vor dem Sheriffs Office!«
Die Cowboys stürmten aus der Schenke zum Mietstall, um der Aufforderung ihres Vormanns nachzukommen.
Auch der Schmied, der Butcher, der Schreiner und der Barbier erklärten, daß sie mitkämen.
»Haben Sie gesehen, in welche Richtung sie geritten sind, Tom?« fragte Baxter den Neger.
»Sie flüchteten nach Norden aus der Stadt.«
Baxter krempelte sich den zerrissenen Hemdsärmel hoch und knurrte: »Man sollte das Galoppieren in der Stadt verbieten. Dann würde einem ein flüchtiger Bandit sofort auffallen, und jeder Bürger könnte ihn an der Flucht hindern. Aber da hier jeder seinen Gaul durch die Straßen dreschen kann, wie er will, kann einem ein flüchtiger Bandit ja nicht auffallen.«
Die Männer gingen hinaus.
Nur Doc Norton blieb zurück und sah sich den schwarzen Tom genauer an.
»Kommen Sie mit hinüber. Sie haben ja mehr Risse im Gesicht, als die ganze übrige Bande zusammen. Das muß sofort bepflastert werden.«
Als der Sheriff sah, daß auch der kleine dicke Barbier mitwollte, stieß er ihn im Laufen an.
»He, wo willst du denn hin?«
»Ich komme mit dir.«
»Geht nicht.«
»Wieso nicht? Ich bin Notdeputy bei dir!« Er keuchte weiter neben ihm her.
»Sieh doch da hinüber!« rief ihm Baxter zu.
Der Barbier warf einen Blick über die Straße und sah in der Tür seines Shops den Mayor stehen, dessen unrasierte rechte Gesichtshälfte noch weiß von Seifenschaum war.
»Der kann warten!« gab er zurück und rannte weiter neben dem Sheriff her dem Mietstall zu.
»Eine blöde Einrichtung, daß die Gäule alle im Mietstall stehen«, ächzte der vierschrötige Schmied.
»Geht nicht anders!« rief ihm der Barbier zu. »Weil die neuen Häuser doch so nahe beieinander stehen mußten, daß kaum noch jemand einen eigenen Hof hat.«
Minuten später preschte die Posse des Sheriffs aus der Stadt.
*
Die Tür des Doktorhauses öffnete sich, und der weißhaarige Negerhüne kam heraus. Mit gesenktem Kopf überquerte er die Straße.
Auf den Vorbauten standen neugierige Frauen und sahen ihm voller Mitleid nach.
Es hatte sich herumgesprochen, was geschehen war. Die Menschen waren wie gelähmt vor Schreck.
Jenny Baxter sollte tot sein? Die frische, lebensfrohe Jenny Black, deren dunkle warme Altstimme und deren wohlklingendes Lachen noch jeder im Ohr hatte!
Sie war ja selbst ein Stück Santa Fé gewesen, die bildschöne, heißblütige Saloonerin der »Fegefeuer-Bar«.
Vor der Schenke standen mehrere Frauen. Als sie den Schwarzen kommen sahen, wichen sie zurück und machten ihm Platz.
Der Riese schob die Pendeltür auseinander und sah seinen kleinen Sohn auf einem Hocker vor der Theke sitzen.
Mit schleppendem Schritt ging der Alte vorwärts.
Plötzlich blieb er stehen und sah auf die Stelle hinter der Theke, wo vor einer halben Stunde noch die Tote gelegen hatte.
»Wo ist sie?« kam es heiser über seine Lippen.
»Sie haben sie weggeholt.«
»Wer?«
»Mister Donegan und Mister Pratt. Der alte Simpson war auch dabei. Und der Mayor. Er war ganz blutig im Gesicht…«
»Wer?« fragte Tom teilnahmslos.
»Der Mayor.«
Der Alte hob den Kopf. »Hat er auch etwa an der Rauferei teilgenommen?«
Der Junge zog die Schultern hoch und ließ sie wieder fallen.
»Ich habe ihn nicht unter den Männern gesehen. Aber er kam vorhin schimpfend drüben aus dem Barbershop und hatte noch das Handtuch und das Rasiermesser in der Hand…«
Es blieb eine Weile still zwischen Vater und Sohn. Dann sagte der kleine Sam leise:
»Können wir sie nicht wiederholen, Dad?«
Der Alte schüttelte den Kopf.
»Nein, Sammy. Wenn der Mayor dabei war, dann war es in Ordnung.«
Wieder war es still. Eine schwere Fliege zog brummend ihre Kreise um die Lampe in der Mitte des Schankraumes.
»Was machen wir jetzt?« fragte der Junge.
»Ich weiß es nicht«, antwortete der Vater niedergeschlagen. »Ich kann es dir heute noch nicht sagen. Vielleicht finden wir eine andere Arbeit in der Stadt. Und wenn nicht – Miß Jenny hat uns ja zwei Pferde geschenkt – dann reiten wir eben so lange weiter, bis uns irgendwo jemand brauchen kann. Das Land ist ja groß genug.«
Da fing der Junge leise an zu weinen.
Der Alte holte ihn zu sich, und sie setzten sich beide nebeneinander auf eine der Bänke.
Schließlich hob Sammy den Kopf und wischte mit seiner kleinen braunen Hand die Tränen aus den Augen.
»Können wir nichts tun?«
»Wie meinst du das, Junge?«
»Ich meine, daß Oregon Jack gefaßt wird.«
»Der Sheriff ist ja hinter ihm her.«
»Mister Baxter ist sicher ein guter Sheriff, und ich will nichts gegen ihn sagen. Aber ich glaube nicht, daß er Oregon Jack fangen wird.«
»Das müssen wir dem lieben Gott überlassen, Junge.«
Der kleine Sammy sann darüber nach, wie traurig es doch eigentlich war, daß man das alles dem lieben Gott überlassen mußte. Es wollte einfach nicht in seinen wolligen Schädel hinein, daß man hier so tatenlos herumsitzen sollte, wenn der Mörder seiner geliebten Herrin ungestraft entkam.
Plötzlich sprang er so heftig auf, daß der Alte erschrak, und rief: »ich hab’s, Vater!«
»Was hast du?«
»Ich habe gefunden, wen ich gesucht habe!«
»Und wen hast du gesucht?« fragte Tom langmütig.
»Der Mann, der Oregon Jack fangen wird.«
»Wer sollte das tun, wenn es der Sheriff nicht kann? Ach, Junge, du bist ein Träumer…«
»Nein, Vater. Ich habe die ganze Zeit nachgedacht, und auf einmal fiel es mir ein. Du mußt an Wyatt Earp schreiben!«
»Was…? Wie kommst du denn darauf?«
»Ist er denn nicht ein Freund von uns?«
»Doch, schon, wir waren sehr froh, als er neulich hier bei uns im Hause war und mit Miß Jenny gesprochen hat. Er hat sogar mit uns beiden gesprochen. Aber was sollten wir ihm denn schreiben, Sam? Er hat selbst Arbeit und Ärger genug. Als er hier war, hatte er einen Bandit nach Farmington gebracht. Du siehst, er hat immer alle Hände voll zu tun.«
»Ich weiß, aber wenn ich es richtig überlege, dann frage ich mich, weshalb er überhaupt nach Santa Fé geritten ist, wenn er nach Farmington wollte.«
»Er war ja schon dort, Junge, und befand sich auf dem Rückweg, als er hierherkam.«
»Dann frage ich mich«, beharrte der schokoladenfarbene Boy, »weshalb er wohl über Santa Fé geritten ist, das doch ziemlich weit südlich liegt, wenn er aus dem Westen kam, wo ja Farmington liegt, und hinauf nach Nordosten wollte, zurück nach Dodge.«
Der Alte kramte seine Maiskolbenpfeife aus der Tasche, stopfte sie mechanisch, setzte den Tabak aber nicht in Brand.
Schmerzendes Würgen saß in seiner Kehle, es kam nicht von der Prügelei. Es kam aus dem Herzen. Der plötzliche Tod seiner Herrin hatte den greisen Mann wie ein Hammerschlag getroffen. Ohne sie schien ihm sein ganzes Leben sinnlos und zerstört zu sein.
»Schade, daß ich nicht gut schreiben kann, Dad, sonst würde ich an den Marshal schreiben.«
»Nun sei doch endlich davon still, Junge.«
Der Knirps stand auf und ging zur Tür. Er hatte beide Hände auf den Drehknopf gepreßt.
»Er hat doch zu ihr gesagt, daß er wiederkäme«, meinte er verzagt.
»Wer? Zu wem?«
»Der Marshal zu Jenny.«
»Wann?«
»Als er sich von ihr verabschiedete.«
»Das kann ich mir nicht vorstellen.«
»Ich habe es aber gehört. Er hat es ganz deutlich gesagt. Ich stand in der offenen Küchentür und wollte gerade hinein. Da hörte ich die Stimme des Marshals und blieb stehen, wo ich stand. So habe ich jedes Wort, das die beiden miteinander sprachen, genau verstehen können.«
»Und was hat der Marshal gesagt?«
»Daß er wiederkommt. Und Miß Jenny hat ganz nahe vor ihm gestanden und hat gefragt: Wann? Da hat er gesagt: Bald.«
Der Alte stand ärgerlich auf. »Aber Junge, was ist denn plötzlich in dich gefahren? Was redest du denn da zusammen! So etwas kann man doch nicht einfach dahersagen. Unsere Herrin ist tot – und Wyatt Earp ist ein großer Sheriff. Und wenn du jemand anderem so etwas erzählen würdest, können wir in Teufels Küche kommen.«
»Ich sage es doch nur dir, Dad.«
Der Alte stand vor ihm. »Kann ich mich darauf verlassen, Sammy?«
»Felsenfest, Dad.«
Tom nickte. »Hole mir Papier, Feder und Tinte.«
Der Junge rannte davon und brachte nach wenigen Minuten das Gewünschte.
Der Alte machte sich an die Arbeit.
Er teilte dem Marshal Earp im fernen Dodge mit, was sich soeben in Santa Fé ereignet hatte.
*
Die Depesche war in Dodge City angekommen. Sie hatte bei dem Marshal einen tiefen Schmerz ausgelöst. Noch am gleichen Tag hatte er sich mit Doc Holliday auf die Bahn gesetzt.
Anfangs wollten sie wie immer die Pferde nehmen, aber da Eile jetzt not tat, hatte sich der Missourier für die Bahn entschieden.
Auf der Strecke Dodge City – Santa Fé fuhr die schnellste Lok, die es im ganzen Westen gab. Und da die Ankunfts- und Abfahrtszeiten damals nur ungefähr eingehalten werden konnten, versprach der Lokführer dem Marshal sein möglichstes zu tun.
In Santa Fé würden sie schon gute Pferde mieten können, wenn es notwendig war, dachten die beiden.
*
Es war dunkel geworden.
Auf der großen Station von Santa Fé brannten mehrere Windlichter. Der Dodge City-Express war soeben auf der Station eingelaufen. Eine ganze Reihe von Fahrgästen stiegen aus.
Zwei hochgewachsene Männer in dunklen Anzügen passierten als erste den Perron und gingen raschen Schrittes zur Mainstreet hinauf.
Der eine von ihnen hatte ein braunes, markantes Gesicht, gutgeschnitten, männlich, herb, beherrscht von einem dunkelblauen Augenpaar. Sein Haar war dunkel und kräftig: Einem genauen Betrachter wäre sicherlich aufgefallen, daß ein sonderbarer tiefer Ernst auf diesem Gesicht lag. Es war ein hochgewachsener breitschultriger Mann, dessen Gang kraftvoll und federnd war: Wyatt Earp, der Marshal von Dodge City.
Sein Begleiter war fast ebenso groß wie er selbst, hatte ein blaßblaues, feingeschnittenes, aristokratisches Gesicht und Augen, die eisblau schimmerten.
Dieser Mann war der Georgier Doktor John Henry Holliday.
Die beiden gingen ein Stück die Mainstreet hinunter und sahen schon von weitem, daß in der »Fegefeuer-Bar« kein Licht brannte.
Wortlos gingen sie auf die Schenke zu.
Auf einer Bank neben der Tür, gespenstisch von den anderen Lichtern der Straße beleuchtet, saß ein Mann und starrte vor sich hin.
»Mister Tom!«
Beim Ton dieser Stimme schrak der Neger zusammen und sprang sofort auf.
»Wyatt Earp!« kam es dumpf aus seiner Kehle. »Marshal! Aber das kann doch nicht sein… Ich muß mich irren. Wir haben kein Licht, weil…«
Der Missourier trat auf ihn zu.
»Ich bin es. Sie haben schon richtig gesehen.«
Hastig griff der Neger die Hand des Marshals und hielt sie mit beiden Händen fest.
»Mister Earp! Welch eine Freude…, dabei haben wir gar keinen Grund zur Freude…«
»Ich weiß.«
»Nein, Sie können das Schreckliche doch noch gar nicht wissen.«
»Sie haben mir doch eine Depesche geschickt.«
Da wurden die Augen des Schwarzen noch größer und schimmerten wie zwei Kugeln in der Dunkelheit.
Der Alte dachte an die Worte des kleinen Sam. Sollte der Junge am Ende doch recht haben und der Marshal die schöne Jenny Black tatsächlich geliebt haben?
»Ja, Mister Tom, deshalb sind wir gekommen.«
Der Neger drückte auch die Hand des Georgiers.
»Und der Doc ist dabei! Jetzt sind die Tage des Mörders gezählt. Ich weiß es. Jetzt wird er nicht mehr weit kommen. Ach, es ist fürchterlich…, entsetzlich, Mister Earp.«
»Können wir ins Haus gehen?« fragte der Missourier.
»Natürlich, noch hat mich ja niemand hinausgewiesen.«
Dann saßen sie hinten in der Stube um den kleinen Tisch.
Die riesige dunkelbraune Hand des Negers glitt über die zierlichen Stickereien der weißen Decke.
»Das hat sie selbst gestickt. Sie konnte alles.«
»Ist der Sheriff schon zurück?« erkundigte sich der Marshal.
»Nein, er nicht, aber fast alle anderen. Nur noch der Barbier ist bei ihm und ein Vormann von einer großen Ranch aus der Nachbarschaft.«
»Was haben die Leute von der Posse berichtet?«
»Nicht viel. Die ersten, die zurückkamen, weil sie entweder nicht für einen längeren Ritt gerüstet waren oder schlechte Pferde, schadhafte Sättel, nicht genug Waffen und Munition, Proviant und was weiß ich alles hatten, wußten gar nichts. Auch sie kamen erst nach Mitternacht. Dann folgten am nächsten Tag die nächsten. Von ihnen erfuhren wir, daß Baxter zwei Gruppen gebildet hatte. Die eine führte er selbst und die andere der Cowboy… Ich weiß nicht, wie er heißt, ich glaube, Walker, Mister Baxter folgte einem Hinweis, der ihn nach Nordwesten führte und der Cowboy beharrte darauf, weiter nach Norden zu reiten, da er es für unwahrscheinlich hielt, daß sich Oregon Jack nach Farmington gewendet haben konnte. Er vermutete eher, daß sich die Desperados auf dem schnellsten Weg zur Grenze begeben würden, um nach Colorado zu entkommen.«
»Immerhin müssen sie aus einer Stadt wie Santa Fé eine hartnäckige Verfolgung in Erwägung ziehen, da können sie sich keine Umwege leisten.«
»Sie glauben also, daß der Weidereiter recht hatte?«
»Das wird sich zeigen. Erzählen Sie bitte weiter.«
»Gestern kamen die anderen. Einer nach dem anderen ritten sie hier vorbei. Sie wußten auch nicht vielmehr. Heute abend sind die letzten gekommen. Bis auf den Barbier. Von dem Schmied, der vorhin erst zusammen mit dem Schreiner gekommen ist, erfuhr ich, daß die drei jetzt zusammenreiten. Sheriff Baxter, der Cowboy Walker und der zähe kleine Barbier von da drüben, dem kein Mensch so eine Ausdauer zugemutet hätte. Er hat alles liegen und stehen lassen und ist mitgeritten. Er hat Jenny Black sehr gern gehabt und manchen Kunden so lange beredet, bis er bei uns einen Whisky trinken kam. Leute, die über unsere Schenke schimpften, hatten nicht selten das Glück mit einer kleinen Schramme am Kinn seinen Shop zu verlassen…«
Der Marshal erhob sich. »Hören Sie zu, Mister Tom…«
»Bitte, sagen Sie nur Tom, Marshal.«
»All right. Also, Tom: Sie behalten es für sich, daß wir hier waren.«
»Sie wollen schon weg?«
»Ja, wir müssen jetzt zusehen, daß wir irgendwo zwei gute Pferde bekommen, und dann machen wir uns an die Verfolgung.«
»Gute Pferde?« meinte der Neger nachdenklich. »Hm, Miß Jenny hat mir und meinem Jungen je ein Pferd geschenkt, aber die Tiere sind natürlich nichts für Sie. Sie brauchen harte Klasserenner. Wenn ich es recht bedenke… Owen Hamp hat gute Tiere. Aber er ist ein Geizhals und verlangt unverschämte Mietpreise.«
»Wir gehen zu ihm.«
»Warten Sie, der Bruder des Mayors hat einen großartigen Falbhengst, noch sehr jung, aber ein Renner ohnegleichen. Ich habe nur ein einziges Mal ein ganz ähnliches Pferd gesehen. Sie selbst waren damit hier, Mister Earp…«
Wyatt nickte.
Tom meinte: »Man müßte ihn fragen. Ich glaube, er war ein guter Bekannter Ihres Bruders Morgan, und wenn er hier war, hat er auch oft von Ihnen gesprochen. Er schätzt Sie sehr. Soll ich ihn fragen?«
»Nein, danke, Tom. Ich werde es selbst tun.«
»Dann hat Jimmy Laugran noch einen hervorragenden Renner. Einen Schwarzen. Auch einen Hengst. Den könnte ich fragen. Er kam auch oft zu uns. An der Verfolgung konnte er nicht teilnehmen, da er sich vor zwei Wochen das Bein gebrochen hat und im Bett liegen muß…«
James Burton war ein Stiefbruder des Mayors. Er wohnte in der Fieldstreet und hatte eine große Getreidehandlung.
Ein Mädchen, das vorm Hoftor kehrte, sah den Marshal fragend an.
»Wo finde ich Mister Burton?« fragte er.
»Mister Burton? Er ist hinten im Stall.«
»Allein?«
»Ja«, sagte das Mädchen, das fieberhaft überlegte, woher es den gutaussehenden, saubergekleideten Fremden kannte.
Wyatt bedankte sich, durchquerte den Hof und trat in den Stall.
Burton hörte ihn kommen und kam mit einem Hafersack aus der Futterkammer.
Verblüfft blieb er beim Anblick des Marshals stehen.
»By gosh! Wyatt Earp!«
Wyatt trug ihm sein Anliegen vor.
Da stellte der Getreidehändler den Hafersack ab und erkärte: »Hören Sie, Marshal, der Falbe ist das beste Pferd in ganz Santa Fé. Er kostet ein Vermögen. Ich würde ihn keinem Menschen geben – außer Ihnen. Und ich tue es sogar gern für Jenny Black. Ich wüßte keinen Mann, den ich lieber auf der Fährte dieses Mörders wüßte, als Sie, Marshal.«
Ohne ein weiteres Wort holte er seinen eigenen Sattel vom Bock und ging damit in eine der Boxen.
Wyatt folgte ihm.
Der Falbhengst war wirklich ein prächtiges Tier, und der Missourier mußte insgeheim dem Neger recht geben, denn das Pferd hatte tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit mit seinem eigenen unvergessenen Schwarzfalben.
Ein paar Minuten später trabte der Marshal vom Hof.
Doc Holliday hatte sich von Tom erklären lassen, wo Jim Laugrans Haus lag. Obgleich der Georgier es nicht wollte, bestand der Schwarze darauf, ihn zu begleiten, da das Haus etwas abseits lag.
Leider hatte der Spieler nicht das gleiche Glück, das der Missourier hatte. Ein ältliches Mädchen erklärte ihm, daß Mister Laugran Schmerzen habe und im Bett liege.
Ob er ihn denn nicht drei Minuten sprechen könne, fragte der Spieler.
Nein, das wäre unmöglich.
Da meinte der Schwarze ärgerlich: »Hören Sie, Miß Laugran, Mister Holliday ist ein Gentleman!«
»Mein Bruder braucht keinen Gentleman«, entgegnete das Mädchen, »sondern einen Doktor.«
»Aber der Gentleman ist ein Doktor«, erklärte der Schwarze gestenreich.
Die Frau musterte den Georgier forschend.
»Sie sind ein Doc?«
»Ja…«
Sie winkte ihm auf eine männliche Art mit dem Arm.
»Well, kommen Sie!«
Holliday und der Schwarze folgten ihr die Treppe hinauf.
Jimmy Laugran hatte anscheinend einen Rausch. Allerdings hielt der Gambler die Möglichkeit nicht für ausgeschlossen, daß der Mann Schmerzen gehabt hatte und wahrscheinlich auch aus Ärger über sein Mißgeschick einmal zur Flasche gegriffen hatte.
»Was wollen Sie?« fragte er mit schwerer Zunge und stieß dann eine gurgelnde Lache aus. »Mann, das ist ja ein Ding! Ich sehe Sie nicht nur einmal, ich sehe Sie einmal weiß und einmal schwarz!«
Mit einem Ruck setzte er sich im Bett auf. Dicke Schweißperlen standen auf seiner Stirn. Keuchend stieß er leise vor sich hin:
»Ich sehe ihn einmal weiß… und einmal schwarz? He, das kann doch nichts mit meinem Bein zu tun haben. Ich bin krank, total krank!«
»Mein Name ist Holliday«, sagte der Gambler, aber Laugran hörte gar nicht hin. Er dachte nur an sich und seine Krankheit.
Da trat der Neger zum Schrecken Hollidays an das Bett und ergriff den kranken Fuß des Eisenhändlers.
»Hören Sie, Mister Laugran«, meinte er unter fürchterlichem Augenrollen, »dieser Gentleman da hat sich extra Ihre schäbige Treppe heraufgequält, um Sie zu besuchen. Er ist ein Doc, verstehen Sie, ein Doc! Sie können mir nicht erzählen, daß sich außer ihm schon ein Doc so erniedrigt hat, Ihre baufällige Treppe da hinaufzukriechen!«
»Au! Au!« hatte der Kranke ausgerufen, und dann waren die drei Buchstaben wie Signale in sein Hirn vorgedrungen. Doc!
Der elegante Fremde war also ein Doc! Das vermochten selbst die Whiskyschwaden unter seiner Schädeldecke nicht wegzuwischen. Schon erheblich nüchterner, fragte er den Gambler.
»Sie sind tatsächlich ein Doc und sind zu mir heraufgekommen?«
»Ja, eigentlich bin ich für Zähne zuständig, aber…«
»Zähne?« Laugran fiel in die Kissen zurück. »Das ist es ja, Doc. Es ist mein Zahn, der mich quält, und nicht das Bein. Dieses scheußliche Ding da sticht mich seit drei Tagen und drei Nächten fürchterlich.«
Holliday, der seit seiner Bostoner Zeit seine schwarze, krokodillederne Instrumententasche ständig bei sich trug, entgegnete: »Machen Sie den Mund auf. – Tom, würden Sie die Lampe halten?«
Der Neger nahm die Kerosinlampe vom Nachttisch und hielt sie so, daß der Georgier sehen konnte.
Der hervorragende Bostoner Arzt, der vor mehr als einem Jahrzehnt seine glänzende Praxis und eine wirklich hoffnungsvolle Karriere wegen der furchtbaren Krankheit, die er von einem Patienten gefangen hatte, aufgeben mußte, brauchte nur einen kurzen Blick, um zu sehen, was los war.
Wortlos öffnete er seine Tasche, doch ehe er das Instrument herausnahm, sah er sich suchend um.
»Wo ist sie?«
»Wer?« fragte Laugran.
»Die Flasche«, entgegnete der Spieler kühl.
»Ich verstehe Sie nicht…«, stotterte der vor Angst noch nüchterner werdende Eisenhändler.
»Die Flasche!« sagte Holliday scharf, denn die Zeit drängte ihn ja.
Erschrocken griff der Kranke unter die Decke und brachte eine noch zu einem Drittel gefüllte Whiskyflasche hevor.
Kleinlaut erklärte er: »Ich habe sie schon seit Tagen im Bett und trinke nur ab und zu mal daraus.«
»Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen«, schnitt ihm der Spieler die Rede ab. »Es ist Ihre Sache, was Sie mit den Flaschen machen, die sich in Ihr Bett verirren. Trinken Sie!«
»Was?«
»Sie sollen trinken!« herrschte ihn der Arzt an.
Laugran nahm einen winzigen Schluck.
»Was war denn das, Mann? Das war ein Nipper für einen Vogel. Trinken Sie endlich einen ordentlichen Schluck, noch einen, noch einen und jetzt noch einen! So, das wird reichen.«
Glucksend und nach Luft schnappend hielt der Eisenhändler die Flasche in die Luft.
Tom nahm sie ihm ab.
Mit einem schnellen Griff hatte Holliday eine kleine vernickelte Zange in die Rechte genommen und in die Linke einen Spiegel.
»Einen Augenblick die Luft anhalten.«
Jimmy Laugran verspürte einen kurzen stechenden Schmerz, und als er anfangen wollte zu schreien und seine Schwester erschrocken den Kopf durch den Türspalt steckte, erhob sich der Spieler schon.
»Seien Sie still, Mister Laugran, die Sache ist schon vorbei.«
Auguste Laugran kam, alle Rücksicht vergessend, in das Zimmer.
»Das ging ja rasend schnell. Doktor Papercorn in der Lincolnstreet läßt sich damit immer eine halbe Stunde Zeit. Ich habe auch vier wacklige Zähne…«
»Später, Miß, später«, unterbrach der Gambler ihren Redestrom.
Der Eisenhändler zog die Brauen bis hoch in die Stirn.
»He?« krächzte er gedehnt. »Es blutet zwar, tut aber kaum noch weh!«
»Kann ich mir denken«, entgegnete Holliday gelassen. »Und gegen das Bluten wird Ihnen die Miß eine Tasse Kamillentee bringen.«
Laugran strahlte über das ganze Gesicht.
»Doc, Sie sind eine Kanone! Das lasse ich mir was kosten.«
»Nicht nötig«, erwiderte der Spieler, während er seine Instrumente in die Tasche packte. »Sie werden mir Ihren schwarzen Hengst leihen, weil er das einzige Pferd ist, mit dem ich in der Lage bin, dem Marshal Earp bei der Verfolgung des Mörders Oregon Jack zu begleiten.«
Laugran zog die Brauen zusammen. »Wie war das?« stotterte er.
»Wyatt Earp hat die Verfolgung des Mörders Oregon Jack aufgenommen. Und da ich ihn seit einigen Jahren auf solchen Verfolgungsjagden begleite, meinen eigenen Gaul aber in Dodge City lassen mußte…«
Laugran saß kerzengerade im Bett und schlug sich mit der flachen Rechten vor die Stirn.
»Doc Holliday?«
Der Spieler nickte. »Wenn es Ihnen recht ist.«
»Recht ist!« rief Laugran. »Mann, Doc, Sie sind eine Wolke! Und wenn ich noch einmal Zahnschmerzen habe und wüßte, daß Sie in Montana wären, liefe ich Ihnen bis dahin nach. Auguste, du mußt noch einmal in den Hof und den Stall aufschließen.«
Fünf Minuten später trabte der Georgier auf dem Rücken des Rapphengstes aus dem Hof des Eisenwarenhändlers.
Der weißhaarige Neger stand am Tor und winkte ihm nach.
»Good luck, Doc, und fare well!«
*
Holliday ritt im scharfen Trab in die Mainstreet hinauf, wo er sich mit Wyatt Earp verabredet hatte.
Der Marshal stand schon wartend neben seinem Pferd vor der Fegefeuer-Bar. Und als er den Hufschlag hörte, blickte er die Straße hinunter.
Schon an diesem Geräusch erkannte er, daß es kein gewöhnliches Pferd war, das sich da näherte.
Holliday rief ihm schon von weitem zu: »Alles klar, aufgesessen!«
Der Missourier schwang sich sofort in den Sattel und trabte neben dem Spieler los.
»Ging nicht so ganz glatt, was?« rief er ihm zu.
»Wie man’s nimmt. Es war ein Backenzahn…«
Die beiden Dodger verließen gegen halb zehn die Stadt und trabten nach Norden davon.
Aber schon eine halbe Meile hinter der Stadt hielten sie an und schlugen in einer kleinen Mulde ihr Nachtlager auf.
Wyatt lag mit dem Kopf auf seinem Sattel, hatte sich in seine Jaccarilladecke gewickelt und blickte zu den flimmernden Sternen hinauf.
Seit dem Augenblick, da ihm der Georgier oben in Dodge die Schreckensbotschaft übermittelt hatte, lag der Schmerz wie ein düsterer Druck in seiner Seele und meldete sich immer dann, wenn er von den Ereignissen des Tages einmal Abstand nehmen konnte.
Jenny Black war tot.
Er hatte sie seit vielen Jahren geliebt, ohne es eigentlich selbst klar zu wissen.
Immer und immer wieder hatte es ihn in das ferne Santa Fé gezogen, aber nie hatte er es für richtig gehalten, mit der Frau zu sprechen.
Er war nicht auf der Suche nach einer Frau durch dieses Land geritten, aber es war auf die Dauer kein Leben ohne Frau. Sicher, es gab immer wieder Freundinnen hier und dort, in allen Städten, aber es wurde doch Zeit, daß er sich ein neues Heim gründete und an die Zukunft dachte. Es war doch ausgeschlossen, daß er weiter jahrelang in dieser Unrast durch die Staaten ritt, Mördern folgte, Räubern, Menschen, die sich auf ungeheuerliche Weise gegen das Gesetz vergangen hatten, ohne daß er wirklich wußte, wo sein Zuhause war. Dodge? Well, es war natürlich seine Heimat seit fast einem Jahrzehnt, aber er war doch immer allein. Doc Holliday wohnte seit Jahren mit der blonden Kate Fisher zusammen, daß er noch nicht mit ihr zum Reverend gegangen war, um endlich den Ring zu tauschen, lag weniger an dem Doc als vielmehr an dem unseligen Umstand, daß sein Freund, der Marshal Earp, immer einen unaufschiebbaren Ritt hatte, auf den ihn der Gambler dann auch nicht allein ziehen lassen wollte. Es lag an der Zeit, die mit ihren Wirren die Menschen im Gegensatz zu der Bevölkerung der zivilisierten Zonen weit aus dem Gleichmaß ihres Lebensrhythmus’ geworfen hatte.
Und dann hatte er eines Tages Jenny Black gesehen. Anfangs war es nur ihre blendende Schönheit, die ihn gefesselt hielt. Dann erschrak er vor sich selbst, weil er sich immer wieder bei dem Gedanken an die Frau überrascht hatte. War sie nicht viel zu selbstherrlich für ihn, zu stolz und vielleicht auch zu schön? Hieß es nicht, daß man eine schöne Frau wohl ansehen, aber nicht heiraten sollte? Nicht allein wegen der vielen anderen Augen, die sie weiterhin anschauen würden…
Unbewußt hatte es ihn immer wieder nach Santa Fé getrieben, in die Nähe. Und Doc Holliday war es, der schließlich den entscheidenden Anstoß gegeben hatte.
Er hatte noch spät in der Nacht zu ihm gesagt:
»Wie soll das weitergehen, Wyatt. Sie können doch nicht unentwegt und rastlos durch die Savanne reiten und Banditen folgen, durch die Prärien des Westens hetzen, um Menschen zu jagen, die anderen Unglück und Elend gebracht haben. Das muß einmal vorbei sein. Sie haben längst Ihre Pflicht getan. Sie haben mehr Verbrecher gejagt als sonst irgend jemand in diesem Land. Es kann niemand von Ihnen erwarten, daß Sie Ihr Leben Tag für Tag für das Gesetz in die Schanze schlagen, Sie sind kein Jüngling mehr und müssen endlich auch an Ihre Zukunft denken…«
So hatte er gesprochen, der Spieler Holliday, der selbst sein Leben Tag für Tag für die Angelegenheiten seines Freundes Wyatt Earp in die Schanz schlug.
»Es muß irgendwie geändert werden können, Wyatt, denn auch der Stärkste ist eines Tages ausgepumpt und ermattet. Noch sehen Sie strahlend gesund aus, aber das darf Sie doch nicht soweit bringen, auf den Tag zu warten, an dem Sie so elend sind, wie ich es manchmal bin. Es muß ein Ende haben. Sie können Bat Masterson auf den Trail schicken oder Bill Tilghman, es sind beides prächtige Männer, die nicht weniger energisch vorgehen werden als Sie…«
Der Marshal hatte längst über diese Worte nachgedacht. Viel länger, als der Georgier vermutete.
Aber saß nicht schon in seiner ahnenden Seele die Gewißheit dessen, was kam? Wußte er nicht schon, daß es noch lange kein Ende haben sollte? Daß er noch Jahre durch die Savannen reiten würde, durch die Prärien und über die Berge des Westens, um Mörder zu jagen, um Menschen zu stellen, die anderen die Hölle auf dieser Erde bereitet hätten?
»Solange ich gesund bin, Doc, bleibe ich im Sattel. Es sind ihrer zu viele, die raubend, plündernd und mordend durch dieses junge Land ziehen.«
*
Beim ersten grauen Schimmer, den der neue Tag im Osten über den Horizont warf, erhoben sich die beiden, wickelten ihre Decken zu Sattelrollen, wuschen sich in einem winzigen Creek, und kochten sich auf einem kleinen eisernen Dreibein in Wyatts altem Kupferkesselchen, das auf all seinen Ritten dabeigewesen war, einen Morgenkaffee, zu dem es Brot und Käse gab.
Dann wurden die Pferde gesattelt, und die beiden Männer stiegen auf.
Sie waren westlich von der kleinen Ansiedlung San Moris.
Hier kannte ihn kaum jemand, und selbst wenn ihn einer erkannt hätte, wäre es nun nicht mehr so wichtig gewesen. Der Missourier hatte auf jeden Fall vermeiden wollen, daß es sich schon am Vorabend in Santa Fé herumsprach, daß er und Holliday angekommen waren.
Deshalb hatte er den Getreidehändler gebeten und Holliday den zahnkranken Laugran bitten lassen, nichts über ihre Anwesenheit in der Stadt verlauten zu lassen.
Zumindest der Getreidehändler würde schweigen. Und Laugran hatte Zahnschmerzen und konnte sein Bett wegen des Beins noch nicht verlassen; es war also anzunehmen, daß die Nachricht vom Auftauchen Wyatt Earps in der Stadt verborgen blieb.
Weshalb er so großen Wert darauf legte?
Weil er nicht für ausgeschlossen hielt, daß Oregon Jack weder nach Norden noch nach Süden, Westen oder Osten geflüchtet war, sondern noch in der Stadt war. Oder jedenfalls ganz in der Nähe.
Ein so gerissener und kaltherziger Verbrecher konnte möglicherweise auf den Gedanken kommen, sich gleich hinter der ersten Deckung zu verstecken, um die ganz sicher aufbrechende Posse an sich vorbeireiten zu lassen.
Sieben Häuser bildeten die Ansiedlung San Moris, die eigentlich noch zu Santa Fé gehörte und schon ein knappes Jahrzehnt später von der sich gewaltig ausbreitenden Stadt aufgesogen wurde.
Vor dem zweiten Haus war ein alter Mann damit beschäftigt, morsche Zaunlatten durch neue zu ersetzen.
Holliday hielt bei ihm an und rutschte aus dem Sattel.
»Hallo, Mister, heißt diese Stadt hier San Moris?«
»Stadt?« Der Mann kratzte sich lächelnd unter dem Hut. »Ja, vielleicht ist es bald eine wirkliche Stadt. Jetzt sind es sieben Häuser und mehrere Scheunen. Wir kommen aus der Schweiz drüben im alten Europa, wissen Sie, und da haben wir gedacht, es wäre nett, wenn wir unsere Stadt San Moris nennen würden, nach einer kleinen Stadt bei uns daheim in den Bergen.«
Holliday nahm sein Zigaretten-Etui aus der Tasche und hielt es dem Mann hin.
Der lehnte ab. »Ich rauche nur Pfeife.«
Er nahm seine zernagte Maiskolbenpfeife aus der Tasche und kramte ein paar Tabakkrümel hervor.
Holliday zerbrach eine Zigarette und zog die Papierhülle davon. Den goldenen Tabak hielt er dem Alten hin.
»Nehmen Sie.«
»Was denn, ist das nicht zu schade für die Pfeife, der teure Tabak, den Sie für die fertigen Zigaretten nehmen?«
»Unsinn, stopfen Sie ihn in Ihre Pfeife.«
Er lehnte sich gegen seinen Rappen und stieß den Hut aus der Stirn.
»Wir hatten uns hier mit ein paar Freunden verabredet, mein Partner und ich.«
Wyatt tippte an den Hutrand.
Der Alte erwiderte den Gruß.
»Hier gibt’s aber weder einen Saloon, noch ein Boardinghouse.«
»Was – soll das etwa heißen, daß es bei euch nirgends einen Drink gibt?«
»Einen Drink? Well, wir reiten hinüber in die Stadt. Es ist ja nicht weit, nur etwas über eine halbe Meile.«
»Und wer kein Pferd hat, der muß hierbleiben und verdursten. Nein, zuerst hat mir Ihr San Moris gefallen, Mister, aber jetzt finde ich es direkt trostlos. Kein Wunder, daß sich unsere Freunde hier nicht aufgehalten haben.«
»Wie konnten Sie sich auch an einem so kleinen Ort verabreden?«
»Ach, Jackson war der Ansicht, daß es ein guter Treffpunkt wäre, wo man sich nicht verfehlen könne. Santa Fé kannten wir alle nicht, und deshalb beschlossen wir, uns in San Moris zu treffen.«
»Das tut mir leid für Sie. Wie viele Männer waren es denn?«
»Drei.« Holliday schnipste die Asche von seiner Zigarette.
Der Mann schüttelte den Kopf.
*
Noch viermal wiederholte sich diese Szene, in Little Wellington, in Dodery und in West und South Varney, alles kleine Randortschaften in der näheren Umgebung Santa Fés.
Und immer mit dem gleichen Erfolg.
Niemand hatte die drei Reiter gesehen.
Gegen zwölf Uhr erreichten sie im Südwesten der Stadt, aber immer noch im Umkreis von zwei, drei Meilen, eine kleine Häuseransammlung, die überhaupt keinen Namen zu haben schien.
Ein Junge saß auf einem Feldstein und spielte mit einem Feuersalamander.
Holliday beugte sich zur Seite und fragte:
»Sag mal, hast du diesen prächtigen Burschen selbst gefangen?«
Der Junge nickte eifrig.
»Hm, man sagt, es gäbe diese seltenen roten Feuersalamander nur dort, wo eine besonders schwatzhafte Frau wohnt.«
Der Kleine zog die Brauen bis unter den Pony.
»Das wußte ich noch gar nicht. Dann werde ich doch gleich mal bei der alten Ely Sanders im Garten suchen…«
Er rannte davon.
»Was soll das denn?« wollte der Marshal wissen.
Holliday blickte in den azurfarbenen Himmel.
»Ist das nicht eine mörderische Hitze heute?«
»Wie im Llano…« Sie ritten weiter.
Ein Mann hackte im Schatten eines größeren Hauses Holz.
»He, Mister«, fragte ihn Holliday, »wo finden wir Mrs. Sanders?«
Der Mann richtete sich auf und meinte:
»Die Alte – ja, sie lebt tatsächlich noch. Sie sind ein Verwandter?«
»Wie haben Sie das denn herausgefunden?«
»Sie redet seit hundert Jahren von einem Neffen aus Georgia.«
»Ja, ich komme aus Georgia, ist nur schon eine Weile her.«
Damit hatte er sogar die pure Wahrheit gesagt.
»Also, sie wohnt unten rechts im letzten Haus an der Straße. Das Haus liegt etwas zurück. Ein altes halbverfallenes Ding. Damals, vor fünf Jahren, als sie auf den Tod darniederlag, freuten sich ihre Nachbarn schon, daß sie den alten Kasten endlich niederbrennen könnten.«
»Nette Nachbarn.«
»Ja, wie man’s nimmt. – Also, das vorletzte Haus auf der rechten Seite, hier an der Straße nach Albuquerque.«
»Thanks.«
Die beiden ritten weiter.
Das vorletzte Anwesen auf der rechten Straßenseite war eine baufällige große Holzbude, eingeschossig, mit einem gewaltigen ausgebauten Kamin.
Mehrere Hunde lungerten vor dem Tor herum.
Der Bretterzaun bestand zum größten Teil aus Zwischenräumen, die meisten Bretter fehlten, manche existierten nur noch halb, andere fristeten ihr Dasein in der Schräglage.
Die beiden ritten auf das Tor zu.
Wyatt stieß es vom Sattel aus mit dem Stiefel auf.
Klatsch! Der linke Torflügel stürzte krachend in den Hof.
Holliday lachte laut auf.
»Sie lassen sich den Besuch bei der alten Klatschbase ja etwas kosten.«
Zwei Hunde stoben jaulend davon.
Ein dickbauchiger Neufundländer kam bellend durch die freigewordene Lücke.
»Der scheint darauf gewartet zu haben«, meinte der Spieler. »Die Lücken im Zaun waren zu eng für ihn.«
Wyatt stieg vom Pferd und streichelte dem massigen Tier den schwarzen Schädel.
Da ertönte ein kreischender Aufschrei, der die anderen Hunde, die auf dem Fluchtweg zum Hause hin waren, wie angewachsen stehenbleiben ließ.
Die Tür der Behausung war geöffnet worden, und eine wenigstens sechseinhalb Fuß große Frau kam kreischend in den Hof. Ihr wirres graues Haar kam unter dem ausgeblichenen blauen Kopftuch hervor. Ihr Gesicht war von unzähligen Falten zersägt.
Die Augen waren schrägstehend und viel zu weit von der Nasenwurzel entfernt, was ihr eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Weidetier gab. Lang und spitz herunterhängend die Nase, an den Enden nach unten gebogener Strich der Mund. Das Kinn war spitz und seltsam dunkelbraun.
Die Frau priemte.
Ihr graues Kleid war überall mit Flicken besetzt und die blaue Schürze ebenfalls. Riesige schwarze Stiefel schlotterten um ihre Beine.
Mit raschem, watschelndem Gang kam sie auf die beiden Reiter zu.
Wyatt Earp und Doc Holliday stiegen ab. Die Frau kam bis dicht an sie heran.
Dann stemmte sie ihre mit einer pergamentenen Haut überzogenen Hände in die breiten Hüften.
»Was ist mir das, he? Kommen da zwei Kerle daher und zertrümmern mir mein Tor!«
»Tor?« Holliday sah sich um.
Die Frau stieß urplötzlich den Kopf vor wie ein Raubvogel und belferte mit ihrer schrillen Kreischstimme:
»Banditengesindel! Lumpenpack! Ich knalle jeden ab, der es wagt, bei…«
»Aber Mrs. Sanders«, meinte der Marshal fast leise mit seiner dunklen sonoren Stimme.
Die Frau horchte auf, schloß einen Augenblick die Augen und schien dem Klang dieser Stimme nachzulauschen.
Zur Verblüffung der beiden bekreuzigte sie sich dann und stieß im höchsten Diskant hervor:
»Allmächtiger, er ist wieder auferstanden, der selige Sheriff Earp! Er ist wieder auferstanden! Ja, denn der Herr gibt Zeichen und Wunder, auch den Ärmsten der Armen, in seiner Ratlosigkeit…«
»In seinem Ratschluß«, verbesserte der Spieler.
»Was?« Sie warf den Kopf herum.
»Well, er spricht nicht nur wie der tote Sheriff, er sieht auch fast so aus, wie Morgan heute aussehen müßte.«
»Sie kannten Morgan Earp?« fragte Holliday.
»Kannten? Welch ein Wort. Ich war gewissermaßen seine Vertraute. Immer, wenn er Trost, Rat und Hilfe suchte, kam er herausgeritten zu mir, um mich zu bitten…«
»Sehen Sie«, wandte sich der Gambler an den Marshal. »Auch andere Leute haben Einfälle.«
»Scheint in der Familie und deren nächster Umgebung zu stecken.«
Holliday nahm seine Zigaretten heraus.
Blitzschnell zuckte die lange knochendürre Hand der Frau nach vorn – schwupp, hatte sie zwei Zigaretten an sich gerissen.
»Ich hätte nur eine genommen. Aber die zweite ist als Anzahlung für den Torflügel.«
»Schade, wenn nun Jackson schon hier wäre, hätte er das Tor gleich für Mrs. Sanders reparieren können!«
»Welcher Jackson?« fragte die Frau mit erwachender Neugier.
»Ach, ein Freund von uns. Er wollte eigentlich schon hier sein…«
»Hier?« fragte die Alte mit vorgestrecktem Kopf.
»Ja, wir hatten uns hier am Ende der Stadt verabredet. Aber Jack ist ein Verschwender, er bleibt in jeder Schenke hängen und vertut sein Geld. Well, sein Vater ist ein steinreicher Mann und hat genug, um ihn leben zu lassen wie ein König. Es war eigentlich völlig unnötig, daß er ein Handwerk erlernte, aber…«
Der Gambler tischte ihr eine Story auf, daß es dem Marshal die Haare zu Berge trieb.
Plötzlich legte die Alte den gichtgekrümmten Zeigefinger der Rechten an die welken Lippen.
»Drei Reiter? Hm, warten Sie, Prestly, dieser Hamsterer hat mich gebeten, nicht darüber zu sprechen, aber wenn es so ist und dieser Jackson ist Ihr Freund, dann sieht das doch alles anders aus. Vor allem, wenn für mich ein neues Tor dabei herausspringt. Und das ist sowieso immer so eine Sache bei Prestly! Ihr Freund Jackson soll da sehr vorsichtig sein. Prestly hat vier Töchter und sucht nur Schwiegersöhne. Also, wenn ich Ihnen erzählen würde, wie gerade diese M…«
Wyatt blickte auf die Uhr und unterbrach den Redestrom der Frau.
»Wir wollen sehen, daß wir weiterkommen. Jackson wird nach La Cienega geritten sein.«
»Wer weiß«, meinte die Alte. »Bei Prestly sind jedenfalls ein paar Leute abgestiegen…«
»Vorgestern?«
»Es muß vorgestern gewesen sein. Jedenfalls habe ich da erst die Hemden im Hof hängen sehen.«
»Hemden?«
Holliday nickte verständnisinnig.
»Sie kennen natürlich die Hemden von Mister Prestly alle so genau, daß es Ihrem scharfen Auge sofort auffallen würde, wenn einmal ein fremdes Hemd im Hof hängt.«
»Richtig. Genauso ist es.«
»Aber könnte sich Mister Prestly denn nicht einmal ein neues Hemd gekauft haben?«
»Nein, ziemlich ausgeschlossen. Das letzte hat er erst vor fünf Jahren gekauft, als ich krank wurde. Und außerdem hingen zwei fremde Hemden da und Strümpfe. Und er hat mehr Mist aus dem kleinen Stall geholt als sonst, und die Frau hat beim Butcher mehr Fleisch gekauft, und der Bäcker hat ihr gestern zwei Brote einpacken müssen und Zigarren raucht Prestly gar nicht, aber Mrs. Prestly hat Zigarren gekauft, und sich bei Jenussin nach dem Zug nach Albuquerque erkundigt.«
»Sehr einleuchtend«, meinte Holliday. »Wahrscheinlich hat oder haben die Besucher der Prestlys diesen Zug schon genommen?«
»Nein. Ihre Hemden hingen gestern abend noch da.«
»Aber sie können in der Nacht weitergeritten sein.«
»Nein, die Frau hat heute morgen Whisky geholt…«
Holliday tat, als wolle er aufsteigen.
»Tja, dann wollen wir mal hinüber zu Prestly reiten, um zu sehen, ob unser Freund Jackson dabei ist.«
»Nein!« Die Frau ergriff ihn am Arm. »Warten Sie, Sie dürfen nichts von mir sagen!«
»Warum nicht. Er kennt Sie…«
»Wie meinen Sie das?« fragte sie scharf, mit hochgeworfenem Kopf.
»Ich meine, er wird doch keinen Grund zum Ärger haben, wenn wir unseren Freund Jackson bei ihm begrüßen, schließlich hatten wir uns hier am Ausgang der Ansiedlung verabredet. Ich traf vorhin eine Frau, die meinte, als wir auf Sie, Mrs. Sanders, zu sprechen kamen, Sie wären eine gute Frau…«
Die alte Sanders nickte wohlgefällig.
»… nur hätten Sie ziemlich viel Ärger im Dorf verursacht…«
Schlagartig veränderten sich Gesichtsausdruck und Haltung der Alten.
»Wer hat das gesagt? Sicher die Cryanson. Na, warte, der werde ich es geben, der fetten Wachtel! Ich kratze ihr morgen beim Krämer die Augen aus. Es ist eine dicke kleine, nicht wahr, mit öligem Haar und rot angestrichenen Backen! Das tut sie, seit sie es an der Lunge hat und immer bleicher und bleicher wird…«
Wenn sie sich noch eine Viertelstunde bei der Alten aufgehalten hätten, würde ihnen die Ortschaft mit allem, was sich hier ereignete, so vertraut gewesen sein, als hätten sie schon ein halbes Jahrzehnt hier gelebt.
»Well, Madam, dann werde ich einmal hinübergehen und nachsehen, ob Jackson vielleicht drüben Unterschlupf gesucht hat. Denkbar wäre es immerhin, denn er konnte schließlich nicht auf der Straße auf uns warten.«
Die Alte hob mahnend den Zeigefinger, während sie eine der Zigaretten des Spielers zerknüllte und zusammen mit dem zerfetzten Papier als Priem hinter einen Backenzahn schob.
»Vorsicht, Mister! Prestly ist ein ziemlich merkwürdiger Vogel. Er meint ja, ich hätte es nicht bemerkt, aber er hat verdammt eigenartige Angewohnheiten…«
»Wie meinen Sie das?«
Sie wiegte nachdenklich den Kopf und tat, als wolle sie sich ihre Geheimnisse nicht abringen lassen.
»Man ist ja keine Schwätzerin…«
»Beileibe nicht!« meinte der Spieler mit entrüsteter Miene. »Wer das behauptet, verdiente Ohrfeigen!«
»Eben. Und man kümmert sich ja auch nicht um andere Leute, sonst wüßte man ja viel, viel mehr. Was geht es mich schließlich an, was die Prestlys tun. Sie haben kein Geld, sich mitten in der Woche ein Huhn zu leisten, und doch haben sie gestern abend Huhn gegessen…«
»Und Prestly hat so seine Eigenarten?«
»Weiß Gott, weiß Gott. Wozu geht ein Mann abends mit dem Gewehr herum?«
»Ach, vielleicht hat er Platzangst.«
»Was…, nein, er rennt mit dem Gewehr herum.«
»Glaube ich nicht, Sie werden sich getäuscht haben. Wozu sollte…«
»Ich mich getäuscht haben? Für wen halten Sie mich, Mister. Was ich sehe, sehe ich.«
Die beiden verabschiedeten sich.
Holliday hatte ihr noch ein paar Zigaretten dagelassen, was sie mit einem grienenden Lächeln wortlos quittiert hatte.
Ganz sicher hockte sie jetzt hinter einer Bretterstelle, die breit genug war, ihren Körper zu verdecken, und linste durch ein Astloch, um zu beobachten, was weiter geschah.
»Ein furchtbares Weib«, meinte der Spieler.
»Die Neugier und der Tratsch in Person«, stimmte der Marshal zu. »Übrigens keine schlechte Idee, das Dorfklatschmaul herauszusuchen und auszuquetschen. Sie haben ja die Rosinen regelrecht herausgelockt.«
»Es wird sich in spätestens fünf Minuten herausstellen, ob es sich gelohnt hat oder ob es wieder eine Niete war.«
Das nächste Anwesen, das letzte Haus des Ortes, lag näher an der Straße. Als die beiden auf den Hof zuritten und Wyatt einen Blick hinüber zum Nachbaranwesen warf, mußte er sich wundern, daß die neugierige Alte über eine solche Distanz soviel erhaschen konnte.
»Was hartnäckige Weiberneugier doch alles zustande bringen kann«, meinte der Spieler, der den Blick Wyatts beobachtet hatte. »Die Frau kennt das Leben der Prestlys höchstwahrscheinlich besser als die Prestlys selbst.«
Ein vierschrötiger, muffig dreinblickender Mann mit verkniffenem Gesicht kam aus dem Haus.
»Was wollen Sie?« krächzte er.
Wyatt Earp war draußen vorm Tor hinter der Fenz stehengeblieben.
Holliday ritt dem Mann entgegen und stieg vom Pferd.
»Sie werden entschuldigen, Mister, mein Name ist Henry, John Henry aus Boston.«
Er lüftete seinen Hut mit einer steifen, städtischen Gebärde und lächelte dünn.
»Ich bin vom Gouverneur beauftragt worden, den Distrikt hier zu bearbeiten. Es soll festgestellt werden, ob hier in der Stadt ein Sheriff Bureau gelegt werden muß oder…«
»Stadt?« knurrte der Mann. »Wo ist denn hier eine Stadt! Der Gouverneur muß Sand im Hirn haben, wenn er in dieses Nest einen Sheriff setzen will. Das ist doch reine Geldverschwendung.«
»Ach, wissen Sie, es ist ja nicht unser Geld, das Ihre und nicht das meine. Ich habe die Gelder auftragsgemäß in Santa Fé in Empfang genommen…«
»Die Gelder?« entfuhr es dem Mann.
»Nun ja«, tat Holliday leichthin und so, als habe er den Einwurf nicht bemerkt, »die Gelder zur Errichtung eines standesgemäßen Hauses für den Sheriff. So etwas wird sofort erledigt, wenn es einmal festgelegt worden ist. Die haben ja das Geld da oben, Sie wissen schon – wir Kleinen krautern für ein paar Dollars jahrelang herum, und wenn sie so einen Bau für einen Sternträger und ein Jail anlegen wollen, dann ist Geld reichlich da…«
Jacob Prestly stand mit offenem Mund da. Er war dem gerissenen Georgier glatt auf den Leim gegangen. Aber es war kein Wunder, zu gewandt, zu sicher spielte der Gambler seine Rolle, und zog man sein tadelloses Aussehen hinzu, so war die Tatsache, daß ihm der Mann auf den Leim ging, gar nicht einmal so verwunderlich.
Prestly legte den Kopf auf die Seite und fragte so offensichtlich lauernd, daß Holliday ihm am liebsten eine Ohrfeige gegeben hätte.
»Was wollten Sie denn bei der Sanders, he?«
»Ach, nichts.«
»Haben Sie auch ihr das alles erzählt?«
»Guter Mann, seh ich so aus?«
»Und wo waren Sie sonst noch?«
»Noch nirgends. Ich merkte gleich, daß die alte, einfache Frau von diesen Dingen nichts versteht, und fragte sie nach Nebensächlichkeiten. Sie meinte, Sie seien auch nicht so ohne…, ja, das meinte sie unter anderem.«
Der vierkantige, massige Schädel Prestlys flog herum.
»Diese verdammte Hexe! Na, eines Tages drehe ich ihr doch noch den Hals um!« stieß er zur Verwunderung des Spielers auf Französisch hervor.
Holliday hatte jedes Wort verstanden, tat aber, als habe er kein Wort begriffen, indem er fragte:
»Wie meinten Sie ganz richtig, Mister?«
»Was? Ach, ich meinte, die Ärmste ist auch ziemlich krank und wird es nicht mehr lang machen. – Ja, Mister…«
»Henry, John Henry.«
»Also, Mister Henry, das ist natürlich eine Sache, die überlegt werden müßte. Wenn ein Sheriff hier säße und ein Jail hier wäre, könnte sich hier manches ändern. Man hat ja so was schon erlebt«, log er weiter. »Ich war vor Jahren mal in einer kleinen Ansiedlung, die war noch kleiner als Agua. Eines Tages kam der Gouverneur auf den Gedanken, einen Sheriff dahinzusetzen, und siehe da, die Stadt wurde rasch größer.«
Er entwickelte plötzlich direkt eine gewisse flinke Beredsamkeit.
Nach Hollidays Schätzung war er ein Franzose oder doch aber ein Abkömmling von französischen Einwanderern, denn hier in diese gottverlassenen Gegend gab es ganz sicher für einen solchen Menschen keine Gelegenheit, die französische Sprache zu erlernen. Ganz davon abgesehen, daß dieser Mann auch gar nicht so aussah, als hätte er solche Ambitionen.
Und je länger er sprach, desto deutlicher hörte der Spieler den gallischen Akzent heraus, den der Mann anfangs beim langsamen Sprechen sehr geschickt vermieden hatte.
»Tja, dann werde ich mal sehen, wo ich noch eine Nachfrage halten kann«, meinte Holliday. »Es muß ja nun entschieden werden. Einige Bürger von Agua haben nämlich den Antrag gestellt…«
»Ach«, unterbrach ihn Prestly mit sichtlichem Erschrecken in den Augen. »Da haben also ein paar Halunken hier aus dem Nest den Wahnsinn ausgeheckt!« Wieder hatte er französisch gesprochen.
»Was meinten Sie?«
»Ich…, ich meinte, daß es also von hier ausgeht…, daß es also hier…«
»… fortschrittliche Menschen gibt«, half ihm Holliday.
»Richtig, ja, das meinte ich. – Übrigens, Mister Henry, Sie können ins Haus kommen. Wir werden zusammen einen Drink nehmen und die Sache noch einmal richtig durchsprechen. So etwas will ja gut überlegt sein. Schließlich tragen Sie ja die Verantwortung.«
»Ich?« tat der Spieler verdutzt.
»Nun ja, Sie sollen es ja hier an Ort und Stelle entscheiden und doch«, wieder der lauernde Blick, »gleich den Bau eines Hauses in Auftrag geben und Zahlungen leisten… All die Arbeit haben Sie doch, oder etwa nicht?«
»Schon, schon…«
Der Franzose ergriff ihn am Arm und zog ihn ins Haus.
Nie begriffen die beiden Dodger eine solche Unvorsichtigkeit.
Hatte Prestly denn nicht bemerkt, daß es zwei Männer waren, die drüben bei der Alten gewesen wa-ren?
Er führte den Gambler ins Haus.
Holliday kam in einen dunklen Korridor und sah zu, daß er nicht etwa vor Prestly, sondern neben ihm ging.
»So, Sie haben also das Geld bei sich, Mister Henry? Das ist ja sehr schön. Dann wollen wir Ihnen mal alle weiteren Wege ersparen.«
»Wie meinen Sie das?« fragte Holliday.
»Sie können es hierlassen. Ich selbst werde für den Bau des neuen Office sorgen.«
»Sehr liebenswürdig, Mister, aber dazu bin ich nicht befugt.«
»Dann befuge ich Sie dazu«, schnarrte Prestly plötzlich mit verändertem Ton.
»Ich verstehe Sie nicht…«
»Du wirst gleich verstehen.«
Prestly riß einen Revolver unter der Jacke hervor, hielt aber in der Bewegung inne, als ihm der Spieler einen seiner eigenen Colts in die Rippen drückte.
»Was fällt Ihnen ein, Mensch? Sie bedrohen mich in meinem eigenen Haus mit einem Revolver? Roy!« schrie er dann. »Mensch, wo steckst du? Ich bringe hier einen fetten Hasen an, und du schläfst.«
Holliday war darauf gefaßt gewesen.
Er schob sich so unter die nach oben geschlossene Treppe, daß er jedenfalls nicht aus dem Hinterhalt angegriffen werden konnte. Und dann warf er seine nächste Angel aus.
»Ich möchte wissen, was mein Freund Gene Hosters sagen wird, wenn er von der Geschichte erfährt. So grob bin ich bisher noch niemals behandelt worden. Ich kann doch nicht einfach das Geld für das Office hierlassen. Was sollte da erst Gene machen, der die Gelder für drei Bauten bei sich führt.«
Da kam hinten von der Treppe her die schnarrende Stimme eines Mannes.
»Ich kann dich wirklich nicht verstehen, Prestly, daß du so grob mit dem Mann umgehst.«
Knarrende Schritte auf der Treppe.
Holliday sah im Lichtschimmer, der von der nicht ganz geschlossenen Haustür in den Flur fiel, die Gestalt eines hünenhaften Mannes.
Es war der Verbrecher Roy Abbot, einer der drei Desperados, die in Santa Fé den Raubmord an der Saloonerin der Fegefeuer-Bar verübt hatten.
Die Überlegungen Wyatt Earps hatten sich also schon zu einem Teil als richtig erwiesen.
Die drei Verbrecher hatten sich getrennt und jeder für sich sofort in unmittelbarer Nähe der Stadt Deckung genommen.
Der herkulische Abbot hatte sein Pferd in eine leerstehende Scheune gezogen und die Dunkelheit abgewartet. Dann war er hier nach Agua geritten, um Prestly aufzusuchen, den er von früher her kannte. Er hatte zwar nicht viel Geld bei sich, aber für einen Mann wie Prestly waren auch ein paar Dollars viel Geld. Der Tagelöhner war arbeitsscheu, und seine Frau war krank. Dennoch ließ der brutale Mann sie noch alle Arbeiten, die es im Haus und sonst noch zu tun gab, ausführen. Er hatte sogar seine Frau veranlaßt, Abbots Hemden auszuwaschen, das, was er auf dem Leib trug, und sein Wechselhemd.
Die Beobachtungen der alten Sanders waren also nicht falsch gewesen.
Doch Holliday wußte nicht, wer der Mann war, der da vor der Tür stand. Aber er wußte, daß hier im Haus nur ein Mann und eine Frau lebten.
»Wer sind Sie?« fragte er.
»Ich bin Prestlys Bruder, Jim.«
Das war also schon eine Lüge. Und damit war der Fall für den Georgier klar.
Roy Abbot seinerseits hätte längst die Karten aufgedeckt, aber er war dem zweiten Angelwurf des Georgiers an den Haken gegangen.
»Wo treibt sich denn jetzt Ihr Partner herum, Mister?«
»Mein Partner? Der ist doch ganz in der Nähe.« Und dann zählte er die kleinen Ansiedlungen auf, die er heute zusammen mit dem Marshal aufgesucht hatte. »Da irgendwo muß er stecken.«
Prestly knurrte: »Was soll der Quatsch, Roy. Der Kerl hat mir einen Revolver zwischen die Rippen gedrückt.«
»Sie nennen sich Jim, er nennt Sie Roy? Was ist das bloß für eine Familie?« fragte Holliday harmlos.
»Also, Sie glauben, er könne in San Moris sein?« fragte Abbot ungeduldig.
»Ja, wenn ich mich recht erinnere, muß er da sogar sein. Und ich weiß auch, wo.«
»Kommen Sie«, sagte Abbot rauh, »ich muß mit ihm sprechen.«
Da krächzte Prestly: »Diesmal schöpfe ich mit ab, Roy.«
»Halt dein Maul, Mensch.«
Doc Holliday mußte seine Rolle glänzend gespielt haben, denn die beiden nahmen kein Blatt mehr vor den Mund. Jedenfalls Prestly nicht.
»Der Bursche bleibt hier.«
Abbot stand breitbeinig da. Plötzlich hatte er einen Revolver in der Hand.
»Du hast Pech gehabt, Prestly, diesmal bin ich dran.«
Holliday stand halb im Dunkeln. Er handelte blitzschnell. Aus stumpfem Winkel feuerte er eine Kugel auf Abbots Rechte ab, die dem Verbrecher den Revolver aus der Hand stieß. Im nächsten Augenblick riß er Prestly den Revolverlauf über den Schädel.
Hüstelnd und weinend kam eine Frau hinten aus der Stube.
»Um Gottes willen, was macht ihr schon wieder?«
»Gehen Sie hinaus, Jim«, befahl Holliday Abbot.
Der Riese krächzte: »Das gelingt dir nicht, Stadtfrack. Ich bin Roy Abbot. Ich stampfe dich in den Boden.«
»Blas dich nicht auf, Abbot, und geh hinaus.«
Prestly war rechts an der Korridorwand in sich zusammengesunken.
Abbot wandte sich um, öffnete die Tür, trat auf die Schwelle und riß die Tür dann blitzschnell hinter sich zu.
Er glaubte, dem Mann im Korridor ein Schnippchen geschlagen zu haben, und brach in eine Lache aus, die aber sogleich wieder erstarb.
Neben ihm stand ein Mann und sah ihn aus harten stahlblauen Augen an.
»Hallo, Roy.«
»Wer sind Sie?«
»Wo ist Jack?«
»Der ist doch weiterge… He, wer sind Sie?«
Wyatt bannte ihn mit seinem Blick.
»Ich habe dich gefragt, wo Jack ist!«
»Ich weiß es nicht.«
»Wo habt ihr euch getrennt?«
»Oben…«
»Gleich hinter der Stadt, dann bist du zu deinem Freund Prestly hier geritten. Und Jack? Wo ist er?«
Abbot war bleich geworden.
»Was fällt Ihnen ein, Mann! Wer sind Sie überhaupt?« krächzte er mit schwankender Stimme.
Da packte Wyatt ihn am Revers und stieß ihn gegen die Tür. »Mach den Mund auf, Abbot!«
»Ich…« Blitzschnell ließ er sich fallen und wollte den Gegner unterlaufen.
Aber ein knackender Handkantenschlag auf die linke Schulter ließ seinen rechten Arm kraftlos niedersinken.
Wyatt riß den schweren Mann hoch und schleuderte ihn von sich in den Hof.
Abbot stolperte, kam zu Fall und saß auf seinem Hinterteil.
Die Hände auf den Boden gestützt, starrte er den Marshal aus flimmernden Augen an.
Ganz hinten, tief in seinem Hirn, dämmerte ihm ein entsetzlicher Gedanke.
An wen erinnerte ihn dieser Mann?
An… Morg! Ja, an den Sheriff Morgan Earp! Dieser war nur älter und wohl auch größer und stärker.
Und doch mußte es Morgan Earp sein.
Es waren schließlich ein paar Jahre seit damals vergangen.
»Morg!« kam es heiser durch seine großen gelben Zähne.
Wyatt zog die Brauen zusammen. »Sprich dich aus, Abbot«
»Ich dachte…, Sie wären draufgegangen, unten in Tombstone!«
»Das möchtest du wohl! Steh auf!«
Langsam erhob sich der ungeschlachte Tramp.
Wyatt stand breitbeinig da und hatte die Arme über der Brust verschränkt.
»Ich frage dich jetzt zum letztenmal, Roy Abbot: Wo ist Jack Duncer?«
»Ich weiß es nicht. Und wenn ich sage, ich weiß es nicht, Sheriff, dann weiß ich es nicht. Überhaupt, wie kommen Sie hierher? Jack meinte doch, Sie wä…«
Ein fürchterlicher Faustschlag riß ihn von den Beinen.
»Ich bin Wyatt Earp, Abbot. Ich habe dich gewarnt.«
Wyatt…?« stammelte der Bandit. »Sie sind Wyatt Earp?«
Die Haustür ging auf.
Prestly stolperte in den Hof.
Der Georgier folgte ihm.
»Ja, Abbot, er ist Wyatt Earp, und ich bin Doc Holliday. Du bist im Bilde, laß also die alberne Fragerei und beantworte die Frage.«
Prestly hatte den Kopf herumgeworfen und stierte den Missourier aus weit offenen Augen an.
»Er ist… der Marshal Earp.«
Holliday sah den Marshal an. Dann zog er den Revolver.
»Der Fall ist klar, Marshal. Wir können uns und anderen eine Menge Mühe ersparen. Die Zeugen haben erklärt, daß Abbot Jenny Black erschossen hat. Und Prestly war dabei. Der dritte Mann war Jack Duncer. Wozu sollen wir die beiden noch hinauf in die Stadt schleppen. Wir haben andere Arbeit; schließlich müssen wir Duncer jagen. Abbot soll gehängt werden. Wir sparen den Strick und den Gang zum Galgenhügel. Prestly wird wegen Beihilfe zum Mord ebenfalls zum Tode durch den Strang verurteilt. Wir kürzen das Verfahren ab. Wer soll zuerst sterben?«
Prestly taumelte einen Schritt vorwärts und hob beschwörend die Hände.
»Marshal! Ich…, das ist doch alles Wahnsinn… Ich meine…, ein Irrtum. Der Doc irrt sich. Ich bin gar nicht dabei gewesen. Ich doch nicht! Abbot war dabei und Duncer…, aber ich war nicht der dritte Mann! Meine Frau kann bezeugen, daß ich das Haus in der letzten Woche überhaupt nicht verlassen habe!«
Auch Abbot spürte, daß seine Knie weich geworden waren. Vielleicht hätte er sich nicht so schnell niederzwingen lassen, wenn nicht ausgerechnet das eingetroffen wäre, was er auf dem Ritt nach Santa Fé befürchtet hatte.
Wenn er irgend etwas und irgendwen auf dieser Welt fürchtete, dann waren es die Earps. Er hatte genug von ihnen gehört, um zu wissen, wie eisenhart sie waren. Und dann hatte er Morgan in der Stadt mehrmals in Aktion gesehen. Wenn er dann bedachte, daß der große Earp, dieser Wyatt Earp da war, dann vermochte er überhaupt nicht weiterzudenken.
Wyatt übersah Prestly.
»Abbot, Sie haben gehört, daß Sie des Mordes an der Saloonerin Jenny Black beschuldigt worden sind!«
Der Verbrecher stieß röhrend hervor:
»Das ist eine Lüge, Marshal! Jack hat geschossen. Ich habe mich mit dem Neger geschlagen. Der schwarze Bursche wird es bezeugen!«
Holliday zog die Brauen zusammen.
»Er hat gesagt, daß du geschossen hast!«
Abbot schüttelte verzweifelt den Kopf.
»Nein, nein, nein! Ich schwöre es!«
»Banditenschwüre!« sagte der Spieler verächtlich.
Prestly war grau geworden; er hatte seine schleimige, ölige Art völlig verloren.
Oben im Haus jammerte seine Frau.
Sie bangten plötzlich beide um ihr Leben.
Wyatt blickte Abbot aus harten Augen an.
»Gehen Sie da hinüber an die Wand, Abbot!«
Der Verbrecher begann so stark zu zittern, daß seine Zähne laut aufeinanderschlugen.
»Marshal…, ich… kann doch nicht etwas sagen, das ich tatsächlich nicht weiß. Ich… bin mit ihm und dem anderen…«
»Dreckskerl!« schrie Prestly. »Sag ihm, daß ich es nicht wahr. Ich habe dich aufgenommen hier, obgleich ich schon am Abend hörte, was du getan hast!«
Dieser Henry Jerome, Sohn eines französischen Abenteurers, der in den fünfziger Jahren einen amerikanischen Namen angenommen hatte, weil er drüben in Texas steckbrieflich wegen Falschspiels gesucht wurde, hatte die Unverschämtheit, jetzt noch, in Anbetracht der beiderseitig schlechten Lage, über seinen Partner herzufallen.
»Ich habe dich bezahlt, Prestly!« rief Abbot in rasendem Zorn. »Meine letzten fünfundzwanzig Dollar habe ich dir gegeben…«
»Das glaube ich schon«, unterbrach ihn Holliday. »Eilig genug hattest du es ja, zu dem Geld meines Kameraden zu kommen, der oben in San Moris wartete.«
Abbot ließ den Kopf hängen.
»Well, ich bin ein Bandit… aber ich habe die Frau nicht niedergeschossen! Marshal!« wandte er sich an den Missourier. »Ich kann mir nicht denken, daß Sie einen Mann wegen eines Mordes richten lassen wollen, den er gar nicht begangen hat.«
»Richten lassen?«
»Soll der Doc mich denn nicht niederschießen? Sie haben mich doch hier an die Fenz geschickt…«, stammelte der Mann bebend.
»Der Doc – ich schätze, daß ihm eine Kugel zu schade ist für so einen Halunken. Und aus meiner Nähe habe ich dich nur geschickt, weil du stinkst!«
»Ich habe eines seiner Hemden an!« rief Abbot zitternd. »Auch dafür ist er bezahlt worden. Er hat einen meiner beiden Revolver dafür bekommen, für ein lächerliches schäbiges altes Kattunhemd, dieser Strolch.«
»Und nun denkst du, wenn du den zweiten Revolver noch gehabt hättest«, schleuderte ihm Holliday entgegen, »stündest du jetzt nicht hier?«
»Ja! Nämlich, als Sie mir den Colt aus der Hand schossen, war ich ja waffenlos.«
Holliday trat von der Tür weg in den Hof, bis auf fünf Yards an den Banditen heran, hatte plötzlich einen seiner Colts aus dem Halfter gezogen und warf ihn dem Tramp zu.
»Er ist geladen, Abbot! Sechs Schuß. Sieh nach!«
Holliday hatte den anderen Revolver nicht etwa in der Hand.
Ruhig und furchtlos stand er da.
Abbot hatte den Revolver aufgefangen, ließ die Trommel routieren – und sah plötzlich auf.
Zu seinem Schrecken entdeckte er in der linken Faust des Missouriers einen großen sechseckigen Buntline-Revolver, dessen Mündung genau auf seine Brust zeigte.
»Steck den Colt ins Halfter, Abbot!« mahnte ihn der Marshal.
Der Verbrecher schob den Colt mit verbissenem Gesicht in den Lederschuh. Dann sah er auf.
Holliday war einige Schritte zurückgegangen.
Genau acht Yard lagen zwischen den beiden Männern.
Abbot durchmaß die Distanz mit den Augen, und plötzlich sah er in die eisblauen diamantharten Augen des Georgiers.
Ein kalter Schauer rann über seinen Rücken.
Damned! Da drüben stand Doc Holliday.
Der Mann, von dem es hieß, daß er der schnellste Schütze des Westens wäre. Der viele große Gunmen geschlagen hatte und den aus den Stiefeln zu schießen noch keiner geschafft hatte!
War er, Roy Abbot, denn irrsinnig geworden? Wie konnte er sich eine echte Chance gegen diesen Mann ausrechnen? War er doch tatsächlich nur ein einigermaßen guter Schütze.
Und der Mann da drüben hatte eine tödlich sichere Hand!
Aber ging es nicht um sein Leben?
War es nicht so oder so verwirkt?
Wenn der Marshal ihm diese Chance einräumte, dann war es eine – gegen den Galgen, der keine bot.
Trotzdem stieß Abbot durch die Zähne: »Sie werden mich hängen lassen, Marshal!«
»Der Mörder Jenny Blacks wird hängen!« sagte Wyatt ausweichend.
»Ich bin nicht ihr Mörder!«
»Wer ist es denn?«
»Ich habe doch gesagt, es ist Duncer!«
»Wo ist Duncer?«
»Ich weiß es nicht. Ich vermute aber, daß er nach Norden geritten ist, nach Colorado. Da kamen wir auch her…«
»Und da werdet ihr auch gesucht. Du wirst mir nicht erzählen wollen, daß ausgerechnet ein so gerissener Bursche wie Oregon Jack wieder dahin zurückreiten wird, woher er gekommen ist.«
»Ich weiß es nicht.«
»Er lügt«, sagte Holliday rauh.
Abbot hätte gern den Colt gezogen. Aber zu groß waren die Angst und der Respekt vor dem Georgier.
In einer Minute, ach, in einer halben Minute, in wenigen Sekunden würde er das tödliche Blei aus dem anderen Colt des Spielers in der Brust haben. Ohne den Revolver selbst auch nur halbhoch gebracht zu haben.
Was für ein unheimlicher Schütze war Morgen Earp gewesen. Er hatte selbst gesagt, daß Doc Holliday erheblich schneller wäre.
Wenn ein Mensch zu wählen hat, ob er in einer halben Minute sterben soll oder erst in einigen Tagen, dann wird er die halbe Minute ausschlagen.
Auch Roy Abbot schlug sie aus.
Sein Kopf sank plötzlich auf seine Brust, und dann glitt der Revolver aus seiner Hand und fiel auf den Boden.
»He, wie geht dieser Trampel mit meinem Revolver um?«
Doc Holliday kam auf ihn zu und hob die Waffe auf, wischte sie ab und schob sie ins Halfter zurück.
»Also an den Galgen«, sagte er schroff.
Prestly hatte die Szene mit jagenden Pulsen verfolgt. Er war tatsächlich einfältig genug gewesen, noch eine Hoffnung auf Abbot zu setzen. Vielleicht gelang es Roy ja, Doc Holliday zu erwischen.
Aber jetzt, da er sich kampflos geschlagen gab, sprang Presly vor und brüllte ihn an.
»Feiger Kerl! Elendes Großmaul! Jetzt hast du dir den Strick selbst verdient. Jawohl, verdient hast du ihn…«
»Ruhe!« donnerte ihn der Marshal an. Als er aber weiter fluchte, packte Wyatt ihn am Arm und schleuderte ihn zurück.
»Ruhe habe ich gesagt, Prestly.«
Der Franzose keuchte: »Ich war nicht dabei! Aber er wollte mich hineinreißen, dieser Skunk!«
»Ich hatte nicht den Eindruck, daß er dich hineinreißen wollte, Prestly. Aber er hatte seine Chance. Und hat auf sie verzichtet. Du sollst das gleiche Recht haben. Ich gebe auch dir eine Chance.«
Wyatt hielt ihm seinen Revolver hin, den er im rechten Halfter trug.
Prestly starrte sekundenlang auf die schwere Waffe und schüttelte dann den Kopf.
»Nein…, ich… ich bin kein so guter Schütze, als daß ich mir eine Chance gegen Sie ausrechnen könnte.«
»Ah, und ihn nanntest du einen Feigling. Ich stelle fest, daß auch du ein Großmaul bist, Prestly.«
Abbot rührte sich nicht mehr.
Wyatt fesselte ihm die Hände auf den Rücken, und dann wurde auch Prestly gefesselt.
Holliday holte die Pferde aus dem Stall.
Dann verließen sie den Hof.
Mrs. Sanders bekam den Mund vor Verwunderung nicht zu.
Was hatte das zu bedeuten? Prestly und sein Bekannter wurden gefesselt abgeführt… von den beiden Fremden.
Ein alter Mann mit eisgrauem Bart humpelte am Straßenrand entlang und flüsterte seinem kleinen Enkel zu, auf den er seinen rechten Arm gestützt hatte:
»Da, Jimmy, sieh dir den Mann an, der da auf dem Falben sitzt. Sieh ihn dir genau an. Weißt du, wer das ist?«
»Ein Richter?« riet der Junge.
»Nein, Jimmy. Es ist Wyatt Earp.«
»Wyatt Earp? Nein!«
»Doch. Ich habe dir doch erzählt, daß ich ihn oben in Dakota gesehen habe, in den Black Hills…«
Mit runden Kinderaugen blickte der Junge dem hochgewachsenen Reiter nach.
»Dann muß doch der Mann auf dem Rappen neben ihm…«
»… Doc Holliday sein!« beendete der Großvater den Satz.
Die beiden waren die einzigen Menschen in der Ansiedlung, die den Marshal erkannt hatten.
Und sie dachten nicht daran, ihr Geheimnis preizugeben.
»Wenn der Marshal sich hier nicht zu erkennen gegeben hat, dann wird er seinen Grund dafür haben«, meinte der Alte. »Und Prestly ist schon längst fällig gewesen. Traurig, daß erst Wyatt Earp herkommen muß, um diesem Burschen das Handwerk zu legen.«
Der Posträuber, Rinderdieb und Heckenschütze Henry Jerome Prestly war endlich gefaßt worden.
Wer der andere Gefangene war, wußten die Leute nicht.
*
Erst nach Einbruch der Dunkelheit ritten Wyatt Earp und Doc Holliday in die Stadt ein.
Vor dem Sheriff Office sprang Holliday aus dem Sattel und öffnete das Hoftor.
Sheriff Baxter war vor zwei Stunden mit seinem Freund, dem Barbier, zurückgekommen.
Sie hockten beide hier im Hof auf der Treppe.
Als die Reiter hereinkamen, sprangen sie auf.
Baxter erkannte den Marshal.
»Tausend Teufel, das ist doch…«
»Ssst!« mahnte ihn der Georgier.
Baxter brach ab.
Wyatt Earp stieg ab und begrüßte den Sheriff.
»Etwas erreicht?«
»Nein… Sie wissen also schon…«
»Wir haben schon…«, sagte der Gambler.
»Was?«
»Einen von dem Terzett. Es ist Roy Abbot.«
»Abbot!« entfuhr es dem Sheriff. »Der Halunke war doch schon einmal in der Stadt. Ich glaube, er verzog sich damals vor Morg.«
»Stimmt.«
Wyatt holte die beiden Banditen vom Pferd.
»Das hier ist Prestly, er hat Abbot bei sich versteckt gehalten, obgleich er glaubte, Abbot habe Jenny Black ermordet.«
Baxter packte die beiden und schob sie vor sich her.
»Vorwärts, für euch Halunken habe ich sichere Warteräume zum Galgen…«
*
Bis spät in die Nacht saßen die Männer im Sheriffs Office und berieten miteinander.
Sheriff Baxter berichtete, daß er bis an die Grenze hinauf geritten war – ohne jeden Erfolg.
Zwar hatte er immer wieder Hinweise bekommen, wo jemand die drei Verbrecher gesehen haben wollte, aber alle Spuren waren im Sand verlaufen.
»Wollen Sie etwa weitersuchen?« fragte Baxter den Marshal.
»Ja, das will ich. Und zwar so lange, bis ich Duncer gefaßt habe.«
Innerlich atmete der Sheriff auf. Hätte er sich einen besseren Mann auf der Fährte des Mörders wünschen können? Ganz sicher nicht! Wyatt Earp würde nicht eher rasten und ruhen, als bis er den Mörder der Wirtin aus der Fegefeuer-Bar gestellt hatte.
»Am liebsten ritte ich mit dem Marshal«, sagte der kleine, zähe Barbier. »Ich würde diesem Scheusal gern eine Spezial-Rasur verpassen! Dieses blutjunge Weib da niederzuknallen! Das ist doch die letzte Gemeinheit, das Erbärmlichste und Widerlichste, was ich mir denken kann! Was hat sie ihm getan?«
»Er wollte ihr Geld«, sagte Wyatt sachlich.
»Ihr Geld! Well, muß er sie dazu niederschießen?«
»Abbot behauptet, er habe mit dem Neger gekämpft.«
Der Sheriff stand auf.
»Wollen wir nicht hinübergehen und mit Tom sprechen?«
Sie gingen in die dunkle Fegefeuer-Bar.
Der schwarze Tom hatte noch im Hof gearbeitet, kam sofort und zündete eine große Kerosinlampe an.
Als das Licht in den Schankraum fiel, vermochten die Männer sich eines Gefühls eisiger Kälte nicht zu erwehren.
Hier war sie ermordet worden. Da drüben an der Theke.
Wyatt blickte den Neger an.
»Sie haben mir erzählt, daß Sie mit dem großen Kerl gefightet hätten?«
»Ja, hier an der Tür. Er warf sich mir entgegen, und ich konnte ihm glücklicherweise, kurz bevor er mich niederreißen konnte, einen Schlag in die Magengrube versetzen.«
»Genau das hat er mir erzählt«, berichtete Wyatt.
Sie standen an der Theke – und der schwarze Tom schenkte dem Georgier, dem Sheriff und dem Barbier einen Brandy ein.
Der Marshal trank keinen Alkohol.
Wyatt hatte schnell festgestellt, daß Baxter ihm auch keinen nützlichen Hinweis geben konnte, den er vielleicht auf seinem Ritt gewonnen hatte.
»Well«, sagte er nach einer halben Stunde, »dann reite ich im Morgengrauen mit Doc Holliday weiter.«
»Wohin?« wollte der Sheriff wissen.
»Ich werde nach Los Alamos hinaufreiten.«
»Weshalb dorthin?«
»Weil wir überall sonst hier in der Nähe schon waren. Und weil in der Nähe der Straße nach Los Alamos keine Ansiedlung liegt. Wenn Duncer ein gutes Pferd hatte, konnte es ihm durchaus gelingen, die Straße zu erreichen und auf ihr nach Nordwesten in Richtung Los Alamos zu entkommen.«
*
Auf halbem Wege zwischen Santa Fé und Los Alamos lag White Rock.
Wyatt Earp und Doc Holliday hatten es so eingerichtet, daß sie nicht über die Mainstreet in die Stadt kamen.
Der Gambler entdeckte in einer Seitengasse einen kleinen Saloon, vor dem eine Pferdetränke stand. Während Wyatt die Tiere tränkte, betrat der Spieler die Schenke.
Es war ein schmalbrüstiger, schlauchartiger Raum, der selbst jetzt am Tage mit zwei Kerosinlampen erhellt werden mußte. Die Theke zog sich links vom Eingang bis fast in die Hälfte des Schankraumes. Rechts hinten in der Ecke pokerten vier Männer.
An der Theke lehnten fünf Männer, starrten in ihre Gläser und dösten vor sich hin.
Der Wirt war ein ellenlanger Mensch, sicher einsfünfundneunzig hoch. Hager wie ein Vorbaupfeiler, mit einem schmalen Gesicht, das den Spieler an einen Pferdekopf erinnerte.
Holliday trat an die Theke und stützte sich, wie er es immer tat, mit der linken Hand auf, während er die Rechte in die Hüfte stemmte.
Der Salooner hob seinen Kopf und sah ihn an.
Fehlt nur, daß er jetzt wieherte, dachte der Spieler.
»Mister?« fragte der Wirt mit tiefer Baßstimme.
»Einen Brandy.«
Holliday musterte die Männer unauffällig, die sich im Schankraum befanden, trank seinen Brandy, zahlte und ging wieder hinaus.
»Er ist nicht drin.«
Wyatt hatte Roy Abbot, nachdem er ihn in Santa Fé eingesperrt hatte, nach dem dritten Mann gefragt. Abbot wußte nicht viel über ihn zu sagen.
»Ich kenne ihn nicht, ich glaube, er heißt Percy, aber auch das wird sicher nicht stimmen. Duncer wird ihn gekannt haben. Wozu soll ich ihn beschreiben, wenn Sie mich doch hängen lassen wollen.«
»Wenn du jetzt glaubst, daß du am dickeren Ende sitzt, Abbot«, hatte der Marshal zurückgewiesen, »dann irrst du dich. Es ist möglich, daß du am Galgen vorbeikommst, wenn sich herausstellt, daß Duncer tatsächlich der Mörder der Frau ist. Aber dann ist zumindest deine Freiheit für immer verwirkt. Wegen Beihilfe zum Raubmord. Und was das hier in diesem Land bedeutet, weißt du genau: Straflager auf Lebenszeit.«
»Am Galgen vorbei?« hatte der Bandit gestottert. Und der fürchterliche Inhalt der drei Worte »Straflager auf Lebenszeit« schien ihm gegen den Galgen das Paradies zu sein. Sofort hatte er eine Beschreibung des Mannes gegeben, des Verbrechers Percy Clowsterfield.
Wyatt hatte sich die Beschreibung immer wieder durch den Kopf gehen lassen und war schließlich ganz sicher, daß er keinen Mann kannte, der so aussah.
Sie führten die Pferde langsam zur Mainstreet hinauf.
Oben an der Ecke war ein großer Mietstall. Als sie die Tiere durchs Tor führten, kam ein Mann heraus. Er war mittelgroß, untersetzt, hatte einen massigen blauroten Schädel und gewaltige Arme, an denen zwei regelrechte Tatzen hingen. Handschaufeln von einem Ausmaß, wie sie die beiden Dodger nie zuvor bei einem Menschen gesehen hatten.
Der Mann war schon vorbei, machte noch zwei Schritte und blieb plötzlich stehen.
Wyatt hatte das Aussetzen der Schritte sofort bemerkt, blieb stehen und sah sich um.
Vier Yard vor ihm stand der bullige Mensch und fixierte ihn scharf.
»He, sind Sie Lewis Nordland?« rief er dem Marshal zu.
Wyatt schüttelte den Kopf. »Nein.«
Trotzdem blieb der Mann stehen und sah ihn an.
Wyatt führte weiter sein Pferd in den Mietstall hinter dem Spieler her.
Als er den Sattel abschnallte, warf er noch einen Blick auf die Straße und sah eben noch, wie der Mann um die Torecke blickte.
Von jetzt an tat der Missourier, als habe er keinerlei Argwohn geschöpft und den Mann nicht bemerkt.
Als sie die Pferde zum Stalltor führten, meinte der Spieler:
»Er ist noch immer da.«
»Ich weiß.«
»Kennen Sie ihn?«
»Nein.«
»Der Bursche gefällt mir nicht.«
»Mir auch nicht. Aber das will ja nichts besagen.«
»Nein, aber der Kerl gefällt mir ganz besonders schlecht«, beharrte der Spieler. »Mir scheint, daß Ihr Auftauchen ihn irgendwie erschreckt hat.«
»Richtig, den Eindruck habe ich auch.«
Sie gaben die Pferde ab und verließen den Mietstall.
Kaum waren sie auf dem Vorbau der Mainstreet angelangt, als Holliday sagte:
»Ein Mann aus der ersten Schenke folgt uns.«
»Ein Cowboy?«
Holliday nickte.
Wyatt lehnte sich an einem Vorbaupfeiler und zündete sich eine Zigarette an.
»Habe ich bemerkt. Gehen Sie weiter.«
Der Spieler schritt weiter über die Stepwalks, und Wyatt blieb bei dem Vorbaubalken.
Der Mann in der Cowboytracht kam heran und blieb stehen.
Da wandte sich der Missourier um.
»Suchen Sie mich, Amigo?«
»Sie? Nein.«
»Das ist gut.« Wyatt wandte sich wieder um.
Der Cowboy ging weiter.
Hinten überquerte Doc Holliday die Straße.
Jetzt folgte Wyatt ihm unauffällig.
Holliday verschwand gerade zwischen den Pendeltüren einer großen Schenke.
Der Cowboy folgte ihm, blieb dann aber stehen.
Wyatt beobachtete, wie der Mann sich sichernd nach allen Seiten umsah.
Dann ging er langsam auf die Schenke zu, schob erst einen der hölzernen Schwingarme der Tür zur Seite und dann den anderen. Dann verschwand auch er in dem Saloon.
*
Doc Holliday hatte sich sofort, als er die Schenke betreten hatte, links an einen Tisch gesetzt.
Der Cowboy ging prompt an ihm vorbei.
Da tat der Gambler etwas, was er sonst nie tat. Er stand auf und verließ die Schenke.
Als der Cowboy schließlich auch herauskam, um sich nach dem Mann, dem er gefolgt war, umzusehen, sah er zunächst niemanden, dann aber, als er sich umsah, entdeckte er die beiden Männer neben der Tür.
Sie lächelten ihn an.
Der Cowboy stieß einen Fluch aus.
Da war Holliday auch schon bei ihm.
»Was hast du auf dem Herzen, Boy?«
»Ich?«
»Ja. Ich spreche mit dir, wenn ich mich nicht irre. Und ich rate dir, das nicht zu vergessen.«
Der Mann war noch ziemlich jung, hatte grünliche Augen und da, wo andere Männer einen Bart trugen, einen dünnen weichen Flaum auf der Oberlippe. Ein schwaches Lächeln huschte über sein Jungengesicht.
»Es ist verrückt, Mister, und jetzt ist es mir auch wirklich peinlich, daß ich Ihnen gefolgt bin. Aber einer der Männer unten in der Schenke sagte, Sie wären Doc Holliday.«
Der Spieler sah sich nach dem Marshal um.
»So? Sagte er das?« Wyatt Earp kam heran. »Wer war der Mann?«
»Ich kenne ihn nicht.«
»Junge, sei vorsichtig«, mahnte ihn der Marshal.
Der Cowboy wurde einen Ton bleicher im Gesicht.
»Ich kenne ihn wirklich nicht, Mister. Aber jetzt, da ich Ihr Gesicht ansehe, bilde ich mir ein, daß ich Sie schon einmal gesehen habe.«
»Das kann schon sein. Ich komme viel herum. – Sag mir, wie der Mann aussah.«
»Er war groß, kräftig…«
»Wie alt?«
»Fünfzig vielleicht.«
Holliday fragte: »War es der Mann, der neben dir an der Theke stand?«
»Ja. Seiner ledernen Jacke nach könnte er ein Felljäger sein.«
»Und weshalb bist du mir gefolgt?« fragte Holliday.
Eine purpurne Röte übergoß das Gesicht des Burschen.
»Well…, eh…, mein Name ist Jefferson, Cliff Jefferson. Ich arbeite auf der Ranch meines Vaters, acht Meilen vor der Stadt…«
»Ich habe dich nicht gefragt, wo du arbeitest, Cowboy, sondern weshalb du mir gefolgt bist.«
»Weil der Mann sagte, das war Doc Holliday, der eben hier stand. Die anderen Männer an der Theke lachten ihn aus. Da schlug er mit der Faust auf das Tropfblech, daß die Gläser tanzten, und meinte: ›Ich wette zwanzig Dollar, daß es Doc Holliday war.‹ Dann fing eine Riesenstreiterei an, und möglicherweise zanken
sie sich noch herum. Ich bin gegangen.«
»Hinter mir her.«
Der Cowboy nahm seinen Hut ab und drehte ihn unsicher wie ein Junge in den Händen, um schließlich stockend hervorzubringen: »Sind Sie Doc Holliday?«
Der Spieler nickte. »Noch was?«
»Nein, Sir. Es ist nur… Ich habe schon so viel von Ihnen gehört, und da dachte ich mir, daß ich Sie unbedingt sehen müßte, wenn Sie wirklich hier sind.«
»All right«, versetzte Holliday kühl, »das ist ja nun geschehen. So long, Cowboy.«
»So long, Doc!«
Wyatt Earp blieb noch neben dem Cowboy stehen.
»Du wirst das für dich behalten, Boy.«
»Was?«
»Daß Doc Holliday in der Stadt ist.«
»Aber selbstverständlich, Mister –?«
»Earp«, sagte der Marshal und wandte sich ab.
»Selbstverständlich, Mister Earp«, sagte der Cowboy und hielt plötzlich den Atem an. Earp? War dieser große Mann vielleicht Wyatt Earp?
Die beiden gingen zurück in die Gasse. Und Doc Holliday betrat erneut die Schenke.
Wyatt blieb draußen bei den Pferden zurück.
Der große Mann in der ledernen Jacke stand immer noch an der Theke, als Holliday eintrat.
Da stieß ein kleiner, kränklich aussehender Mann den in der Lederjacke an.
»He, was ist, Mister? Sie haben einen Adler gewettet.«
Augenblicklich flogen Rede und Widerrede hin und her.
Der Salooner musterte indes den Gambler und lachte schließlich meckernd wie eine Ziege, indem er sich zu Doc Holliday niederbeugte.
»Es ist zum Hüpfen, Mister. Hier hat einer eine ganz verrückte Behauptung aufgestellt, und schon setzen die Wetten ein.«
»Was wurde denn behauptet?«
»Daß Sie Doc Holliday wären.«
Der Spieler machte ein verdutztes Gesicht. Und dann brach er plötzlich in ein Lachen aus, in das nach und nach die ganzen Gäste einstimmten, außer dem Mann in der ledernen Jacke. Er nahm einen Goldfuchs aus der Tasche und ließ ihn klimpernd aufs Thekenblech fallen.
»Damned, ich hätte sogar hundert Dollar gewettet. Sie haben eine geradezu unheimliche Ähnlichkeit mit Doc Holliday.«
»Ausgeschlossen«, erwiderte der Spieler.
»Warum?«
»Weil ich keine Ähnlichkeit mit mir selber haben kann.«
Die Männer lachten wiehernd, auch der Wirt, doch der brach zuerst ab.
»He, was hat der Mann da gesagt?«
In diesem Moment wurde vorn ein Schwingarm der Pendeltür aufgerissen.
»Doc, kommen Sie!« Es war Wyatt Earp.
Holliday lief sofort auf ihn zu.
Als er neben dem Marshal auf dem Vorbau stand und die Straße hinunterblickte, wurden seine Augen, die gerade noch freundlich gelächelt hatten, hart wie Bergkristalle.
Mehrere Männer kamen die Gasse hinunter.
Der Gambler zählte sieben.
In ihrer Mitte ging der schwere, vierschrötige Mann, der vorhin aus dem Mietstall gekommen war, als sie ihn betreten hatten.
Neben ihm ging ein Mann, der mittelgroß war und auf hagerem Rumpf einen quadratischen Schädel trug. Die untere Hälfte seines Gesichtes war schlecht rasiert, und sein Mund stand offen, weil er höchstwahrscheinlich durch die lange spitze Nase keine Luft bekam. Die hoch an der Nasenwurzel sitzenden Augenbrauen gaben ihm den Anschein, als blicke er verwundert drein.
»Percy«, sagte Holliday leise.
»Den Eindruck hatte ich auch«, entgegnete der Marshal. »Abbot hat ihn doch verdammt gut beschrieben.«
Die Männer waren inzwischen herangekommen.
Der Untersetzte, dem die beiden Dodger am Mietstalltor begegnet waren, deutete auf den Vorbau.
»Das sind die beiden Kerle, die mich beschimpft haben, Boys.«
Die Boys ließen sich nicht lange Zeit. Sie stürmten auf den Vorbau. Der erste war der Mann mit den Prankenhänden. Wyatt stieß ihn mit dem Fuß von der Treppe zurück. Und zwei andere folgten ihm gedankenschnell nach.
Knackend hieb Doc Holliday einem dritten einen Revolver über den Schädel und wehrte einen vierten mit dem gleichen Hieb ab.
Da gab Percy Clowsterfield einen Schuß ab.
»Zur Seite, Leute. Solche Halunken behandelt man anders.«
Er stieß, ohne klares Schußfeld zu haben, den Revolver vor und feuerte. Die Kugel klatschte dicht neben Wyatts Kopf in einen Vorbaupfeiler. Der Marshal hatte sich zur Seite geworfen und sah zu seiner Verwunderung, daß Holliday langsam die Treppe hinunterging.
»Hallo, Percy!« rief er mit klirrender Stimme. »Ich bin doch wirklich neugierig, ob du den Nerv hast, hier vor allen Leuten mir eine Kugel in die Brust zu jagen.«
Clowsterfield sah ihn aus gefährlich flackernden Augen an.
»Ob ich das wagen werde? Du wirst dich wundern, Halunke! Ich schieße Ed Caldrup nieder, wo ich ihn treffe.«
Die Hähne der beiden Revolver des Marshals knackten.
»Ha, Percy…«
»Ich bin Percy Clowsterfield, und nur für meine Freunde bin ich Percy. Du gehörst nicht dazu, Langer!«
Clowsterfield hieß er also.
Wyatt blieb an der Vorbaukante stehen.
»Du hast einen kalten Nerv, Caldrup!« fuhr Clowsterfield den Gambler an. »Der Mann hier hat dich und deinen Partner vorhin im Mietstall erkannt. Und ich kenne dich ja sowieso.«
Der Spieler schob die Daumen in die Ausschnitte seiner giftgrünen Weste.
»Du bist ein Spaßvogel, Percy. Schade, daß du in Santa Fé nicht so gut aufgelegt warst!«
Der Bandit starrte ihn erschrocken an und sah sich dann nach seinen Helfern um.
Oben aus der Schenke war der Felljäger gekommen. Die anderen Männer, die an der Theke gestanden und am Spieltisch gesessen hatten, folgten ihm.
Wyatt überlegte fieberhaft, was Clowsterfield bewogen haben könnte, ihn und Holliday hier so anzugreifen.
Hatte der Bandit ihn etwa erkannt?
Nicht ausgeschlossen.
Und jetzt ritt er die alte Tour. Erkennen eines bekannten Verbrechers. Festnehmen lassen, am besten gleich niederschießen, um sich selbst auf diese Weise rasch Luft zu machen.
Da rief der Felljäger: »He, Mann, das ist nicht Caldrup! Ich habe Tim Caldrup in Denver gesehen! Dieser Mann ist…«
»Du hältst das Maul!« brüllte Clowsterfield dem Mann entgegen.
Und als der Fellhändler dennoch weitersprechen wollte, hob Clowsterfield blitzschnell den Colt an Holliday vorbei und feuerte eine Kugel zum Vorbau, die dem Jäger sengend den Oberarm verletzte.
Das war Wyatt zuviel. Mit harten Schritten ging er die Vorbautreppe hinunter an Holliday vorbei und blieb einen halben Yard vor dem Banditen stehen.
»Clowsterfield! Du kennst mich. Mein Name ist Earp. Wyatt Earp, ich bin aus Dodge City nach Santa Fé gekommen, weil du da…«
»Lüge!« brüllte der Tramp.
Wyatt hieb ihm blitzschnell den Colt aus der Faust und stieß ihn zurück, daß er gegen seine Helfer stolperte.
»Du hältst jetzt deinen Rand, Bandit! Ich bin dir gefolgt, weil du die Saloonerin Jenny Black erschossen hast!«
Der Tramp wurde weiß wie eine gekalkte Wand. Aber er wagte keinen Widerspruch mehr, da die erste Kostprobe der Entschlossenheit des Marshals ihn über nichts im unklaren gelassen hatte.
»Was?!« rief da der Felljäger. »Dieser Hund hat Jenny Black erschossen?«
Er stürmte auf die Straße. Zwei andere Männer folgten ihm.
Wyatt Earp trat einen Schritt zur Seite.
Er wußte, daß Percy Clowsterfield von Doc Holliday scharf bewacht wurde.
Mit harten Augen musterte er den Gorillamann mit den prankenartigen Händen, der ihnen vorhin oben im Mietstalltor begegnet war und offensichtlich ein Freund Clowsterfields war.
»Na, Mister?«
Der Mann sah ihn aus gelben Schlangenaugen an.
Plötzlich sprangen seine Lippen auseinander.
»Du bist Vingat Pligger, Caldrups Partner. Ich habe dich sofort erkannt.«
»Ach! Mir scheint eher, daß du sehr genau wußtest, wer ich bin. Und wenn ich scharf nachdenke, werde ich mich an dein Hundegesicht bestimmt auch noch erinnern, Brother.«
Da geschah es.
Eine Frau schrie auf.
Ein heiserer Schrei aus mehreren Männerkehlen erfüllte die Straße.
Reaktionsschnell wich Wyatt dem Hieb aus, konnte aber den blitzartig nachgeschickten Haken nicht ganz vermeiden und wurde zurückgeschleudert.
An der Vorbautreppe stolperte er.
Der Mann mit dem Hundeschädel war sofort bei ihm und wollte den vermeintlich geschlagenen Gegner hochreißen.
Da wuchtete ihm der Missourier einen krachenden Rechtshänder an die Kinnlade, dem er augenblicklich einen fürchterlichen linken Haken folgen ließ.
Aber der Quadratschädel des anderen flog nur hin und her.
Der Mann blieb stehen.
Ein widerliches, höhnisches Grinsen kroch über sein breitflächiges Bullbeißergesicht.
Dann hob er den Kopf an. »Da, schlag noch einmal zu!«
Er hatte sich in seiner Nehmerkraft verrechnet.
Wyatt sah den angehobenen Kinnwinkel, den empfindlichsten Punkt, den ein Mann im Faustkampf überhaupt hatte – und schon riß er einen Uppercut hoch, der genau an dieser Stelle detonierte.
Die umstehenden Männer zuckten zusammen und verzogen die Gesichter.
Der Bullbeißer-Mann hatte den Hieb durch den ganzen Körper wie einen Blitzschlag gespürt. Aber er fiel nicht. Er stand auf seinen breiten Elefantenfüßen und stierte den Marshal aus wässerigen Augen an.
Wyatt fixierte ihn scharf, dann rief er plötzlich:
»Zur Seite, Doc – er kommt!«
Holliday wich sofort einen Schritt zur Seite – und zur namenlosen Verwunderung der Zuschauer kippte der menschliche Koloß plötzlich wie ein gefällter Urwaldriese über die Absatzkanten nach hinten, um der Länge nach auf die Straße zu schlagen.
Der Marshal war schon wieder bei Clowsterfield.
»Und jetzt zu dir, Percy! Hast du noch irgend etwas zu sagen?«
Der Bandit war im Grunde seiner Seele ein Feigling.
»Flynn hat mich gewarnt…«, stotterte er. »Er sagte: Wyatt Earp ist in der Stadt. Er ist bestimmt deinetwegen hier.«
»Flynn, das ist der Penner da?«
Clowsterfield nickte.
»Well, er wird ins Jail geschafft!«
Plötzlich war auch ein Mann mit einem Stern da.
»Sie sind Wyatt Earp?« fragte er.
Wyatt packte Clowsterfield am Arm. »Ja, ich bin Wyatt Earp. Wecken Sie das Gorilla-Baby da, und schleppen Sie es ins Jail. Und diesen Mann hier nehme ich mit.«
Flynn wurde weggeschafft, und mit weichen Knien torkelte er zwischen dem Sheriff und den anderen Männern zum Jail; er wußte immer noch nicht, was eigentlich passiert war.
Schließlich standen nur noch Wyatt Earp und Doc Holliday mit dem Tramp Percy Clowsterfield auf der Straße.
Die anderen hatten sich auf den Vorbau verzogen, wie es im Westen üblich war, weil man von da aus die beste Aussicht auf weitere Geschehnisse hatte, die sich auf der Straße abspielten, und man vor Schlägen und Kugeln da wenigstens einigermaßen sicher war.
Was geschah mit diesem stoppelbärtigen Banditen, der in Santa Fé eine Frau erschossen haben sollte? Was würde der Marshal mit ihm anstellen?
Wyatt zog ihn mit sich in die Schenke und preßte ihn da auf einen Stuhl.
Niemand hatte gewagt, ihm zu folgen. Aber an der Tür standen sie, an den Fenstern und hinten am Hofausgang. Mit angehaltenem Atem lauschten sie den Worten des Missouriers.
»Hör zu, Clowsterfield, du weißt, wessen du beschuldigt wirst…«
Der Tramp keuchte: »Ich habe es gehört, Marshal, aber es ist doch nicht die Wahrheit!«
»Ach, dein Partner Abbot war anderer Ansicht.«
Ein eisiger Schlag durchzuckte den Tramp.
Der Marshal hatte Roy Abbot gefaßt!
Damned, dann konnte er diese Hoffnung also begraben: Abbot würde ihn nicht befreien.
Und was war mit Duncer? Nein, diesem Kerl traute Clowsterfield nicht so viel Kameradschaft zu.
Was hatte der Marshal gesagt? Abbot sei anderer Ansicht? Sollte das etwa bedeuten, daß der Halunke dem Marshal erzählt hatte, er, Clowsterfield, hätte die Frau erschossen?
Das wäre ja ungeheuerlich.
Der Tramp sank noch mehr in sich zusammen.
»Wo steckt Duncer?« traf da die metallene Stimme des Marshals an sein Ohr.
»Ich weiß es nicht.«
Wyatt riß ihn aus dem Stuhl hoch.
»Du weißt es. Du bildest dir nur ein, daß er dich raushauen würde!«
»Nein, der bestimmt nicht«, gab der Bandit zu. »Der ganz bestimmt nicht.«
Der Missourier stieß ihn wieder in den Stuhl.
»Wo ist er?«
Clowsterfield hob die Arme und ließ sie wieder sinken.
»Sie können mich auseinandernehmen, Marshal – ich weiß es nicht.«
»Ihr seid doch zusammen geritten.«
»Nein, nur bis zum Stadtrand. Dann verschwand Roy irgendwo nach Westen…« Er brach ab.
»Weiter!«
Im Schädel des Banditen war ein neuer Gedanke aufgetaucht! Nein, Duncer würde ihn sicher nicht befreien, aber wenn er, Clowsterfield, ihn verriet, mußte er damit rechnen, daß Oregon Jack ihn töten würde, aus Rache.
Und außerdem, was gab es denn schon zu verraten?
Was wußte er denn schon von ihm?
Er wußte ja tatsächlich nicht, wohin er geritten war.
»Sprechen Sie weiter!« mahnte ihn die Stimme des Marshals.
»Weiter…?« stammelte er.
Wieder riß Wyatt ihn hoch. Er mußte rauh und hart mit diesen Menschen umgehen, denn zu was sie fähig waren, hatten sie ja bewiesen. Und jede Stunde, die Duncer gewann, bedeutete einen bedeutenden Vorsprung.
»Ich weiß es nicht!«
Der Blick der stahlblauen Augen des Marshals bohrte sich in die tückischen Augen des Verbrechers.
»Rede, Bursche, sonst lernst du den gröbsten Mann des Westens kennen, das verspreche ich dir!«
Clowsterfield schluckte.
»Well, er… ritt weiter…, ich meine…, ich ritt hierher nach Nordwesten… und er…«
»Und er!?«
»Er ritt zurück.«
Wyatt ließ ihn so plötzlich los, daß er vor dem Stuhl auf den Boden fiel.
»Was…? Zurück?«
»Ja.«
»Wohin?«
Der Outlaw rappelte sich hoch.
»Ich weiß es nicht. Er sagte: Ich habe die Kasse vergessen! Dann war er verschwunden.«
Wyatt kam ganz dicht an den Banditen heran.
»Gib acht, Mann, wenn du dir jetzt eine Story ausgedacht hast, war es das Dümmste, was du dir in deinem sinnlosen Leben geleistet hast. Denn du kannst ihm keinen Vorsprung verschaffen, deinem Boß, weil ich ihn jagen werde, bis ich ihn habe. Ihm hilfst du nicht, aber mir schadest du, wenn du mich jetzt zurückjagst nach Santa Fé. Aber dann gnade dir Gott! So, und jetzt kommst du mit ins Jail zu deinem Freund Flynn. Wahrscheinlich kommt er auch an den Galgen. Da habt ihr dann ja ein paar Tage Frist, um euch über alles auszusprechen.«
»Ich… komme an den Galgen?« stotterte der Desperado bebend.
»Natürlich, Mörder werden gehängt!«
»Wen… habe ich ermordet?« fragte er vorsichtig.
»Zunächst Jenny Black. Und das genügt. Komm jetzt!«
Wyatt zerrte ihn hoch und band ihm die Hände auf den Rücken.
Als er ihn hinausführte, riefen einige Männer:
»Gleich aufhängen, den Mörder! Sofort!«
Aber der Marshal schob sich mit seinem Gefangenen hinaus auf die Straße.
Die Männer folgten den beiden zur Mainstreet.
Wo war Doc Holliday?
Wyatt hatte sich ein paarmal nach ihm umgesehen, vermochte ihn aber nicht zu entdecken.
Als er Clowsterfield im Jail abgeliefert hatte, trat er mit dem grauhaarigen kleinen Sheriff in den Vorbau.
»Haben Sie meinen Gefährten gesehen?«
»Doc Holliday? Nein.«
»Merkwürdig. Na, wenn er herkommen sollte, ich warte im Mietstall.«
»All right, Mister Earp.«
Wyatt ging zum Mietstall und holte die beiden Pferde heraus, um sie aufzusatteln.
Der Georgier blieb aus.
Da band Wyatt den Rappen an den Zügelholm, zahlte schon die Boxen und ritt auf die Straße. Im Trab kreuzte er durch die Mainstreet und die anliegenden Gassen.
Wo war Doc Holliday?
Wyatt ritt zum Sheriff Office zurück und sah den Spieler gerade herankommen.
»He, Doc – ich suche Sie wie eine Stecknadel. Wo waren Sie denn?«
Holliday ging neben dem Marshal auf den Mietstall zu.
»Bei den Leuten, die mit Flynn und Clowsterfield gekommen waren, entdeckte ich zwei Figuren, die ich schon einmal gesehen hatte. Vermutlich in Santa Fé. Sie waren auch die ersten Helfer, die sich nach Flynns Sturz davonmachten. Die anderen türmten erst, als sie Clowsterfield mit in die Schenke zerrten. – Ich habe nicht gewartet, bis die Straße frei war, sondern bin auf einem kleinen Umweg in die Häuserenge gegangen, in der die beiden anderen vorhin verschwunden waren. Sie waren natürlich nicht mehr da. Aber ein Junge hatte sie gesehen. Er kannte sie sogar. Es waren zwei Männer aus Santa Fé, namens Jollyson und Lutkin. Sie sollen sich häufig hier aufhalten und mit Flynn reiten. – Ich fand sie in einer Kneipe am nördlichen Stadtrand. Da lehnten sie beide an der Theke und hatten schon das zweite Glas gekippt. Sie redeten so unbekümmert laut, daß ich jedes ihrer Worte auf der Straße verstehen konnte. Jollyson sagte: Percy wird hängen, und Oregon Jack wird ihn nicht heraushauen. Aber es ist seine Stärke, an einem solchen Tag ganz in der Nähe irgendwo ein Depot auszuräumen…«
Wyatt stieß sich den Hut aus der Stirn. Richtig, das hatte er auch schon gehört: Jack Duncer hatte sich eine raffinierte Masche ausgeklügelt, die, so gefährlich sie auch schien, von ihm häufig durchexerziert worden war.
Wenn irgendwo ein Verurteilter gehängt wurde, machte er sich in der unbewachten Stadt an das Werk. Wer paßte schon ausgerechnet in der Stunde, in der eine Hinrichtung vollzogen wurde, auf seinen Kassenschrank auf?
Die wenigsten Menschen.
Das hatte sich der kaltherzige Desperado zunutze gemacht.
Selbst wenn er nicht direkt in Santa Fé war – er würde vielleicht kommen, wenn er erfuhr, daß Percy Clowsterfield wegen des Mordes an der Frau gehängt wurde.
Sie hatten den Mietstall erreicht.
Der Georgier holte sein Pferd und zog sich in den Sattel.
Sie ritten zum Sheriffs Office zurück.
»Ich habe es mir überlegt, Sheriff!« rief Wyatt dem Sheriff entgegen. »Wir müssen doch nach Santa Fé zurück und werden Clowsterfield mitnehmen. Sie können Flynn ja zur Verhandlung hinüberschaffen lassen!«
»Wie Sie wollen, Mister Earp…«
*
Santa Fé war außer sich über den Tod der schönen Saloonerin gewesen.
Und jetzt hatte Wyatt Earp ihren Mörder gefunden! So rasch war er mit ihm zurückgekommen.
Sheriff Baxter, der Neger Tom, Doc Norton und alle, die wußten, wer der wirkliche Mörder war, hatten nach einer kurzen Beratung dem Plan des Marshals zugestimmt.
Es wurde allenthalben verkündet: Roy Abbot habe seinen eigenen Kameraden Percy Clowsterfield des Mordes an der Frau beschuldigt. Aber Clowsterfield schweige.
Am nächsten Vormittag ließ Wyatt erst vorsichtig, dann immer stärker das Gerücht ausstreuen, Clowsterfield habe gestanden.
Am nächsten Tag sollte die Verhandlung sein. Sie fand hinter geschlossenen Türen statt, nur im Beisein der Geschworenen, des Richters selbstverständlich, des Marshals, des Sheriffs, der Zeugen und der Angeklagten.
Es geschah eigentlich nichts im Court House von Santa Fé an diesem Tag. Man führte die Leute hinein, hielt sich eine halbe Stunde drinnen auf und führte die Leute wieder hinaus.
Als die Desperados wieder im Jail waren, verkündete ein rasch gefertigtes Plakat vorm Bureau des Sheriffs, daß der geständige Mörder Percy Anatol Clowsterfield am kommenden Montag gegen acht Uhr am Morgen auf dem Galgenhügel gehängt würde.
Er hatte also gestanden, wahrscheinlich unter dem Druck der Beweislast.
Und was war mit Duncer? Er war ganz plötzlich zur Nebenfigur geworden.
Man tröstete sich damit, daß Wyatt Earp auch ihn noch stellen würde. Wer einmal den Marshal auf den Fersen hatte, war so gut wie erledigt, auch wenn er noch tausend Meilen zwischen sich und seinem Verfolger hatte.
Wozu sollte man sich noch weitere Gedanken über diesen Duncer machen. Der Mörder war ja gefaßt, geständig und verurteilt. Alles war doch fast reibungslos abgelaufen. Daß es nur der Energie des Marshals und eigentlich einem Spiel des Zufalls zu danken war, daß dieser stoppelbärtige Bandit gefaßt worden war, kümmerte niemanden.
Jenny Black würde gerächt werden – durch den Tod des Mörders.
Im Sheriff Office saßen die wenigen Eingeweihten beieinander und berieten weiter.
Der Mayor fand: »Das Ganze ist natürlich ein höllisch gewagtes Spiel. Well, Clowsterfield wird zum Galgen geführt, und daß er dabei Blut und Wasser schwitzt, das ist kein Unglück. Er büßt dabei einen Teil seiner Verbrechen.«
Wyatt überlegte immer noch, ob er Clowsterfield nicht doch einweihen sollte. Zu fürchterlich war das, was dem Mann zugemutet wurde. Zum Hinrichtungsplatz geschleppt zu werden für einen anderen.
Holliday schwieg.
Der Sheriff knurrte: »Es kann dem Schurken weiß Gott nicht schaden.«
Die Überlegung des Marshals, daß Oregon Jack, falls er noch in der Nähe der Stadt war, durch die Nachricht von der bevorstehenden Hinrichtung Clowsterfields angelockt werden könnte, war natürlich nicht unlogisch. Zudem kam, daß Duncer sich sagen würde, Clowsterfield hat gestanden, weil er so hofft, daß ich ihn heraushauen werde.
Aber ob sich der tatsächliche Mörder der Jenny Black so weit vorwagen würde, daß er in die Netze des Marshals geriet, das war natürlich eine große Frage.
Es war ja nicht ausgeschlossen, daß er sich sagte: Knüpft den Burschen nur auf! Dann habe ich die Sache vom Hals, und mit dem Mord der Saloonerin kann mir keiner mehr kommen. Immer vorausgesetzt, daß sich der Bandit noch in Stadtnähe aufhielt.
*
Selbstverständlich hatte Wyatt Earp auch einen Plan entwickelt, wie die Hinrichtung noch im letzten Augenblick aufgehalten werden konnte.
Der schwarze Tom mußte angelaufen kommen und schreien:
»Halt! Marshal! Sheriff! Richter Jefferson! Halt! Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen…, aber der Mann war es nicht! Er war es nicht! Ich kann es doch nicht aufrechterhalten, daß er geschossen hat! Es war doch dieser Abbot! Ja, er muß es gewesen sein! Ich weiß es jetzt sicher!«
Das alles war bis ins Kleinste durchgesprochen worden.
Jetzt galt es nur, die Zeit abzuwarten.
Und Zeit genug hatte Wyatt dem Mörder eingeräumt, dies für den Fall, daß Duncer sich nicht in der Nähe Santa Fés, sondern vielleicht in der weiteren Umgebung aufhalten sollte. Er mußte Gelegenheit haben, zu kommen.
Er hatte ja bisher keine Scheu gehabt, solche Ritte auch in anderen Städtchen, wo man ihn vorher gesehen hatte, zu unternehmen, dann würde er auch hier keine Skrupel haben.
Aber war er überhaupt hier in der Nähe? Das war die eine Sorge des Marshals. Wenn er nämlich nicht hier war, brauchte der große Plan noch keineswegs als fehlgeschlagen betrachtet werden. Denn dann würde man eine neue Verhandlung anberaumen, ebenfalls hinter verschlossenen Türen, in der es sich herausstellte, daß Abbot tatsächlich der Schuldige war.
Bis zum neuen Hinrichtungstag vergingen dann noch weitere Tage, die Duncer selbst aus einer größeren Entfernung heranlocken konnten.
Die Zeit kroch im Schneckentempo dahin.
Als die Nacht vor dem Hinrichtungsmorgen herangekommen war, saßen die verantwortlichen Männer im Sheriff Office zusammen.
Der Richter meinte: »Ich habe da wegen der zweiten Verhandlung Bedenken, Mister Earp. Beim erstenmal haben sich die Leute durch den allgemeinen Schock noch nichts bei ihrem Ausschluß von der Verhandlung gedacht, und ich konnte den Sheriff erklären lassen, daß es keine öffentliche Verhandlung geben könne, da ja immer noch einer der Verbrecher auf freiem Fuß herumlaufe. Aber ich weiß nicht, ob sich das ein zweites Mal durchzwingen läßt.«
»Ich hoffe sehr, daß wir keine zweite Verhandlung brauchen«, meinte der Marshal.
»Hoffentlich«, knurrte der Sheriff, »aber wir müssen bei dem Plan bleiben, weil wir gar keine andere Chance haben, Duncer herzulocken. Gerade, weil er bekannt für derartige Überfälle ist…«
Noch einmal gab der Marshal den Männern zu bedenken, ob man nicht Clowsterfield einweihen solle. Unmenschlich schien ihm die fürchterliche Belastungsprobe, die dem Banditen da zugedacht worden war.
Aber die anderen beharrten auf ihrer einmal gefaßten Meinung: Dieser Schurke soll Blut und Wasser schwitzen!
Wyatt sah Holliday an. Der zog die Schultern hoch. Meinte dann aber doch:
»Ich finde, daß es an der Sache nichts ändern würde, wenn der Tramp eingeweiht wäre.«
»Nichts ändert!« rief der Sheriff. »Aber Doc, bedenken Sie doch, wenn er nun plötzlich losbrüllt?«
»Brüllt, was soll er brüllen?«
»Er kann Duncer warnen!«
»Das wird er nie tun, nachdem der ihn im Stich gelassen hat. Außerdem hat er dann doch gar keinen Grund mehr, wenn der Marshal ihn über den wirklichen Vorgang aufgeklärt hat. Im Gegenteil.«
»Aber dann ist es eine Rolle, die er zu spielen hat«, meinte der Mayor zu bedenken geben zu müssen. »Und wer weiß, ob er sie überhaupt so spielen kann, wie es für den Zweck der Sache notwendig ist!«
Holliday entgegnete: »Wenn er sie nicht spielt, kann man ihm unterwegs noch nachhelfen. Das können Sie getrost mir überlassen.«
Die Männer blickten einander nachdenklich und sorgenvoll an.
Endlich, nach stundenlanger Beratung, hatte man sich dahingehend durchgerungen, daß Wyatt Earp selbst den Banditen aufklären solle. Er saß ohnehin seit gestern in einer Einzelzelle, die in Santa Fé nur für zum Tode Verurteilte bestimmt war und am anderen Ende des Ganges lag, wo niemand hören konnte, was in dem kleinen Raum gesprochen wurde.
*
Es war Mitternacht, als der Sheriff den Zellengang aufschloß.
Eine winzige Kerosinlampe warf einen müden Lichtschein in den langen Gang und auf die Gittertüren.
Wyatt Earp ging allein an den Zellen vorbei und verschwand im Quergang, wo neben einer Rumpelkammer nur noch die Zelle des zum Tode Verurteilten lag.
Er nahm die kleine Lampe, die auch diesen Gang nur schwach erleuchtete, und öffnete die Zelle des Banditen.
Clowsterfield lehnte hinten an der Steinwand, eine düstere gespenstische Gestalt. Nur seine Augen blinkten aus dem verschwommenen Gesicht.
»Was wollen Sie noch?« krächzte er mit zitternder Stimme. Und dann schrie er, daß es dem Marshal in den Ohren dröhnte: »Ich will keinen mehr sehen. Sie schon gar nicht! Ich will allein sein bis zum letzten Gang. Allein! Ich bin unschuldig!«
Wenn der Marshal es noch nicht befürchtet gehabt hätte, würde er es jetzt gewußt haben: Der Mann hatte keine Kontrolle über seine Nerven mehr. Er war fertig. Schon jetzt, an dem einen einzigen Tag, in zwölf schmalen Stunden, hatte er tausend Höllen der Angst durchgestanden. Er war völlig zusammengebrochen und knickte jetzt vor dem Marshal wimmernd in die Knie ein.
Wyatt blickte auf ihn nieder und richtete ihn dann auf.
»Setzen Sie sich da auf den Hocker, Clowsterfield. Ich habe mit Ihnen zu sprechen.«
»Nein«, wimmerte der Mann, »niemand hat mit mir zu sprechen, niemand mehr. Ich bin ein zum Tode Verurteilter…«
Wyatt packt sein haariges Kinn und riß es hoch.
»Jetzt hören Sie mir zu, Mensch.«
Clowsterfield starrte ihn an und klammerte dann seine ungefesselten Hände um die Handgelenke des Missouriers.
»Weshalb haben Sie mich nicht nach Sescattewa geschickt, lebenslänglich in die Steinbrüche? Für Sie wäre es doch einerlei gewesen. Ich bin unschuldig! Weshalb… weshalb muß ich sterben! Weshalb an den Galgen…«
So leise, daß es nur der Bandit hören konnte, sagte der Marshal:
»Sie sollen ja gar nicht sterben, Mann.«
»Wa…«
Wyatt preßte ihm die Hand auf den Mund und erstickte den Schrei, den der Outlaw ausstoßen wollte.
»Hören Sie genau zu.«
Und nun erklärte er dem fassungslos Zuhörenden, was er beschlossen hatte.
Percy Clowsterfield war außerstande, sich zu erheben.
Immer noch hatte er die Hände um den linken Unterarm des Marshals gepreßt.
»Sie wissen also, daß ich unschuldig bin«, stammelte er.
»An dem Mord an Jenny Black – ja.«
»Ich bin unschuldig«, keuchte der Tramp, »Jack hat geschossen…«
»Ich weiß. Und es gibt keine echte Verhandlung, bis ich ihn nicht auch habe.«
Und noch einmal erklärte er dem Verbrecher alles.
Auch was er auf dem Weg zum Galgenhügel zu tun hatte.
Plötzlich verdüsterte sich die Miene des Outlaws wieder, die sich eben erst etwas aufgehellt hatte. Mißtrauisch starrte er den Marshal an.
»Ist das auch keine Finte?«
»Nein, Clowsterfield. Aber Sie werden genau tun, was ich Ihnen gesagt habe! Und wenn Sie irgend etwas anderes tun, sind Sie verloren.«
Diese Drohung war leer, aber der Bandit merkte es gar nicht mehr. Tausend Stimmen schienen in seinen Ohren zu singen, er wollte gar nicht wissen, was sonst mit ihm geschah, ob er nun nach Sescattewa kommen würde, oder was ihm die richtige Verhandlung anhängen würde, weil es für ihn nur eine wichtige Tatsache gab: Er würde nicht hängen.
Erst nach einer Dreiviertelstunde verließ Wyatt die Zelle.
»Alles klar?«
»Alles, Marshal. Und… vielen Dank. Ich weiß genau, daß die Leute mich ohne Sie schon aufgeknüpft hätten!«
*
Es war ein düsterer, verschleierter Morgen. Gar nicht typisch für die Sonnenstadt Santa Fé.
Die Menschen hatten sich in der Mainstreet vor dem Jail versammelt. In dunklen Anzügen.
Eine Hinrichtung war in dieser großen Stadt ein Ereignis, dem von Seiten der Bevölkerung bedeutend mehr ernste Teilnahme entgegengebracht wurde und das mehr Zeremonien zu durchstehen hatte als anderswärts in den kleinen zerrissenen Westernstädten, wo man für solche Zeremonien weder Zeit noch Mühe aufwendete.
Der Mayor stand mit dem Marshal auf dem Vorbau.
Auch der Sheriff war da.
Dann holte der Sheriff den Verurteilten.
Wyatt war zufrieden: Das Gesicht Clowsterfields war blaß genug. Er hatte anweisungsgemäß den Kopf tief gesenkt.
Baxter packte ihn und fesselte ihm die Arme auf den Rücken.
Mit einem Gefühl dumpfen, würgenden Grauens blickten die Menschen den Todeskandidaten an.
In einer halben Stunde würde dieser Mann nicht mehr leben.
Langsam setzte sich der Zug in Bewegung. Fast hundertfünfzig Menschen folgten ihm.
Niemandem fiel es auf, daß der Marshal plötzlich verschwunden war.
Mit schleppendem Schritt ging Percy Clowsterfield vorwärts. Es ging aus der Stadt hinaus auf den Galgenhügel zu, der im Laufe der Zeit immer weiter von der City verlegt worden war, da die Häuser, die immer tiefer in die Prärie hinauskrochen, den Platz brauchten. So war es gekommen, daß der einst wirklich für diese makabren Zwecke benutzte Hügel schon fast mitten in der Stadt lag und die eigentliche heutige Hinrichtungsstätte viel weiter draußen und längst kein Hügel mehr war.
Clowsterfield hatte nicht einmal aufgesehen, als ihm aber das Genick zu schmerzen begann, hob er einmal den Kopf – und zuckte zusammen.
Nur etwa noch vierhundert Yard voraus sah er einen kahlen Baum trotz der diesigen Luft kristallklar vor sich. Um seinen mächtigen Stamm herum standen auch schon eine Menge Leute.
Unwillkürlich sah der Bandit sich um.
Wie nun, wenn der Marshal ihn angelogen hatte, wenn er durch eine fromme Lüge nur hatte vermeiden wollen, daß er, der Verurteilte, laute Beschuldigungen in die Gegend schrie oder sich sonst irgendwie laut benahm?
Wie nun, wenn es niemals einen Neger geben würde, der im letzten Augenblick angerannt kam, um ihn zu retten?
Wenn alles nur Lug und Trug war? Und wenn dieser bartgesichtige Sheriff, der ihn da mehr vorwärtsschleppte als er ging, tatsächlich die feste Absicht hatte, ihm den hanfenen Strick um den Hals zu legen…?
Dicke Schweißperlen traten auf die Stirn des Banditen.
Was für eine Garantie hatte er denn, daß Wyatt Earp die Wahrheit gesagt hatte?
Keine.
Oder nur die eine, daß er eben Wyatt Earp war, ein Mann, von dem man sagte, daß er nichts mehr liebe als die Wahrheit.
War das genug? Für ihn, der zum Galgen geschleppt wurde? Zu einem kahlen abgestorbenen mächtigen Baumriesen, um den sich Hunderte von Menschen versammelt hatten!
Was aber hätte er sonst tun sollen? Er mußte weitergehen, Fuß vor Fuß setzen, dem Galgenbaum entgegen.
Wie andere diesen Weg vor ihm gegangen waren, die ihr Leben verwirkt hatten.
War sein Leben nicht verwirkt?
Er fragte sich immer wieder – und plötzlich bewegten sich seine Lippen tonlos und rasch: Der verstockte Bandit betete…
*
In der Mainstreet herrschte eine beklemmende Stille.
Der Mann, der von der kleinen Finnleystreet zur Mainstreet hochritt, wurde von niemandem beachtet.
Ehe er die Mainstreet erreichte, rutschte er aus dem Sattel und band den Gaul an den kleinen Zügelholm direkt neben dem Hoftor der Bank von Santa Fé.
Es war ein mittelgroßer unauffälliger Mann, etwa vierzig Jahre alt, mit glattanliegendem Haar. Sein Gesicht war scharf geschnitten, mit einer spitzen Nase, braunen stechenden Augen und einem kleinen, fast lippenlosen Mund.
Zwei tiefe, harte Falten zogen sich fast von den Augen her um den tiefgekerbten Mund herum bis zu den Kinnwinkeln. Es war kein angenehmes Gesicht, Unduldsamkeit, Trotz, Herrschsucht und Brutalität waren für den Menschenkenner darin zu finden.
Es war der Desperado Jack Duncer, der seit Tagen fieberhaft gesuchte Mörder der Jenny Black.
Kaltherzig hatte sich der Bandit in einer kleinen Scheune der Gublon Farm verborgen gehalten. Niemand hatte ihn da bemerkt.
In der Nacht war er dann immer in die Stadt gekommen und hatte sogar unten im Webster Cash Saloon zuweilen einen Drink genommen.
Niemand hatte den Mörder erkannt.
Auch in der vergangenen Nacht war er in der Stadt gewesen, er hatte erfahren, daß Abbot den ebenfalls von dem Dodger Marshal gefaßten Clowsterfield des Mordes an der Frau beschuldigt hatte.
Ein zynisches Lächeln war um die Mundwinkel des Mörders gehuscht.
Sie hofften auf Rettung durch ihn!
Diese Hohlköpfe! Sollten sie doch draufgehen, alle beide. Er brauchte sie nicht mehr. Und viel Nutzen hatten sie ihm ja ohnehin nicht gebracht.
Gestern hatte er dann erfahren, daß Clowsterfield zum Tode durch den Strang verurteilt war und kurz nach Tagesanbruch auf dem Galgenhügel draußen aufgeknüpft werden sollte.
Die Berechnungen des Marshals erfüllten sich auf eine wahrhaft unheimliche Weise.
Der Mörder Duncer kam nicht nur, wenn irgendwelche Menschen aufgeknüpft wurden, um die Zeit zu einem Raub auszunutzen, er kam auch, als sein eigener Partner gehängt werden sollte, für eine Tat, die er gar nicht vollbracht hatte!
*
Er war gekommen, um endlich der Bank einen »Besuch« abzustatten, damit der heiße Gang in das bunte Santa Fé nicht nur ein reines »Verlustgeschäft« bleiben sollte.
In dem Bau gab’s sicher mehr Geld als sonst irgendwo.
Als er in dem Hof des Anwesens verschwand, dachte er noch kurz daran, daß es gerade Clowsterfield gewesen war, der ihn bei seinem ersten Ritt in die Stadt, an jenem unseligen Morgen, an dem er dann die junge Frau ausgelöscht hatte, noch vor dem Gang in die Bank bewahrt hatte, weil er durch eines der Fenster mit seinen wachen Augen den Sheriff entdeckt hatte, jedenfalls den blinkenden Stern…
Und jetzt legte dieser gleiche Sheriff ihm, dem an dem Tod der Saloonerin völlig Unschuldigen, den Strick des Todes um den dürren Hals.
Wieder lachte der Mörder leise und hämisch vor sich hin.
Der Hof war sauber aufgeräumt.
Drüben links waren die Stallschuppen des Bankiers und ein Anbau für Geräte. Dazwischen sah überall die ziemlich neue Fenz hervor.
Rechts lag das Haus. Aus Stein gebaut, sicher nur erst wenige Jahre alt. Ein ziemlich protziger Bau.
Na warte, Alter, dich werde ich um ein paar Bucks erleichtern, dachte der Verbrecher, als er plötzlich geduckt und wie ein Schatten vom Tor auf die Hausfront zuhuschte.
Da nahm er hinter einem kleinen leichten Pferdewagen Deckung und lauschte.
Im Hof blieb alles still.
Auch im Haus war nichts zu hören.
Erst nach zwei Minuten verließ die Ratte in Menschengestalt ihren Platz und sprang mit weiten Sätzen auf das Hoftor zu.
Verschlossen.
Duncer warf es ein; er tat so etwas nicht zum erstenmal, das zeigte die Sicherheit, mit der er vorging.
Er stand im Hausgang und lauschte wieder.
Nichts rührte sich.
Damned, sollte ihm das Glück so zuwinken wollen, sollte etwa der ganze Laden leer und alle Bewohner ausgeflogen sein?
Ausgeflogen? Sie waren mit wilder Neugier zum Galgenhügel gelaufen, um den Mann sterben zu sehen.
Den Mann, von dem nur er – Oregon Jack Duncer – mit Sicherheit wußte, daß er am Tod der Saloonerin unschuldig war.
Er nahm ein Geldstück aus der Tasche und warf es auf die Flurfliesen.
Die Münze klimperte durch den Gang und blieb dann still vor der Haustür liegen.
Nichts rührte sich.
Duncer hatte den Revolver in der Linken und verließ die Türnische der Küche, huschte weiter durch den Korridor und warf von weitem einen Blick durch die mit Schmiedeeisen verzierten Türfenster nach draußen.
Die Straße war menschenleer.
Da – der Mörder zuckte zusammen.
Ein Geräusch war an sein Ohr gedrungen.
Ein Geräusch, das ihm einen heißen Stich durch die Brust jagte: Irgendwo wurden große metallene Geldstücke aufeinandergelegt.
Geld wurde gezählt!
Duncer rieb sich mit dem Handrücken über den Mund und prüfte seinen Revolver.
Er sah vorn links neben dem Eingang die breite Tür zum Schalterraum.
Sie stand nur angelehnt.
Mit unendlicher Vorsicht näherte er sich ihr und stieß sie auf.
Hinter den Gittern stand ein Mann und zählte Geld. Ein Mann im weißen Hemd, mit brauner Weste bekleidet, den grünen Marienglasschirm auf der Stirn. An den Ärmeln schwarze lange Hemdschoner.
Duncer duckte sich tief nieder und öffnete die Tür so weit, daß er eintreten konnte.
Wenn jemand auf dem Vorbau stand, konnte er ihn unmöglich sehen, da er sich tief auf den Boden gekauert hatte.
Langsam bewegte er sich vorwärts.
*
Doc Holliday hatte in der Spalte zwischen den beiden Häusern, dem Bankhaus und dem nebenanliegenden Clothing Shop Bery Andersons, hinter den drei die Lücke verschließenden Brettern gestanden.
Da sich auf der Mainstreet nichts rührte, verließ er sein Versteck, schob die nur angelehnten Bretter zur Seite und blieb an der Vorbauecke stehen.
Zu diesem Zeitpunkt war der Desperado schon im Bankraum.
Holliday blickte die Straße hinunter und zündete sich eine Zigarette an, dann nahm er eine uralte Zeitung aus der Tasche, die ihm der Barbier für diesen Fall aus seinen Vorräten gegeben hatte.
Aber was dem Ohr des Spielers entgehen konnte, da es in fast absoluter Lautlosigkeit geschah, vermochte seinem scharfen Auge nicht zu entgehen.
Er hatte die drei Fenster des Schalterraumes im Auge. Die untere Hälfte dieser Fenster war milchig mattiert – dennoch hätte man selbst ein Kind sehen müssen, wenn es den Schalterraum betreten hätte, so niedrig lagen die Fenster.
War es ein Zufall, daß der Georgier gerade in diesem Augenblick das erste Fenster streifte, als sich drinnen die Tür bewegte?
Sicher nicht. Niemand war auf solchem Posten wachsamer als er, der ewig mißtrauische, argwöhnische Mann, der es gewohnt war, fast ständig von Feinden umgeben zu sein, von Menschen, die ihn haßten oder fürchteten und ihn deshalb töten wollten.
Er sah, wie sich die Tür bewegte.
Und da er nicht den mindesten Schatten hinter dem Fenster sah, schrillte es in seinem Hirn Alarm.
Sofort verließ er seinen Platz und ging ein Stück die Straße hinunter.
Wyatt Earp hielt sich in Barkers Goldnuggett Saloon auf, der größten Schenke Santa Fés.
Da der Verbrecher bei seinem ersten Besuch keine Bank, sondern eine Schenke heimgesucht hatte, hielt der Missourier es für durchaus möglich, daß er auch jetzt wieder eine Schenke besuchen würde, um zu »seinem« Geld zu kommen.
Hollliday stieß die Tür auf.
»Wyatt!«
Der Salooner nickte.
»Er ist im Hof! Ich sag ihm Bescheid.«
»Lassen Sie, ich gehe zu ihm.«
Holliday lief durch den Schankraum, den kleinen Flur und öffnete die Korridortür.
Wyatt Earp kam hinter einem Kistenstapel hervor.
»Doc? Was gibt’s?«
»Ich will keine Gespenster an die Wand malen – aber es ist jemand im Schalterraum der Bank.«
»Stimmt, Ton Hancorver, einer der Kassierer. Er zählt Geld. Ich war vor einer Viertelstunde noch bei ihm.«
»Wie groß ist der Mann?«
»Na, einsfünfundsiebzig wenigstens.«
Der Spieler schüttelte den Kopf.
»Well, dann hat er eine merkwürdige Vorliebe. Er geht nämlich nicht aufrecht wie ein normaler Mensch, sondern kriecht über den Boden. Weshalb eigentlich nicht, ist mal was anderes.«
Wyatt Earp war sofort neben Holliday auf der Hoftreppe.
Und jetzt berichtete der Spieler, was er beobachtet hatte.
»Damned, dann ist er also schon in der Bank – wenn es wirklich Duncer sein sollte.«
»Wir werden es erleben.«
Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, marschierten die beiden davon. Wyatt Earp auf die Straßenfront des Bankhauses zu, Holliday durch einen Häuserspalt, über die Nordmauer des Hofes zur Rückfront.
Wyatt hatte sich tief niedergeduckt und unter das erste Fenster geschlichen.
Angestrengt lauschte er – aber es blieb alles still.
Sollte der Tramp etwa schon gehandelt haben?
Mit größter Vorsicht kroch der Marshal zurück und kam dann aufrecht gehend wieder.
Er hielt den Kopf leicht gesenkt und tat, als blicke er auf die Vorbaubohlen.
Dabei aber streifte er blitzschnell mit einem Blick den Teil des Schalterraumes, der von draußen zu sehen war.
Er bemerkte den Schatten sofort, der vorn vor der Schalterbank niederzuckte.
Doc Holliday hatte sich also nicht geirrt: Duncer war da!
Zumindest war ein Bandit in der Bank, denn wer hätte sich sonst durch den Schalterraum in dieser Stellung schleichen sollen.
Wyatt ging weiter – und kam lautlos zurück, duckte sich tief nieder und blieb unter dem zweiten Fenster am Boden knien.
Drinnen war immer noch alles still.
Und der Clerk zählte sein Geld.
Er stand allerdings so, daß Duncer ihn wohl sehen konnte, aber schlecht einen Schuß auf ihn anbringen konnte, da hinter den Gitterstäben noch Glas war.
Duncer hatte alles genau bedacht.
Da waren die Gitter und dahinter das Glas.
Er mußte dicht vor der Schalterklappe mit dem Colt hochschnellen.
Wenn er dann wirklich auf den Mann schoß, war es sinnlos. Er mußte ihn zunächst mit dem Colt bedrohen, da der Clerk ja das Geld erst an den Schalter zu bringen hatte!
Jetzt war er unter dem Schalterbrett, nahm den Colt fest in den Griff und schnellte hoch.
»Hände hoch!«
Der Clerk zuckte wie unter einem Peitschenschlag zusammen.
»So, Boy, nun gib mal die schönen großen Bündel her, die da links neben dir liegen. Und zwar blitzschnell. Wenn du dir Zeit läßt, ergeht’s dir wie Jenny Black.«
Der Clerk hatte sich umgedreht und stierte dem Verbrecher fassungslos ins Gesicht.
»Oregon Jack!« entfuhr es ihm.
Der Desperado lachte humorlos.
»Schwatz nicht – hol das Geld, sonst gibt’s Blei!«
Der Mann nickte und packte mit fliegenden Händen so viel der großen Dollarnotenbündel zusammen, wie er fassen konnte. Stolpernd lief er damit zum Schalter, fiel hin, hörte den heiseren Fluch des Tramps und richtete sich wieder auf.
»Los, Halunke, sammle den Zaster ein! Und Tempo!«
Der Mann war nicht absichtlich gestürzt. Der Angstschweiß rann ihm schon durch die dünnen Brauen in den Augen.
»Vorwärts, schneller, die beiden Packen da auch noch, ja, bück dich, Kerl!«
Der Mann nahm auch die beiden noch am Boden liegenden Bündel auf und kam an den Schalter.
Duncer raffte die Päckchen mit wilder Hast an sich.
»Kann ich helfen?« kam da eine eisigkalte klirrende Stimme von der Tür her.
Der Tramp wirbelte herum und schoß sofort.
Mit dieser rasendschnellen Reaktion hatte er seine »Klasse« bewiesen; er war zweifellos einer der ganz gefährlichen Bankräuber.
Doc Holliday, er war es, der an der Tür gestanden hatte, war bereits wieder im Gang, als die Kugel in das Holz des Türrahmens klatschte, genau dorthin, wo er gerade mit dem Kopf gewesen war.
»Komm raus, Jack! Die Reise ist zu Ende!«
Eine wilde röhrende Lache scholl durch den Schalterraum.
Duncer, der sich niedergeduckt hatte, zuckte hoch und riß dem glotzend dastehenden Clerk den Revolverlauf über den Schädel.
Der Mann sank in sich zusammen.
Im Rücken war der Bandit also vorerst frei.
Da zersprang vorn eine Straßenscheibe, und die Scherben flogen prasselnd in den Raum.
Die schneidende Stimme des Marshals ließ den Bandit zusammenzucken.
»Gib auf, Duncer! Sonst kommst du nicht lebend aus der Mausefalle!«
»Bluff, Mister –«
»Mein Name ist Earp. Und vorn an der Tür steht Doc Holliday. Du hast keine Chance mehr! Wirf deine beiden Colts hier gegen die Fensterwand und steh auf!« Da federte der Tramp hoch und wollte sich über das schmale Schalterbrett schwingen, um in den Kassierraum zu kommen.
Der kaltblütige Spieler aber war auf dem Posten.
»Halt!«
Duncer ließ sich fallen und schoß dann.
Aber die Kugel des Georgiers war schon bei ihm.
Der rechte Revolver wurde ihm wie mit einer Eisenstange aus der Hand geschleudert.
Als er zum anderen Colt greifen wollte, stieß der Marshal den großen Buntline-Revolver durch die zertrümmerte Scheibe.
»Laß das Ding stecken, Duncer!«
Holliday kam auf ihn zu, bückte sich neben ihm – und da schnellte sich der Tramp wie eine Pantherkatze hoch.
Aber das Reaktionsvermögen des Mannes, den er anspringen wollte, war noch schneller.
Hart und keuchend krachte der große Lauf des schweren fünfundvierziger Frontierrevolvers von Doc Holliday über den Schädel des Mörders.
Jack Daniel Duncer war gefällt.
Wyatt hatte das Fenster inzwischen aufgestoßen und war in den Schalterraum gesprungen.
Holliday riß dem betäubten Verbrecher den Revolver aus dem zweiten Halfter.
Wyatt Earp lehnte sich über das Schalterbrett.
»Kommen Sie, Doc, sehen Sie mal nach dem Clerk, der blutet an der Strin.«
Als der Spieler den Bandit aus den Augen ließ, geschah es.
Der steinharte, mit allen Wassern gewaschene Verbrecher federte sofort auf die Füße und riß einen Cloverleaf aus der Hosentasche.
Wie ein Phantom hechtete ihm der Missourier entgegen und riß ihn nieder.
Der Cloverleaf polterte über den Boden davon.
Wyatt hieb dem wie eine Raubkatze um sich schlagenden Mann einen Faustschlag an die Schläfe und riß den Erlahmenden hoch.
»Komm, old Guy, hinaus an die frische Luft. Hier ist es verdammt stickig…«
Holliday hatte sich davon überzeugt, daß der Clerk wieder zu sich gekommen war, und die kleine Platzwunde an der Schläfe war weniger schlimm als die anschwellende Beule oben auf der Kopfschwarte.
Wyatt hatte Duncer wie einen toten Hasen am Genick gepackt und schleppte ihn auf die Straße.
Mit einem heiseren Schrei kam drüben der kleine Sammy aus dem Haus.
»Das ist er, Marshal! Sie haben den richtigen…«
Da kam Doc Holliday aus der Bank und rannte über die Straße.
Drüben stand sein Pferd. Er sprang in den Sattel und galoppierte davon.
Aber der schwarze Tom hatte den Zug zum Galgenhügel längst mit dem verabredeten Lärm gestoppt. Mit zerknirschtem Gesicht hatte der Sheriff den Tramp Clowsterfield zurückgeführt.
Eine Viertelstunde später saßen sie alle drei im Jail, die Männer, die an jenem Morgen in die Stadt gekommen waren, um zu rauben.
Und der Mörder Duncer Oregon Jack sah wirklich dem Galgentod entgegen.
*
Am nächsten Morgen öffnete der Lawyer Grinda Jenny Blacks Testament.
Es besagt nicht mehr und nicht weniger, daß für den unvorhergesehenen Fall Jennys Todes der schwarze Hausknecht Tom und dessen Sohn Sam die »Fegefeuer-Bar« erben sollten…
– E?N?D?E?–