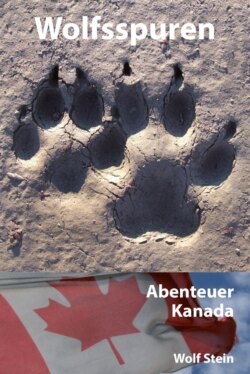Читать книгу Wolfsspuren - Wolf Stein - Страница 4
Ein Schiff wird kommen
ОглавлениеHereby I certify Mr. Wolf Stein, voyage NO. “78 W” on M/V “Canada Senator” from 13 th to 26 th June 2007.
From the port of Genoa via the port of Fos sur mer,the Westmediterranean Sea, the Strait of Gibraltar, the North Atlantic Ocean and the St. Lorenz to the port of Montreal he covered a distance of 4168 nautical miles.
Montreal, 26 th June 2007
… so steht es in meinem von Kapitän Stellmacher höchstpersönlich unterschriebenen, offiziell abgestempelten und freudig überreichten Meilenzertifikat, das ich, neben vier weiteren Passagieren der M/V Canada Senator, am 26. Juni 2007 im Hafen der ostkanadischen Metropole Montreal aufgeregt entgegennahm. Hinter uns lag eine spannende zweiwöchige Schiffsreise von Italien nach Kanada - nicht etwa auf einem schwimmenden Einkaufs- und Unterhaltungstempel mit allem möglichen Schnickschnack und Rambazamba, nein, etwas unluxuriöser und einfacher auf einem richtigen Containerschiff.
Ja, das ist sie, die M/V Canada Senator, ein 202 Meter langer Riese aus Eisen. Was Echtes, was Handfestes! Nichts für Leute, die auf hoher See lieber ein neues Handtäschchen erwerben oder mit Genuss im Casino ihre Kohle zum Schornstein rausblasen, anstatt die frische Meeresluft an Deck einzuatmen, hautnah das Auf und Ab der Wellen zu spüren und begeistert dem weit entfernten Sonnenuntergang entgegen zu schippern. Zweitausend Container á 20 Fuß und 36 Mann Besatzung befördern Waren aus aller Welt von Europa nach Nordamerika und wieder zurück. Und jeweils fünf Passagiere. Mehr sind nicht erlaubt. Man braucht jedoch Nerven und eine gewisse Gelassenheit, wenn man sich auf solch eine Überfahrt einlässt. Die kann übrigens ganz einfach im Internet unter dem Begriff Frachtschifftouristik gebucht werden. Abfahrt- und Ankunftsdatum sind aber keineswegs sicher. Der Mitreisende muss sich bewusst sein, dass nicht er, sondern die zu befördernde Ladung im Mittelpunkt steht. Warten auf Ein- und Ausfuhrgenehmigungen, Beladen, Entladen, Streiks, die allgemeine Wetterlage, technische Schwierigkeiten - all diese Faktoren können zu Verzögerungen führen. Zeitliche Abweichungen im Reiseplan sind deshalb keine Seltenheit. Ich konnte jedoch nicht ahnen, dass es gerade mich dermaßen hart treffen würde.
Zunächst sollte unser Frachter am 03. Juni vom Containerterminal im Stadthafen von Genua ablegen. Das Stechen in die See verschob sich aber aufgrund eines Sturms im Nordatlantik und einer kurzzeitigen Arbeitsniederlegung der Hafenbelegschaft in Frankreich um mehrere Tage auf Samstag, den 09. Juni. Dies wurde mir in einer Informations-E-Mail ausführlich erklärt. So weit, so gut. Hotel umgebucht! Flug umgebucht! Am Donnerstag, dem 07. Juni, flog ich mit meiner Freundin Anne nach Genua. Anne wollte mich dort drei Tage begleiten und dann mit dem Schiff wegfahren sehen.
Doch alles kam anders.
Nach weiteren zwei Tagen Aufenthaltsverlängerung ihrerseits verabschiedete sie nicht mich am Hafen, sondern ich sie unter Tränen am Bahnhof. Sie fuhr zurück nach Deutschland. Einer musste ja schließlich Geld verdienen. Noch immer war nicht klar, wann die Canada Senator endlich einlaufen würde. Selbst ständiges Nachfragen in der ortsansässigen Agentur brachte mich nicht wirklich weiter.
»Voraussichtlich am Dreizehnten«, hieß es nun. »Ach ja … und das Hafenterminal hat sich übrigens geändert. Sie müssen jetzt nach Voltri.«
Na toll! Anne hatte unser Hotel extra so gebucht, dass ich praktisch aus der Schwingtür direkt auf das Schiffsdeck gefallen wäre. Jetzt wurde ich auch noch zu einer 25minütigen Zugfahrt gedrängt, denn Voltri liegt weit außerhalb der Stadt. Wie schon gesagt: Fracht vor Passagier!
Auf den 13. Juni hoffend, tingelte ich etwas gelangweilt durch Genuas Stadtviertel und klagte Anne per Telefon mein Leid. Die italienische Stadt hat zwar einiges an Attraktionen zu bieten, Wurzeln schlagen wollte ich hier jedoch nicht. Schon gar nicht bei dieser Affenhitze. Abends saß ich auf der Dachterrasse des Agnello Doro Hotels und beobachtete sehnsüchtig das Hafengeschehen. Große Fähren fuhren unter Vollbeleuchtung ein und aus, Segelboote, Motorjachten und Containerschiffe. Nur eben nicht mein Containerschiff. Doch alles Warten hat irgendwann ein Ende und das nicht nur im Märchen. Es war unglaublich - wie vorausgehofft, erhielt ich an einem Mittwoch, es war tatsächlich der 13. Juni, den Befehl, an Bord zu gehen. Oder besser gesagt: Die Erlaubnis, an Bord gehen zu dürfen.
Ein leichtes Grinsen zierte mein verschwitztes Gesicht, als ich mit Sack und Pack den von Containern nur so überquellenden Hafen in Voltri erreichte.
»Wo ist mein Schiff?« dachte ich. »Wo? Oder war alles doch nur ein Witz? Die Hoffnung stirbt zuletzt!«
Wenig später schlängelte sich ein Shuttle der Hafeninformation durch das endlos scheinende Labyrinth aus gestapelten Frachtbehälterburgen. Mit mir als Beifahrer.
Dann lag sie vor mir im Dock. Zwei gigantische Lastkräne fuhren auf Schienen parallel zur Canada Senator. Ich stieg die wackligen Stufen der Schiffsleiter hinauf. Überall rannten Arbeiter mit Helmen umher. Manche grüßten kurz. Punkt 15 Uhr meldete sich Passagier Stein auf der Brücke - bereit zum Ablegen. Aber so weit war es noch lange nicht. Die italienischen Hafenarbeiter waren ein Verein für sich. Ihr Motto: Belade ich heute nicht, belade ich morgen nicht, und übermorgen vielleicht auch nicht. Nur immer schön entspannt bleiben. Diese Arbeitseinstellung war auch der Grund dafür, dass der Frachter bereits ganze zwei Tage in Sichtweite vor Anker gelegen hatte und nicht anlanden durfte. Das erfuhr ich von Sylvia und Holger aus Österreich, zwei meiner Passagierkollegen, deren Hotel sich direkt in Voltri befand. Von dort aus konnten sie das Geschehen mit dem Fernglas genau beobachten.
»Das muss man sich mal vorstellen!« sagten sie. »Da hat man tagelang dieses blaue Schiff, auf das man so lange warten musste, direkt vor der Nase und kann nicht drauf. Wir wären fast verrückt geworden.«
Jeder hatte seine eigene Geschichte des Wartens. Neben Sylvia und Holger kamen noch Marco und Nina an Bord, ein junges Pärchen aus der Schweiz. Während Sylvia und Holger ihr gesetztes Alter genossen und jeden Sommer in ihrer kleinen Hütte in Ontario verbrachten, wollten Marco und Nina es wissen. Sie waren auf Weltreise - mit dem Fahrrad! Die beiden hatten bereits die Strecke über Frankreich bis nach Italien auf ihren teuren Drahteseln hinter sich gebracht. Zwei Jahre lang wollten sie in die Pedale treten. Doch da man mit dem Fahrrad, oder dem Velo, wie es in der Schweiz heißt, bekanntlich nicht über das Wasser fahren kann, waren sie auf dem Schiff gelandet.
Wir alle besaßen eine Gemeinsamkeit: Aus Abenteuerlust und Neugier hatten wir uns für diese eher unkonventionelle Art des Reisens entschieden. Mal was anderes eben.
Nach dem ersten Kennenlernen brachten alle ihre Koffer auf Kammer, wie man seemännisch sagt. Auf Deck herrschte reges Treiben. Wir mussten uns erst einmal allein beschäftigen, bevor wir offiziell begrüßt wurden. Als ich die Tür meiner Einzelkabine 413 öffnete, fielen mir fast die Augen raus. Nicht vor Schreck über die Winzigkeit der Kajüte, sondern weil ich nicht glauben konnte, was für ein geräumiges, gemütlich eingerichtetes Zimmer sich dahinter verbarg. Hier konnte ich es leicht aushalten - bequeme Holzmöbel, zwei Fenster nach Steuerbord, sogar frisches Obst auf dem Tisch. Fast zu viel des Guten, schließlich hatte ich gerade noch über die feinen Damen und Herren auf ihren Luxuslinern gespottet. Später fand ich heraus, dass das überschwängliche Platzangebot den Nachwehen des Kalten Krieges zu verdanken war. Die M/V Canada Senator wurde 1992 in Polen gebaut. Sie war nicht nur als Frachtschiff, sondern gleichzeitig auch als Truppentransporter konzipiert worden. Um mangelnde Raumfreiheit brauchten wir uns somit keine Sorgen zu machen. Dies nur als kleiner Insidertipp für Menschen mit Klaustrophobie.
Der Rest des ersten Tages verging wie im Flug. Irgendwann sammelte uns der Sicherheitsoffizier ein, belehrte uns und startete seinen Schiffsrundgang.
»Hier ist die Offiziersmesse. Dort essen auch Sie. Essenzeiten stehen da drüben auf dem Plan. Getränke, Süßigkeiten und so weiter können Sie hier kaufen. Und jetzt weiter in den Wäscheraum.«
Wir folgten gehorsamst. Es ging unter Deck. Nicht weit vom Wäscheraum entfernt befand sich das Sportstudio - wenn man es so nennen will - bestückt mit einer alten Tischtennisplatte, ein paar selbstgebastelten Hanteln, alten Fitnessgeräten, einer separaten Sauna und einem einfachen Pool, der regelmäßig mit frischem Meereswasser gefüllt wurde. Wir fragten, ob so eine Ausstattung auf Containerschiffen Standard sei.
»Nein, nicht unbedingt. Vieles ist dem Kapitän zu verdanken. Aber auch sonst ist die Senator eines der angenehmeren Schiffe. So was braucht man, wenn man monatelang zur See geht.«
Das stimmt wohl. So vollkommen ist keine Seefahrerromantik, dass man sich nicht über ein wenig Ablenkung und Annehmlichkeit nach getaner Arbeit freut.
Im Anschluss an die Führung begrüßte uns der Kapitän. Er wünschte uns einen angenehmen Aufenthalt. Wir waren uns sicher, den würden wir haben.
Es freute mich, dass die Chemie zwischen uns Passagieren stimmte. Hätten ja auch alles komische Vögel sein können. Noch mehr freute mich jedoch, dass es endlich zum Abendbrot ging. Neben der reichhaltigen Hausmannskost, die uns das Küchenteam Ariel, Glen und Nick von nun an täglich kredenzte, gab es in der Messe die Gelegenheit, die Mannschaft unter die Lupe zu nehmen. Zumindest den deutschen Teil. Denn die Offiziere waren alle deutscher Herkunft, genauso wie die Schiffsmechaniker, der Praktikant und die sechs Auszubildenden. Der Rest der Besatzung bestand aus philippinischen Arbeitern, die in der separaten Mannschaftsmesse speisten. Dies rief sofort meinen Gerechtigkeitssinn auf den Plan. Zunächst richtete sich mein Verdacht auf empörende Rassentrennung. Doch auf Nachfrage wurde ich beruhigt. Es sei eine absolute Ausnahme, die aufgrund der Auszubildenden getroffen wurde, dass die Mannschaft mit in der Offiziersmesse essen darf. Und die Philippinos würden lieber unter sich bleiben.
Nun ja, ich konnte es ihnen nicht verdenken. Ich glaube im philippinischen Speisesaal herrschte mehr Stimmung als im deutschen. Das war schon eine lustige und freundliche Truppe, wenngleich in der Rangordnung ganz unten angesiedelt. Die philippinischen Arbeiter liebten das Karaokesingen und gaben sich ihrer Liebe mit ungezügelter Leidenschaft hin. Jeden Abend sangen sie sich vor dem Fernseher im Freizeitraum die Seele aus dem Hals, zu Schnulzen und Schmuseliedern aus den alten und glorreichen Zeiten der Popgeschichte. Mit einem Ehrgeiz und einer Inbrunst, jedes Frauenherz wäre zu Tränen gerührt dahin geschmolzen. Oder hätte Tränen gelacht. Es war eine unbeschreibliche Mischung aus Charme und Witz. Alles in allem verstand sich die Mannschaft sehr gut. Jeder schien mit seinem Gegenüber klarzukommen. Auch Kapitän Stellmacher war bei allen beliebt.
In der ersten Nacht schlief ich sehr unruhig in meiner Koje. Sylvia, Holger und Co ging es genauso. Ständig donnerte es draußen. Das Schiff wackelte. Dabei lagen wir noch im Hafen. Schuld waren die Italiener, die wohl lieber nachts arbeiteten als tagsüber. Vielleicht mussten sie auch durcharbeiten, um überhaupt mit dem Be- und Entladen fertig zu werden.
Der nächste Tag brachte wiederum viel Neues - nur keine Abfahrt, jedenfalls nicht sofort. Dafür jedoch die Erfahrung, dass es in der Seefahrt immer noch gang und gäbe ist, den Bordmüll ins offene Meer zu kippen, wenn man nur weit genug vom Festland entfernt ist. Erschreckend! Frachter aus aller Herren Länder kippen also regulär alles, was nicht mehr gebraucht wird, über Bord. Auch hier bildete die Canada Senator zum Glück eine Ausnahme. Deutsche Schiffe unterliegen strengen Regelungen in Bezug auf die Entsorgung des eigenen Abfalls. Weiterhin lernten wir, welche ungeheure Logistik hinter der ganzen weltweiten Containerwirtschaft steckt.
Am Abend waren sich alle einig, dass es doch nun bald mal losgehen müsse. Wäre von Anfang an alles ohne Verzögerungen verlaufen, hätten wir jetzt schon fast in Kanada angelegt. Um 23:30 Uhr änderte das immer gegenwärtige, leichte Dröhnen an Bord plötzlich seine Intensität. Wir saßen gerade beim gemeinschaftlichen Kartenspiel auf Kammer, als sich die Sicht aus Holgers und Sylvias Fenster merklich änderte. Die strahlenden Lichter der Stadt zogen langsam vorbei. Nein! Waren wir wirklich dabei, abzulegen? Uns hielt nichts mehr auf unseren Stühlen. Alle stürmten raus auf das Oberdeck. Wir standen sprachlos im Wind. Gespannt beobachteten wir das Ablegemanöver. Zwei Lotsenboote gaben die Richtung vor. Ein kleiner Lichtkegel war alles, was von Genua übrig blieb. Der Nachthimmel präsentierte sich sternenklar. Die Luft roch nach Treibstoff. Die Maschine beschleunigte langsam aber sicher auf Reisegeschwindigkeit. Der Gegenwind ließ unsere Haare und Jacken flattern. Blickten wir direkt in Fahrtrichtung, mussten wir die Augen zukneifen. Es wurde richtiggehend frisch. Zufrieden zogen wir uns in unsere Kojen zurück und träumten von dem, was uns in den nächsten zwei Wochen wohl alles widerfahren würde. Das Schönste war jedoch, überhaupt endlich in See gestochen zu sein. Schiff ahoi!
So ging es durch das nördliche Mittelmeer geradewegs bis nach Fos sur mer in Frankreich. Bei den Franzosen ging alles blitzschnell. Am späten Vormittag eingelaufen, am Abend bereits wieder ausgelaufen - wieder mittels zweier hilfreicher Lotsen, wieder unter den neugierigen Augen von uns Passagieren.
Nachts leuchtete die Venus am Himmel. Neben ihr stand ein wunderschöner Sichelmond. Als Höhepunkt schossen unzählige Sternschnuppen am Firmament entlang.
In der Meerenge von Gibraltar verharrte ich am folgenden Tag stundenlang am Bug. Ich wartete auf Delphine. Die werden dort häufig gesichtet. Meine Geduld wurde mehr als belohnt. In kleinen und großen Gruppen kamen sie von Backbord und Steuerbord angeschwommen und sprangen in der vorwärtspeitschenden Bugwelle umher. Es schien den Delphinen ein wahres Vergnügen zu sein. Die Begegnung mit ihnen war es mir ebenso.
Bald darauf war kein Land mehr in Sicht. Überall nur Wasser. Ich machte mich mit den sechs Lehrlingen bekannt - alles Kerle. Bei einem Namen kam ich allerdings ins Stutzen.
»Und wie heißt Du?« fragte ich einen der Azubis, der mit einer Flasche Bier im Gang saß. Es war spät abends, weit nach Schichtende, also kein Problem mit dem Bier.
»Daniela«, lautete seine Antwort.
»Daniela? Oh bestimmt ein italienischer Name, oder?«
»Nee, wieso?« fragte er.
Ich antwortete, dass Daniela meiner Meinung nach als Männername nur in Italien vorkäme und in Deutschland nur Frauen so hießen.
»Äh, Moment«, sagte Daniela, »ich bin doch ne Frau!«
»Upps!«
Leicht irritiert musterte mein verdutzter Blick Danielas Erscheinung.
»Das hätte sie aber draufschreiben müssen«, dachte ich, versuchte nun aber schleunigst, nicht noch mit dem zweiten Fuß ins Fettnäpfchen zu treten.
»Na ja! Sag ich doch! Prost!«
Was Besseres fiel mir nicht ein. Ich hoffe, Daniela hat es mir nicht zu übel genommen. Dann fragte ich sie, wie das so sei als einziges Mädel unter all den Männern, obwohl es ja eigentlich gar nicht auffiel.
»Nicht immer leicht, soviel steht fest«, meinte sie.
Daniela feierte auf dieser Reise ihren Geburtstag. Sie lud alle zu einer Partysause ein. Und wie wurde da wohl gefeiert? Mit Bier, Sekt, Häppchen für den kleinen Hunger und natürlich ... mit Karaoke! Die philippinischen Kollegen drehten voll auf, sangen sich in Ekstase und machten den Abend unvergesslich.
Die Tage auf dem Atlantischen Ozean vergingen schneller als gedacht. Wir verbrachten die Zeit mit Sport, Tischtennis, Lesen, Essen, Schlafen, Sauna, Erzählen, DVD-Abenden, Meeresbeobachtungen, diversen Schiffsführungen und im Pool. Dessen Wellengang passte sich dem Schwanken des Schiffes an. Herrschte raue See, entwickelten sich im Pool kräftige Wellen. Beschweren konnten wir uns jedoch nicht. Neptun meinte es gut mit uns. Dank des guten Wetters wurde niemand seekrank. Nur hin und wieder schaukelte es etwas kräftiger. Je nach Schlagseite gestaltete sich das Treppensteigen mal leichter, mal schwerer. Anfangs hatten wir Passagiere uns noch einen Sturm gewünscht, zumindest einen klitzekleinen, nur um es mal miterlebt zu haben. Doch als die Matrosen uns Bilder und Videos des letzten Märztaifuns im Atlantik zeigten, waren wir überzeugt, auch ohne Sturm leben zu können. Die Wellen, die wir zu sehen bekamen, schlugen mit solcher Wucht gegen das Schiff, dass die Gischt weit über die obersten Container spritzte. Auf Deck standen jeweils vier davon übereinander! Außerdem schaukelte der 202-Meter-Frachter wie eine Nussschale auf und ab. Die Mannschaft verbrachte zwei Tage festgeschnallt in den Kojen. Das gewaltige Ausmaß des Wetterextrems bezeugten massive Schäden in der Bugreling - beindicker Stahl, verbogen wie Maschendraht. Unglaublich, welche Kraft aufgepeitschtes Wasser entwickeln kann. Von einem Sturm hatten wir damit genug gesehen, noch dazu als wir erfuhren, dass wir uns auf dem ungefähren Kurs der Titanic befanden. Beruhigend für mich war, dass sich das Rettungsboot direkt neben meiner Kabine befand.
Nicht satt sehen konnten wir uns an der untergehenden Sonne. Fast jeden Abend erlosch der rote Feuerball allmählich im Meer, um am Tag darauf wie neu entzündet wieder aus ihm emporzusteigen. Nur ein paar vernebelte Tage trübten die ansonsten perfekte Wetterbilanz.
Jeden Morgen tickten die Uhren anders auf der Canada Senator. Das lag daran, dass ab Mitte der Reise jede Nacht die Zeit um eine Stunde zurückgestellt wurde. So konnten wir uns langsam und problemlos an den Zeitunterschied zwischen Zentraleuropa und Ostkanada gewöhnen. Obgleich Tag für Tag eine Stunde hinzukam, die Zeit verging viel zu schnell. Und obwohl der Küchenchef bereits damit begonnen hatte, den wöchentlichen Menüplan wieder von vorn zu kochen, was einigen Vollzeitmatrosen aus der Mannschaft schon zum Hals raushing, gab es von Langeweile keine Spur. Unsere fünfköpfige Reisegruppe erlangte Zutritt zu den heiligen Hallen des Maschinenraumes - unter persönlicher Führung des 1. Ingenieurs. Was für eine Ehre! Die graue Eminenz, wie wir ihn nannten, hatte sich tagelang betteln lassen. Ein ganz schöner Sturkopf. Einer, der alles konnte und alles wusste. Kein einfacher Mensch. Aber seine Führung war gut. Mit Hörschutz bewaffnet schlichen beziehungsweise hetzten wir durch die Gänge hinter ihm her. Überall ratterte und dampfte es. Wenn die graue Eminenz uns etwas ins Ohr schrie, verstanden wir meistens nur die Hälfte. Allein der Motor des Eisenriesens war knappe 14 Meter hoch, wie ein Haus. Die Antriebsschraube brachte es auf 8 Meter im Durchmesser. Angeblich gibt es nur noch vier Maschinen dieser Bauart weltweit. Im Kontrollraum sah es aus wie in der Schaltzentrale eines Atombunkers zu Zeiten des Kalten Krieges.
»Ich erzeuge hier so viel Energie, dass ich locker eine ganze Großstadt versorgen könnte«, sagte der Herr der Maschinen. »Satte 45 Minuten braucht das Schiff, um volle Fahrt aufzunehmen. Und 40 Minuten, um zum völligen Stillstand zu kommen.«
Das hieß übersetzt: Alle anderen sollten lieber ausweichen und sich nicht mit der Canada Senator und deren 1. Ingenieur anlegen.
Ein ganz anderes Kaliber als die graue Eminenz war der Schiffsmechaniker Bernd. Auch ein waschechter Seemann, den wir nur den Seebären nannten - kräftig, mit Vollbart und immer eine spannende Geschichte aus vergangenen Zeiten auf Lager. Wie die, als er die Besatzung eines im Sturm untergegangenen Holzfrachters retten musste. Damals wäre er fast draufgegangen. Die langen Baumstämme rissen sich unter Wasser durch den natürlichen Auftrieb nach und nach los und schossen wie riesige Pfeile aus den Wellen.
»Hätte uns irgendeiner dieser Stämme getroffen, wäre Ruhe im Karton gewesen«, sagte Bernd mit weit geöffneten Augen.
Wir fragten den Seebären, wie groß die höchsten Wellen waren, die er je zu Gesicht bekommen hat.
»Die waren 18 Meter hoch. Das ist faszinierend, aber nicht schön.«
»18 Meter! Meine Güte!«
Bernd schien in Ordnung. Von ihm konnte man viel über die Seefahrt lernen. Nicht umsonst war er Ausbilder der Lehrlinge und gleichzeitig zuständig für die gerechte Verteilung der an Bord befindlichen DVD-Sammlung. Eines Abends sahen wir uns mit ihm den auf hoher See sehr passenden Film `Der Untergang der Pamir´ an. Der Klassiker trieb Sylvia leichte Schweißperlen auf die Stirn.
Unserem Freund, der grauen Eminenz, trieb etwas ganz anderes den Schweiß auf die Stirn, nämlich dass wir mit nackten Füßen die Messe zum Essen betraten. Dies wurde an Bord nicht gern gesehen. Wir fünf wussten das natürlich nicht, sind die erste Zeit immer barfuß mit Sandalen zur Mahlzeit stolziert und haben uns über diejenigen lustig gemacht, die mit kurzen Hosen, Sandaletten und hohen schwarzen oder weißen Strümpfen bekleidet angerannt kamen. Das sah schon ulkig aus. Dezent auf unseren unangepassten Kleidungsstil hingewiesen, wurden wir bei einem gemeinsamen Bier am Abend.
»Also von jetzt an immer Socken tragen! Aber bloß keine grünen!« sagte der 1. Ingenieur.
»Wieso denn das?« fragte Nina.
Die Antwort hatte etwas mit dem Klabautermann zu tun, dem guten und hilfreichen Geist der Schifffahrt.
»Der trägt nämlich grüne Socken und hat grüne Zähne. Und wenn man den Klabautermann sieht, ist es zu spät. Der Klabautermann zeigt sich nur, wenn das Schiff untergeht. Grüne Socken bringen den Tod auf See. So sieht es aus.«
Ob Seemannsgarn oder nicht, keiner von uns wollte dem Klabautermann begegnen. Zum Glück hatte niemand von uns grüne Strümpfe im Gepäck.
Der beste Teil der abenteuerlichen Überfahrt lag vor uns: Der St. Lorenz Strom. Unser Kurs führte vorbei an Neufundland, hinein in die Mündung des Flusses und immer weiter stromaufwärts bis nach Montreal. Wale kreuzten unseren Weg - Belugas, Grauwale und Orkas. Es ging unter gigantischen Brücken und Starkstromleitungen hindurch, vorbei an der Stadt Quebec, an Wäldern, kleinen Häuschen und Leuchttürmen. Das Ufer kam näher und näher, so nah, dass es ein Leichtes war, den Leuten in die Fenster zu gucken. Man stelle sich das bildlich vor: Man sitzt gemütlich im Garten bei Kaffee und Kuchen, plötzlich fährt ein stattliches Containerschiff an einem vorbei und die Passagiere winken einem freundlich zu. So eng wird es auf dem St. Lorenz.
Am 26. Juni hatten wir es geschafft. Montreal empfing uns bei herrlichstem Sonnenschein. Wir standen oben auf dem Sonnendeck. Der Zoll kam an Bord. Die Beamten fragten, ob alles ordnungsgemäß verlaufen sei, gaben jedem von uns einen Stempel in den Reisepass und entließen uns in die Freiheit. Kapitän Stellmacher drückte uns die Meilenzertifikate in die Hände. Ich verabschiedete mich von ihm, von Holger, Sylvia, Marco, Nina, dem Seebären und der Mannschaft. Einige Adressen wurden ausgetauscht. Dann ging ich mit meinem Rucksack von Bord.