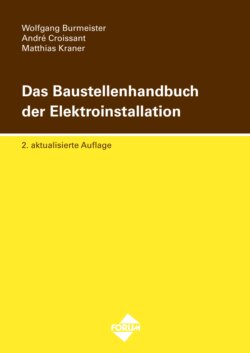Читать книгу Das Baustellenhandbuch der Elektroinstallation - Wolfgang Burmeister - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеGrundlagen einer fachgerechten Elektroinstallation
Technische Rahmenbedingungen
Für die Ausführung elektrotechnischer Arbeiten gibt es eine Vielzahl an Regelungen, die zu beachten sind. Nachfolgend wird ohne Anspruch auf Vollständigkeit auf die wichtigsten Regelungen eingegangen.
VDE-Richtlinien
| Norm | Kurztext |
| VDE 0100 | Die Norm ist das „Grundwerk“ der elektrischen Anlagen in Gebäuden. Die Teile repräsentieren alle Umsetzungsphasen. |
| VDE 0100-100 | Anwendungsbereich, Zweck, Grundsätze |
| VDE 0100-200 | Begriffe – Errichten von Niederspannungsanlagen |
| VDE 0100-300 | Bestimmung allgemeiner Merkmale. In Teil 4 werden Schutzmaßnahmen behandelt. |
| VDE 0100-410 | Schutz gegen elektrischen Schlag |
| VDE 0100-420 | Schutz gegen thermische Einflüsse |
| VDE 0100-430 | Schutz von Kabeln und Leitungen bei Überstrom |
| VDE 0100-44x | Schutz bei Störspannungen und elektromagnetischen Störgrößen |
| VDE 0100-450 | Schutz gegen Unterspannung |
| VDE 0100-460 | Trennen und Schalten |
| VDE 0100-48x | Auswahl von Schutzmaßnahmen. Hier Teil 482 interessant für Brandschutz bei besonderen Risiken und Gefahren |
| VDE 0100-5xx | Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel |
| VDE 0100-600 | Prüfungen |
| VDE 0100-7xx | Anforderungen an Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art |
| VDE 0101 | Starkstromanlagen über 1 kV |
| VDE 0102 | Berechnung von Kurzschlussströmen in Drehstromnetzen |
| VDE 0103 | Berechnung der Wirkung der Kurzschlussströme |
| VDE 0105 | Betrieb von elektrischen Anlagen |
| VDE 0106 | Verfahren zur Messung von Berührungsstrom und Schutzleiterstrom |
| VDE 0108 | Starkstromanlagen und Sicherheitsstromversorgung in baulichen Anlagen für Menschenansammlungen, Teile 1 bis 8 und 100 |
| VDE 0151 | Werkstoffe und Mindestmaße von Erdern bezüglich der Korrosion |
| VDE 0160 | Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektrischen Betriebsmitteln |
| VDE 0165 VDE 0170 | Elektrische Betriebsmittel für gasexplosionsgefährdete Bereiche |
| VDE V 0166 | Errichten elektrischer Anlagen in durch explosionsgefährliche Stoffe gefährdeten Bereichen |
| VDE 0184 | Überspannungen und Schutz bei Überspannungen in Niederspannungsstarkstromanlagen mit Wechselspannungen |
| VDE 0185 | Blitzschutz |
| VDE 0276 | Strombelastbarkeit und Umrechnungsfaktoren für Starkstromkabel |
| VDE 0293 | Kennzeichnen der Adern von Kabeln |
| VDE 0413 | Messen und Überwachen von Schutzmaßnahmen der elektrischen Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis 1.000 V Wechselspannung und 1.500 V Gleichspannung |
| VDE 0510 | Akkumulatoren und Batterieanlagen mit Sicherheitsanforderungen |
| VDE 0558 | Zentrale Stromversorgungssysteme mit unterbrechungsfreien Stromversorgungsanlagen (USV) |
| VDE 0603 | Installationskleinverteiler und Zählerplätze |
| VDE 0604 | Elektroinstallationskanäle |
| VDE 0605 | Elektroinstallationsrohrsysteme |
| VDE 0606 | Installationsdosen und Verbindungsklemmen |
| VDE 0623 | Stecker und Steckdose, Kupplungen für industrielle Anwendungen |
| VDE 0636 | Niederspannungssicherungen |
| VDE 0641 | Leitungsschutzschalter |
| VDE 0642 | Geräteschutzschalter |
| VDE 0660 | Niederspannungsschaltgeräte und Niederspannungsschaltgerätekombinationen Bemessungswerte, Typprüfungen, Hausanschlusskästen, Sicherungskästen |
| VDE 0661 | Ortsveränderliche Fehlerstromschutzeinrichtungen (PRCDs) für Hausinstallationen |
| VDE 0663 | Differenzstromüberwachungsgeräte für Hausinstallation (RCMs) |
| VDE 0664 | Fehlerstrom-Differenzschutzschalter |
| VDE 0711-x | Leuchten |
| VDE 0800 | Fernmeldetechnik |
| VDE 0805 | Einrichtungen der Informationstechnik – Sicherheit |
| VDE 0828 | Elektroakustische Notfallsysteme |
| VDE 0829 | Elektrische Systemtechnik |
| VDE 0830 | Alarmanlagen |
| VDE 0833 | Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall |
| VDE V 0834 | Rufanlagen in Krankenhäusern, Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen |
| VDE 0845 | Schutz von Fernmeldegeräten gegen Blitzeinwirkung |
| VDE 0848 | Sicherheit in elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Feldern |
| VDE 0855 | Kabelverteilsysteme für Fernseh-, Ton- und interaktive Multimediasignale (inklusive Sende- und Empfangsanlagen in separaten Teilen der Reihe VDE 0855) |
| VDE 0887 | Koaxialkabel |
| VDE 0888 | Lichtwellenleiter |
| VDE 0891 | Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen für Fernmeldeanlagen |
| VDE 1000-10 | Anforderungen an die im Bereich der Elektrotechnik tätigen Personen |
Tab. 1: Übersicht über die wichtigsten VDE-Normen (Quelle: Kraner)
Energiewirtschaftsgesetz
Das Energiewirtschaftsgesetz fordert u. a., dass die Installation nach den Rechtsvorschriften und anerkannten Regeln der Technik auszuführen sind. Die Installation soll die technische Sicherheit gewährleisten. Dabei wird davon ausgegangen, dass diese eingehalten sind, wenn die Ausführung nach den Normen der VDE oder nach den Regeln in einem anderen EU-Staat erfolgt. Bei der Ausführung haftet der Verantwortliche. Hierbei ist zu beachten, dass der Ausführende der Installation nicht immer der Verantwortliche ist, sondern dies auch der Planer oder Bauleiter sein kann, unter dessen Anweisung die Ausführung erfolgt. Die Behörden können einen Nachweis verlangen, dass die Anforderungen an die technische Sicherheit bei der Errichtung und beim Betrieb nachgewiesen wird. Um den Nachweis führen zu können, sind für den Betreiber entsprechende Erklärungen des Ausführenden nötig, die bestätigen, dass die Anlagen technisch sicher und nach den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt wurden. Diese Erklärung sollte durch eine entsprechende Dokumentation mit Messprotokollen belegt werden können. Diese Dokumentation sollte im Betrieb mit den Nachweisen der Inspektion, Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung laufend ergänzt und gepflegt werden.
Es wird ferner vorausgesetzt, dass jeder, der sich mit der Errichtung oder dem Betrieb elektrischer Anlagen oder von Komponenten hierfür befasst, selbst für die Einhaltung der Anerkannten Regeln verantwortlich ist. Daraus lässt sich z. B. eine Fortbildungspflicht ableiten, denn die Nichteinhaltung dieser Anerkannten Regeln der Technik kann im Schadensfall als fahrlässige Handlung aufgefasst werden.
Anerkannte Regeln der Technik
Die Anerkannten Regeln der Technik sind technische Festlegungen, die von Fachleuten allgemein als richtig betrachtet werden, Fachleuten allgemein zugänglich sind und langfristig erprobt sind.
Eine allgemein gültige Definition oder Zusammenstellung gibt es nicht, da die Dokumente sehr fachspezifisch sind. Allgemein wird angenommen, dass Normen, speziell wenn sie öffentlich erstellt werden, Teil der Anerkannten Regeln der Technik sind. Jedoch ist zu beachten, dass die Erfüllung der Normen nicht gleich bedeutend mit der Einhaltung der
Anerkannten Regeln der Technik sein muss, da diese veraltet sein oder auch Sachverhalte darstellen können, die dem Stand der Technik entsprechen. Jedoch wird davon ausgegangen, dass, wenn ein Errichter die Erfüllung nach Normen nachgewiesen hat, der Betreiber oder Eigentümer der Anlage dem Errichter dann nachweisen muss, dass die Anerkannten Regeln der Technik nicht eingehalten worden sind.
Stand der Technik
Der Stand der Technik stellt den Wissensstand dar, der technisch ausgeführt werden kann. Jedoch sind die Lösungen nicht dauerhaft erprobt (es gibt z. B. Pilotprojekte), oder der Zugriff auf das hierfür nötige Wissen steht nur bestimmten Fachkreisen oder noch nicht allgemein zur Verfügung.
Stand der Wissenschaft und Forschung
Das Wissen über Sachverhalte und für technische Lösungen steht nur Forschern zur Verfügung. Die technischen Lösungen sind experimentell oder rechnerisch nachgewiesen, aber in der Umsetzung nicht erprobt.
Da die Begriffe „Anerkannte Regeln der Technik“, „Stand der Technik“ und „Stand der Wissenschaft“ zum Teil rechtlich festgelegt sind, ist es wichtig, sich für den jeweiligen, spezifischen Fachbereich bei Verbänden, Normenausschüssen Ministerien oder auch Universitäten zu informieren.
Gute Informationsquellen über den aktuellen Stand des Regelwerks bieten:
• Bundestechnologiezentrum für Elektro- und Informationstechnik (bfe)
• Bauministerkonferenz (http://www.is-argebau.de/?x=1400O)
• www.voltimum.de
Niederspannungsanschlussverordnung
Beruhend auf dem Energiewirtschaftsgesetz wurde 2006 die Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) als „Verordnung über allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung“ erlassen. Die NAV legt fest, dass für die elektrische Anlage ab dem Zähler der Anschlussnehmer verantwortlich ist. Die Anlage muss nach Gesetz, Verordnungen und den Anerkannten Regeln der Technik errichtet und betrieben werden. Die Installation darf durch den Versorger oder durch Installateure, die in einer Liste des Versorgers aufgenommen sind, ausgeführt werden. Alle eingesetzten Geräte müssen nach § 49 des Energiewirtschaftsgesetzes nach den Anerkannten Regeln der Technik gefertigt sein. Führen diese Geräte ein VDE-, GS-, oder CE-Zeichen wird angenommen, dass die Geräte diese Anforderungen erfüllen. Die Inbetriebnahme der elektrischen Anlage muss dem Versorger angezeigt werden, dies betrifft auch alle Geräte ab einer bestimmten Leistung oder der Möglichkeit einer Netzrückwirkung. Der Versorger kann die elektrische Anlage prüfen, und er kann Anschlussbedingungen (TAB = Technische Anschlussbedingungen) erlassen. Auf den Webseiten der Versorger können die TAB in der Regel heruntergeladen werden.
Technische Anschlussbedingungen
Die Technischen Anschlussbedingungen der Versorger regeln den Anschluss an das Nieder- oder Mittelspannungsnetz. Nachfolgend wird als Beispiel die TAB 2011 Mittelspannung und die TAB Niederspannung der Süwag Netz GmbH vorgestellt.
TAB Mittelspannung
Die TAB Mittelspannung hat zwei Bereiche, die aufgrund der sinkenden Versorgungssicherheit sowie der momentanen Diskussion über die Veränderung der Stromversorgung zukünftig im gewerblichen Bereich stark an Bedeutung gewinnen werden, weswegen neben der kundeneigenen Mittelspannungseinspeisung hier auch verstärkt die Eigenerzeugung behandelt wird.
Die TAB Mittelspannung regelt die Abnahme durch eine kundeneigene Anlage bzw. die Einspeisung durch den Kunden. Folgende Richtlinien des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) gelten hierbei übergeordnet:
• BDEW „TAB Mittelspannungsnetz“ (Mai 2008)
• BDEW „Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“ (Juni 2008)
In den Mittelspannungsbereich fallen Erzeugungsanlagen mit einer maximalen Scheinleistung je Übergabestation, die größer als 100 kVA sind.
Der Kunde ist für die Einhaltung der technischen Anschlussbedingungen, des Regelwerks und der Richtlinien verantwortlich. Für die Anmeldung, den Aufbau und den Betrieb einer kundeneigenen Anlage sind folgende Unterlagen notwendig:
• Meldung der Geräte, die eine Netzrückwirkung verursachen könnten, dies sind z. B.:
– Motoren ab S ≥ 50 kVA,
– Schweißmaschinen, Pressen, Sägen ab S ≥ 20 kVA,
– Stromrichter, Schmelzöfen ab S ≥ 60 kVA.
• Errichtungsplanung, d. h. eine Zusammenstellung aller Projektunterlagen (Pläne, Berechnungen, Ausführungsdetails, Einstellungen, Fabrikate)
• Austausch der Kontaktdaten der Ansprechpartner zwischen Netzbetreiber und Anschlussbetreiber
• Anschlussnutzungsvertrag
• Versorgungsmitteilung des Stromlieferanten an der Entnahmestelle des Netzbetreibers
Die Anbindung der kundeneigenen Anlage erfolgt in der Regel über eine einfache Stichanbindung. Dies kann z. B. aus Gründen der Versorgungssicherheit auch in anderer Form erfolgen. Die Anschlusskosten trägt der Kunde. Dies betrifft auch die Verlegung des Verbindungskabels von der Netzstation zur Mittelspannungsschaltanlage im Umspannwerk. Die Eigentumsgrenze sind die Kabelendverschlüsse der Kabel. Ferner ist vom Kunden eine Tonfrequenzrundsteuerung vorzusehen.
In den TAB werden detailliert alle Daten gegeben, die für die Auslegung der Anlagen für den Netzanschluss von Bedeutung sind. Beispiele hierzu werden im Kapitel Stromversorgung gezeigt.
Für die Einspeisung durch kundeneigene Erzeugungsanlagen sind folgende Unterlagen notwendig:
• Je nach Datum gelten unterschiedliche technische Anforderungen, die im Einzelnen geprüft werden müssen. Besonders viele Regelungen betreffen hier die Windenergieanlagen.
• Antragstellung mit Vordruck, sofern auch eine Übergabestation errichtet werden muss
• Lageplan
• Datenblatt einer Erzeugungsanlage
• Einheitenzertifikat je nach Datum
• Anlagenzertifikat bei Anlagen mit Anschlussleistung > 1 MVA und/oder einer Anschlussleitungslänge > 2 km je nach Datum und für Windenergieanlagen generell
• Inbetriebsetzungsprotokoll für die Übergabestation mit Anwesenheit des Netzbetreibers (Einladung mindestens 14 Tage vor Inbetriebsetzung)
• Inbetriebsetzungsprotokoll für die Anschlussanlage (Erzeuger) mit Anwesenheit des Netzbetreibers (Einladung mindestens 14 Tage vor Inbetriebsetzung)
• Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungseinheiten (Anwesenheit des Netzbetreibers ist nicht erforderlich)
Das Einheitenzertifikat, Sachverständigengutachten und Anlagenzertifikat sind nach FGW TR8 (Fördergesellschaft Windenergie und andere erneuerbare Energien, Technische Richtlinie für Erzeugereinheiten und -anlagen „Zertifizierung der Elektrischen Eigenschaften von Erzeugereinheiten und -anlagen am Mittel-, Hoch- und Höchstspannungsnetz“, Teil 8) anzufertigen.
Die Erzeugungsanlagen müssen sich an der statischen Spannungshaltung bzw. sogar an der dynamischen Netzstützung beteiligen.
Bei der dynamischen Netzstützung dürfen sich Erzeugungsanlagen bei einem Netzfehler nicht vom Netz trennen, um großflächige Versorgungsunterbrechungen zu vermeiden.
Ferner müssen sie Blindstrom einspeisen, um die Netzspannung zu stützen. Damit wird der Spannungseinbruch in der Tiefe reduziert. Außerdem dürfen die Erzeugungsanlagen nicht mehr induktive Blindleistung aus dem Netz entnehmen als vor dem Fehlerfall dem Netz entnommen wurde. Ferner wird zwischen einer eingeschränkten dynamischen Netzstützung (keine Netztrennung und keine zusätzliche Entnahme an induktiver Blindleistung im Netzfehlerfall) und einer vollständigen dynamischen Netzstützung bei der alle drei Kriterien eingehalten werden müssen unterschieden. Bezüglich Spannungseinbrüchen und wiederkehrenden Leistungseinspeisung sind Grenzkurven und ein Einspeisegradient definiert. Auch die Blindstromliefercharakteristik zur Spannungsstützung ist geregelt.
Wirkleistungsabgabe/Erzeugungsmanagement
Die Wirkleistungsabgabe wird vom Netzbetreiber über eine Funkrundsteuerung realisiert. An einer Klemmleiste können über potentialfreie Wechslerkontakte die Leistungsstufen 100 % (K1), 60 % (K2), 30 % (K3) und 0 % (K4) abgegriffen werden. Die Leistungsreduzierung nach Signalübertragung soll nach spätestens fünf Minuten erfolgt sein. Die Installation geschieht durch einen beim Netzbetreiber zugelassenen Installateur. Der Anlagenbetreiber gewährleistet den Empfang der Funkrundsteuersignale. Ferner hat der Anlagenbetreiber einen Lastgangzähler an die Erzeugeranlage zu installieren und stellt dem Netzbetreiber online die 1/4 h-Messwerte nach EDIFACT-Dateiformat zur Verfügung.
Blindleistung
Die Blindleistung soll so geregelt werden, dass sie sich in folgendem Bereich befindet: 0,95 (kapazitiv) < cos φ < 0,95 (induktiv).
Die Erzeugungsanlagen sollen dabei entweder der grundlegenden cos φ(P-)Kennlinie (Leistungsverschiebung eingespeiste Wirkleistung binnen zehn Sekunden) oder der Q(U-) Kennlinie (Blindleistungseinspeisung in Abhängigkeit der Netz-Sollspannung binnen einer Minute) folgen.
Weitere Informationen zum Aufbau der Schaltanlagen siehe Kapitel Stromversorgung (Mittelspannung).
TAB Niederspannung/Hausanschluss
Die Technischen Anschlussbedingungen Niederspannung werden von den Netzbetreibern unterschiedlich ausgelegt, auch wenn in der Regel die „Technischen Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Niederspannungsnetz (TAB 2007), die „Ergänzungen zu den TAB 2007“ und die VDN-(BDEW)-Richtlinien hier z. B. über die „Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ übergeordnet gültig bleiben. Es gelten die jeweils gültigen TAB zum Errichtungs- bzw. Umbauzeitpunkt. Der Anschlussnutzer stellt sicher, dass die TAB angewandt werden. Die Ausführung ist nur durch ein vom Netzbetreiber konzessioniertes Unternehmen möglich. Abweichungen von den Anschlussbedingungen sind mit dem Netzbetreiber abzustimmen. Im Folgenden wird wie bei der Mittelspannung von der TAB Niederspannung 2010, Süwag Netz GmbH, ausgegangen.
| Betriebsspannung am Netzanschlusspunkt | Un-10 % < Un (95 % in einer Woche) < Un + 10% |
| Un-15 % < U n (100 % in einer Woche) < Un + 10% | |
| siehe auch DIN EN 50160 | |
| Blindleistungskompensation | 0,9 kapazitiv < cos φ < 0,9 induktiv, Anlage wird abhängig vom cos φ gesteuert oder bei dezentraler Kompensation mit dem Verbraucher geschaltet |
| Netzsystem | bei der Süwag liegt ein TN-Netz vor |
| Inbetriebsetzung | • Mitteilung Inbetriebsetzung fünf Werktage setzung vorher durch Anschlussnutzer |
| • Vorlage Inbetriebsetzungsauftrag bei Netzbetreiber | |
| Änderungen, Erweiterungen, Außerbetribnahme | • Änderung durch Nutzer ist bei Netzbetreiber anzuzeigen |
| • Änderung durch Netzbetreiber wird Nutzer angezeigt, Nutzer hat seine Anlage auf seine triebnahme Kosten anzupassen und auf den technischen Stand zu aktualisieren | |
| Netzrückwirkungen | • der Kunde ist verpflichtet, die Anlage entsprechend zu planen und zu errichten, damit mögliche Rückwirkungen sich im zulässigen Maße bewegen (siehe VDN „Technische Regeln zur Beurteilung von Netzrückwirkungen“) |
| • in vertraglichen Regelungen mit dem Netzbetreiber sind Rückwirkungen in das Versorgungsnetz verhandel- und vertraglich regelbar | |
| • schnelle Spannungsänderungen: ΔU < 3 % U | |
| zulässige Flickerstärken: PIt,i = 0,5 und P st,i = 0,8 | |
| Oberschwingungsbegrenzung: in Abhängigkeit der Bezugsleistung mit Netzbetreiber abstimmen | |
| Spannungsunsymmetrien: maximaler Unsymmetriegrad in zehn Minuten: SkV = Kurzschlussleistung am Verknüpfungspunkt in kVA SA = Anschlussleistung der Ein- bzw. Zweiphasenlast | |
| Tonfrequenzrundsteuereinrichtungen: Der Kunde hat seine Anlage mit Filtern selbst zu schützen und darf durch eigene Frequenzen das Rundsteuersignal nicht beieinträchtigen. |
Tab. 2: Anschlussbedingungen an das Mittelspannungsnetz (Quelle: TAB Niederspannung 2010, Süwag Netz GmbH)
Für die Abrechnungsmessung sind Zähler für die Erfassung der elektrischen Wirkarbeit (Arbeitsmessung) erforderlich, und ab 100.000 kWh oder einer erzeugten Leistung von 100 kW oder mehr ist eine registrierende Leistungsmessung erforderlich. Für die registrierende Leistungsmessung sind folgende Mindestmaße erforderlich: Schrankhöhe 70 cm, Schrankbreite 50 cm und Schranktiefe 22,5 cm.
Die Messgeräte werden vom Messstellenbetreiber in einem schutzisolierten Zählerschrank vom Kunden bereitgestellt und montiert. Der Zählerschrank soll für die Montage elektronischer Zähler geeignet sein und Raum für zusätzliche Geräte und eine Wandlermessung bieten, die ab einem Betriebsstrom größer 60 A (41 kVA) notwendig wird. Wandler für die registrierte Leistungsmessung werden vom Messstellenbetreiber zur Verfügung gestellt. Wandlermessungen ab Betriebsströmen größer 250 A sind mit dem Messstellenbetreiber projektbezogen abzustimmen.
Die Messplätze müssen den Anforderungen der TAB 2007 entsprechen. Zählerfernauslesungen, wie sie für die registrierende Leistungsmessung erforderlich werden, erfordern vom Kunden die Bereitstellung einer analogen, durchwahlfähigen Telefonleitung mit einem Endgeräteanschluss (TAE-N) in unmittelbarer Nähe zur Abrechnungsmessung. Die Steuerimpulse zur Datenerfassung können dem Kunden vom Messstellenbetreiber zur Verfügung gestellt werden. Eine Vergleichsmessung durch den Kunden mit eigenen Messgeräten nach „Meetering Code 2006“ ist erlaubt. Die gemeinsame Nutzung von Wandlern ist mit dem Messstellenbetreiber abzustimmen. Elektroheizungen (Speicher- oder Direktheizungen) und Durchlauferhitzer mit einer Leistung größer 18 kW erfordern eine Lastabwurfsteuerung.
Beim Parallelbetrieb von Erzeugeranlagen sind folgende Sicherheitssysteme erforderlich:
• Entkupplungsschutz zur Trennung der Erzeugeranlage vom Netz, falls diese unzulässige Spannungen und Frequenzen erzeugt. Hierzu ist ein Kuppelschalter erforderlich, der durch Schutzrelais ausgelöst wird. Nachfolgend ist eine Tabelle der Süwag Netz GmbH aus der TAB Niederspannung 2010 dargestellt, aus der die Schutzeinstellungen hervorgehen.
Tab. 3: Sicherheitseinstellungen Niederspannungsnetz (Quelle: TAB Niederspannung 2010, Süwag Netz GmbH)
• Das Systemsicherheitsmanagement dient der Vermeidung von Gefährdungen für das Netz und erlaubt die Senkung der Einspeiseleistung. Auch bei kleineren Anlagen kann das gefordert werden. Bei Anlagen größer 100 kW sind fernsteuerbare Einrichtungen vorzusehen. Dies sind Relais, die über die Funkrundsteuerung ausgelöst werden. In der Regel findet eine Reduzierung in vier Stufen statt (0 %, 30 %, 60 %, 100 %). Für Anlagen kleiner 30 kW kann eine bidirektionale Sicherheitsschnittstelle (BISI) als Ersatz für die vom Verteilungsnetzbetreiber zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion verwendet werden.
Weitere Informationen zum Aufbau von Messkonzepten siehe Kapitel Stromversorgung (Niederspannung).
Musterbauordnung
Die Musterbauordnung wird von der Bauministerkonferenz beschlossen und dann durch die Länder in die Landesbauordnungen überführt. Für die Projektarbeit ist die Sichtung der Landesbauordnungen erforderlich. Für eine übergeordnete Sichtweise wird hier auf die Musterbauordnung eingegangen.
Die Musterbauordnung 2008 definiert fünf Gebäudeklassen und Sonderbauten. Von besonderer Bedeutung sind die Sonderbauten, da diese besondere Anforderungen an die Versorgungs- und Betriebssicherheit stellen. Nachfolgend wird eine Auswahl an Sonderbauten gelistet:
• Hochhäuser (Gebäude mit einer Höhe von mehr als 22 m)
• Verkaufsstätten (Verkaufsräume und Ladenstraßen) mit einer Grundfläche von mehr als 800 m²
• Versammlungsstätte mit Versammlungsräumen für mehr als 200 Besucher und mit gemeinsamen Rettungswegen für die Versammlungsräume
• Versammlungsstätten im Freien und Freisportanlagen für mehr als 1.000 Besucher, die ganz oder teilweise aus baulichen Anlagen bestehen
• Schank- und Speisegaststätten mit mehr als 40 Gastplätzen
• Beherbergungsstätten mit mehr als zwölf Betten
• Spielhallen mit mehr als 150 m² Grundfläche
• bauliche Anlagen, die höher als 30 m sind
• Gebäude mit mehr als 1.600 m² Grundfläche des größten Geschosses (Nichtwohngebäude)
• Räume für Büro- und Verwaltungsnutzung mit mehr als 400 m² Grundfläche
Die Höhe ist dabei definiert als Distanz zwischen der mittleren Geländeoberfläche bis zur Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum möglich ist.
Die Bauordnung stellt allgemeine Anforderungen an Anlagen, um die öffentliche Ordnung, das Leben, die Gesundheit und die natürlichen Grundlagen nicht zu gefährden. Ferner dürfen nur zugelassene Bauprodukte und Bauarten verwendet werden. Die als Technische Baubestimmungen eingeführten technischen Regeln sind zu beachten und werden durch die oberste Baubehörde öffentlich bekannt gemacht.
Brandschutz
Elektrische Betriebsräume sind meist eigene Brandabschnitte, da diese eigene Nutzungseinheiten mit erhöhter Brandgefahr darstellen und im Mittelspannungsbereich sogar Druckwellen auslösen können, die einer Explosion gleichwertig sein können. Für diese Art der Räume gilt § 29.
§ 29 fordert, dass Trennwände zwischen Nutzungseinheiten, zwischen Nutzungseinheiten und anders genutzten Räumen, die Räume mit Explosionsgefahr oder erhöhter Brandgefahr abschließen, oder zwischen Aufenthaltsräumen und anders genutzten Räumen im Kellergeschoss ausreichend lang widerstandsfähig gegen die Brandausbreitung sind. Satz 5 fordert, dass hier Öffnungen nur in erforderlicher Zahl und Größe zulässig sind und feuerhemmende, dicht und selbst schließende Abschlüsse haben müssen.
Für Öffnungen in Brandwänden nach § 30 sowie in Decken, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben ist (§ 31), gelten die gleichen Anforderungen wie für die Wände nach § 29. Leitungen, Leitungsschlitze und Schornsteine dürfen die Feuerwiderstandsfähigkeit nicht herabsetzen.
Tab. 4: Feuerwiderstandsklassen und Kurzformen nach DIN 4102, vereinfacht (Quelle: Kraner)
Rettungswege, notwendige Flure und Treppenräume
In § 35 wird eine Sicherheitsbeleuchtung für Gebäude gefordert, die höher als 13 m sind.
Elektrische Anschlüsse können für Lüftungsöffnungen in innen liegenden, notwendigen Treppenräumen erforderlich sein, die im Erdgeschoss und im obersten Geschoss vorzusehen sind. Des Weiteren kann es erforderlich sein dass die nach § 36 nicht abschließbaren, rauchdichten und selbst schließenden Abschlüsse in notwendigen Fluren zur Ausbildung von Rauchabschnitten elektrische Anschlüsse benötigen, um automatische Türschließsysteme mit Brandmeldern oder Haltemagnete (um z. B. Türen offen zu halten) ansteuern zu können. Nach § 40 dürfen Installationen in Rettungswegen, notwendigen Fluren und Treppenräumen nur durchgeführt werden, wenn die Nutzung als Rettungsweg im Brandfall ausreichend lang möglich ist und eine Brandweiterleitung ausreichend lang nicht zu befürchten ist.
Aufzüge
Aufzugsschächte müssen nach § 39 eine Öffnung zur Rauchableitung haben. Diese kann mit einem elektrischen Öffnungsmechanismus versehen sein und bedarf dann eines elektrischen Anschlusses mit entsprechendem Funktionserhalt.
Sanitäre Anlagen
Sanitäre Anlagen ohne Fenster sind nach § 40 nur zulässig mit Lüftung. Dies kann bei einer Ausführung mit einem lokalen Ventilator dazu führen, dass ein elektrischer Anschluss erforderlich ist.
Blitzschutzanlagen
Die Musterbauordnung fordert in § 46, dass Gebäude mit einer dauernd wirksamen Blitzschutzanlage zu versehen sind, wenn es bei diesem aufgrund der Lage, Bauart oder Nutzung leicht zu einem Blitzschlag kommen oder ein Blitzeinschlag schwere Folgen haben kann. Die Berechnung und Planung erfolgt nach DIN EN 62305 Teile 1 bis 4 (VDE 0185-305 1–4).
Bauleiter
Nach §§ 53 und 56 hat der Bauherr vor Baubeginn oder bei einem späteren Wechsel des Bauleiters den Namen des Bauleiters an die Bauaufsichtsbehörde mitzuteilen. Der Bauleiter
• wacht über die Durchführung der Baumaßnahme entsprechend den öffentlich-rechtlichen Anforderungen,
• erteilt nötige Weisungen,
• achtet auf den sicheren bautechnischen Betrieb der Baustellen und auf das gefahrlose Ineinandergreifen der Baustelle,
• benötigt die erforderliche Sachkunde und Erfahrung und muss ggf. Fachbauleiter hinzuziehen, die er zu koordinieren hat.
Die Verantwortung der Unternehmen bleibt hierbei unberührt (siehe § 55).
Entwurfsverfasser und Fachplaner
Der Fachplaner wird nach § 54 vom Entwurfsverfasser herangezogen, wenn die „erforderliche Sachkunde und Erfahrung“ fehlen. Der Fachplaner ist für die von ihm gefertigten Unterlagen, die er unterzeichnen muss, verantwortlich. Für die Koordination aller Fachplanungen ist der Entwurfsverfasser verantwortlich.
Unternehmer
Der Unternehmer ist nach § 55 verantwortlich für
• die öffentlich-rechtliche Übereinstimmung der Arbeiten,
• die ordnungsgemäße Einrichtung und den ordnungsgemäßen Betrieb der Baustelle,
• die Erbringung und Bereithaltung der erforderlichen Nachweise über die Verwendbarkeit der verwendeten Bauprodukte und Bauarten auf der Baustelle,
• den Nachweis der Eignung zur Erbringung einer Leistung und der dafür nötigen Vorrichtungen.
Neben der Musterbauordnung gibt es noch detaillierte Verordnungen für
• Versammlungsstätten,
• Hochhäuser,
• Verkaufsstätten und
• Garagen.
Ferner gibt es Festlegungen über Schiebetüren in Rettungswegen und elektrische Verriegelung an Türen. Für elektrische Betriebsräume wird nachfolgend die EltBauVO vorgestellt.
Verordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen
Die EltBauVO, Stand 2009, legt für Transformatoren und Schaltanlagen über 1 kV sowie für ortsfeste Stromerzeugungsanlagen und zentrale Batterieanlagen, die für vorgeschriebene sicherheitstechnische Anlagen vorgesehen sind folgendes fest:
• Die Unterbringung erfolgt im Gebäude in eigenen Räumen oder Gebäudeteilen, die durch Brandwände abgetrennt sind und maximal 4 m unter Geländeoberfläche oder maximal im Erdgeschoss, nicht aber höher untergebracht sein dürfen.
• Die Betriebsraumgröße muss einen ordnungsgemäßen Betrieb ermöglichen (Gangbreiten, Schaltungsabstände sind zu beachten).
• Mindesthöhe > 2 m
• Die Bedienungs- und Wartungsgänge müssen eine Durchgangshöhe von mindestens 1,8 m haben.
• Rettungsweglänge aus elektrischem Betriebsraum bis Ausgang < 35 m
• Türen schlagen nach außen auf. Zugangstüren sind feuerhemmend, selbst schließend und rauchdicht. Türen ins Freie sind selbst schließend und rauchdicht.
• Zugang zu notwendigen Treppenräumen können nur über einen Vorraum und nicht direkt erfolgen! Der Vorraum darf den Zugang zur Schaltanlage und Trafostation ermöglichen, aber keinen Zugang zu anderen Räumen bieten. Der Traforaum muss einen Zugang unmittelbar ins Freie oder über einen Vorraum ins Freie haben.
• Be- und Entlüftung erfolgt direkt aus dem Freien und ins Freie. Lüftungskanäle, die andere Räume kreuzen, müssen feuerbeständig sein. Kanäle nach außen benötigen ein Schutzgitter. Die Räume müssen frostfrei sein und ggf. beheizt werden.
• In den elektrischen Betriebsräumen dürfen nur die für den Betrieb der Räume nötigen Installationen (Leitungen und Einrichtungen) sein.
• Raumabschließende Wände außer Außenwände müssen mindestens feuerbeständig sein und müssen einem Druckstoß eines Kurzschlusslichtbogens standhalten. (Anmerkung: Hier kann es sinnvoll sein, eine Ausblasöffnung ins Freie vorzusehen.)
• Bodenbeläge sind nicht brennbar und antistatisch auszuführen. Bei Transformatorenstationen ist der Boden flüssigkeitsundurchlässig auszuführen. Das Fassungsvermögen des Bodens, um z. B. das Öl von drei Transformatoren in einer Station aufzufangen, kann bis zu 1.000 l betragen. Hier sind ggf. Schwellen an den Türen zu installieren.
• Türen zu Batterieräumen müssen mit dem Schild „Batterieraum“ gekennzeichnet werden.
Musterrichtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen
Die MLAR, Stand 2005, gilt für Leitungsanlagen in notwendigen Treppenräumen, Rettungswegen und Fluren sowie für Räume zwischen notwendigen Treppenräumen und Ausgängen ins Freie. Leitungsanlagen sind dabei Lichtwellenkabel und elektrische Kabel (= elektrische Leiter) inklusive Rohrleitungen, Armaturen, Hausanschlusseinrichtungen, Verteilern etc.
Im Prinzip muss die genannte Installation so ausgeführt werden, dass die Nutzung dieser Bereiche weder statisch noch funktional eingeschränkt wird. Daher wird in diesen Bereichen gefordert, dass entweder die elektrischen Anlagen unter Putz (minimale Abdeckung 15 mm) ausgeführt oder entsprechend verkleidet werden oder dass die verwendeten Materialien ein entsprechend verbessertes Brandverhalten aufweisen.
Des Weiteren wird für alle bauaufsichtlich geforderten sicherheitstechnischen Anlagen ein Funktionserhalt gefordert. Auch dieses wird durch untere Putzverlegung (minimale Abdeckung 30 mm), durch Abdeckung oder Umhausung oder durch Material mit Funktionserhaltsqualitäten erreicht.
In beiden Fällen sind entsprechende Prüfzertifikate und Nachweise nötig. Wichtig dabei ist, dass bei der Verlegung von Kabelsystemen auch die Aufhängung bzw. die Befestigung der Dauer des Funktionserhalts entspricht. Auch dies muss mit Prüfzertifikaten nachgewiesen werden.
Die MLAR fordert dabei einen Funktionserhalt von 90 Minuten für
• Wasserdruckerhöhungsanlagen zur Löschwasserversorgung,
• maschinellen Rauchabzüge in Hochhäusern oder für Sonderbauten, bei denen dies gefordert wird,
• Bettenaufzüge in Krankenhäusern und
• Feuerwehraufzüge.
Ein Funktionserhalt von 30 Minuten wird gefordert für
• Installationen in notwendigen Fluren, Treppenräumen,
• Sicherheitsbeleuchtungsanlagen,
• Personenaufzüge mit Brandfallsteuerung,
• Brandmeldeanlagen,
• Alarmierungsanlagen und
• natürliche Rauchabzugsanlagen.
Der Funktionserhalt dieser bauaufsichtlich geforderten sicherheitstechnischen Anlagen fordert die Funktion der Anlage als Ganzes für den gegebenen bzw. geforderten Zeitraum. In diesem Zusammenhang wird auch gefordert, dass Verteiler für diese sicherheitstechnischen Anlagen entsprechend geschützt und nur für diese verwendet werden. Betrieblich erforderliche Sicherheitssysteme können in den Verteilern mit aufgelegt werden, wenn diese die bauaufsichtlichen Sicherheitssysteme nicht einschränken, d. h. , wenn der Funktionserhalt gewährleistet ist. Als Folge hiervon sind Verteiler für Sicherheitsbeleuchtungen in eigenen Räumen mit entsprechenden Wänden und Türen vorzusehen, oder der Verteiler muss in entsprechender Brandklassifikation errichtet werden.
Elektrische Leitungen mit verbessertem Brandverhalten erfüllen die Anforderungen der Baustoffklasse B1 (schwer entflammbare Baustoffe).
In nachfolgender Tabelle 1 wurde versucht, als Anmerkung die verschiedenen Kabeltypen in die Brandklassifikation einzuordnen. Diese Einordnung entspricht nicht der DIN 4104 und auch nicht der DIN EN 13501-1. Es wird empfohlen, die entsprechenden Einordnungen von den zu verwendenden Kabelherstellern zu erfragen bzw. entsprechende Nachweise vorlegen zu lassen.
Abschließend sei auf die Richtlinien des Verbands der Sachversicherer (VDS) verwiesen, die aus Versicherungsgründen Empfehlungen aussprechen. So gibt z. B. die VDS 2025:2008-01 weitere Hinweise zu Leitungsanlagen. Sie wurde an die Anforderungen der MLAR angepasst. VDS 2097-6 („Baulicher Brandschutz, Produkte und Anlagen, Teil 6: Kabel und Rohrabschottungen“) stellt die allgemein zugelassenen Kabel- und Rohrabschottungen zusammen.
Tab. 5: Baustoffklassen nach DIN 4102 und DIN EN 13501-1
Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln
Das EMVG (2008, geändert 2009) setzt die Anforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG um. Im Folgenden wird das Gesetz als nationale Umsetzung vorgestellt, insoweit es für die Baustelle von Bedeutung ist.
Das Gesetz behandelt die EMV für elektrische Betriebsmittel, d. h., für elektrische Geräte und ortsfeste Anlagen. Das generelle Ziel ist es, dass die Geräte und Anlagen nicht andere Geräte und Anlagen stören und die elektromagnetischen Felder aus der Umgebung die Funktion der Geräte und Anlagen nicht beeinträchtigen.
In der Bauleitung ist daher zu beachten, dass die eingesetzten Geräte den Anforderungen des EMVG entsprechen, d. h., dass die Geräte entsprechend geprüft und zugelassen sind. Für „ortsfeste Anlagen“ (§ 12) ist Folgendes zu beachten:
• Die Ausführung hat gemäß den Anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen.
• Die Anlagen dürfen den Betrieb von Funk- und Telekommunikationsgeräten nicht stören.
• Die Anlagen dürfen selbst nicht durch elektromagnetische Felder gestört werden.
• „Die zur Gewährleistung der grundlegenden Anforderungen angewandten allgemeinen Anerkannten Regeln der Technik sind zu dokumentieren“ (§ 4). Dies hat zur Folge, dass diese Unterlagen mit Bestandteil der Revisionsunterlagen sein müssen. Vom Bauleiter sollte geprüft werden, dass diese Unterlagen auch tatsächlich vorhanden sind. Ferner sollte der Bauleiter eine Konformitätserklärung des Anlagenerrichters einholen.
• Der Betreiber ist für die Konformität der Anlagen verantwortlich und muss in der Lage sein, der Bundesnetzagentur, solange die ortsfeste Anlage in Betrieb ist, die aktuelle, dem Ausführungsstand und Betriebszustand entsprechende Dokumentation vorzulegen. Dies hat zur Folge, dass dieser Teil der Revisionsdokumentation vom Betreiber stets aktuell zu halten ist. Faktisch betrifft das den größten Teil der Revisionsunterlagen für die Elektrotechnik, da in den heutigen Geräten, die eingesetzt werden, zumeist ein elektronisches Schaltgerät verbaut wird. Daher sollte in der Revisionsdokumentation der Betreiber auf die Pflicht der Pflege der Unterlagen hingewiesen werden.
• Wer eine ortsfeste Anlage vorsätzlich oder fahrlässig nicht richtig betreibt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro belegt werden kann. Die Bundesnetzagentur ist ferner berechtigt, Korrekturen anzufordern oder sogar die störenden Anlagen abzuschalten.
Auch der VDS gibt bezüglich einer EMV-konformen Errichtung von elektrischen Anlagen weitere Empfehlungen in der Richtlinie VDS 2349 „Störungsarme Elektroinstallation zur Berücksichtigung der EMV“.
Elektroinstallation gemäß DIN 18012 bis 18015
Die DIN-Normen 18012 bis 18015 werden als Planungsnormen bezeichnet, auf die in anderen Normen hingewiesen wird und dadurch als Empfehlung für den elektrotechnischen Bereich im Wohnungsbau von Bedeutung sind.
| DIN-Normen | |
| DIN 18012 | Hausanschlusseinrichtungen in Gebäuden – Raum und Flächenbedarf |
| DIN 18013 | Nischen für Zählerplätze |
| DIN 18014 | Fundamenterder |
| DIN 18015-1 | Planungsgrundlagen von elektrischen Anlagen in Wohngebäuden |
| DIN 18015-2 | Art und Umfang der Mindestausstattung von elektrischen Anlagen in Wohngebäuden |
| DIN 18015-3 | Leitungsführung und Anordnung der Betriebsmittel elektrischer Anlagen in Wohngebäuden |
Tab. 6: Planungsnormen für Wohngebäude (Quelle: Kraner)
In DIN 18012 werden Mindestanforderungen für folgende Hausanschlusseinrichtungen empfohlen:
• Wasserversorgung
• Entwässerung
• Fernwärme
• Gasversorgung
• Stromversorgung
• Telekommunikation
Raumanforderungen Hausanschluss
Die Anschlüsse lassen sich in einem Raum unterbringen, allerdings benötigt der Hausanschluss mit NH-Schmelzsicherungen ausreichend Bedienfreiheit. Dafür werden 1,2 m als ausreichend angesehen. Aufgrund des Alterungsverhaltens vieler elektrischer Bauelemente soll der Anschlussort belüftet sein und eine Temperatur unter 30 °C haben.
Die Anschlussnische sollte ca. 80 cm breit, 25 cm tief und 2 m hoch sein.
Neben Gas- und Wasseranschluss können die Fundamenterderfahne, die Kabeleinführung in einem Schutzrohr (maximal 3 m von der erschließenden Außenwand entfernt), der Hausanschlusskasten nach DIN 43627 und ein zweifeldriger Zählerschrank nach DIN 43870 untergebracht werden.
In einem Mehrfamilienhaus mit bis zu vier Parteien können die Versorgungseinrichtungen an einer Hausanschlusswand untergebracht werden. Die Wand muss unmittelbar an die einführende Außenwand grenzen. Die Medien sollen nach einem Einführungsbereich von 50 cm von der Außenwand kreuzungsfrei verlegt werden. Die Hausanschlusswand sollte 2 m hoch sein. Der Zugang unter Installationen etc. soll höher als 1,8 m sein. Auch hier ist ein Arbeitsraum von 1,2 m Tiefe vorzusehen.
Bei größeren Wohngebäuden (mehr als vier Parteien) ist ein Hausanschlussraum vorzusehen. Die Mindestmaße sind 2 x 2 x 1,8 m (L x B x H). Falls nur eine der gegenüberliegenden Wandseiten für Installationen verwendet wird, kann die Breite auf 1,5 m reduziert werden. Die minimale Durchgangshöhe ist auch hier 1,8 m. Der Raum
• benötigt eine Be- und Entlüftung,
• muss an die versorgende Außenwand anschließen,
• darf nicht über 30 °C warm werden und
• muss über allgemein zugängliche Räume erreichbar sein.
Die Tür muss zur Aufnahme der Installationsgeräte ausreichend breit sein und wird außen als Hausanschlussraum gekennzeichnet.
In allen Fällen sind Mehrspartenhauseinführungen nach DIN 18012 zugelassen.
Trotz der DIN 18012 sind die Hauseinführungen mit den Versorgungsunternehmen bezüglich Größe und Einrichtung abzustimmen. Anforderungen durch das EEWärmeG, die ENEV sowie der Wunsch nach Einsatz regenerativer Energien erfordern häufig größere Maße. Es ist zu beachten, dass sich die Anforderungen aufgrund der aktuellen Entwicklung bezüglich des beschleunigten Atomausstiegs in den kommenden Jahren sehr stark ändern werden. Dies ist bei der Darstellung der Hausanschlussvarianten bereits erkennbar.
Hausanschluss, Hauptleitung und Netzform
Bei der Planung der Starkstromanlagen sind die technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers zu beachten. Die Betriebsmittel des Hauptversorgungssystems sind in allgemein zugänglichen Räumen oder Bereichen unterzubringen. Dies kann der Hausanschlussraum, die Hausanschlusswand oder auch die Anschlussnische sein. Die erforderlichen Maße ergeben sich dabei aus den Anforderungen des lokalen Netzbetreibers und des Gebrauchsnutzens.
Die Hauptleitung ist mit einem Mindestquerschnitt von 16 mm² als Drehstromleitung auszuführen. Die Mindeststrombelastbarkeit beträgt 63 A. Nach dem Übergabepunkt kann meist zwischen einem TN-C- und einem TN-S-Netz gewählt werden. Aufgrund der zunehmenden Dichte an elektronischen Geräten in privaten Haushalten und auch der zunehmenden Rückeinspeisung in das öffentliche Netz durch Eigenstromerzeugungsanlagen ist im Allgemeinen ein TN-S-Netz zu empfehlen.
Bei der Versorgung mehrerer Wohnungen können zur Kabeldimensionierung Gleichzeitigkeitsfaktoren angenommen werden, die abhängig von der Ausstattung aus Praxismessungen ermittelt wurden.
Nachfolgende Tabelle zeigt eine überschlägige Abschätzung der Wohnungsanzahl in einem Gebäude mit den dafür anzunehmenden Hausanschlusssicherungsgrößen und Kupferhauptkabelquerschnitten. Bei den zugrunde gelegten Annahmen ist zu berücksichtigen, dass durch die derzeitigen Veränderungen im Energiemarkt seitens des Gesetzgebers, z. B. durch das EEG und die zugehörigen Verordnungen, auf einen niedrigeren Energieverbrauch und insbesondere auf einen niedrigeren Stromverbrauch hingearbeitet wird. Die derzeit schrittweise Einführung des Smart Metering als Bestandteil des Smart-Grid-Konzepts wird zu einem veränderten Verbraucherverhalten führen. Insgesamt wird angestrebt, dass die Gleichzeitigkeit des Leistungsbedarfs gesenkt wird. Zusammen mit der Einschränkung der Elektroheizung und dem Zwang zur Verwendung von regenerativen Energien für die Warmwasserversorgung wird damit der Leistungsbedarf in den Wohnungen sinken. Dem wirkt die zunehmende Verbreitung der Informationstechnik in den Wohnungen entgegen. Insgesamt ist damit qualitativ mit einer Leistungsbedarfssenkung in den Wohnungen bei gleichzeitig höherem Energiebezug zu rechnen. Die direkte Beeinflussung des Verbrauchs durch zeitabhängige Stromkosten (Verbrauch und Leistung) wird das Verbraucherverhalten ebenfalls verändern.
Tab. 7: Dimensionierung Hauptkabel und Sicherung abhängig von der Anzahl der Wohnungen (Quelle: Kraner)
Bei der Auslegung sind der maximale Spannungsfall zwischen Zähler und Verbraucher sowie die o. g. langfristigen Entwicklungen zu beachten.
Der zulässige Spannungsfall in Hauptstromversorgungssystemen beträgt in Abhängigkeit des Scheinleistungsbedarfs (S):
| Scheinleistungsbedarf | Zulässiger Spannungsabfall in Hauptstromsystemen |
| S < 100 kVA | Δu = 0,5 % |
| 100 kVA < S < 250 kVA | Δu = 1,0 % |
| 250 < S < 400 kVA | Δu = 1,25 % |
| S > 400 kVA | Δu = 1,5 % |
Tab. 8: Spannungsfall Hauptstromversorgung (Quelle: TAB 2007 Bundesmusterwortlaut des BDEW, Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft)
Elektrische Anlagen in Wohnungen
Nahe dem Lastschwerpunkt der Wohnung wird ein Stromkreisverteilerschrank nach DIN 43871 und DIN VDE 0603-1 geplant, der abhängig von der Größe und Ausstattung der Wohnung mindestens zweireihig sein sollte. Der Verteilerschrank kann unter Putz oder auf Putz montiert werden. Bei Unterputzmontage erfolgt die Kabeleinführung unter Putz. Für Nachverkabelungen ist es sinnvoll, Leerrohre vorzusehen. Die Aussparung muss statisch überprüft werden und den Brandschutzanforderungen entsprechen. Der Verteilerschrank wird mit Leitungsschutzschaltern für die Stromkreise ausgestattet. Stromkreise mit Steckdosen und in Bädern erhalten einen FI-Schalter (Fehlerstromschutzschalter-RCD). Die Verkabelung erfolgt in der Regel unter Putz mit Kupferkabel mit einem Querschnitt von 1,5 mm². Im Gewerbebau werden in der Regel nur noch selten Querschnitte von 1,5 mm² verwendet. Dort sollte generell, außer für Leuchtenstromkreise, mit einem Mindestquerschnitt von 2,5 mm² gearbeitet werden. Für Herd und Herdplatten beträgt der Querschnitt je nach Anschlusswert und Entfernung 2,5 bzw. 4 mm². Elektrische Küchengeräte wie Herd, Kochplatte, Geschirrspülmaschine etc. erhalten separate Stromkreise. Die anderen Geräte können über mehrere Stromkreise abhängig von der Leistungsaufnahme zusammengefasst werden. Der Anschluss von Nachtstromspeicheröfen und Durchlauferhitzern erfordert spezielle Schaltungen.
Anordnung von Leitungszonen
Die Verkabelung erfolgt in den Wänden:
• waagrecht 30 cm über dem Fußboden bzw. unter der der Fertigdecke
• vertikal 15 cm von den Rohbauöffnungen der Türen, Fenster und Raumecken
• in der Küche sowie in Hobby- und Arbeitsräumen gibt es eine zusätzliche waagrechte Installationszone, 115 cm über dem fertigen Fußboden. Dieser Bereich wird als Vorzugshöhe bezeichnet.
Räume mit Badewanne oder Dusche – Schutzbereiche
In Räumen mit Badewanne, Dusche oder Waschbecken werden drei Schutzzonen definiert, mit der Angabe was und mit welcher Spannung dort installiert werden darf. Die elektrischen Geräte in diesen Räumen werden über einen Fehlerstromschutzschalter mit einem Auslösedifferenzstrom von größer 30 mA betrieben.
Tab. 9: Schutzzonen in Bädern
Planung von Telekommunikationsanlagen
Für die Erschließung der Wohnungen sollen Leerrohre aus dem Hausanschlussbereich geführt werden. An einem Wohnungsübergabepunkt ist Platz für die heute übliche Ausrüstung eines Netzabschlusses, Splitters und Routers vorzusehen. Von dort sollen über Leerrohre weitere Anschlussstellen versorgt werden.
Die Telekommunikationstechnik verändert sich sehr stark durch die Konvergenz mit dem Datennetz. Heutige Systeme können daher kostensparend und zukunftssicher mit Standarddatenkabeln der neuesten Generation in Unterputzmontage ohne Leerrohre aufgebaut werden. Leerrohrsysteme haben den Vorteil, dass diese Flexibilität bieten, jedoch ist der Preis dafür hoch. Es sind zusätzliche Brandschotte nötig, die bei jeder Änderung wiederhergestellt werden müssen. Zu guter Letzt leidet der Schallschutz oft unter der implizit eingebauter Rohrtelefonie.
Planung sonstiger Fernmelde-, Informationsverarbeitungs- und Hauskommunikationsanlagen
Zu diesen Anlagen gehören
• Gefahrenmeldeanlagen,
• Brandmeldeanlagen,
• Einbruch- und Überfallmeldeanlagen,
• Videoüberwachungsanlagen.
Ferner gehören Anlagen und Systeme dazu, wie z. B.:
• Klingelanlage,
• Gegensprechanlage.
Gefahrenmeldeanlagen werden in der Regel aus versicherungstechnischen Gründen gefordert. Diese Anlagen müssen dann nach den Richtlinien des Verbands der Sachversicherer (VDS) aufgebaut werden. Der Aufbau kann nur von durch den VDS zugelassenen Fachfirmen erfolgen. Eine Besonderheit ist die Verpflichtung, in Wohngebäuden Brandmelder zu installieren, die eine akustische Brandalarmierung auslösen. Ansonsten sind Aufbau und Betrieb der Gefahrenmeldeanlagen ähnlich:
• Die Anlagen bestehen aus einer Zentrale, einem Datenbus, verschiedenen Meldern und Signalisierungselementen. Das Bussystem ist entweder stern- oder ringförmig aufgebaut.
• Der Aufbau erfolgt nach einer n+1-Ausfallsicherheit, d. h., die Anlage bleibt bei einem Fehler voll funktionsfähig, und erst der zweite Ausfall führt zu Störungen des Anlagenbetriebs.
• Stromkreis- und Leitungsüberwachung
• Die Anlagen haben eine unabhängige zweite Stromversorgung, zumeist eine Batterie, die den Betrieb der Anlagen bei Stromausfall aufrechterhält.
• Die Alarme werden an eine ständig besetzte Stelle übertragen, die dann geeignete Maßnahmen ergreift.
Die Klingel- und Gegensprechanlage werden heute häufig zu einer Hauskommunikationsanlage zusammengefasst. Diese besteht aus einer Türstation an der Haupteingangstür, die eine Sprechstelle mit beleuchtetem und beschriftbarem Namensschild sowie die Klingeltastenfunktion bietet. An der Wohnungseingangstür befindet sich dann zumeist nur noch ein Klingeltaster. In der Wohnung befindet sich die Gegensprechstelle, mit der Besucher an der Türstation empfangen werden können und mit der Türöffner ausgelöst werden kann. Aktuelle Systeme bieten eine Kamera an der Haupttürsprechstelle und einen kleinen Monitor in der Gegensprechstelle.
Planung von Empfangs- und Verteilanlagen für Ton- und Fernsehrundfunk sowie für interaktive Dienste
Die Anlagen werden nach DIN VDE 0855 aufgebaut. Wie viele Schwachstrombereiche werden die Ton- und Fernsehtechniken in der Gebäudetechnik von der Informationstechnik vereinnahmt. Dies bedeutet, dass zunächst die Verkabelung konvergiert und dann auch die eingesetzten Techniken zunehmend von der Computertechnik bestimmt werden. Die Normung geht derzeit von zwei Fällen aus:
• Antennenanlage
• Breitbandverkabelung
Die Konvergenz zur Datenverkabelung und zur Computertechnik wird hier noch nicht berücksichtigt.
Die Antennenanlage besteht entweder aus einer terrestrischen Antenne für den Empfang des DVB-T-Signals oder aus einer Satellitenantenne für den Empfang des DVB-S-Signals.
Je nach Größe des zu versorgenden Wohngebäudes wird das System unterschiedlich aufgebaut. Das gemeinsame Element des Systems ist das für die Datenübertragung nötige Koaxialkabel, das sternförmig von einem Verteilpunkt im Dachbereich in die Wohnungen geführt wird. In der Vergangenheit wurden häufig die Wohn- und Schlafzimmer aller Wohnungen in einem Gebäude versorgt und mit einer Leerdose versehen. Hierbei wird empfohlen, das Kabel in Leerrohren zu führen, um es später austauschen zu können. Da die Entwicklung in diesem Bereich weitergegangen ist, gibt es nun Gebäudeinvestoren, die entweder ein Koaxialkabelnetz ohne Leerrohre oder nur Leerrohre verlegen.
Die Verkabelung des Breitbandfernsehens ist topologisch identisch zur Antennenverkabelung mit dem Unterschied, dass der Verteilpunkt sich meist im Hausanschlussbereich befindet, d. h. im Keller und nicht im Dachbereich.
Zukünftig wird es diese Verkabelung gar nicht mehr geben, stattdessen wird diese über das Datennetz abgebildet. In neuen Gebäuden wird dies zunehmend umgesetzt.
Planung des Fundamenterders in Verbindung mit dem Potentialausgleich
Nach DIN 18014 ist ein Fundamenterder vorzusehen, der in die Potentialausgleichschiene einzubinden ist (DIN VDE 0100-410, DIN VDE 0100-540) . Bei der Ausbildung einer weißen oder schwarzen Wanne oder der Isolierung der Grundplatte ist ein Erdkontakt nicht mehr gewährleistet. In diesen Fällen kann der Fundamenterder nicht mehr zur Potentialsteuerung und als Ableiter für den Blitzschutz verwendet werden. Stattdessen muss für den Blitzschutz zur Gewährleistung des erforderlichen Erdübergangswiderstands ein Edelstahlringleiter um das Gebäude vorgesehen werden, der regelmäßig mit dem Fundamenterder zur Potentialsteuerung zu verbinden ist. Die maximale Feldlänge ist dabei 20 x 20 m. Je nach Schutzanforderung kann es erforderlich sein, die Feldgröße zu verringern.
Planung der Blitzschutzanlage
Für Wohngebäude wird in der Regel keine Blitzschutzanlage gefordert. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass eine Blitzschutzanlage zum Schutz der Gebäude und der Elektronik sinnvoll ist.
Selbst bei der Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach eines Wohngebäudes wird derzeit kein Blitzschutz gefordert. Durch die ersten Schadensfälle an Photovoltaikanlagen durch Überspannungen und den damit folgenden Anforderungen bei den Sachversicherern kann davon ausgegangen werden, dass eine Blitzschutzanlage in Zukunft verbindlich werden wird. Unabhängig davon ist die Installation eines Blitzschutzes auch aufgrund der zunehmenden Installationen von elektronischen Geräten zu empfehlen.
Planung des Überspannungsschutzes
Der Überspannungsschutz wird häufig als „innerer Blitzschutz“ bezeichnet. Das Ziel ist es, Überspannungen im Gebäude gezielt abzubauen und damit entsprechend geschützte Bereiche bzw. Zonen aufzubauen. Bei der Planung ist ein Zonenkonzept zu entwickeln, indem Bereiche bestimmt werden, die einen bestimmten Schutz benötigen. Die Schutzelemente sowie die Schirmungsmaßnahmen werden anhand des Schutzzonenkonzepts ausgelegt.
Im Wohnungsbaubereich vereinfacht sich in der Regel ein solches Zonenkonzept zu einer äußeren und inneren Zone. Die innere Zone wird durch die Fangeinrichtungen von unmittelbaren Einschlägen und nach der Hauseinspeisung sowie zwischen den anderen eingeführten Medienleitungen durch Überspannungsschutzeinrichtungen der Klasse B (Blitzstromableiter) geschützt. In den Verteilungen werden dann Überspannungsschutzeinrichtungen der Klasse C eingebaut, um das Stromnetz vor Überspannungen zu schützen. Die Geräte werden durch Überspannungsschutzeinrichtungen der Klasse D geschützt.
Die Planung ist nach DIN VDE 0100-534, 0185-3, auszuführen. Die Planung eines wirkungsvollen Blitz- und Überspannungsschutzes sollte gewissenhaft ausgeführt werden und umfasst weitere Maßnahmen, als zuvor dargestellt wurden.
Insbesondere ist es wichtig, dass sich der Wohnungsbau bezüglich der immer häufiger verwendeten elektronischen Geräte und installierten Datennetze immer weniger vom Gewerbebau unterscheidet, bei dem eine dedizierte Planung des Blitzschutzes und der Potentialsteuerung seit Jahren Standard ist.