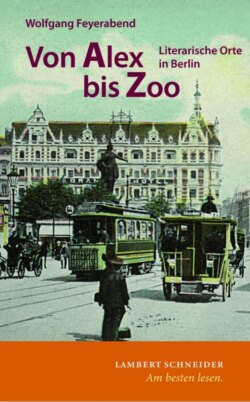Читать книгу Von Alex bis Zoo - Wolfgang Feyerabend - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
„Bald war ich zu Hause in Berlin“ –
Eine literarische Topographie
ОглавлениеKaum ein anderer Ort in Deutschland ist so oft zum Gegenstand literarischer Darstellung erhoben worden wie Berlin. Waren es im 18. Jahrhundert zumeist Briefe, Tagebücher und publizistische Arbeiten, die von dem erwachenden Interesse zeugen, wurde die preußische Hauptstadt in der Epoche der Romantik allmählich auch zum Schauplatz des Erzählens, so etwa in E. T. A. Hoffmanns Geschichten „Das öde Haus“ oder „Des Vetters Eckfenster“. Der erste Berlin-Roman von Belang entstand demgegenüber erst spät, Mitte der 1850er Jahre. Es war „Die Chronik der Sperlingsgasse“, mit der der 26-jährige Wilhelm Raabe sein Debüt gab und zum Shootingstar avancierte. Die Resonanz des Buches beschränkte sich freilich auf den deutschsprachigen Raum.
Der Aufstieg zur Reichshauptstadt rückte Berlin nicht nur politisch und wirtschaftlich, sondern, durch das Schaffen Theodor Fontanes, auch literarisch ins Zentrum Europas. Fast scheint es, als habe jedoch der übergroße Schatten, den sein Werk warf, die nachfolgende Autorengeneration zögern lassen, sich der Kapitale aufs Neue als Erzählhintergrund zu versichern. Heinrich Manns 1900 veröffentlichter Roman „Im Schlaraffenland“ oder Georg Hermanns 1906 erschienener Roman „Jettchen Gebert“ steht als Ausnahme von der Regel. Längst auch waren die Hoffnungen auf gesellschaftliche Veränderungen verflogen. Heinrich Mann blieb wenig mehr, als den Hauptstadtparvenüs den Zerrspiegel der Satire vorzuhalten, und Georg Hermann entführte seine Leser bezeichnenderweise aus dem wilhelminischen Berlin in das des Biedermeier.
Der enorme Fortschritt in Wissenschaft und Technik, die inzwischen alle Bereiche erfassende Industrialisierung oder der rasante Umbau der Stadt zu einem hochmodernen Gemeinwesen fand, gleichermaßen als Chance und Bedrohung ausgemacht, vor allem in den Gedichten der Jugend Widerhall. Ein Lebensgefühl, das der russische Dichter Boris Pasternak, der 1906 als 17-Jähriger gemeinsam mit den Eltern auf seiner ersten Auslandsreise nach Berlin gekommen war, noch einmal im Abstand eines halben Jahrhunderts beschwor:
Alles war ungewöhnlich, alles ging anders vor sich. Als lebtest du nicht, sondern wärst in einem Traum, nähmst an einer erdachten, für niemanden verbindlichen Theatervorstellung teil. Niemanden kennst du, niemand hat dir zu befehlen. Eine lange Reihe aufschlagender und zuschlagender Türen die ganze Wand der Waggons entlang, zu jedem Abteil eine eigene. Vier Schienenwege über eine Ring-Estakade, die über den Straßen ragt, den Kanälen, den Rennställen und Hinterhöfen der Riesenstadt. Sich nachjagende, einholende, nebeneinanderlaufende und sich trennende Züge. Die sich verdoppelnden, kreuzenden, schneidenden Lichter der Straßen unter den Brücken, die Lichter der ersten und zweiten Etagen in der Höhe der Hocheisenbahnen, die mit bunten Lämpchen illuminierten Automaten der Bahnhofsbüfetts, die Zigarren, Süßigkeiten, Zuckermandeln auswarfen. Bald war ich zu Hause in Berlin, trieb mich in seinen zahllosen Straßen und grenzenlosen Parks herum, sprach deutsch, das Berliner Idiom nachahmend, atmete das Gemisch von Lokomotivendampf, Leuchtgas und Bierschaum, hörte Wagner.
Die Abdankung des Kaisers 1918, die Errichtung einer parlamentarischen Demokratie und der damit verbundene Wegfall der Zensur verhalfen in den 1920er Jahren der Presselandschaft zu ungeahnter Blüte. Feuilletons und Reportagen spürten den Stimmungen der jungen Republik nach. Namen wie Joseph Roth oder Egon Erwin Kisch prägten sich ein. Mit Franz Hessel wurde der literarische Flaneur zum Begriff. Doch der moderne Großstadtroman ließ auf sich warten. Noch mussten der Alptraum des Ersten Weltkriegs und eine gescheiterte Revolution bewältigt werden.
Mit Alfred Döblins „Berlin Alexanderplatz“ war es dann soweit. Das Buch erschien 1929 und wurde nicht nur ein Welterfolg, sondern gilt bis heute als der Berlin-Roman schlechthin. 1931 folgten „Käsebier erobert den Kurfürstendamm“ von Gabriele Tergit und „Fabian“ von Erich Kästner. Das Jahr 1932 brachte gleich drei signifikante und ebenfalls wieder in der Hauptstadt spielende Werke hervor: „Das kunstseidene Mädchen“ von Irmgard Keun, „Kleiner Mann – was nun?“ von Hans Fallada und „Herrn Brechers Fiasko“ von Martin Kessel.
Dieser zum Jahresende auf den Markt gebrachte Roman geriet indes, noch bevor er überhaupt Wirkung zeitigen konnte, schon in die Mühlen der nationalsozialistischen Kulturpolitik. Die braunen Machthaber ließen alles, was ihnen als „Asphaltliteratur“ galt, lauthals verbieten oder stillschweigend in der Versenkung verschwinden. Die maßgeblichen Bücher, auch jene die Berlin zum Hintergrund haben, entstanden fortan im Exil, darunter Döblins „Pardon wird nicht gegeben“ oder Klaus Manns „Mephisto“.
Zu den wenigen Romanen von Rang, die unter dem NS-Regime das Licht der Öffentlichkeit erblickten, zählt Jochen Kleppers „Der Vater“. Ein auf den ersten Blick unverfängliches Buch, das in die Epoche Friedrich Wilhelms I., des „Soldatenkönigs“ führt, aber eben das Bild eines sich immer wieder vor Gott verantwortenden und religiös toleranten Herrschers zeichnet. Der überraschende Erfolg, sogar beim deutschnationalen Publikum, ließ an höchster Stelle die Alarmglocken schrillen. Der Autor, der außerdem mit einer Jüdin verheiratet war, wurde aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen, womit ihm jede Möglichkeit genommen war, sich weiterhin literarisch zu betätigen.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Nazi-Diktatur lag Berlin wie die meisten deutschen Großstädte in Trümmern, sah sich aber darüber hinaus in drei Westsektoren und einen Ostsektor geteilt. Nicht aus der Rumpfstadt, sondern aus Hamburg, Köln und München, kamen denn auch jene Erzählwerke, die dem Deutschland der unmittelbaren Nachkriegszeit eine literarische Stimme gaben und sich mit Namen wie Wolfgang Borchert, Heinrich Böll oder Wolfgang Koeppen verbinden.
Der Mauerbau von 1961, später die Studentenrevolte lenkten die Aufmerksamkeit wieder auf Berlin. Die Erzählungen „Der geteilte Himmel“ von Christa Wolf und „Zwei Ansichten“ von Uwe Johnson erschienen. 1969 kam der Roman „Örtlich betäubt heraus“, in dem sich Günter Grass nach der „Danziger Trilogie“ erstmals in seiner Epik einem aktuellen Thema und Westberlin als vorrangigem Schauplatz zuwandte. Bereits ein Jahr zuvor hatte Günter de Bruyn den in Ostberlin spielenden Roman „Buridans Esel“ veröffentlicht. Ab den 1970er Jahren nahm die Zahl der Erzählwerke stetig zu, die das Leben in der einen oder anderen Stadthälfte oder die Teilung selbst reflektierten.
Mauerfall und Wiedervereinigung sowie der schwierige Prozess des Zusammenwachsens, der hier, anders als in der ost- und westdeutschen Provinz, hautnah zu erleben war und noch zu erleben ist, gestalteten sich auch für die Literatur zur Herausforderung. Antworten ließen nicht lange auf sich warten. Von Julia Franck über Reinhard Jirgl bis hin zu Ulrich Peltzer liegen inzwischen viel beachtete Romane vor.
Der vorliegende Band versteht sich als Wegweiser durch die literarische Topographie der Stadt. In alphabetischer Reihenfolge werden Straßen, Plätze, Viertel und Baulichkeiten vorgestellt, die seit dem 18. Jahrhundert bis heute Eingang in Romane und Erzählungen, Essays und Feuilletons, Reiseberichte und -briefe, Tagebücher und Lebenserinnerungen gefunden haben. Autorinnen und Autoren des In- und Auslandes, namhafte wie vergessene, kommen in ausgewählten Texten zu Wort. Nicht alle bewahrten sich ein so freundliches Andenken wie Boris Pasternak. Einige schieden enttäuscht, verbittert, im Zorn. Zeit und Umstände gestatteten nichts anderes. Kalt gelassen indes hat Berlin nur wenige.