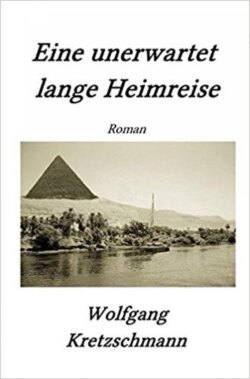Читать книгу Eine unerwartet lange Heimreise - Wolfgang Kretzschmann - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 1.
Das durchdringende Piepen des Weckers weckte mich. Verschlafen öffnete ich die Augen und sah auf die grün leuchtenden Ziffern des Weckers. 6.18 Uhr prangte mir entgegen. Was für eine komische Zeit, um geweckt zu werden, dachte ich so bei mir. Nicht 6.15 Uhr oder 6.20 Uhr, nein, da stand 6.18 Uhr. Im Urlaub um diese Zeit aufgeweckt zu werden, hatte sicher eine Bedeutung. Ach ja, es war der letzte Tag meines zehntägigen Urlaubs in Ägypten. Badeurlaub in Hurghada am Roten Meer. Heute war leider Abreisetag.
Ich stand langsam auf und ging nur mit einer kurzen Pyjamahose in modischem Streifenmuster in das Badezimmer. Dort entledigte ich mich des Sakkara-Biers vom Vorabend in die WC - Schüssel und schaute in den Spiegel.
Ein 36-jähriger Mann mit leicht gebräuntem Body, wo der erste Ansatz eines kleinen Wohlstandsbauches vorhanden war und die ersten grauen Haare am Kopf durchkamen, schaute mich aus grau-grünen Augen an. Ein Gesicht, nicht gerade Robert Redford, aber tageslichttauglich, wie die Mädels es nannten.
„Rolf, altes Haus“, sagte ich, „schlecht schaust du aus.“
Rolf Rüdiger Klinger, ja das bin ich. Findelkind, aufgewachsen in einer Pflegefamilie. Bereits verwitwet durch einen tragischen Verkehrsunfall, keine lebenden Kinder. Wohnhaft in einer kleinen Stadt in Schleswig-Holstein, vor den Toren der Stadt Hamburg. Eine kleine Eigentumswohnung von satten 100 qm Größe konnte ich inzwischen mein Eigentum nennen. Ein schicker Audi A3 Sport in Schneeweiß gehörte mir ebenso wie eine große Sammlung von DVD und Blu-Rays. Eingerichtet war meine Wohnung normal, ich möchte fast sagen spießig, wie sicher einige Bekannte behaupten würden. Die übliche 3-2-1 Sitzgelegenheit in Freundlichem dunkelgrün in Leder und eine Schrankwand in Buche furniert. Schlafzimmer Ikea Style, ebenfalls in Buche furniert. Außergewöhnliches, Fehlanzeige, wenn man von dem Beamer im Wohnzimmer an der Decke und der Dolby - Surround Anlage mit der 3 Meter Leinwand einmal absah. Es war eben mein Hobby, Filme anzuschauen und ein Fernseher gab mir nicht das richtige Feeling. Beruflich arbeitete ich jetzt als Sachbearbeiter einer Krankenversicherung. Ich war dafür zuständig, dass die Rechnungen der Ärzte korrekt waren, sonst gab es kein Geld. Es war ein Job, der mir zwar lag, aber nicht mein Beruf. Normalerweise wäre ich Arzt der Chirurgie, wenn da nicht die Sache mit meiner Frau Sabine gewesen wäre.
Wir hatten uns beim Studium im zweiten Semester bei einer Vorlesung kennengelernt. Sie hatte neben mir gesessen und mich um einen Kugelschreiber gebeten. Eine schlanke, wahnsinnig gut aussehende Frau, mit leuchtenden Augen, der ich sofort einen Kugelschreiber und mein Herz schenkte. Ihre Augen hatten mich in Bruchteilen von Sekunden in ihren Bann gezogen.
Aus diesem kurzen Blick entwickelte sich eine handfeste Beziehung, die wir bei jeder Gelegenheit kräftig auslebten. Im Überschwang unserer jugendlichen Gefühle dachten wir nicht an Verhütung und es endete damit, dass Sabine schwanger wurde. Ihre Familie hätte einer Abtreibung niemals zugestimmt und so heirateten wir im zarten Alter von 23 Jahren.
Leider verlief die Schwangerschaft nicht ohne Komplikationen, doch Sabine bekam das Kind. Es war ein Junge und wir nannten ihn Benjamin. Nach den ersten Untersuchungen war klar, er war schwerstbehindert und man machte uns keine Hoffnung, dass Benjamin alt werden würde. Sabine brach ihr Studium ab, um sich ganz um Benjamin zu kümmern. Durch die Belastung von Benjamins Pflege, kam es immer öfter zum Streit mit Sabine und auch mein Studium wurde nicht das Beste. Trotzdem beendete ich es mit Ach- und Krach.
Benjamin starb im Alter von 5 Jahren. Sabine nahm sich das sehr zu herzen. Ich überschüttete sie in dieser Zeit mit sehr viel Verständnis und Liebe und so kamen wir wieder zueinander. Nach dem Studium fing ich als Assistenzarzt im Krankenhaus an. Schließlich kam ich in die Chirurgie und arbeitete gut, jedenfalls nach Meinung meiner Oberärzte.
Sabine nahm nach dem Tod von Benjamin ebenfalls ihr Studium wieder auf. So waren wir beide auf einem guten Weg.
Es war der 12. März, der alles veränderte. Wir hatten mit unseren Freunden Karten gespielt, was wir einmal im Monat machten. Einmal bei uns, einmal bei unseren Freunden. Diesmal waren wir zu ihnen gefahren. Der Abend ging schnell vorbei und wir verabschiedeten uns so gegen
23 Uhr. In fröhlicher Stimmung fuhren wir in Richtung der Hauptstraße, die wir überqueren mussten, um zu unserer Wohnung zu fahren. Die Ampel zeigte grün und so fuhr ich los. Den heranrasenden Wagen sah ich nicht. Er fuhr direkt in die Beifahrerseite unseres Autos.
Unser Wagen wurde quer über die Kreuzung geschleudert. Dort prallte er gegen die Ampel und mein Kopf wurde trotz der Seitenairbags in die Seitenscheibe gestoßen. Was zur Folge hatte, dass meine Schädelknochen auf der linken Seite teilweise zertrümmert wurden und ein anderer Teil in den angrenzenden Garten flog. Zum Glück waren Rettungskräfte schnell vor Ort. Als ich schließlich wieder zu mir kam, war ich im Krankenhaus.
Der behandelnde Arzt erzählte mir was von Glück gehabt, dass ich noch lebe. Ich hatte einen gebrochenen Arm und mein Schädel zierte jetzt eine neue experimentelle Titanplatte, der einige seltene Erden beigemengt waren. Es sollte die Abstoßung verhindern und das Einwachsen verbessern. Ein Experiment, dem ich nicht die Zustimmung gegeben hätte, aber ich war nicht bei Bewusstsein gewesen und meine Kollegen hatten es gut gemeint. Ansonsten ging es mir einigermaßen gut. Allerdings verschwieg er mir, dass Sabine den Unfall nicht überlebt hatte. Nur ein paar Tage vor ihrem
30. Geburtstag.
Der Unfallfahrer war stockbesoffen mit überhöhter Geschwindigkeit in unseren Wagen gefahren. Er hatte überlebt, zwar ebenfalls schwer verletzt, aber er lebte.
Da ich einige Wochen im Koma lag, war die Beerdigung von Sabine bereits gewesen. So konnte ich mich nur am Grab still von ihr verabschieden.
Es folgten der Ganze gerichtliche Kram und die damit verbundenen Umstände. Der Fahrer bekam meiner Meinung nach eine viel zu milde Strafe. Ich war verbittert und mir ging es nicht besonders. Dadurch vernachlässigte ich alles und jeden, zog mich ziemlich zurück. Zu allem Übel kam der Alkohol und dadurch gab es Probleme im Krankenhaus. Ich war nicht mehr zuverlässig, machte zum Glück keine schwerwiegenden Fehler, aber ich wurde dank meines Oberarztes letztendlich den Job los.
Nach einigen Monaten der Selbstfindung und Dank meines Freundes Hilfe kam ich vom Alkohol los. Von irgendetwas musste ich schließlich leben und so kam ich an den Job bei der Krankenversicherung. Finanziell ging es mir gut, denn durch den Unfall bekam ich eine Lebensversicherung und eine Unfallversicherung ausgezahlt, die wir bei dem nervigen Versicherungsvertreter abgeschlossen hatten. Im Nachhinein dankte ich dem Vertreter für seine Hartnäckigkeit. Dadurch konnte ich mir die Eigentumswohnung leisten und kam mit meinem Einkommen gut über die Runden.
Sport ist Mord – nach der Devise lebte ich. Essen ist notwendig, aber großartig kochen, nein danke. Zumal meine Kochkünste hervorragend waren. Mein Opa war Koch in einigen großen Hotelküchen gewesen und hatte mir einiges beigebracht. Es wäre also kein Problem gewesen, einmal kurz etwas Leckeres zu brutzeln. Doch meistens war ich einfach zu faul, das gebe ich gerne zu. Es war ja auch viel bequemer, schnell einmal ein Mikrowellengericht hier, ein Dosengericht da und nicht zu vergessen, es gab ja noch die Lieferservices. Einmal schnell eine Pizza oder Chinesisch, wer sagt da schon Nein. Als ich noch verheiratet war, war es anders, da habe ich gerne gekocht. Doch das war Schnee von gestern.
Nun stand ich hier vorm Spiegel in Ägypten und schaute mir das entgegenblickende Elend an.
Ich putzte schnell die Zähne, rasierte mich und wollte gerade unter die Dusche, als plötzlich eine nackte Frau an mir vorbeieilte und sich auf den Toilettensitz fallen ließ.
Ach ja, Ludmilla, hatte ich völlig verdrängt. Wir hatten uns gestern Abend recht nett unterhalten und nach ein paar Bierchen wusste ich alles über Ludmilla aus Kasachstan. Ihr „Göttergatte“ sei langweilig, ständig voll und bringe es nicht mehr. Sie bräuchte einmal wieder einen Mann, der ordentlich kann. Nun, wir hatten wohl die Nacht verbracht, aber ich dachte, sie wäre bereits wieder bei ihrem Mann.
„Sorry du, völlig verpennt, muss sofort verschwinde“, sagte sie in ihrem russisch-deutschen Akzent und lies erst einmal ebenfalls das Sakkara-Bier in die Schüssel rauschen. Anschließend huschte sie wieder ins Zimmer, zog sich erstaunlich schnell ihre Klamotten und ihre High-Heels Pantoletten an, bevor sie mir noch kurz ein Buzzi-Buzzi zurief und weg war sie.
Ja, Frauen, das war auch so ein Thema. Ich hatte seit dem Tod meiner Frau nichts Festes mehr gehabt, sondern nur schnelle Bekanntschaften. Drive - In und bitte das Tagesmenü. Hier einmal ein Küsschen und da einmal ein Quickie, bloß nichts Festes. War das wirklich die Erfüllung? War das schon alles? Nein! Schließlich glaubte ich noch an die große Liebe. Ich war mir sicher, irgendwann würde ich die Richtige finden oder Sie mich. Nur wann und wo, das stand noch in den Sternen.
Ich stieg in die Dusche und duschte ausgiebig, um Ludmilla wegzuwaschen. Trocknete mich kurz ab, zog die Badehose an, Hose und T-Shirt und ab an den Strand.
Bevor ich zum Frühstück ging, wollte ich noch schnell das letzte Mal für diesen Urlaub in das 28 Grad warme und herrlich klare Wasser des Roten Meeres springen.
Es war eine Wohltat. Man konnte tief ins Wasser blicken und die Fische schwimmen sehen. Das Hotel hatte eine vorgelagerte Insel mit eigenem Riff, wo die bunten Fische sich tummelten. Es war ein fünf Sterne Schuppen, aber nicht so ein großer Klotz, sondern eher klein. Dafür aber sauber und man konnte sich gut erholen. Die Zimmer waren hübsch, und da man sich meistens sowieso nur zum Schlafen dort aufhielt, auch völlig ausreichend.
Nach dem Bad im Meer folgte das Bad im Zimmer. Klar, ich hatte mich auch am Strand geduscht, denn der Salzgehalt ist echt heftig. Ich habe gelesen das vier Prozent Salz im Wasser sein sollen. Hört sich nicht viel an, aber es schmeckt nach vierzig Prozent und man klebt wie ein Blatt von den Klebenotizblöcken. Ich packte meinen Koffer und ging zum Frühstücksbuffet.
Noch einmal schlemmen, wie Gott in Frankreich. Es gab von allem reichlich. Brötchen, Brot in verschiedenen Sorten, frisch oder getoastet. Eier in allen Darreichungsformen. Müsli, Marmelade, Wurst und Käse. Obwohl, der schmeckte mir nicht wirklich, da können wir besseren Käse in Deutschland herstellen. Zum krönenden Schluss folgten kleine Kuchen. Der Magen war einfach zu klein, für die herrlichen Leckereien.
Ludmilla und ihr Igor waren ebenfalls im Frühstücksraum. Der Haussegen hing schief, das konnte ich sehen. Igor war im Gesicht rot wie eine Tomate und schaute sich im Raum um. Er sollte mehr auf seine Gesundheit achten, schätze, er hat Probleme mit dem Blutdruck. Hoffentlich hatte Ludmilla nichts von mir erzählt. Eine Prügelei war das Letzte, was ich jetzt gebrauchen konnte. Also tat ich so, als wenn ich sie nicht kannte. Schaute immer in eine andere Richtung und verließ im gemächlichen Schritt den Frühstücksraum.
An der Rezeption bezahlte ich die Minibarrechnung und was sonst noch so offen war.
Hmm, konnte mich nicht daran erinnern, Krimsekt aufs Zimmer bestellt zu haben. Doch dann sah ich Datum und Uhrzeit. Ludmilla dachte ich nur. Anschließend setzte ich mich in die Hotellobby. Dort sollte ich in ca. 20 Minuten abgeholt werden, um zum Flughafen gebracht zu werden.
Angst vorm Fliegen hatte ich keine, obwohl ich schon einmal eine Landung mit Hindernissen miterlebt hatte. Es war sehr stürmisch gewesen und wir sollten in Hamburg landen. Beim Landeanflug wackelte das Flugzeug hin und her. Es ging herauf und herunter. Der Pilot hatte echte Mühe das Flugzeug zu stabilisieren. Zweimal wurde der Landeanflug abgebrochen und er musste wieder durchstarten. Was dazu führte, dass die „Kotztüten“ reichlich benutzt wurden und die Luft sich mit dem herrlichen Duft nach frisch Erbrochenem mischte.
Mir machte das nichts aus. Wer schon einmal bei einer Obduktion anwesend war, weiß, was Gestank ist. Aber so war das für mich fast ein lieblicher Duft. Trotzdem möchte ich nicht das Reinigungspersonal gewesen sein. Beim dritten Anflug klappte endlich die Landung. Es knallte ganz schön und ich vermutete, dass der Pilot wohl alles darangesetzt hatte, um die Maschine nach unten zu bekommen. Aber das war auch das einzig erwähnenswerte Erlebnis, was ich beim Fliegen gehabt hatte. Ansonsten war fliegen wie Bus fahren, nur etwas schneller.
Pünktlich kam der Transferbus, um mich im Hotel abzuholen. Der Koffer war schnell verstaut und los ging es zum Flughafen. Der Reiseleiter teilte den Anwesenden mit, dass es eventuell Verspätungen geben könnte. Ein Schwarm von Heuschrecken sei gerade in Flugplatznähe und störe den Flugverkehr. Nach Ankunft am Flughafen hüpften auch schon die ersten rosafarbenen Heuschrecken durch die Gegend. Erstaunlich, wie groß die waren. Man erklärte uns, dass die Heuschrecken, wenn sie diese Farbe hätten, fliegen können. Anschließend würden sie gelb und würden sich vermehren. Es wären wohl einige Sprühflugzeuge mit Gift unterwegs, um diesen Schwarm zu vernichten, deshalb gäbe es eine kleine Verspätung. Na prima, dachte ich, checkte ein und ging in den Wartebereich.
Die Passkontrolle war wieder himmlisch. Ein Blick, ein Stempel – weitergehen. Na, mir sollte es recht sein. Dafür durchleuchteten sie das Gepäck minutenlang. Ich musste sogar meine Schuhe ausziehen und durchleuchten lassen. Es waren schöne ockerfarbene Kamelboots. Halbschuhe, schön bequem und man konnte damit kilometerweit laufen, ohne Blasen an den Füßen zu bekommen. Selbst mein Gürtel wurde unter die Lupe genommen, dabei war das nun wirklich kein besonders schöner Gürtel. Na ja, es diente schließlich der Sicherheit.
Nach dreißig Minuten Verspätung wurde endlich unser Flug aufgerufen und wir quälten uns an Bord des Flugzeugs. Ich hatte meinen Koffer aufgegeben und nur noch einen kleinen Handgepäckkoffer dabei. Dort waren meine Papiere und etwas zum Lesen, sowie T-Shirt, Badelatschen, eben alles Lebensnotwendige. Meinen Platz fand ich schnell, 15 a, direkt am Fenster. Das Flugzeug war nicht voll besetzt. Neben mir waren noch zwei Plätze, aber der mittlere blieb frei. Im Sitz zum Gang nahm eine Frau Platz.
„Guten Tag“, sagte sie mit einem Lächeln.
„Guten Tag“, erwiderte ich höflich. Sie war, so schätzte ich sie, Mitte vierzig. Braun gefärbtes langes Haar, eine Sonnenbrille in die Stirn geschoben. Sie war braun gebrannt, nicht ganz schlank und hatte eine beachtliche Oberweite. Alle Achtung dachte ich so bei mir, ganz schöne Kaliber. Ob die Natur diese Hügel schuf oder die Hand eines Kollegen, konnte ich so natürlich nicht feststellen. Falls es künstliche Brüste waren, hätte ich sie gerne einmal genauer angeschaut. Natürlich rein beruflich.
Nachdem sie endlich ihren Platz eingenommen hatte, was erstaunlich lange dauerte, quälte sie einen I-Pod aus ihrer Hosentasche. Typisch Frau, erst hinsetzen und dann den
I-Pod herausholen, anstatt das Ganze umgekehrt zu machen. Sie stöpselte sich auch gleich die Ohrhörer in die Ohren und schloss mit einem tiefen Atemzug die Augen.
Ich konnte leise hören, dass da wohl ein Hörbuch ablief. Nun, ich nahm mein Buch, „der Schwarm“ und fing an zu lesen, wo ich am Strand aufgehört hatte. Es war ganz schön dick, die Hälfte hatte ich geschafft.
Kurz vor dem Start die obligatorischen Sicherheitshinweise der Crew. Natürlich schaute ich nicht zu, man kannte die Leier ja schon. Wenn das Flugzeug abstürzt, ist eh alles zu spät, da nützt auch keine Schwimmweste in der Wüste. Der Start verlief reibungslos und ich schaute aus dem Fenster. Schnell gewannen wir an Höhe und ich konnte die Wüste sehen. Der Himmel war strahlend blau, keine Wolke war zu sehen. Der Flugkapitän meldete sich per Bordsprechanlage.
„Guten Tag, meine Damen und Herren, ich bin Kapitän Hans Krause und begrüße sie auf unserem Flug von Hurghada nach Hamburg. Die Flugzeit wird 4 Stunden und 50 Minuten betragen...“ Ich hörte nicht mehr hin, denn es war ja immer das Gleiche.
In Ägypten war ich jetzt das vierte Mal. Es war einfach toll im Roten Meer zu schnorcheln oder einfach nur zu baden. Von den schönen Barabenden einmal ganz zu schweigen.
Nachdem wir so eine knappe Stunde geflogen waren, begann der Service. Es sollte etwas zu essen geben. Fisch oder Hühnchen hörte ich. Wurde auch Zeit, ich bekam langsam aber sicher Hunger. Das Essen wurde von den Flugbegleitern ausgeteilt und ich nahm das Hühnchen. Für den kleinen Hunger reicht es ja, dachte ich und verputzte alles Essbare. Wehmütig dachte ich an das herrliche Buffet im Hotel. Meine Sitznachbarin hatte ebenfalls das Hühnchen verputzt und nach einem freundlichen Lächeln widmete sie sich wieder ihrem Hörbuch.
Hatte wohl keine Lust auf Konversation. Ich schaute aus dem Fenster und war in Gedanken versunken. Es wäre schön, wenn jetzt Sabine noch hier gewesen wäre. Sie hatte ein tolles Lachen und war sehr warmherzig gewesen. Auf Dauer wollte ich nicht allein sein, das war nichts für mich.
In meiner Kindheit war ich bei meiner Pflegefamilie als Einzelkind aufgewachsen. Klar, man hatte Freunde gehabt und auch heute hatte man noch Freunde. Aber eine Partnerin, mit der man durch dick und dünn ging, die fehlte mir. Noch sagte ich, denn ich war ein unverbesserlicher Optimist. Bei mir waren die Gläser halb voll und nicht halb leer. Ein Sudoku Rätsel wurde immer mit Kugelschreiber begonnen. Es gab keine unlösbaren Aufgaben, es musste halt nur lange genug nach einer Lösung gesucht werden. Das war meine Lebenseinstellung.
Ein Geräusch holte mich aus meinen Überlegungen in die Wirklichkeit zurück. Die Schönheit neben mir hatte einen Schluckauf und versuchte es zu unterdrücken. Die Geräusche, die sie dabei erzeugte, waren herzzerreißend komisch. Ich ignorierte es und wollte gerade wieder weiterlesen, als meine Aufmerksamkeit durch ein Leuchten im Fenster geweckt wurde.
Es war, als ob eine grün-blaue Leuchtkugel am Himmel stand. Nicht besonders groß, aber das war geschätzt. Was konnte das sein? Sie war sehr weit weg, kam aber immer näher. Ein UFO? Meine erste Vermutung, denn ich kannte keinen solchen Flugzeugtyp. Die Kugel bewegte sich in Richtung unseres Flugzeugs.
Plötzlich ging alles sehr schnell. Die Kugel kam mit einem irren Tempo auf unser Flugzeug zu gesaust, traf das Flugzeug. Ein Knall, ein grellweißer Blitz, ich sah und hörte nichts mehr. Irgendwie fühlte ich etwas, aber was es war, kann ich nicht sagen. Schreie drangen dumpf an mein Ohr, aber waren es Schreie? Wie lange das Ganze dauerte, kann ich nicht beantworten. Mir kam es vor, als wenn es überhaupt nicht enden wollte. Ich fühlte mich wie in einem Tunnel. Sterbe ich? War, dass das Licht, von dem immer alle sprachen? Ich kam mir schwerelos vor. Plötzlich ein Stoß, ein heftiger Schmerz und dann Dunkelheit.
Kapitel 2
Überall Schmerzen war das Erste, was ich wieder fühlte. Alles tat weh, jeder Zentimeter meines Körpers schien von einem Profiboxer bearbeitet worden zu sein. Nur langsam verebbten die Schmerzen.
Vorsichtig öffnete ich meine Augen. Es blieb trotzdem dunkel, nicht stockdunkel, aber eben dunkel. Irgendwie war mir kalt, mein Mund war staubtrocken und ich hatte Sand im Mund. Ich musste ausgiebig husten und spuckte den Sand aus. Selbst in der Nase hatte ich Sand. Ich versuchte, mit der rechten Hand meine Nase zu erreichen. Es tat höllisch weh. Endlich schaffte ich es. Mit reiben und schnäuzen versuchte ich allen Sand zu entfernen.
Mein Kopf fühlte sich an, als ob ich eine wahnsinnige Sauforgie hinter mir hatte. Ich versuchte, meinen Kopf zu bewegen. Die erneut auftretenden Schmerzen ließen es bei einem Versuch.
Was war passiert? Ich konnte mich nur noch an das schreckverzerrte Gesicht der hübschen Frau neben mir im Flugzeug erinnern und an das Licht. Meine Finger spürten Sand. Wie konnte hier Sand sein? War das Flugzeug abgestürzt? Wenn ja, wieso wusste ich nichts davon? Wie hatte ich das überleben können? Hatte ich einen Blackout? Viele Fragen, aber keiner war da um sie zu beantworten.
Langsam gewöhnten sich meine Augen an das Halbdunkel. Scheinbar war es später Abend und ich lag irgendwo im Sand. Nirgends war etwas von dem Flugzeug zu sehen. Keine brennenden Wrackteile oder schreiende überlebende. Nein, es war sehr still. Ein leichter Wind wehte. Meine Hände tasteten umher und schließlich tastete ich meine Brust ab. Wieso hatte ich kein Hemd an? Ich richtete mich auf, Sterne tanzten vor meinen Augen, mir wurde übel. Würgend, aber nicht übergebend, schwankte ich im Sitzen hin und her. Was zum Teufel war passiert? Nun merkte ich zu meinem Erstaunen, das ich nackt war. Keine Hose, Strümpfe, Schuhe – alles weg! Tod dachte ich, so fühlt es sich also an. War ich am Eingang zum Himmel oder der Hölle?
Wieso war hier Sand? Wo ist das helle Licht, das man sehen soll? Die Übelkeit ließ langsam nach, nur die Kälte blieb. Ich schaute mich um, nichts außer Sand. Kilometerweit nur Sand, jedenfalls soweit ich in der Dunkelheit schauen konnte. Scheinbar war ich aber noch auf der Erde, denn langsam konnte ich Sterne erkennen und der Mond stand am Horizont.
„Okay, Rolf“, sagte ich mit eigenartig belegter Stimme. Nachdem ich mich mehrmals geräuspert hatte, spuckte ich ein paar Mal aus und sagte, um mich selbst zu beruhigen: „Immer ruhig bleiben und keine Panik. Das Wichtigste, du lebst.“ Schön, meine Stimme konnte ich wieder hören.
Ein leichter Windstoß wehte Sand an meinen Körper und ich fröstelte. Vorsichtig versuchte ich aufzustehen. Es gelang, auch wenn ich wieder Sterne sah, die nicht am Himmel standen. Nach kurzer Zeit konnte ich wieder klar sehen. Keine Menschenseele zu sehen. Nur Sand, davon aber reichlich, egal wo ich hinschaute. War ich noch in Ägypten? Wenn ja, wo war ich? Da ich hier nicht Wurzeln schlagen wollte, musste ich also entscheiden, wo lang? Wo gab es Rettung? Wehte der Wind jetzt vom Meer ins Landesinnere oder umgekehrt? Ich entschied mich gegen den Wind zu gehen, damit ich eine Richtung hatte. Ein markanter Lichtpunkt in der Ferne am Himmel und ich ging los.
Langsam kam ich irgendwie voran. Wie lange ich so vor mich hin trottete, weiß ich nicht. Ging ich jetzt schon Stunden durch die Wüste oder waren es lediglich Minuten? Ich hatte jedes Zeitgefühl verloren. Es wurde immer kälter, ich durstiger und müder. Jetzt bemerkte ich, dass ich kaum Kondition hatte. Alle Muskeln taten weh. Hätte doch das Angebot des Fitnessstudios annehmen sollen.
Ob ich die Richtung noch einhielt? Da war ein Licht, es war noch weit weg. Ich hielt an, schaute genau hin. Ja, ein Licht. Es flackerte, das könnte ein Lagerfeuer sein. Oder Einbildung! Egal wer oder was da war, es konnte meine Rettung sein.
Ich beschleunigte meine Schritte. Langsam kam ich näher. Ja, es war ein Feuer, Rettung für mich.
„Hallo“, rief ich. „Ich brauche Hilfe“. Mit letzter Kraft lief ich auf das Feuer zu. Jetzt konnte ich erkennen, dass mehrere Gestalten am Feuer saßen. Einer war aufgesprungen und hielt etwas in der Hand.
„Hilfe“, rief ich und ging langsamer. Er rief mir irgendetwas zu, was ich aber nicht verstand.
„I need Help“ versuchte ich es in Englisch, während ich japsend nach Luft schnappte. Er schien zu verstehen. Die anderen Gestalten waren inzwischen ebenfalls aufgestanden und hatten, wie der Erste, gebogene Schwerter gezogen. Ich konnte es nicht glauben, die hatten Säbel!
Der als Erstes aufgestanden war, sagte in Englisch: „Halt!
das ist weit genug. Bleibt stehen.“ Wie befohlen blieb ich stehen und schon sprudelte es aus mir heraus: „Mein Name ist Rolf Rüdiger Klinger, ich komme aus Deutschland. Das Flugzeug muss abgestürzt sein, ich habe nichts anzuziehen, mir ist kalt und ich bin durstig. Können sie mir helfen?“
„Effendi“, sagte er, lies dabei sein Säbel sinken, „kommt ans Feuer und wärmt euch.“ Er sagte etwas in einer fremden Sprache, ich nahm an, es war arabisch, zu seinen Begleitern. Sie ließen ebenfalls die Säbel sinken. Einer ging in ein kleines Zelt. Das sah ich erst jetzt, als ich langsam ans Lagerfeuer ging.
Ahh – das tat gut, endlich Wärme. Der im Zelt verschwunden war, kam mit einem über den Arm gelegten Hemd oder so etwas Ähnlichem und gab es mir. Es war ein sackähnlicher Ganzkörper etwas, wie alle Ägypter es trugen. Genauso wie die Männer, die hier am Lagerfeuer saßen. Ich glaube, es heißt „Gallabea“ oder so ähnlich.
„Zieht es an und setzt euch zu uns ans Feuer, Effendi“, sagte der freundliche Ägypter. Ich nahm einfach an, dass er Ägypter war.
„Trinkt diesen Tee und erzählt uns, was passiert ist.“
„Danke für eure Hilfe“, sagte ich und nahm dankbar den heißen Tee, nachdem ich das „Hemdchen“ anhatte. Der Tee war in einem einfachen Tonbecher und schmeckte gut. Ein Kaffee wäre mir jetzt lieber gewesen, aber der Tee tat es auch.
„Mein Name ist Mohamed Omar Tambuk“, sagte mein Retter. Dabei legte er die rechte Hand auf seine Brust und verneigte sich leicht.
„Mein Name ist Rolf Rüdiger Klinger“, antwortete ich.
„Ihr kommt aus Europa, Effendi?“, fragte Omar.
„Ja, um genau zu sein, aus Deutschland“, antwortete ich.
„Deutschland?“, fragte er mit einem komischen Gesicht. „Seid ihr schon lange in Ägypten?“, fragte Omar.
„Nein, noch nicht lange“, antwortete ich und trank einen Schluck Tee.
„Sind die Kriege in Europa noch?“, fragte Omar.
„Welche Kriege?“, fragte ich erstaunt.
„Vor vierzehn Tagen war noch alles normal“, antwortete ich und schlürfte an meinem Tee. Omar schaute mich sehr komisch an.
„Nun, ich meine die heiligen Kreuzkriege, die die Gläubigen gegen die Ungläubigen führen. Die auch hier bei uns lange Zeit gewütet haben, jetzt sind sie aber Richtung Persien unterwegs.“
Ich verstand nur Bahnhof. Was meinte Omar damit? Die Glaubenskriege waren doch schon lange vorbei. Meinte er etwa die? Oder den Krieg im Iran? Afghanistan? Syrien?
„Ihr müsst entschuldigen“, sagte ich, „ich habe länger keine Nachrichten gesehen.“ Omar schaute seine Begleiter an und lachte.
„Hat man euch auf den Kopf geschlagen, als ihr ausgeraubt wurdet, Effendi?“
Ich muss ein selten doofes Gesicht gemacht haben, den Omar und seine Freunde lachten, bis ihnen die Tränen kamen.
„Ich weiß nicht, was passiert ist“, sagte ich wahrheitsgemäß. „Kann mich an nichts mehr erinnern. Weiß nur noch, dass ich hier irgendwo aufgewacht bin. Wo sind wir hier eigentlich?“
„Das ist die Wüste vor der Hafenstadt Alexandria“, sagte Omar. „Wir kommen aus Kairo.“
„In Kairo war ich auch schon“, antwortete ich, „die Pyramiden und das ägyptische Museum.“
„Museum?“, fragte Omar, „was ist das?“ Jetzt schaute ich ihn fragend an.
„Nun, wo alle Kunstschätze aufbewahrt werden.“
„Was!“, sagte Omar ziemlich erstaunt. „Ihr durftet in die Schatzkammer vom Pharao?“
Jetzt dreht er durch, dachte ich. Pharao! Klar doch, den blöden Reisenden ein bisschen auf den Arm nehmen. Doch irgendwie sagte er das sehr glaubwürdig.
„Mir ist schlecht, ich habe Kopfschmerzen und ich weiß nicht einmal, welcher Tag heute ist“, sagte ich und hatte ein flaues Gefühl im Magen.
Er überlegte und sagte dann: „Heute ist der 3. Tag des 8. Monats im Jahr des Herrn 1148 nach eurer Zeitrechnung, Effendi“.
Dem Zug, der mich in diesem Moment von hinten überfuhr, während ich unter einer bimmelnden Kirchenglocke saß und dem Klang eines Presslufthammers lauschte, der das Datum in meinem Kopf hämmerte, war ich völlig ausgeliefert. Ich saß wie versteinert. Nur langsam kam ich in die Wirklichkeit zurück.
„Das ist doch ein schlechter Scherz“, flüsterte ich und fast wäre mir der Teebecher aus der Hand gerutscht. Wenn das Datum stimmte, war ich in der Vergangenheit. Wie sollte so etwas gehen? Das war unmöglich! Gut, da war dieses komische Licht gewesen und ich hatte auch schon einige Filme gesehen, wo so etwas klappte. Aber das waren Hollywoodfilme und keine Wirklichkeit. Und wenn es wahr wäre, warum ausgerechnet in diese Zeit? Aus dieser Zeit hatte ich einmal ein paar Bücher gelesen, aber mich sonderlich nie ausführlich mit dieser Zeit und den Umständen, geschweige denn mit den Gepflogenheiten und Lebensumständen auseinandergesetzt.
Nachdem ich mich wieder etwas gefangen hatte, sagte ich: „Na klar, der 3. August 1148. Nun mal Butter an die Fische. Wo ist die versteckte Kamera?“ Ich schaute mich lächelnd um. Jeden Augenblick irgendwo das Schild „Verstehen sie Spaß“ zu entdecken. Verdammt gute Schauspieler, dachte ich. Verziehen keine Mienen. Ich sah ein paar Zelte und Kamele, sonst nichts. Sehr beeindruckend, die Kulisse, dachte ich bei mir.
Das Datum kreiste immer noch in meinem Kopf, als Omar sagte: „Ich verstehe den Sinn eurer Sprache nicht. Wir Reisen nach Alexandria um einen Medikus aufzusuchen“.
Das brachte mich wieder zurück in die Gegenwart.
„Einen Medikus?“ echote ich. „Ich bin ein Medikus.“ War ja richtig, nur dass ich zurzeit nicht als Arzt arbeitete, aber das sagte ich nicht.
„Ihr seid Medikus, Effendi?“, fragte Omar erstaunt.
„Ja, ich bin Medikus“ ich hatte gelesen, dass Arzt früher so hieß.
„Oh, das ist gut“, sagte Omar.
„Seine Tochter Aynur bedarf der Hilfe“, sagte sein Begleiter. Er hieß glaub ich Hazem Hasan. Die Vorstellung der Namen war irgendwie an mir vorbeigegangen.
„Wo ist eure Tochter und was hat sie für Beschwerden?“, fragte ich nun ganz in meinem Element.
„Der mit uns reisende Baader Mohamed Ben Nerva meint, sie hat die Seitenkrankheit“, sagte Hazem Hasan.
„Seitenkrankheit? Ach ja – kann ich deine Tochter mal sehen?“, fragte ich. Seitenkrankheit, so hatte mein Professor in der Vorlesung uns beigebracht, wurde früher die simple Blinddarmentzündung genannt. Wir Studenten hatten sie immer „Bockwurstkrankheit“ genannt, weil der entzündete Blinddarm so prall wie eine Bockwurst aussah. Wie konnte der Baader zu dieser Zeit eine Appendizitis, Pardon, Seitenkrankheit erkennen? Wenn es wirklich die Zeit war, die sie mir genannt hatten. Ich ging immer noch von einem schlechten Scherz aus.
Wir gingen zu einem Zelt. Im Zelt war es dunkel, sodass man so gut wie nichts sehen konnte. Irgendjemand war im Zelt, denn ich hörte ein Stöhnen.
„Meine Tochter ist 13 Jahre alt, sie hat starke Schmerzen in der Bauchseite, hier“, sagte Omar und zeigte auf die rechte Bauchseite.
„Ich brauche Licht, sonst kann ich sie nicht untersuchen.“
Omar holte eine Fackel und ich konnte nun genug sehen. Ich schaute das Mädchen an, es war sehr dünn, hatte einen unregelmäßigen Atem. Die Stirn war sehr heiß und schweißbedeckt, zudem war ihr Gesicht verschleiert. Hohes Fieber vermutete ich. Ein Druck in die Bauchseite, loslassen und das Mädchen schrie auf. Die Bauchdecke fühlte sich auch sehr hart an. Das könnten zugegeben Symptome einer erstklassigen Blinddarmentzündung sein. Aber ohne genaue Blutuntersuchung konnte ich es nur vermuten. Es gab schließlich genug andere Krankheitsmöglichkeiten.
Sie trug ein sehr schönes Kleid mit einem außergewöhnlichen Muster. Passte irgendwie gar nicht zu den sonst so ärmlich gekleideten Männern, aber ich dachte mir nichts dabei, da ich andere Probleme hatte.
Was konnte ich hier jetzt tun? Normalerweise würde ich einen Krankenwagen rufen und ab in den Operationssaal. Aber hier in der Wüste? Die Symptome sahen erschreckend echt aus. Sollte ich wirklich in der Vergangenheit sein?
„Wie weit ist es bis Alexandria?“, fragte ich.
„In drei Tagen erreichen wir die Stadt“, sagte Hazem Hasan.
Ich überlegte, was ich machen konnte. In drei Tagen würde das Mädchen wahrscheinlich einen Blinddarmdurchbruch haben und daran sterben. Ich hatte noch ein Dilemma. Wenn ich wirklich in der Vergangenheit war, so waren Operationen nicht so wie zu meiner Zeit alltäglich. Soweit ich wusste, waren sie sogar verboten gewesen. Das Öffnen der Körper war aus Glaubensgründen nicht erlaubt, falls ich mich richtig erinnerte. Dem Medikus war auch der Umgang mit Blut verboten. Das war nur dem Baader erlaubt. Zum Glück war einer hier, aber wie sollte ich hier helfen?
Mir kam noch etwas in den Sinn: Wenn ich in der Vergangenheit dieses Mädchen retten würde, was für Auswirkungen hätte das für die Zukunft? Das Mädchen mochte vielleicht unbedeutend sein, aber sie bekam eventuell Kinder, die vielleicht etwas bewirkten und so weiter. Was bei ihrem Tod nicht passieren würde. Durfte ich also dieses Mädchen retten? Mal abgesehen davon wusste ich nicht einmal, ob sie eine provisorische Operation hier in der Wüste überleben würde. Aber, ich hatte den ärztlichen Eid geschworen, beziehungsweise würde ihn in Zukunft schwören. Was für eine beschi…ene Situation.
Die Chancen standen astronomisch hoch, dass sie während der Operation starb. Dazu käme das Problem, wie sollte ich erklären, dass ich ihren Körper geöffnet hatte? Wo sollte ich hier in der Wüste steriles Operationsbesteck herbekommen? Blutkonserven, Narkose und so weiter. Nicht durchführbar dachte ich.
Laut sagte ich: „Ja, sie hat die Seitenkrankheit und leiser „sie wird sterben.“ Omar schaute mich entsetzt an.
„Effendi, wie könnt ihr so etwas sagen? Ihr seid Medikus, es muss doch etwas geben, was ihr tun könnt.“
Ich überlegte lange und sagte: „Es gäbe eine neue Möglichkeit aus Germanien. Sehr gefährlich, aber die einzige Möglichkeit, um überhaupt eine kleine Chance zu haben. Die Risiken sind hoch und es gibt keine Garantie.“
Omar schaute mich skeptisch an und fragte: „In „Germanien“ gibt es das?“
Ich nickte nur. „Lasst uns das später klären. Wo ist der Baader?“ Omar rief einen Mann heran.
„Das ist Mohamed Ben Nerva, der Baader.“
„Sei gegrüßt, Mohamed Ben Nerva. Was habt ihr an Medikamenten, Kräutern und an medizinischen Geräten dabei? Skalpell und so weiter? Besitzt ihr Äther?“ Ich bestürmte ihn mit Fragen, die ihn doch recht erstaunten. Aber er gab bereitwillig Auskunft.
Mohamed Ben Nerva hatte selbstverständlich keinen Äther dabei, er wusste nicht einmal, was das war. Ich fragte, was er zum Betäuben nehme. Er hatte ein Mittelchen, was Schmerzen linderte und eine Salbe, die eine betäubende Wirkung der Haut hatte. Sie wurde aus Mohnsamen hergestellt, behauptete jedenfalls Mohamed Ben Nerva.
Ich nahm ihn beiseite und fragte: „Wie betäubt ihr die Patienten, wenn ihr ihnen helfen wollt?“
„Effendi, wir schneiden und nähen so. Das ist schmerzhaft, aber nicht zu ändern, da die meisten sich die Salbe nicht leisten können“.
Na riesig, dachte ich, ohne Betäubung und ich will hier operieren.
„Hört gut zu, Mohamed Ben Nerva, ich beabsichtige das Mädchen, zu operieren. Das heißt, ich muss den Körper aufschneiden.“ Entsetzt sah er mich an.
„Effendi, darauf steht die Todesstrafe. Seid ihr etwa auch Chirogikus? Kennt ihr euch damit aus? Wisst ihr alles über die Lehre der vier Säfte? Aber selbst wenn, es ist verboten den Körper zu öffnen“, sagte aufgebracht Mohamed Ben Nerva.
Ja, die vier Säfte, die kannte ich. Früher glaubte man, dass im Körper vier Säfte waren. Das Blut, der Schleim, schwarze und gelbe Galle. Was für ein Blödsinn!
„Das weiß ich Mohamed Ben Nerva, deshalb frage ich euch, ob ihr mir helfen werdet. Niemand wird davon erfahren, denn wenn alles gut geht, wird das Mädchen gesund. Wenn es schief geht, nun, sie wird eh sterben, ohne Operation.“
Mohamed Ben Nerva rang mit sich und fragte: „Habt ihr das schon einmal gemacht, Effendi?“
Jetzt musste ich Farbe bekennen. „Ja“, sagte ich und verkniff mir zu sagen, dass allein in der Ausbildung zum Arzt das x-mal geübt wurde. Im Krankenhaus war es eine Routineoperation. Eigentlich nichts Besonderes, solange der Blinddarm nicht geplatzt war. Ich hatte die Operation sehr oft gemacht, war recht geschickt gewesen, doch das konnte ich Mohamed Ben Nerva wohl schlecht erzählen. Wir schnitten fast keinen Patienten mehr auf, sondern arbeiteten mit der Schlüssellochmethode. Minimal-Invasiv, wie wir sagen, mit Endoskopen.
Ich schaute mir die „vorsintflutlich“ medizinischen Utensilien von Mohamed Ben Nerva an und sagte: „Wir benötigen deine Skalpelle und ein Zelt mit Licht. Niemand außer uns beiden darf das Zelt während wir operieren betreten. Wir brauchen Jod. Habt ihr das?“ Er schaute verständnislos.
„Deine Skalpelle müssen wir abkochen, damit sie keimfrei sind.“
„Ihr redet in Rätseln, Effendi.“
Ich erklärte ihm, dass wir in meiner Heimat mehr über die Seitenkrankheit wüssten und sie „Blinddarmentzündung“ genannt wurde. Nichts Besonderes, aber tödlich, wenn er sich entzündete und nicht entfernt wird. Ich erklärte, wie ich die Operation durchführen wollte.
Da ich nichts Großartiges zur Verfügung hatte, musste das Wenige reichen. Das wird spannend, dachte ich.
„Das Zelt muss komplett abgedichtet sein, damit möglichst wenig Sand hereinkommt. Habt ihr einen Spiegel?“, fragte ich Mohamed Ben Nerva. Er schüttelte den Kopf.
„Wir brauchen etwas blank poliertes.
„Geht ein Säbel?“, fragte er.
„Ja, das sollte gehen.“
Die Erklärung an Omar war eine andere. Ein komplizierter Aderlass sei erforderlich, um seine Tochter zu retten. Ich erklärte ihm, was ich benötigte. In einem Topf wurde Wasser gekocht und die medizinischen Utensilien des Baaders wurden darin abgekocht und somit einigermaßen keimfrei. Mohamed Ben Nerva bereitete alles vor. In einer Stunde sollte es hell werden und dann wollten wir beginnen. Ich sagte Omar, dass niemand das Zelt betreten sollte, bis ich es erlaubte.
Mohamed Ben Nerva hatte alles erledigt, so wie ich es ihm aufgetragen hatte. Die Skalpelle waren gesäubert, abgekocht und mit einem Tuch abgedeckt, einigermaßen saubere Verbände vorbereitet.
Damit das Mädchen nicht vom provisorischen Operationstisch hüpfen konnte, hatte ich sie mit Seilen fixiert. Sah nicht schön aus, war aber notwendig.
Das Schwerste war die Narkose. Wie sollte ich sie betäuben? Wenn ich sie irgendwie bewusstlos machen könnte, wäre das sehr hilfreich.
Ich flößte ihr das Schmerzmittel ein. Da ich nicht wusste, wie es wirken würde, gab ich ihr nach und nach mehr davon. Das Mädchen wurde ruhig, atmete aber noch gleichmäßig, also noch ein bisschen.
Den Puls kontrollieren, okay, er war gleichmäßig. Die betäubende Mohnsalbe aufgetragen, ein paar Minuten warten. Eine Nadel wurde zum Prüfinstrument. Sie zuckte nicht.
„Na dann, auf geht’s.“ Ich hatte Mohamed Ben Nerva aufgetragen, sich ordentlich zu waschen, ebenso wie ich. Allerdings war es nur provisorisch möglich, da wir nur begrenzte Wasservorräte hatten. Einen Mundschutz hatte ich aus Stoff provisorisch gefertigt. Sah recht abenteuerlich aus. Auf Kittel mussten wir verzichten, war nicht genug Stoff da.
Ich gab Mohamed Ben Nerva den Säbel und sagte, er solle das Zeltdach etwas aufschlitzen. Dann sollte er die Sonnenstrahlen mit dem Säbel so auf die zu operierende Stelle lenken. So hatte ich wenigstens etwas Licht. Mohamed Ben Nerva schaute interessiert zu, als ich das Skalpell nahm und den ca. 12 cm langen Schnitt setzte. Das Mädchen schrie aus Leibeskräften und fiel in Ohnmacht. Gott sei Dank, dachte ich, jetzt konnte ich weitermachen.
Wie lange hatte ich das schon nicht gemacht? Aber es war wie Fahrrad fahren, einmal gelernt, bleibt gelernt.
Ruhig öffnete ich die Wunde, tupfte das Blut ab und sagte zu Mohamed Ben Nerva, er möge den Lichtstrahl in die offene Wunde lenken. Es klappte. Ich hatte ein paar Haken improvisiert, damit konnte ich die Wunde spreizen. Mohamed Ben Nerva hielt den einen Haken und das Schwert. Sah sehr unbequem aus, aber es ging. Langsam legte ich den Blinddarm frei. Ich wollte gerade das Skalpell über einer Fackel heißmachen, damit ich sozusagen beim Schneiden die Wunde gleich verschweißen würde, als das Mädchen sich zu regen begann. Mir blieb nichts anderes übrig. Schweren Herzens gab ich ihr einen Faustschlag gegen die Schläfe, damit die Blutzufuhr zum Gehirn unterbunden wurde. Sie wurde wieder ruhig.
„Tut mir leid“, murmelte ich, nahm das heiße Skalpell, schnitt und ein zischendes Geräusch und Dampf kam aus der Wunde.
Vorsichtig, sehr vorsichtig, nahm ich den abgeschnittenen Blinddarm heraus, damit er nicht jetzt noch platzte. Es hatte tatsächlich geklappt!
Das Schließen der Wunde war danach ein Kinderspiel. Eine saubere Naht war zu sehen.
„Wir müssen sie sauber verbinden und jeden Tag den Verband wechseln. Würdet ihr das übernehmen?“, fragte ich Mohamed Ben Nerva. Er nickte stumm. Jetzt kam der schwierigste Teil. Sie musste wieder aufwachen. Ich öffnete das Zelt und ließ frische Luft herein. Nun fühlte ich den Puls des Mädchens, er war regelmäßig und ich hatte ein gutes Gefühl.
Die blutverschmierten Tücher warf ich ins Feuer. Ich hoffte, das ich sauber genug gearbeitet hatte. Sie hatte tatsächlich nur wenig Blut verloren. Nun hieß es warten.
Endlich, nach ein paar Minuten, kam Aynur langsam zu sich. Sie stöhnte und rief etwas, was ich nicht verstand. Ihr Vater Omar war sofort bei ihr und sprach in seiner Sprache mit dem Mädchen.
„Sie hat immer noch Schmerzen in der Seite und jetzt auch noch am Kopf!“ Omar schaute mich fragend an.
„Das ist normal, ich musste sie ja auch an der Seite zur Ader lassen, das gibt Kopfschmerzen“, log ich. „Die nächsten Tage werden entscheiden, ob sie leben oder sterben wird. Das liegt jetzt in Allahs Hand“, sagte ich salbungsvoll. Mohamed Ben Nerva schaute mich strafend an, sagte aber nichts.
„Können wir weiterreisen Effendi?“, fragte Omar.
„Habt ihr einen Wagen?“
„Ja, einen haben wir, er ist aber beladen“, antwortete Omar.
„Wir sollten sie möglichst wenig bewegen, jedenfalls für einen Tag“, antwortete ich. „Auch lange Fußmärsche sind nicht möglich, erst in zwei Tagen kann sie langsam anfangen, zu gehen. Jetzt ist sie sehr erschöpft und braucht unbedingt Ruhe. Sonst kann ich für nichts garantieren.“
Omar nickte und sagte: „Gut, einen Tag können wir noch rasten.“
Wir gingen gemeinsam zum Lagerfeuer und setzten uns.
„Erzählt von euch, Effendi“, sagte Omar. Da war ich nun etwas in der Klemme. Wie sollte ich ihm erzählen, dass, wenn es wahr war, ich aus der Zukunft kam? Ich dachte mir, ich könnte etwas erzählen, was unverfänglich klang. Also erzählte ich, dass ich verheiratet war, ein Kind hatte, beide gestorben waren. Das schmückte ich so aus, als wenn es auch in dieser Zeit passiert wäre.
Omar hörte zu und fragte nicht dazwischen. Als ich nicht weitererzählte, fragte er: „Wie seid ihr nach Ägypten gekommen, Effendi?“
„Mit einem Schiff, zu Studienzwecken. Ich habe gehört, dass eine neue Krankheit aus dem Osten kommt. Die wollte ich studieren und wenn möglich natürlich helfen“ log ich. Dabei dachte ich an die Pest. Der Zeitrahmen war, glaube ich ein anderer, aber genau wusste ich es nicht. Omar und seine Begleiter erst recht nicht.
Wobei mir nicht ganz klar war, ob ich vielleicht nicht ebenso erkranken könnte. Soweit ich wusste, hatte ich alle Impfungen und sogar meine Tetanusimpfung war frisch, aber die Pest? Ich wusste, dass Sauberkeit das Ganze verhindern konnte. Selbstverständlich auch der Kontakt mit den Infizierten selbst und den Erregern, den Flöhen, die von den Ratten in die Städte gebracht wurden. Ich sollte mich also dementsprechend immer kontrollieren, ob ein Flohbiss stattgefunden hatte.
„Habt ihr davon gehört?“, fragte ich.
„Nein“, sagte Omar, „aber wir sind ständig unterwegs und wissen nicht, was in den großen Städten so passiert. In Alexandria könnten sie mehr wissen.“
Wenn ich also wirklich in die Vergangenheit geschleudert worden war, musste ich mir langsam Gedanken machen, wie es weitergehen sollte. Kein Zuhause, keine Familie oder Freunde. Kein Fernsehen, kein Telefon, kein Auto. Ja, nicht mal Elektrizität! Wie sollte ich ohne das alles auskommen? Natürlich könnte ich mir einiges selbst bauen. Elektrizität war für mich kein Geheimnis, aber zu dieser Zeit wohl Hexenwerk.
Wenn ich tatsächlich hier in dieser Zeit festsaß, musste ich mir überlegen, wo wollte ich leben? In Deutschland? Hier in Ägypten? Da war das Sprachproblem. Gut, ich beherrschte Englisch und Deutsch. Ein bisschen Latein, aber das dürfte nicht reichen, um in Ägypten als Arzt zu arbeiten. Einmal davon abgesehen, ich hatte eine Ausbildung zum Chirurgen und war mit der Gerätemedizin „groß geworden“. Hier gab es nichts dergleichen. Kein Röntgengerät oder Überwachungsmonitore, von Krankenhäusern einmal ganz zu schweigen.
Hier gab es nur Kräuter und die Kunst des Arztes. Das würde ein großes Problem werden. Also zurück nach Deutschland. Aber wie? Ohne Moos nichts los. Wie sollte ich mir das Geld verdienen? Die einzige Chance sah ich darin, jemand zu finden, dem ich mein Wissen verkaufen konnte. Ich könnte auch eine Erfindung machen und die verkaufen. Schließlich kam ich aus der Zukunft und konnte ja mal eben schnell etwas erfinden. Aber, was wurde in dieser Zeit gebraucht? Das war nicht so einfach. Wie überlebte ich bis dahin?
Sollte ich vielleicht eine Dönerbude aufmachen?
Probleme über Probleme. Ich wusste im Moment nicht, wie es weitergehen sollte. Ich war nicht nur heimatlos, sondern auch in einer hoffnungslosen Lage.
Da hatte ich eine Idee und sprach den Baader an: „Sagt einmal Mohamed Ben Nerva, wohin reist ihr eigentlich?“
„Ich bin auf dem Weg nach Alexandria.“
„Was wollt ihr da machen?“, fragte ich nicht ohne Hintergedanken.
„Nun, ich muss Geld verdienen, Effendi“, sagte er lachend.
„Prima“, rief ich, „wollen wir uns zusammentun? Ich weiß mehr über Medizin, als ihr euch vorstellen könnt und wenn wir zusammenarbeiten, bringe ich euch eine Menge bei. Was sagt ihr dazu, Mohamed Ben Nerva?“
„Hmm, ich werde es mir überlegen, Effendi“ wich Mohamed Ben Nerva aus.
Klar, er hatte die Operation gesehen und wusste, ich achtete nicht auf die bestehenden Verbote. Viel schlimmer, ich war auch ein Ungläubiger. Mohamed Ben Nerva hingegen musste sich wohl erst an den Gedanken gewöhnen, dass es nichts Neues zu lernen gibt, ohne die Gefahr, bestehende Gesetze links liegen zu lassen. Also ließ ich ihm die Zeit zu überlegen.
Ich schaute nach meiner Patientin. Aynur schlief tief und ruhig. Ich berührte ihre Stirn und stellte fest, dass das Fieber runter ging. Eigentlich ein Wunder, aber es könnte tatsächlich gut gehen. Sie würde wahrscheinlich überleben.
Nach der ganzen Aufregung war ich sichtlich müde. Ich legte mich in die Ecke vom Zelt, in dem Aynur schlief, und war kurze Zeit später eingeschlafen.
Kapitel 3
Ich wurde recht unsanft geweckt. Irgendjemand schüttelte mich und redete auf mich ein. Leider in einer mir nicht geläufigen Sprache. Ich kam langsam hoch, rieb mir die Augen und schaute in das bärtige Gesicht eines mir unbekannten Mannes. Er trug eine der landesüblichen Ganzkörper - Gallabea und ein Turban. Aber das, was mich am meisten beeindruckte, war der Säbel, mit dem er mir vor der Nase herumfuchtelte und immer wieder irgendetwas laberte.
„Ich kann sie nicht verstehen“, sagte ich. Ich versuchte es mit Deutsch, Englisch und Latein. Plötzlich trat der Typ beiseite und ein etwas größerer trat in mein Sichtfeld.
„Wer sind sie?“, fragte er in Englisch.
„Mein Name ist Rolf Rüdiger Klinger, ich komme aus Deutsch… Germanien“, verbesserte ich mich „und bin Medikus“ antwortete ich auch auf Englisch.
„Ihr seid Medikus?“, fragte er und schaute sich fragend um. „Wo sind eure Begleiter? Eure Unterlagen, eure Utensilien? Ihr wollt mir doch nicht weismachen, dass ihr allein durch die Wüste reist!“
„Wieso allein?“, fragte ich, scheinbar etwas dümmlich aussehend. Ich stand auf, ging zum Zelteingang und schaute hinaus. Genau in das schrecklich schöne Maul eines Kamels. Eine ganze Menge von diesen Tieren mitsamt ihren Reitern war zu sehen. Ansonsten sehr wenig. Das Lagerfeuer war aus, kein weiteres Zelt war zu sehen. Lediglich das kleine Zelt, in dem ich mit dem Mädchen Aynur gelegen hatte. Moment, wo war Aynur? Ich schaute mich im Zelt um. Nichts, absolut nichts war im Zelt. Mein Gesichtsausdruck muss ungefähr dem eines Nilpferdes ähnlich gewesen sein.
„Aber gestern waren Omar und die anderen doch noch da“, sagte ich mehr fragend zu mir. Hatte ich das alles geträumt?
„Mein Name ist Mohamed Wasula Ahmed Turk“, sagte der Hüne. „Wir verfolgen seit fünf Tagen die Entführer meiner Tochter. Habt ihr ein Mädchen bei den Geflohenen gesehen? Erzählt schon, bevor ich euch zu Allah befördere.“ Damit hob er seinen Säbel an meine Kehle und sah überhaupt nicht freundlich aus.
Jetzt wusste ich, warum Omar und seine Kumpels Englisch
Sprachen. Es waren Sklavenhändler!
„Also“, sagte ich, „das war so….“ Ich erzählte, dass ich überfallen und ausgeraubt worden bin, schließlich sollte es ein bisschen glaubwürdig sein. Das ich schließlich nachts auf dieses Lager gestoßen sei. Hier wurde mir geholfen und ja, es wäre ein Mädchen dabei gewesen. Allerdings war das Mädchen sehr schwer krank.
„Wie sah das Mädchen aus?“, fragte Mohamed Wasula.
„Nun, das Gesicht habe ich nicht gesehen, sie war verschleiert. Sie hatte aber ein sehr schönes Kleid mit einer sehr auffälligen Musterung an. Es wäre die Tochter von Omar, so sagte man mir.“
„Dieser hinterhältige Sohn eines Eunuchen“ fuhr Mohamed Wasula hoch. „Was war mit Aynur?“
„Ja, so nannte sie auch Omar“, antwortete ich. „Sie hatte die Seitenkrankheit. Ist euch das ein Begriff?“
„Die Seitenkrankheit!“, rief Mohamed Wasula und wurde etwas bleicher. „Daran stirbt man!“, rief er und schaute mich fassungslos an.
„Ja“, sagte ich, „aber ich habe sie behandelt und sie sollte eigentlich wieder gesund werden, wenn die Operation“, wollte ich sagen, besann mich aber eines Besseren, „die Behandlung erfolgreich war“ sagte ich stattdessen. Mohamed Wasula schaute mich lange an.
„Und wie ging es weiter?“
„Nach der Behandlung von Aynur war ich sehr müde, denn es war sehr, sehr anstrengend gewesen. Das „sehr anstrengend“ betonte ich dabei ausdrücklich. „Ich hatte mich schlafen gelegt, bis ihr mich freundlich geweckt habt. Wo die anderen sind, weiß ich wirklich nicht. Aber sie sagten, sie wollten nach Alexandria. Doch ob es stimmt, kann ich nicht sagen.“
„Nun“, sagte Mohamed Wasula, „wir werden weiter Richtung Alexandria reiten, es ist am nächsten. Eine gute Nachricht habe ich für Euch“ grinste er. „Ihr kommt mit, keine Widerrede!“, sagte er mit einem sehr ernsten Gesichtsausdruck.
Ein Kamel wurde herangeholt und ich sollte aufsteigen.
Oh Gott, auf so einem Flohteppich reiten, das hatte ich noch nie gemacht. Mohamed Wasula zeigte mir, wie es ging und nach kleinen anfänglichen Schwierigkeiten klappte es ganz gut.
Bis zum Abend hatten wir eine gute Strecke zurückgelegt und Wasula meinte: „Morgen Abend werden wir die Stadt Alexandria erreichen. Ich hoffe für euch, Effendi, dass ihr nicht gelogen habt.“
Na toll, ich hatte einen verrückten Vater an der Backe, der mir die Schuld für die ganze Sache gab. Was konnte ich denn dafür, dass er nicht besser auf seine Tochter aufgepasst hatte. Immerhin hatte ich ihr das Leben gerettet. Typisch, Undank ist der Welten Lohn! Es wurde ein Lagerfeuer angezündet.
„Kommt zu mir, Effendi und berichtet mir von euch“, sagte Mohamed Wasula. Ich setzte mich also ans Feuer und erzählte meine frei nach Münchhausen erdachte Geschichte, die sich aber mit der deckte, die ich schon Omar aufgetischt hatte. Anschließend gab es etwas zu essen und zu trinken, was zwar nicht besonders schmeckte, aber sättigte.
„Versucht nicht zu fliehen, Effendi“, sagte Mohamed Wasula. Dabei tätschelte er seinen Säbel und legte sich schlafen. Blödmann dachte ich bei mir. Wo sollte ich den hinlaufen? Müde vom langen Reiten legte ich mich schlafen.
Schon sehr früh wurde ich geweckt.
„Wir wollen weiter“, sagte Mohamed Wasula.
„Ein paar Brötchen und ein weich gekochtes Ei samt Kaffee wären toll“, sagte ich und grinste. Allerdings schaute mich Mohamed Wasula nur an und ging weg.
„Scheint, der Kaffee fällt aus“, sagte ich zu mir und nach einem mehr als kargen Frühstück ritten wir wieder los. Wir waren ungefähr eine Stunde geritten, als plötzlich Mohamed Wasula anhielt.
„Was ist“, fragte ich, „gibt es eine Spur?“
„Nein, schlimmer, einen Sandsturm“, sagte Mohamed Wasula und deutete in Richtung der Sonne. Ich schaute hin und sah nur eine dunkelbraune Wand, die langsam näherkam.
„Wir müssen sofort anhalten und uns schützen“, erklärte Mohamed Wasula. Wie eine Wagenburg wurden die Kamele zum Sitzen gebracht. Die Männer setzten sich neben die Kamele, nahmen Decken und Tücher und schützen sich. Wasula gab mir ebenfalls eine Decke. Einen Sandsturm hatte ich auch noch nicht erlebt.
Wenn ich gewusst hätte, was da auf mich zukam, ich hätte gerne auf diese Erfahrung verzichtet. Unglaublich schnell war er da. Es wehte ein warmer Wind, der ständig stärker wurde und immer mehr Sand heranwehte. Sprechen war nicht mehr möglich. Hätte man es versucht, der Mund wäre in kürzester Zeit voll mit Sand gewesen. Selbst bei geschlossenem Mund hatte man schon ständig Sand im Mund. Meine Augen waren fest verschlossen und tränten trotzdem.
Unglaublich, wie laut es war. Andauernd heulte der Wind und der Sand kam einem vor, als ob jemand mit Schmirgelpapier an einem herumrubbelt. Es war nicht nur unangenehm, sondern tat sogar weh. Man wurde regelrecht unter Sand begraben. Da musste man schon ganz schön aufpassen, dass man nicht lebendig beerdigt wurde.
Das Zeitgefühl hatte ich völlig verloren. War es schon eine Stunde, zwei oder mehr? Keine Ahnung! Durch das ständige Lärmen des Windes wurde ich langsam irre. Ich hielt mir die Ohren zu und hoffte, dass es bald vorbei wäre.
Endlich, nach gefühlten 10 Stunden, ließ der Wind nach und der Sand wurde weniger. Danach Stille, das tat richtig gut. Überall wühlten sich die Männer wieder aus dem Sand. Scheinbar waren sie so etwas gewöhnt. Keine große Sache.
„Nicht der Rede wert, passiert hier öfter“, erklärte mir Mohamed Wasula.
„Ja, war ganz nett, nicht wirklich aufregend“, erwiderte ich und spuckte Sand aus. Mein Mund war trockener als die Wüste Gobi. Überall am Körper war Sand. Ich wog mindestens fünf Kilogramm mehr. Aufstehen und herumhüpfen, abklopfen, das Gewand vom Sand leeren. Mohamed Wasula gab mir etwas Wasser zu trinken. Was für ein Genuss! Anschließend wurden die Kamele befreit und ohne großes Palaver ging es weiter. Das wäre bei uns auf der Titelseite der Bildzeitung gewesen. Hier gab es nicht einmal eine Randnotiz, verrückte Welt!
Ohne viele Umstände ritten wir weiter. Gegen späten Nachmittag, mir tat mein Hinterteil mehr weh, als ich erzählen kann, erreichten wir die Stadt Alexandria. Ein imposanter Anblick. So groß hätte ich sie mir nicht vorgestellt. Überall die hohen Türme und die vielen Häuser. Wahnsinn!
„Wie wollt ihr hier Omar finden?“, fragte ich Mohamed Wasula.
„Da benötigen wir viel Glück. Wenn ich den Kerl richtig einschätze, wird er versuchen, meine Tochter zu verkaufen. Das kann er am besten auf dem Basar. Nur dort wird gehandelt. Mit allem, was es gibt.“
„Aber Menschen? Werden die auch so verkauft? Ist der Sklavenhandel denn noch möglich?“, fragte ich.
Mohamed Wasula schaute mich sehr fragend an und sagte: „Selbstverständlich, es werden Mädchen und Jungen offiziell angeboten und verkauft, aus allen Ländern“, antwortete Mohamed Wasula.
Wir ritten in die Stadt und erreichten den Basar. Ein buntes Treiben erwartete uns. Überall waren Händler mit ihren Waren und riefen irgendetwas, um die Kunden von ihrer Ware zu überzeugen. Da waren Stände mit Gewürzen in allen Farben, Kleidungsstücken in den prächtigsten Stoffen. Stände mit Essen, Früchten, mit Krügen und was weiß ich noch.
Wir stiegen ab und die Kamele wurden angebunden. Zwei Männer blieben bei den Kamelen und versorgten sie mit Wasser und Futter. Die anderen Männer teilten sich auf. Sie schienen genau zu wissen, wonach Sie suchten. Mohamed Wasula nahm mich an seine Seite und bedeutete mir ihm zu folgen. Nun, was sollte ich auch sonst tun? Hatte eh nichts im Terminkalender stehen.
Wir gingen recht schnell durch die Gassen der Händler. Hier und da sprach Mohamed Wasula einen Händler an. Die meisten schüttelten mit dem Kopf. Ich nahm an, dass er nach seiner Tochter fragte. Irgendwann zeigte einer der Händler in eine Richtung. Dort sollte ein Händler sein, der mit Sklaven handelte, erklärte mir Mohamed Wasula. Wir liefen los. Als wir an den besagten Stand kamen, war ein kleiner unscheinbarer Mann mit kurzen schwarzen Haaren damit beschäftigt, ein paar Krüge ordentlich aufzustellen. Mohamed Wasula begrüßte ihn, als ob er ihn schon lange kannte. Es entwickelte sich ein Gespräch, das ich leider nicht verstand. Mohamed Wasula wurde immer lauter und zog plötzlich den Mann zur Seite, und bevor ich wusste, was los war, hatte er seinen Säbel an der Kehle des Mannes. Das kannte ich doch irgendwoher. Kurz darauf kam Mohamed Wasula zu mir.
„Die Söhne von Schweinen waren hier. Sie sollen unten am Hafen sein“, sagte er. Kurz darauf eilten wir mit den Männern von Mohamed Wasula in Richtung Hafen. Dort lagen viele kleinere und größere Schiffe und Boote. Ein emsiges Treiben herrschte auch hier. Ständig liefen Männer mit irgendwelchen Gütern auf die Schiffe herauf oder von den Schiffen herunter. Wie sollten wir da Omar finden? Plötzlich fielen mir zwei Männer auf, die einen Teppich trugen. Er musste sehr schwer sein. Außerdem war er sehr dick.
„Ich wette“, sagte ich zu Mohamed Wasula, „dort ist deine Tochter drin.“
Im Eiltempo liefen wir zu den Männern. Die Männer von Mohamed Wasula zogen ihre Säbel, und bevor sie die Männer mit dem Teppich erreichten, kamen andere Männer von überallher. Auch Omar war dabei. Da ich kein Kämpfer, geschweige denn eine Waffe hatte, hielt ich mich zurück. Es gab einen heftigen Kampf. Überall wurde gekämpft und es gab Tote und Verletzte. Mohamed Wasula war ein guter Kämpfer, er wirbelte mit seinem Säbel durch die Gegend, dass einem schwindelig wurde. Wie viele Angreifer es waren, kann ich nicht sagen. Ich hatte hinter einem Fass Schutz gesucht und wartete auf den Ausgang des Kampfes. An den Teppich zu kommen, war so gut wie unmöglich, ohne von den Kämpfenden entdeckt zu werden.
Mohamed Wasula und seine Männer kämpften mit dem Mut der Verzweiflung.
Mohamed Wasula und Omar kämpften wie in den besten amerikanischen Abenteuerfilmen. Leider war das hier kein Film. Da, Mohamed Wasula schlug eine Finte und stieß Omar den Säbel in den Bauch. Blut spritze und lief am Säbel von Mohamed Wasula entlang. Das war das Ende des Kampfes. Die anderen Kämpfer hatten gesehen, dass ihr Anführer gefallen war, und zogen sich wie flinke Ratten zurück. Ich kam aus meinem Versteck und lief zum Teppich. Vorsichtig wurde er auseinandergefaltet und da lag sie, Aynur. Sie war wach, und als sie ihren Vater sah, fing sie an zu weinen und umarmte ihn.
„Lasst mich nach der Wunde sehen“, sagte ich. Vorsichtig schob ich ihre Bekleidung an der Hüfte beiseite und sah, dass der Verband blutig war.
„Sie muss sofort neu verbunden werden“, sagte ich. Mohamed Wasula nahm seine Tochter und trug sie auf den Armen.
„Kommt mit“, sagte er knapp. Ein kleines Haus am Rand des Hafens war unser Ziel. Es war so eine Art Wirtshaus. Mohamed Wasula stürmte hinein und rief etwas zum Wirt. Der zeigte auf einen angrenzenden Raum. Dort war ein Bett. Mohamed Wasula legte Aynur vorsichtig darauf.
„Ich benötige Verbandszeug und heißes Wasser“, sagte ich zu Mohamed Wasula. „Nadel und Faden wären ebenfalls angebracht, wenn ich einige Wunden deiner Männer sehe.“ Wahrscheinlich musste ich auch die Wunde von Aynur neu versorgen, aber das behielt ich lieber für mich.
Mohamed Wasula sprach mit dem Wirt und einer seiner Männer machte sich auf den Weg, um die Sachen zu holen. Kurz darauf hatte ich alles, was ich brauchte, versorgte die Wunde von Aynur und flickte die Männer zusammen. Einige Wunden musste ich ohne ein schmerzstillendes Mittel nähen. Doch kein Laut des Schmerzes kam über die Lippen der Männer.
Ich hatte mehr Glück als Verstand gehabt. Der Verband von Aynur sah schlimmer aus, als es war. Sie hatte geblutet, aber ansonsten war alles in Ordnung.
„Hört, Mohamed Wasula, eure Tochter sollte mindestens zwei Tage das Bett hüten. Die Wunde muss heilen. Das geht nicht, wenn sie auf einem Kamel durch die Wüste reitet.“
Mohamed Wasula schaute mich an, nickte und sagte: „Gut Effendi, wir bleiben hier, bis meine Tochter wieder reisen kann. Ihr seid mir für ihre Gesundheit verantwortlich.“
Eine Stunde später saßen wir beim Essen, Aynur schlief.
„Effendi Rolf“, sagte Mohamed Wasula. Ich horchte auf, denn vorher hieß ich nur Effendi.
„Ihr habt meine Tochter gerettet. Was bin ich euch schuldig?“
„Mohamed Wasula, ihr habt auch mein Leben in der Wüste gerettet.“
„Nein, ihr Wart nicht in Gefahr, Effendi Rolf, aber meine Tochter war todkrank. Ihr habt sie gerettet. Deshalb stehe ich in eurer Schuld. Was kann ich für euch tun?“
Ich überlegte und sagte: „Mohamed Wasula, ich beherrsche eure Sprache nicht, aber ich muss hier als Medikus arbeiten. Könntet ihr mir die Sprache beibringen? Etwas Geld, bis ich allein zurechtkomme, wäre auch nicht schlecht. Nicht viel, nur, dass ich ein paar Tage etwas zu essen habe. Wenn das nicht zu unverschämt ist“, ergänzte ich.
Mohamed Wasula schaute mich an, lächelte und sagte grinsend: „Nein, das geht in Ordnung, Effendi Rolf. Aber ich kann euch nicht meine Sprache beibringen. Dazu habe ich weder die Zeit noch die Geduld. Doch mein Freund Farid Mahmut Gerka hier“, damit zeigte er auf einen Mann, der rechts neben ihm am Tisch saß.
„Er wird zwei Monde bei euch bleiben und euch unterrichten. Ebenso bekommt ihr etwas Geld von mir, um zwei Monde hier in Alexandria zu leben.“
„Das ist sehr großzügig von euch, Mohamed Wasula“, sagte ich und hatte ein paar Tränen in den Augen.
Die nächsten Tage kümmerte ich mich ausschließlich um die Wunden der Männer und von Aynur. Dank wem auch immer, hatte sie keine Infektion, was schon an ein kleines Wunder grenzte.
Ich fing sofort an, mit Farid zu lernen. Es war schwer, aber ich war ein gelehriger Schüler, wie Farid mir versicherte. Er hatte aber auch eine tolle Art, mir die Sprache beizubringen. Wir gingen durch die Straßen und er zeigte auf Gegenstände und sagte mir, wie sie hießen. Anschließend musste ich sie nachsprechen. So klappte es wunderbar.
Nach drei Tagen kontrollierte ich zum letzten Mal die Wunde von Aynur. In ein paar Tagen könnten die Fäden gezogen werden. Das konnte auch ein Baader machen. Mohamed Wasula sagte, er kenne einen guten Baader, der dies machen könne. Aynur konnte schon einige Schritte gehen. Reiten war aber noch nicht möglich. Mohamed Wasula hatte einen Wagen für Aynur besorgt, so konnte sie im Liegen reisen. Die Verabschiedung war herzlich, aber kurz.
„Ich hoffe, euch noch einmal wiederzusehen, Effendi Rolf.“
„Das hoffe ich auch“, antwortete ich.
„Salam Aleikum!“, sagte Mohamed Wasula und ich antwortete: „Aleikum Salam!“
Nun war ich mit Farid allein und musste sehen, dass ich schnell die Sprache beherrschte. Zwei Monde waren nicht viel Zeit. Farid ging durch die Stadt und verbreitete, dass ein neuer und sehr guter Medikus in der Stadt sei, der sogar die Seitenkrankheit heilen konnte. Es dauerte nicht lange und schon kamen die ersten Sabirah, was im arabischen Patienten bedeutet.
Farid hatte mir ein Zelt gekauft und es in der Nähe vom Basar aufgestellt. Farid hatte auch dafür gesorgt, dass es einen guten Platz bekam. Auf dem Basar wurden auch die Bestrafungen öffentlich durchgeführt. Dieben wurde die Hand abgehakt, dort konnte ich noch den Stumpf vernähen. Frauen, die des Ehebruchs überführt waren, wurden die Bäuche aufgeschlitzt. Da war selbst meine Macht am Ende. Prügelstrafen gab es fast täglich. Stockhiebe auf Fußsohlen oder auf den Rücken. Da konnte ich wieder helfen, aber das musste mehr im Geheimen geschehen, denn es waren ja Gesetzesbrecher und die Strafe war schließlich zur Abschreckung da. Wenn ich die Strafe durch meine Hilfe milderte, so brachte ich mich in Gefahr, ebenfalls eine Strafe zu bekommen.
Also kamen die Bestraften heimlich abends zu mir. Wir trafen eine „Najawa“, was schlicht eine geheime Unterhaltung oder Abmachung war. Ich behandelte die zerschlagenen Fußsohlen und die meist blutigen Rücken. Ohne Hilfe würden viele diese Strafen nicht lebend überstehen. Es gab auch Infektionen, doch ich hatte leider kein Penicillin. Das sollte ich schnellstens erfinden. Ich hatte mir einige Utensilien mithilfe von Farid gekauft. Ein Skalpell, Verbandszeug und was ich sonst so alles gebrauchen konnte. Die Sachen waren zwar nicht mit den Sachen aus meiner Zeit zu vergleichen, aber Not macht erfinderisch.
Farid stellte mich einem Apotheker vor. Mit seiner Hilfe hatte ich einige Salben und Tinkturen zusammengebraut. Der Apotheker staunte nicht schlecht, als ich mein Wissen über einige Kräuter an den Mann brachte. Auf der anderen Seite erstaunte er mich, denn von einigen Sachen hatte ich noch nie gehört, aber so ergänzten wir uns. So bekam ich die Mohnsalbe und er sagte mir, Opium könne man nutzen, um für kurze Zeit zu betäuben. Wenigstens etwas, um Schmerzen zu lindern.
Meine Patienten waren anfangs sehr skeptisch, schließlich war ich kein einheimischer Medikus. Doch das legte sich langsam. Kleine Wehwehchen und auch wieder sehr schwere Erkrankungen, wo jede Hoffnung verloren war, wurden von mir behandelt, aber nicht jede geheilt. Mit der Sprache hakte es hier und da, aber das nahm man mir nicht übel. Denn ich war ja ein Medikus aus Europa. Knochenbrüche waren an der Tagesordnung, Schnittverletzungen und hier und da auch mal Quetschungen, wo selbst ich nur noch amputieren konnte. Doch das machte ich sehr geschickt und so war ich bald mit Arbeit eingedeckt. Farid hatte mir auch beigebracht, was ich als Lohn nehmen konnte. Von den Armen wenig, von den Reichen viel. Auch wie ich sie unterscheiden konnte, brachte mir Farid bei.
So vergingen die Tage. Tagsüber versorgte ich die Patienten und abends lernte ich zusätzlich die Sprache. Sprechen konnte ich die Sprache schon ganz gut, auch verstehen konnte ich. Aber schreiben und lesen, da war ich noch zweite Klasse.
Ich sparte, soviel ich konnte von meinen Einnahmen. Ein schönes Sümmchen hatte ich bald zusammen. Aber es reichte noch lange nicht, um nach Deutschland zu reisen. Ich wohnte in meinem Zelt am Rande vom Basar. In der Nähe gab es die Möglichkeit sich zu waschen und eine Latrine. Nicht gerade schön, aber es sollte ja nicht für immer sein. Denn mein Ziel war klar: ab nach Deutschland!
Nur wie, das stand noch in den Sternen. Es gab die Möglichkeit, eine Schiffsreise nach Italien zu kaufen, aber das würde sehr lange dauern und war auch nicht sicher. Vor allem war es teuer.
Am 07. September 1148 verließ mich Farid. Der Abschied war kurz, aber herzlich. Ich trug inzwischen nur noch landesübliche Kleidung, um nicht zu sehr aufzufallen.
Die Wachen des Basars behandelte ich selbstverständlich zuvorkommend und umsonst. Schließlich wollte ich nicht riskieren, im Kerker zu landen, weil ich irgendwelche Landesgesetze nicht beachtete. Da ich sie umsonst behandelte, war mein Zelt, das am Besten bewachte auf dem ganzen Basar.
Ich hatte irgendwo gelesen, dass der Mensch im Laufe seines Lebens drei Spinnen im Schlaf verschluckt. Das hatte ich locker in den ersten Wochen meines Aufenthaltes hier schon überboten. Denn mein Zelt war alles andere als komfortabel zu nennen. Aber ich hatte wenigstens ein Dach über dem Kopf und musste nicht auf der Straße schlafen. Um endlich wieder nach Deutschland zu kommen, hatte ich mich umgehört. Es gab Karawanen, die nach Europa aufbrachen. Das Geld hätte ich wohl verdienen können, denn auch unterwegs gab es für einen Medikus immer Arbeit. Aber die Reise würde viele Monate dauern und war beschwerlich. Darauf hatte ich keine Lust.
Wenn ich daran dachte, schlappe fünf Stunden mit einem Flugzeug und ich wäre in Hamburg gewesen. Meine Heimreise würde jetzt erheblich länger dauern.
Mein alter Freund Marco hatte mir das Segeln auf seinem Katamaran beigebracht. Ich war zwar kein Könner, aber es war auch nicht unterste Schublade. So kam ich auf eine verwegene Idee. In meiner „Freizeit“ zeichnete ich die Konstruktionspläne für einen Katamaran. Nicht so schön, wie zu meiner Zeit, aber es sollte hier in dieser Zeit möglich sein, das Schiff zu bauen. Nachdem alles fertig war, machte ich mich auf den Weg zum Bootsbauer.
Kapitel 4
Der Bootsbauer Ibrahim Isaak schien nach seinem Aussehen und vom Namen her ein Jude zu sein. Was mich aber nicht störte, ganz im Gegenteil. Ordentlich feilschen machte mir Spaß. Vielleicht war er ja meinem Bauvorhaben nicht abgeneigt. Nach der üblichen Begrüßung erklärte ich ihm, dass ich beabsichtige, ein kleines, aber durchaus seetüchtiges Schiff zu kaufen.
„Oh, ich kenne Euch, Medikus Rolf, ihr habt meinem Vater bei seiner schweren Armverletzung so gut geholfen, dass er seinen Arm nicht verloren hat. Deshalb bin ich euch etwas schuldig“, sagte Ibrahim und deutete auf eine kleine Ecke im Raum, wo wir uns setzen konnten. Er servierte als Erstes einen Tee. „Ihr möchtet also ein Schiff kaufen“, sagte Ibrahim, „leider habe ich im Moment keines fertig.“
„Das ist auch gut so“, sagte ich und zeigte meine Pläne.
„Was ist das für eine sonderbare Konstruktion, Medikus? So etwas habe ich noch nie gesehen“, sagte Ibrahim und studierte aufgeregt und sehr neugierig meine Pläne.
„Was kostet mich das, wenn ihr es für mich baut? Vor allem, wie lange wird es dauern?“, fragte ich.
Ibrahim nahm einen Abakus und fing an zu rechnen. Nach einigen Minuten hatte er die Berechnung fertig.
„Medikus Rolf, weil ihr es seid, werde ich das Schiff für euch bauen. Es soll euch nichts kosten außer dem Material, wenn ich die Pläne anschließend weiterverwenden darf. Wenn alle meine Söhne und Arbeiter daran arbeiten, sollten wir in drei bis vier Monaten fertig sein. Was sagt ihr Medikus Rolf?“
Als Antwort gab ich ihm meine Hand, legte eine ordentliche Menge von meinem sauer verdienten Geld auf den Tisch und wir machten den Vertrag.
Drei Monate noch Zeit, um Geld zu verdienen, damit ich Ausrüstung kaufen konnte. Das Schiff war bestellt, hatte aber noch keine Segel, ganz zu schweigen von den anderen Sachen, die ich auf meiner Reise brauchen werde. Nahrung, Wasser, eine Seekarte, wenn es so etwas überhaupt gab. Einen Kompass, vielleicht auch eine Waffe, ich wusste ja nicht, was auf mich zukam.
Die nächsten Wochen vergingen mit viel Arbeit als Medikus. Zwischendurch hatte ich beim Segelmacher die Segel bestellt. Er hatte zwar etwas erstaunt geschaut, als ich ihm erklärt hatte, was ich wollte, aber ich zahlte seinen Preis und so wurden wir uns einig. Er meinte zwar, dass die Segel nichts taugten, und wollte wissen, was für ein Schiff denn solche Fetzen gebrauchen kann, doch ich sagte nichts. Es waren schließlich moderne Segelformen, die auch ordentlich Geschwindigkeit bringen sollten.
Wasser konnte ich entweder in Fässern, Krügen oder in Ziegenfellbeuteln mitnehmen. Am besten war, ich nahm von jedem etwas mit. Obst und Gemüse konnte ich nur begrenzt, Fleisch und Fisch getrocknet mitnehmen. Fladenbrot und andere Backwaren würden sich nicht lange halten. Meine Liste der zu besorgenden Sachen wurde immer länger. Das Geld, das ich als Medikus verdiente, verschwand gleich wieder für die Besorgungen.
Das meiste lagerte ich bei Ibrahim ein, da das Schiff dort gebaut wurde.
Die Zeit verging und das Schiff näherte sich der Fertigstellung. Ibrahim hatte es im hinteren Teil seiner kleinen Werft gebaut, denn es sollte niemand vorher sehen. Er wollte ja anschließend mehr davon bauen und verkaufen. Für mich war das ein Segen, denn langsam wurde ich als Medikus sehr bekannt. Man hatte mir gesteckt, dass sogar der Statthalter von Alexandria auf mich aufmerksam geworden war. Das passte mir gar nicht. Schließlich wollte ich nicht auch noch in die höheren Kreise kommen. Denn ich wusste nicht, was alles bereits durch mein Wirken hier in der Vergangenheit in der Zukunft verändert worden war. Ich wollte möglichst nicht zu sehr in Erscheinung treten, um in der Zukunft möglichst wenig zu verändern. Denn ich hoffte, irgendwie in meine Zeit zurückzukommen. Hatte zwar keinen Schimmer, wie ich das anstellen sollte, aber Hoffnung stirbt zuletzt. Falls nicht, so war es mein Schicksal in dieser Zeit zu leben.
Es war an einem schönen sonnigen Tag, wie jeder Tag hier sonnig war, gerade hatte ich einen gebrochenen Arm verarztet und war am Aufräumen. Früher Nachmittag, beste Zeit für einen Tee. Was hätte ich für einen Kaffee gegeben!
„Seid ihr der Medikus aus Germanien?“, fragte eine vermummte Gestalt auf Deutsch.
Ich war völlig perplex. Da sprach jemand deutsch. Aber irgendwie war die Stimme komisch, wie verstellt.
„Ja“, sagte ich ebenfalls auf Deutsch. „Der bin ich. Was kann ich für euch tun?“
Die vermummte Gestalt machte mein Zelt zu, kam näher und nahm ihre Vermummung ab. Wow – eine wunderschöne Frau mit einer schlanken Nase, einem Kussmund und einer sehr gepflegten Haut, sowie Augen, die an einen blauen Bergsee erinnerten, kamen zum Vorschein.
Warum dieses Versteckspiel? Ich nahm an, sie wollte nicht, dass es bekannt wurde, dass sie als Frau allein zu einem Mann ging.
„Eine Wunde an meinem Bein, sie ist entzündet und heilt einfach nicht. Könntet ihr da einmal nachsehen?“
„Gern“, antwortete ich. Ich nahm eine Kordel, hängte sie an den Zelteingang, damit signalisierte ich nach außen, ich hatte Patienten oder war nicht da. So konnte ich in Ruhe arbeiten und vor allem, war auch sie geschützt, denn es war bei Strafe verboten, dass eine Frau sich vor einem Mann entblößte. Die Strafe traf auch den Mann und nicht nur die Frau.
„Setzt euch auf die Liege und macht bitte euer Bein frei“, sagte ich.
Sie raffte ihr Gewand nach oben und setzte sich. Da sah ich schon die Wunde am Oberschenkel. Eine Eiterbeule war zu sehen, das Fleisch um die Wunde sah richtig gammelig aus.
„Das sieht nicht gut aus. Warum kommt ihr erst jetzt?“. Vorsichtig befühlte ich die Wunde.
„Wie ist das passiert?“, fragte ich und nahm mein Skalpell.
„Habe einen Pfeil abbekommen. Den habe ich aber herausgezogen“, sagte sie, als wäre es normal, ein Pfeil in den Oberschenkel zu bekommen.
„Dachte, es würde so heilen“, erklärte sie mir, als ob sie die Einkaufsliste vorliest.
„Höchstwahrscheinlich habt ihr nicht alles herausbekommen und jetzt ist eine schwere Infektion in der Wunde. Da muss ich operieren. Das wird nicht ohne starke Schmerzen gehen. Ich habe nur begrenzte Mittel zur Schmerzunterdrückung, es sei denn, ich betäube euch.“
„Betäuben?“, fragte sie und schaute mich fragend an.
Ich wollte gerade ansetzen und erklären, was ich mit Betäuben meinte, da sagte sie: „Keine Betäubung.“ Das sagte sie so bestimmend, dass es keinerlei Widerspruch zuließ.
„Nehmt wenigstens dieses Medikament, es wird die Schmerzen etwas lindern.“
Nach einem leichten Zögern nahm sie das Medikament. Es war eine Mischung vom Apotheker. Es kam einem starken Schmerzmittel gleich, obwohl ich nicht wusste, welche Nebenwirkungen es hatte. In Selbstversuchen hatte ich es getestet. Es funktionierte gut. Die Schmerzen waren nicht mehr ganz so stark, teilweise ganz weg. Aber bei dieser Operation würde es ordentlich wehtun.
„Mir wird so komisch“, sagte sie.
Ich nickte, gab ihr ein sauberes Beißholz und sagte: „Benutzt das, ihr werdet es brauchen.“ Sie nahm es zwischen die Zähne und ich sagte: „Schließt die Augen.“
Sie tat es und ich wartete nicht lang, ein Schnitt mit dem Skalpell und ihr unterdrückter Schmerzlaut war praktisch eins. Sie hatte sich so fest an der Liege festgekrallt, dass ich schon befürchtete, die Liege würde es nicht aushalten. Trotz Schmerzmittel konnte ich gut nachempfinden, was für Schmerzen sie ertragen musste.
Es ergoss sich eine stinkende Brühe aus der Wunde. Schnell und konzentriert arbeitete ich. Ausspülen, weiter öffnen und den Übeltäter finden. Ein kleines Stück Pfeilspitze hatte sich tief, sehr tief in den Oberschenkel gebohrt. Es steckte im Knochen. Ich nahm eine meiner spitzesten Zangen und holte den Pfeilrest heraus. Danach säuberte ich die Wunde.
Wie ich es vermutet hatte, war meine schöne Unbekannte in Ohnmacht gefallen, trotz der Medikamente.
Die Wunde sah schlimm aus. Eine schlimme Entzündung an den Wundrändern ließ mich eine Entscheidung treffen. Ich schnitt vorsichtig einen kleinen Streifen entlang der entzündeten und gammeligen Haut ab. Säuberte alles penibel und vernähte die Wunde sehr sorgsam mit feinen Stichen. Die Narbe sollte nicht so heftig werden. Als ich fertig war, säuberte ich alles, legte ein neues Laken auf die Liege. Dabei musste ich die Frau anheben. Sie war nicht schwer, keine 50 kg schätzte ich.
Ich entfernte das Beißholz aus ihrem Mund. Es war fast durchgebissen. Ich schaute mir das Gesicht genauer an. Sie sah wahnsinnig gut aus, wohlproportioniert und unglaublich sexy. Schweren Herzens bedeckte ich ihr Gesicht mit ihrem Schleier. Falls jemand hereinschaute, war sie wenigstens nicht unbedeckt. Danach versuchte ich, sie zu wecken. Es gelang. Langsam kam sie zu sich und stöhnte.
„Oh, diese Schmerzen“, sagte sie und trotz ihres Schleiers konnte ich sehen, dass sie ihr Gesicht verzog.
Ich gab ihr etwas zu trinken und fragte: „Verratet ihr mir jetzt euren Namen?“
„Rosa Teuber“, antwortete sie. „Eigentlich Rosalinde, aber ich bevorzuge Rosa.“
„Rolf“, erwiderte ich, „eigentlich Rolf-Rüdiger Klinger. Aber mich nennen alle Medikus Rolf“, sagte ich grinsend.
„Was ist mit meinem Bein?“, fragte sie.
„Wie vermutet war noch die Spitze des Pfeils drinnen“, sagte ich und zeigte ihr das Teil.
„Ich dachte, ich hätte alles herausgezogen“, meinte sie nur. Sie stand auf und setzte sich sofort wieder. „Aua! Das tut aber noch sehr weh.“
„Nach so einer Operation solltet ihr noch nicht wieder durch die Gegend laufen. Normalerweise solltet ihr jetzt ein paar Stunden schlafen. Ihr müsst das Bein auf alle Fälle schonen. Keine Belastung!“, sagte ich hart. „In den nächsten Tagen wird sich zeigen, ob euer Bein gut heilt. Wenn nicht, müssen wir sehen, was ich noch machen kann. Wo wohnt ihr?“
„Ich wohne am anderen Ende der Stadt“, sagte Rosa.
„Da kommt ihr nie ohne Hilfe hin. Seid ihr verheiratet?“, fragte ich mit plötzlichem Herzklopfen.
„Nein, wieso fragt ihr? Auf mich wartet nur die Arbeit.“
„Die kann warten“, sagte ich irgendwie erleichtert. „Ich werde ein paar Träger rufen“.
„Nein! Bitte keine Träger“, sagte Rosa irgendwie ängstlich.
„Dann legt euch hin und schlaft. Ich passe auf, dass euch niemand stört. Keine Widerrede!“, sagte ich nun bestimmend und nahm eine Decke und legte sie auf Rosa. Anschließend ging ich aus dem Zelt und setzte mich auf einen Hocker und trank einen Tee. Es war inzwischen fast Abend und wo sollte ich schlafen? In meinem Zelt schlief Rosa. Ich schaute nach ihr. Tief und fest schlief sie. Also nahm ich eine Decke und legte mich im Zelt von innen vor die Zelt Tür. So würde ich immer merken, wenn jemand ins Zelt wollte oder wenn Rosa Hilfe brauchte.
Am nächsten Morgen war ich früh wach. Ich hatte nicht besonders gut geschlafen und mir taten die Knochen vom Liegen auf dem Fußboden weh. Rosa war noch im Traumland. Ich legte meinen Handrücken auf ihre Stirn. Nein, Fieber war nicht spürbar. Sie wachte von der Berührung auf.
„Was? Ach ja“, sagte sie, als ob sie sich erst einmal zurechtfinden musste.
„Wie geht es euch?“, fragte ich. „Schmerzt das Bein noch sehr?“
Sie tastete nach ihrem Bein und sagte: „Ja, es schmerzt noch, aber nicht so wie vorher. Irgendwie anders.“
„Gut, ich muss den Verband wechseln“.
Sie richtete sich vorsichtig auf und machte das Bein frei. Der Verband war teilweise mit Blut bedeckt. Ich nahm ihn ab und schaute mir die frisch operierte Wunde an. Sie sah den Umständen entsprechend gut aus. Ein frischer Verband war schnell angelegt.
„Habt ihr Hunger? Wie wäre es mit Frühstücken?“
Sie nahm lächelnd an. Ich bereitete ein kleines Frühstück vor, nichts Besonderes. Es war auch nicht viel da. Ein paar Rühreier, ein bisschen Obst, Tee und Fladenbrot mussten reichen.
„Erzählt ihr mir, wie ihr nach Ägypten gekommen seid?“, fragte ich.
„Mein Vater war ein Teppichhändler aus Ulm. Er hat mich nach dem Tod meiner Mutter auf die Reise nach Ägypten mitnehmen müssen. Als wir nach zwei Jahren hier endlich ankamen, war ich 15 Jahre alt. Mein Vater handelte mit Teppichen und es lief recht gut. Als ich 18 war, starb er plötzlich von heute auf morgen. Wir wollten gerade wieder nach Germanien aufbrechen. So bin ich in Alexandria gestrandet. Ich lebe seither von dem, was mein Vater hinterlassen hat. Er hatte damals Gold und Edelsteine zum Kauf der Teppiche dabei. Davon kann ich noch ganz gut leben, aber keine Karawane wollte mich mit nach Germanien nehmen. Ich bin inzwischen seit 10 Jahren dabei, einen Weg nach Germanien zu finden. Ich will hier weg. Am Anfang war es schlimm. Ich kannte die Sprache, die hatte ich von meinem Vater gelernt, aber als Frau, hier in Ägypten wurde ich nur geduldet. Schließlich bin ich eine ungläubige Europäerin. Und ihr?“, fragte sie, „wie kommt ein Medikus nach Ägypten?“
„Das ist eine lange Geschichte“, sagte ich ausweichend. „Aber, ich will ebenfalls nach Germanien zurück.“
„Das ist mir bekannt“, sagte Rosa.
Ich fiel fast vom Hocker. „Woher?“, fragte ich sie völlig baff.
„Man munkelt in der Stadt, der germanische Medikus hätte ein Schiff bestellt. Das spricht sich herum. Ebenso wie euer guter Ruf. Ihr seid hier in Alexandria der beste Medikus weit und breit. Ich vermute, der Statthalter wird euch bald zwangsverpflichten.“
„Zwangsverpflichten?“ echote ich. „Wieso das?“
„Der Statthalter ist der mächtigste Mann hier in Alexandria. Was er sagt, ist Gesetz. Wenn er sagt, ihr seid nur noch für ihn und seine Familie da, ist das so. Seine Tochter ist schwer erkrankt. Einer Weissagung nach soll ein Medikus aus einem fernen Land kommen und sie heilen. Freut euch, ihr werdet im Palast leben und es wird euch gut gehen. Nur eure Freiheit wird stark eingeschränkt sein“, sagte Rosa lächelnd, „und Fehler überleben die meisten nicht.“
„Ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf“, antwortete ich.
Sie schaute mich etwas irritiert an.
„Es stimmt, ich habe ein Schiff in Auftrag gegeben und es wird nicht mehr lange dauern, bis es fertig ist. Vielleicht noch eine oder zwei Wochen. Es muss noch getestet und ausgerüstet werden. Aber wenn das erledigt ist, bin ich weg.“
„So bald schon?“ erschrak sie. „Würdet ihr mich mitnehmen?“ Das fragte sie mit einem Augenaufschlag, Sibirien wäre sofort eisfrei gewesen, da konnte ich einfach nicht Nein sagen.
„Wir müssen es heimlich machen“, sagte ich. „Eure Sachen müssen in den nächsten Tagen auf dem Schiff sein. Je früher, desto besser. Es ist noch viel zu tun. Niemand sollte erfahren, dass ihr verschwinden wollt. Erzählt es keinem, nicht einmal euren besten Freunden und Bekannten. Der Statthalter wird überall seine Ohren haben.“
„Ja, das will ich tun“, sagte Rosa.
Ich ließ Rosa mit einer Sänfte nach Hause bringen, denn das Bein sollte geschont werden.
„Kommt morgen, spätestens übermorgen wieder, zum Wechseln des Verbandes“, sagte ich zum Abschied. Sie nickte und wurde weggetragen.
Nach diesen Neuigkeiten machte ich mich sofort auf zu Ibrahim. „Wie weit ist das Schiff?“
„Eigentlich fertig“, sagte er.
„Eigentlich?“, fragte ich. Er zeigte auf den fast zwanzig Meter hohen Mast.
„Wie wollt ihr das Segel allein setzen? Das könnt ihr nicht. Es ist viel zu schwer.“
„Dann müsst ihr noch etwas bauen“, sagte ich, nahm ein Stück Papyrus und zeichnete eine Seilwinde mit einem Flaschenzug. Dazu noch ein paar kleinere andere Sachen. Ibrahim schüttelte nur mit dem Kopf, machte sich aber daran, alles fertigzustellen. Die Segel waren geliefert und waren bereits befestigt, die Takelage ebenfalls fertig.
Ich nahm Ibrahim beiseite, gab ihm Geld und sagte: „Besorge bitte Wasser und Essensvorräte. Es wird noch jemand Sachen bringen. Bitte alles Verladen und bitte Stillschweigen.“ Er nahm das Gold, das reichlich bemessen war und sagte: „Meine Lippen sind versiegelt.“
Am nächsten Tag war das Schiff im Wasser, was leider nicht unbemerkt geblieben war. Dazu war es einfach zu auffällig.
Ein herrlicher Katamaran, zwölf Meter lang. Die beiden Schwimmer waren nicht sehr breit, oben nur ein Meter. Nach unten langsam spitz zulaufend. Dort waren Stauräume für Ersatzsegel, Werkzeug und Vorräte. Der Kajüten Teil war zwischen diesen beiden Schwimmern in der Mitte. Er war fünf Meter lang, knapp drei Meter breit und etwas über zwei Meter hoch.
Ganz vorne war ein Raum als Schlafraum abgetrennt, dann kam auf der linken Seite ein Sanitärraum. Dort war von mir ein Wasserklosett konstruiert worden. Regenwasser oder Meerwasser wurde in ein Fass, das oben an der Decke eingebaut war, gefüllt. Wie bei einer Toilette hatte ich einen Schwimmer aus einer kleinen Magenblase geformt und konnte damit, an einem Gestänge mit Kette ziehen, welches dann das Wasser fließen ließ. Die Rohre hatte ich vom Schmied fertigen lassen. Der Abfluss war mit einer Feder versehen, und wenn ich einen Hebel zog, ging die Klappe auf und der ganze Schmutz verschwand im Ozean. Nun, es war zwar nicht sehr umweltbewusst, aber was interessierte mich das zu dieser Zeit. Außerdem war es rein biologisch und somit abbaubar. Die Dusche funktionierte ähnlich. Das Wasser war je nach Sonneneinstrahlung warm oder kalt. Gegenüber vom Sanitärbereich war die Kombüse. Na ja, es war eigentlich nicht mehr als ein Grill. Eine Arbeitsplatte, ein Schrank und das war es mit der Küche. Ganz hinten der Aufenthaltsraum. Hier waren ein Tisch und ein paar Sitzgelegenheiten. Alles sehr beengt, aber das war der Katamaran.
Ich hoffte, er würde ordentlich seetauglich sein. Ibrahim hatte mir versichert, er würde einen Sturm überstehen. Er hatte das Wort „einen“ so komisch betont. Ob er mir damit etwas sagen wollte? Nun war es eh egal.
Die Menschen im Hafen bildeten eine Menschentraube um das Schiff und schauten, teilweise wurde gelacht.
„Was soll das sein, ein Schiff?“ Mist dachte ich, so viel zu nicht auffallen.
„Es ist ein Experiment“, erklärte ich. „Wir wissen noch nicht, ob es überhaupt etwas taugt.“
„Na, schwimmen tut es ja wenigstens“, rief einer.
„Wir wollen testen, ob ein Schiff mit zwei Rümpfen schneller ist, als ein Schiff mit einem Rumpf“, erwiderte ich.
„Da passt doch nichts rein“, meldete sich ein anderer.
„Doch“, sagte ein anderer, „Ratten.“ Es wurde gelacht, kaum einer fand das Schiff gut.
Umso besser dachte ich. Nachdem das Boot ausgiebig begutachtet und schlecht gemacht worden war, gingen die Menschen ihrer Wege.
In den Schwimmrümpfen war zur Stabilisierung des Schiffes ganz unten eine ordentliche Ladung Blei eingearbeitet. Damit lag das Schiff ruhiger und konnte nicht so schnell kippen. Es war mit das Teuerste am Schiff gewesen. Woher Ibrahim das Metall hatte, wollte ich gar nicht wissen.
Die Rümpfe waren hervorragend gelungen. Zwar aus Holz, aber Glasfasermatten waren wohl schlecht in dieser Zeit zu bekommen. Ganz zu schweigen von dem Kunstharz. Das Schiff war voll ausgerüstet und beladen, es fehlte nur noch der blinde Passagier.
Am Nachmittag wurden zwei Truhen gebracht. Ich verstaute sie unter Deck und holte alle wichtigen Sachen aus meinem Zelt. Das Zelt ließ ich stehen, hängte ein Schild mit: „Bin bald wieder da“ an den Eingang. Das sollte die Leute beruhigen. Ich blieb nun auf dem Schiff. Es war schon später Nachmittag, als eine vermummte Gestalt auf das Schiff kam. Es war Rosa. Mit Krücken hatte sie den ganzen Weg hierher gemacht, um nicht aufzufallen. Rasch brachte ich sie unter Deck und schloss die Luke.
„Ich war sehr vorsichtig“, sagte sie. „Niemand wird mich die nächsten Tage vermissen, denn ich besuche angeblich eine Freundin im Nachbarort.“
„Das klingt gut“, antwortete ich und zeigte ihr das Schiff. „Leider müssen wir uns ein Bett teilen“, sagte ich. „Aber es ist breit genug für uns.“
Sie strahlte mich an, sagte aber nichts.
Ich lächelte zurück und meinte: „Sollte doch kein Problem sein oder?“
„Wenn es in Ordnung ist, würde ich dich gerne Rolf nennen“, sagte Rosa plötzlich, „ist einfacher.“
„Das geht in Ordnung, Rosalinde“, sagte ich grinsend. „Lass mich deine Wunde noch mal ansehen, Rosa“.
Die Wunde sah ganz gut aus. Vorsichtig cremte ich sie mit einer Heilsalbe ein und verband sie mit frischen Tüchern. Wir legten uns nach einem kleinen Mahl früh schlafen, denn ich wollte sehr früh aufbrechen.
Am nächsten Morgen, der 8. Tag des 12. Monats des Herrn, es war der Tag, wo wir abreisen wollten, passierte es. Ich war sehr früh wach und bekam mit, dass sich immer mehr Wachen in der Nähe vom Schiff aufhielten. Das Gefühl, dass etwas nicht stimmte, machte sich bei mir breit.
Es war noch nicht richtig hell, aber in einer halben Stunde würde die Sonne aufgehen und dann war garantiert an Abreise nicht mehr zu denken, da die Wachen das verhindern sollten. Die Wachen hatten das Emblem des Statthalters und damit konnte ich mir denken, was sie wollten. Nein, ich hatte andere Pläne. Ich weckte Rosa und sagte ihr, dass es Ärger gibt.
„Bleib hier unter Deck, ich mache den Rest.“
Vorsichtig, damit niemand durch Geräusche auf mich aufmerksam wurde, schlich ich über das Deck, löste die Halteseile und stieß das Schiff ab. Langsam driftete es vom Ufer weg. Keiner schien darauf zu achten.
Als ich so drei Meter gewonnen hatte, setzte ich meine „Schnellsegelsetzmaschine“ in Gang. Ein schweres Gegengewicht sauste nach unten und zog das große Hauptsegel nach oben. Der Wind griff ins Segel und blähte es auf. Glück gehabt, es wehte ein ordentlicher Wind.
Durch den Lärm aufmerksam geworden, kamen die Wachen herangelaufen und riefen: „Halt im Namen des Statthalters von Alexandria, kommt sofort zurück.“
Na klar Mann, ich dachte nicht im Traum daran. Im Gegenteil, ich setzte das Vorsegel und nahm Fahrt auf. Der Katamaran lag prima im Wasser und die Geschwindigkeit, mit der er durchs Wasser glitt, war für diese Zeit sicher ein neuer Rekord. Als ich nach vorne schaute, bekam ich es mit der Angst, denn die Hafeneinfahrt war links und rechts mit Bogenschützen besetzt. Meine einzige Chance bestand darin, in der Mitte zu bleiben und schnellstmöglich durchzufahren.
Wenn die Wachen auf die Idee kamen, mit Brandfeilen zu schießen, hätte ich ganz schlechte Karten. Ich band das Ruder so fest, dass der Katamaran den Kurs beibehalten würde. Schnell kam die Durchfahrt näher und der erste Pfeilhagel prasselte auf das Schiff nieder. Da ich Schutz in der Kajüte gesucht hatte, war ich in Sicherheit. Der Katamaran erreichte die Durchfahrt und fuhr schnell hindurch. Als ich herausschaute, waren Pfeile im Segel stecken geblieben, aber es waren keine Brandpfeile dabei. Sie hatten das Segel zum Glück nicht groß beschädigt.
Als ich zurückblickte, sah ich zwei große Schiffe, die die Verfolgung aufnahmen. Sollen sie, dachte ich, bei der Geschwindigkeit, die mein Schiff erreichen würde, waren diese lahmen Pötte keine Gefahr.
Mein Schiff sah aus wie ein Igel. Überall steckten die Pfeile. Ich entfernte die Pfeile vorsichtig, so hatte ich eine ganze Menge an Munition. Ein Bogen konnte ich mir selber bauen. Da ich überstürzt aufbrechen musste, hatte ich nicht alles bekommen, was ich eigentlich haben wollte. Eine Waffe hatte ich nicht und was viel wichtiger gewesen wäre, ein Kompass. Aber ich hatte nirgends so etwas gefunden. Ich wusste jetzt auch nicht, ob es zu dieser Zeit schon einen Kompass gab. Ja, etwas Magnetit und schon wäre ein Kompass eine Kleinigkeit. So blieb mir nichts anderes übrig, als in Küstennähe zu segeln.
Wenn mich meine grauen Zellen nicht im Stich ließen, mussten wir eine ganz schöne Strecke zurücklegen. An Afrikas Küste entlang und dann war die Frage, segelten wir quer durch bis Richtung Italien und dort Richtung Venedig? Anschließend müssten wir über die Berge Richtung Deutschland. Man könnte natürlich auch bis Gibraltar segeln, an Spanien, Portugal, Frankreich, Niederlande vorbei und endlich Deutschland erreichen. Die erste Route war wesentlich kürzer. Allerdings mussten wir dann wieder ein neues Fortbewegungsmittel finden.
„Du kannst herauskommen“, rief ich Rosa zu. Sie kam heraus und setzte sich neben mir ans Ruder.
„Das Schiff braucht einen Namen“, sagte sie.
„Wie wäre es mit „Good Hope“, antwortete ich. „Das heißt gute Hoffnung auf Deutsch.“
„Das klingt gut“, sagte Rosa. „So machen wir es.“
Wir hatten eine ordentliche Geschwindigkeit drauf und fuhren ungefähr 200 bis 300 Meter vom Ufer entlang.
Rosa schaute zurück und sagte: „Dort sind Schiffe hinter uns her.“ Ich schaute zurück. Die beiden großen Schiffe hatten alle Segel gesetzt, doch sie fielen langsam zurück. Gegen meine kleine Rennmaschine hatten sie einfach keine Chance.
„Mach dir keine Sorgen, bis heute Mittag, sind sie weit weg. Die können uns nicht einholen.“
Als ich das gesagt hatte, hatte ich das Gefühl, als wenn Rosa erleichtert war. Aber ich beachtete es nicht weiter. Ich straffte die Segel und das Schiff kam auf der einen Seite langsam aus dem Wasser, aber es war trotzdem gut ausbalanciert. So segelten wir Richtung Westen. Hoffte ich zumindest, da ich nur nach der Sonne gehen konnte.
„Wo kommst du eigentlich her und wie hat es dich nach Alexandria verschlagen?“, fragte Rosa.
Ja, ich hatte befürchtet, dass diese Frage kommen würde. Was sollte ich sagen? Das ich aus der Zukunft komme? Ich entschloss mich, noch nicht die Wahrheit zu sagen, sondern erzählte ihr die Geschichte, die ich bisher erzählt hatte. Nur schmückte ich sie ein bisschen mehr aus. Da ich meine Frau und Kind in Germanien verloren hatte, wollte ich eben in der Ferne mein Glück suchen, was aber nicht geklappt hätte. Deshalb wollte ich wieder zurück nach Germanien. Rosa schien die Geschichte zu glauben und mir machte es ein schlechtes Gewissen, sie so angelogen zu haben. Aber was blieb mir übrig?
Der Tag verging ereignislos. Am Strand sahen wir hin und wieder ein paar Ansiedlungen, ein paar Menschen, aber ansonsten nur Sand und das Wasser vor uns. Die Schiffe hinter uns waren verschwunden. Rosa hatte uns etwas zu essen gemacht und es war später Nachmittag, als ich mich entscheiden musste. Fuhren wir weiter, bestand die Gefahr, irgendwo gegen zu fahren. Ankerten wir, bestand die Gefahr von den Schiffen eingeholt zu werden, falls sie uns noch verfolgten. Es wurde sehr schnell dunkel, deshalb lenkte ich das Schiff näher ans Ufer, blieb aber noch weit genug davon entfernt. Der Ankerstein glitt ins Wasser und das Segel wurde eingeholt. Ich bereitete den Start für den nächsten Morgen vor. Alles sollte schnell gehen.
„Wir müssen Wache halten“, sagte ich. „Ich möchte nicht überrascht werden, egal von wem auch immer!“
„Darf ich zuerst?“, fragte Rosa.
„Das geht in Ordnung“, antwortete ich. Wenn Sie kommen, erst in der zweiten Nachthälfte, dachte ich so bei mir.
Nachdem ich die Wunde von Rosa versorgt hatte, die sehr gut heilte, legte ich mich schlafen. Rosa weckte mich in der Nacht.
„Ich glaube, sie kommen.“ Blitzartig war ich wach. Schnell war ich an Deck und schaute in die Nacht. Es war eine klare Nacht, wir hatten Halbmond und ich schaute in das Dunkel. Am Horizont waren Lichter zu sehen. Schwer einzuschätzen, wie weit entfernt. Sie verfolgten uns also immer noch. Hatten sie irgendwelche Späher? Wussten Sie, dass wir hier ankerten? Die Hauptfrage war, warum verfolgten sie uns? Einen kleinen Medikus und eine Frau. Was war so wichtig an mir oder war es gar Rosa? Egal, ich zog den Ankerstein ein, ließ das Segel nach oben gleiten und setzte mich ans Ruder.
„Geh schlafen Rosa“, sagte ich, „mache bitte kein Licht.“
Das Schiff nahm Fahrt auf und ohne Mühe segelten wir los. Die Lichter kamen nicht mehr näher, sondern wurden wieder kleiner. Der Mond schenkte genug Licht, um weiterzufahren. So fuhren wir vorsichtig dem Morgen entgegen.
.
Kapitel 5
Am nächsten Morgen kam Rosa aus der Kajüte und brachte mir einen Tee.
„Na gut geschlafen?“
„Ja, sehr gut. Das Bett ist unglaublich bequem und diese, wie sagtest du, „Toilette“ ist sehr interessant. So etwas habe ich noch nie gesehen. Auch die Waschgelegenheit ist sehr beachtenswert.“
Warte es ab, ich habe noch mehr Überraschungen im Gepäck, dachte ich und lächelte während ich einen Schluck Tee nahm.
„Hier ist etwas für dich“, sagte Rosa und gab mir einen kleinen mit einer Kordel zugeschnürten Stoffsack.
„Mein Beitrag für das Mitnehmen“, sagte Rosa.
Ich öffnete den Beutel und schaute hinein. Lauter Rohdiamanten in den verschiedensten Größen.
„Ähh“, sagte ich, „das ist viel zu viel. Das kann ich nicht annehmen.“
„Doch, nehme sie nur. Ich habe noch mehr davon. Mein Vater hatte eine ganze Menge davon.“
Ich musste schlucken. Da erzählte mir diese Frau ganz beiläufig, dass sie Millionärin ist. Wahrscheinlich wusste sie es noch nicht einmal. Woher hatte ihr Vater die alle?
„Hast du die anderen in deinen Kisten?“, fragte ich.
„Ja, willst du doch mehr?“
„Nein, um Gottes willen. Wie gesagt, das ist mehr als genug, was du mir gegeben hast. Kannst du nähen?“, fragte ich ablenkend Rosa.
„Ja, sehr gut sogar“, antwortete Rosa.
„Prima, ich habe einen Baumwollstoff weben lassen. Er ist im rechten Rumpf. Kannst du daraus für mich eine Hose und ein Hemd machen?“
Rosa lächelte: „Für die Heimat landfein machen?“
„Ja, ich möchte endlich wieder wie ein Germane aussehen.“
„Da kann ich dir noch etwas anbieten. Von meinem Vater habe ich noch ein paar Sachen, vielleicht passen sie dir. Sonst ändere ich sie.“
Sie schaute sich den Stoff an und war überrascht. „Was ist das für ein Stoff? Vor allem in Blau?“
„Nun, ich habe der Weberin gesagt, was sie nehmen soll und sie hat diesen Stoff gewebt.“
Es war ein Stoff, der dem Jeansstoff ähnlich sah. Klar war er nicht so perfekt wie ein industrieller Stoff, aber er sah recht gut aus.
„Steh mal auf“, sagte Rosa, „damit ich Maß nehmen kann.“ Sie war schnell und schaute mich fragend an.
„Werkzeug findest du im linken Rumpf“, sagte ich. „Dort sollte auch eine Schere, Nadel und Faden zu finden sein.“ Rosa machte sich an die Arbeit.
„Hast du sonst noch irgendwelche verborgenen Talente?“, fragte ich, als Rosa mir anschließend das Ergebnis präsentierte.
Sie strahlte mich an und sagte schelmisch: „Wer weiß.“
Die Hose war klasse. Endlich wieder eine vernünftige Hose. Rosa hatte ein Hemd ihres Vaters herausgeholt und es passte einigermaßen.
Als Rosa das nächste Mal aus der Kajüte kam, fiel mir die Kinnlade runter. Sie hatte ihre Kopfbedeckung abgenommen, hatte eine Art Bluse und einen Rock an. Lange braune Haare mit vielen Locken bedeckten ihren Kopf. Eine wunderschöne Frau. Ich glaube, das war der Moment, wo ich mich in Rosa verguckte.
Ich hatte ja auch schon lange keine Frau mehr kennengelernt, von Sex ganz zu schweigen. Und nun stand diese Traumfrau in der Kajüten Tür.
„Na, wie sehe ich aus?“
„Wahnsinnig gut“, sagte ich nur. „Jedes Topmodell würde vor Neid erblassen. Willst du mich heiraten?“, fragte ich Rosa lachend zum Spaß.
Sie schaute mich an, legte den Kopf zur Seite und sagte: „Nun…das kann ich noch nicht sagen. Aber vielleicht?“ Und das schien mir nicht nur so dahingesagt.
Mir wurde richtig warm und das nicht nur, weil die Sonne am Himmel stand. Wir lachten uns an und Rosa setzte sich neben mir ans Ruder. Wir segelten immer noch in Sichtweite des Ufers.
„Wenn ich doch nur einen Kompass hätte“, sagte ich.
„Was ist ein Kompass?“, fragte Rosa.
Ich versuchte ihr zu erklären, dass es eine Art Stein sei, der Eisen anzieht und dass man damit einigermaßen den Kurs von Schiffen bestimmen kann.
„Warte mal“, sagte sie und verschwand in der Kajüte. Kurz darauf kam sie mit einem Beutel wieder.
„Schau, mein Vater hat auf seinen Reisen Steine gesammelt, vielleicht ist ja so einer dabei, wie du ihn brauchst.“
Das wäre mehr als ein Wunder, dachte ich bei mir. Nahm den Beutel und kippte ihn auf den Sitz. Verschiedene kleine und etwas größere Steine lagen in der Sonne und glitzerten um die Wette. Es waren einige Edelsteine und normale hübsche Steine. Ein Rubin war dabei, ein schwarzer Stein, oh, ein Bernstein und etwas schwarzes Zerklüftetes wie, ja, wie Magnetit. Das könnte tatsächlich ein kleines Stück Magnetit sein. Ein kleiner Stein, aber das Stück sollte genügen.
„Das könnte der Stein sein“, sagte ich. „Ich brauche etwas, was schwimmt. Was könnte ich da nehmen?“, dachte ich laut.
„Bist du blind?“, fragte Rosa, „hier ist doch alles aus Holz, haben wir nicht irgendwo etwas übrig?“
Typisch Frau, dachte ich. Ich ging in die Kombüse und holte ein Stück Feuerholz. Eine Nähnadel aus Eisen genommen und immer in einer Richtung mit dem Magnetit darüber gestrichen. Ich schnitzte mit einem Messer ein Loch ins Holz und legte die Nadel hinein. Dann schnitzte ich das Feuerholz so klein wie möglich. Es sollte ja nur schwimmen.
In meinem Becher, den ich schnell mit Wasser füllte, ließ ich vorsichtig das fertige „Stäbchen“ mit der Nadel zu Wasser. Dass es magnetisch war, hatte ich festgestellt, denn am Messer haftete die Nadel. Also, jetzt hieß es Daumen drücken. Heute war das Meer uns gnädig. Es wehte nur ein leichter Wind, sodass das Schiff einigermaßen ruhig lag.
Der selbst gebastelte Kompass funktionierte. Das Holzstück hatte sich in eine Richtung gedreht und drehte sich auch nicht, als ich das Ruder veränderte. Es zeigte immer in die gleiche Richtung.
„Klasse“, rief ich begeistert, „das wird uns helfen.“ Ich markierte Norden, gegenüber Süden, dann Westen und Osten.
„Das ist ein Kompass?“, fragte Rosa scheinbar etwas enttäuscht.
„Ja“, sagte ich. „Das sind die Himmelsrichtungen. Wir müssen genau nach Nordwesten, also diese Richtung oder wir fahren direkt nach Norden und dann nach Westen, so sollten wir Italien erreichen.“
„Woher weißt du das?“, fragte Rosa mit großen Augen.
„Das erkläre ich dir später, lass uns losfahren“ würgte ich Rosa ab.
Da wir nun wussten, wo lang, legte ich den Kurs fest und wir segelten aufs offene Meer hinaus. Am Horizont sah ich ganz klein ein Segel hinter uns. Ob das die Verfolger waren oder war es ein anderes Schiff? Wer es auch war, er war weit weg.
Nun segelten wir in das Unbekannte. Den selbst gebastelten Kompass steckte ich gut weg, er wurde noch gebraucht. Da wir die Richtung hatten, brauchten wir nur ab und zu überprüfen, ob sie noch stimmte.
Das Meer war einigermaßen ruhig. Rosa und ich schienen kein Problem mit der Seekrankheit zu haben. Wir machten gute Fahrt. Während so die Zeit verging, erzählte mir Rosa von sich und ich erzählte Rosa von mir. Da brauchte ich nichts zu verheimlichen, denn ich konnte alles sagen, was mir auf dem Herzen lag. So kam, wie es kommen musste, wir beide kamen uns näher. Wir saßen zusammen am Ruder und ich hatte meinen Arm um Rosa gelegt. Sie hatte ihren Kopf auf meine Schulter gelegt und so fuhren wir mit voll geblähten Segeln in Richtung Italien.
Ein langer Blick in ihre Augen und schließlich küssten wir uns, es gab kein Halten mehr. Wir waren allein auf dieser Welt, nur uns gab es noch. Ich bedeckte Rosa mit Küssen und sie erwiderte sie leidenschaftlich. Da weit und breit nichts außer Wasser zu sehen war, gingen wir schnell in unser „Schlafzimmer“ unter Deck. Was soll ich sagen, es war der beste Sex, den ich seit Langem gehabt habe. Wir liebten uns innig und vergaßen fast alles um uns herum.
Das war der Zeitpunkt, wo ich hätte stutzig werden müssen. Aber, da ich aus einer anderen Zeit kam, fiel es mir nicht auf. Denn Rosa hätte ja eigentlich noch „Jungfrau“ sein müssen, da sie nicht verheiratet war. Woher hatte sie die Erfahrung beim Sex? Auch mal eben so Sex, das war in dieser Zeit nicht üblich, jedenfalls für „ordentliche“ Mädchen. Nur Dirnen gaben sich den Männern hin. Aber zu diesem Zeitpunkt machte ich mir keine Gedanken darüber, das Rosa nicht ganz „koscher“ war. Ich war eben nur ein Mann.
Irgendwann stand ich auf, Rosa war eingeschlafen und ich ging wieder an Deck. Überprüfte mit dem selbst gebauten Kompass unsere Richtung, setzte mich ans Ruder und strahlte übers ganze Gesicht. Rosa hatte mir meine Lebensfreude wiedergegeben. Sie war aber auch fantastisch, nicht nur beim Sex. Jedenfalls soweit ich es in der kurzen Zeit beurteilen konnte. Sie war so positiv, das färbte direkt auf mich ab. Ein Leben mit ihr konnte ich mir gut vorstellen. Da ich hier nun in dieser Zeit gestrandet war, wollte ich das Beste daraus machen. Sie heiraten, vielleicht sogar Kinder bekommen. Warum nicht, dachte ich. Ich summte so vor mich hin und war glücklich.
Nach einiger Zeit kam Rosa aus der Kajüte. Sie hatte sich wieder hübsch gemacht und kam zu mir, küsste mich auf den Mund und fragte:
„Na Hunger, mein hübscher Mann?“
„Klar, hübsche Frau und wie, ich könnte einen Bären essen.“ Rosa lachte und verschwand in die Kombüse, um uns etwas zu essen zu machen.
Der Katamaran machte gute Fahrt. Wie schnell er war, konnte ich nur schätzen, aber darin war ich leider nicht gut. Vielleicht legten wir pro Stunde 15 bis 20 Kilometer zurück. Vielleicht mehr, vielleicht weniger? Wie groß das Mittelmeer war, keine Ahnung. Wenn wir einmal 15 Kilometer zugrunde legen, die pro Stunde zurückgelegt werden, wären es pro Tag 360 Kilometer. 360 mal 10 Tage wären dann 3600 Kilometer. Eigentlich schon ganz schön. Aber wie weit lag Italien von Ägypten entfernt? Hmm, wenn ich mich richtig erinnerte, waren es ungefähr 3600 Kilometer von Hamburg nach Hurghada. Luftlinie, wohlgemerkt. Von Hamburg nach München bummelig 800 Kilometer, bleiben 2800 Kilometer, in Ägypten von Kairo bis Hurghada waren es auch ungefähr 800 Kilometer. Also rund 2000 Kilometer Rest. Wenn ich noch hier, und da etwas Landmasse abzog, dann sechs im Sinn, ergab also ungefähr 1800 bis 2000 Kilometer Wasser. Das bedeutete 6 bis 8 Tage auf See. Aber das war die Luftlinie. Die See Linie würde ganz anders aussehen. Außerdem fuhren wir nicht 24 Stunden nonstop. Wasser und Essen waren bisher genug vorhanden, aber wie lange würde es reichen? Rosa war nicht mit eingeplant gewesen, als ich damals die Reise plante. So mussten wir wohl zwischendurch einmal „tanken.“
Ich hatte noch ein paar Würmer in einem Topf und eine Angel mitgenommen. Wir sollten also versuchen Fische zu fangen. Ob das klappen würde? Versuch macht klug, sagte ich und hielt hinter dem Schiff die Angel ins Wasser. Ein kleines Stück blankes Metall hatte ich beim Haken mit angebunden. Das sollte die Fische locken.
Nach einer Stunde hatten wir Glück, es biss ein Fisch an. Keine Ahnung was für einer es war, aber er wog mindestens 500 Gramm. Der wurde unser Abendessen. Rosa bereitete ihn in unserer drei Sterne Küche zu und er schmeckte himmlisch. Also kochen kann sie auch, dachte ich.
Nun kamen wir an den Punkt, wo es langsam dunkel wurde. Das Ruder war zwar in der Richtung festgezurrt, wo wir hin wollten, aber es war viel zu gefährlich, schlafen zu gehen. Also mussten wir uns wieder mit der Wache abwechseln. Rosa übernahm die erste Wache. Ich legte mich schlafen und sagte Rosa, sie solle mich nicht so spät wecken. Morgen am Tag könnte ich auch noch etwas schlafen, wenn sie am Ruder wäre.
So machten wir es. Rosa holte mich nach geschätzten vier bis fünf Stunden aus dem Traumland. Sie legte sich sofort schlafen und ich setzte mich ans Ruder. Nichts war zu sehen. Der Mond spiegelte sich in den Wellen, durch die unser Schiff glitt. Morgen wollte ich noch mein kleines Geheimnis am Bug des Schiffs setzen. Das würde uns noch einmal ordentlich Geschwindigkeit bringen.
Der nächste Morgen brachte ein bisschen mehr Wind. Das war gut. Ich ging zum Vorsegel, holte es ein und setzte den Spinnaker. Er war in einem himmelblau, sodass er fast gar nicht auffiel.
Wau, da ging ein Ruck durch das Schiff, als er sich zur vollen Größe aufgebläht hatte. Das brachte Geschwindigkeit. Rosa schaute mich fragend an.
„Das ist ein Spinnaker“, erklärte ich Rosa, „so etwas wird bei Segelregatten benutzt.“ Ihr Gesicht war ein einziges Fragezeichen, sie sagte aber nichts.
Wir segelten so den Vormittag dahin, als plötzlich Rosa rief: „Da, am Horizont kommt uns ein Schiff entgegen.“
Ich schaute in die Richtung, in die Rosa zeigte. Tatsächlich, ein Schiff und es schien kein kleines Schiff zu sein. Da ich kein Fernglas hatte, konnte ich noch nicht genaues erkennen. Es hielt in unsere Richtung.
Nach ein paar Minuten konnte ich langsam mehr erkennen und was ich sah, war gar nicht nach meinem Geschmack. Das Schiff hatte keine Flagge am Mast.
„Piraten!“, rief ich Rosa zu. „Gehe unter Deck und schließe die Luken. Bleib unter Deck. Ich werde versuchen einfach an denen vorbeizusegeln.“
Ich setzte mich ans Ruder und nahm eine kleine Kurskorrektur vor. Zum Wegsegeln war es zu spät, sie kamen schnell näher. Aber ich hatte vor meine Geschwindigkeit auszunutzen. Ich steuerte direkt auf ihren Bug zu. So konnten sie nur nach links oder rechts fahren. Da ich nicht vorhatte, die Geschwindigkeit zu senken, fuhr ich mit voll aufgeblähtem Spinnaker auf sie zu.
Es ging alles sehr schnell. Der Kapitän hatte gedacht, ich bin ein kleines, langsames Schiff. Sozusagen leichte Beute für ihn. Leider Pech gehabt!
Ich schätze, seine Intelligenz war nicht größer als die Außentemperatur, die wir zurzeit hatten. Das Schiff kam heran, ich konnte das Geschrei der Piraten hören. Kurz bevor das Schiff mich rammen konnte, wich ich nach rechts aus, und bevor die wussten, was los war, war ich schon vorbei.
Das dumme Gesicht von dem Kapitän hätte ich gerne gesehen. Ich hörte noch irgendjemand etwas schreien, ich schaute zurück und sah, dass sie dabei waren eine Wende einzuleiten. Bis sie damit fertig waren, hatten wir schon ein paar Seemeilen Abstand.
Ich zeigte ihnen eine lange Nase und sang NÄ-NÄ-NA-NÄ-NA-NA.
„Alles klar, kannst wieder herauskommen Rosa“, rief ich zur Kajüte. Die Luke ging auf, Rosa kam heraus und schaute nach dem Schiff.
„Er ist glaube ich sauer, weil ich ihn nicht zum Tee eingeladen habe“, sagte ich grinsend. Rosa lachte und setzte sich. Ich überprüfte den Kurs mit dem Kompassersatz und änderte die Richtung dementsprechend. Die Piraten hatten tatsächlich gewendet und wollten uns verfolgen. Aber es war jetzt schon zu sehen, dass sie keine Chance hatten, uns jemals einzuholen.
„Das war richtig aufregend“, sagte ich.
Rosa schaute mich komisch an. „Auf so etwas kann ich gut verzichten.“
„Du gönnst mir aber auch gar nichts“, sagte ich grinsend. Am Abend holte ich den Spinnaker ein und setzte wieder das Vorsegel.
Wie am Abend zuvor hatte Rosa die erste Wache und ich die Zweite. Die Nacht verlief ereignislos.
Am Morgen des vierten Tages unserer Reise angelten wir wieder. Leider hatten wir diesmal kein Glück.
„Du, Rolf“, sagte Rosa, „das Spülwasser fürs Abort ist alle.“
„Das ist das kleinste Problem“, sagte ich und füllte mit Meerwasser das Fass wieder auf.
„Kannst wieder loslegen“, sagte ich grinsend.
„Das ist eine tolle Sache“, sagte Rosa. „So etwas habe ich noch nie gesehen.“
Bei uns wäre es tiefstes Mittelalter, dachte ich. Wenn ich nur an die modernen Wasserklosetts der Japaner dachte, mit vorgewärmtem Sitz, Wasserreinigung und Föhntrocknung. Dagegen war mein selbst gebautes Plumpsklo nichts.
Der Wind war kräftig und blies in die richtige Richtung, also setzte ich wieder den Spinnaker und damit ging es flott voran.
Gegen frühen Mittag erspähten wir wieder ein Segel, diesmal allerdings kein Piratenschiff. Es war ein Handelsschiff, das unter spanischer Flagge fuhr.
„Du sprichst zufällig spanisch?“, fragte ich Rosa.
„Nein, kein Wort.“
„Hmm, ich auch nicht“, sagte ich. „Aber wir sollten trotzdem versuchen, mit ihnen zu sprechen. Vielleicht können sie uns sagen, wie weit es noch bis nach Italien ist.“
Ich holte den Spinnaker ein und wir segelten auf das Schiff zu. Der Spanier schien uns ebenfalls entdeckt zu haben, denn er hielt ebenfalls auf uns zu. Eine halbe Stunde später waren wir dicht nebeneinander.
„Olla“, rief ich.
„Olla“, schallte es zurück und dann kam etwas in Spanisch, was ich nicht verstand.
„No comprende, Senior, ich spreche nur Deutsch oder Englisch“, sagte ich in Englisch.
„Oh, ich spreche Englisch“, antwortete der Mann. „Mein Name ist Kapitän Miguel Sanches de la Querra. Was machen sie mit so einer kleinen komischen Konstruktion hier mitten auf dem Meer? Sind sie lebensmüde, Senior?“
„Das ist eine neue Konstruktion, von mir zu Testzwecken entwickelt“, antwortete ich. „Wir sind auf dem Weg nach Italien, ist es noch weit?“, fragte ich einfach zurück.
„Nach Italien? Mit dem Schiffchen? Sie sind wahnsinnig, Senior! Wir kommen von dort, aus Napoli. Wir sind jetzt zehn Tage auf See.“
Ahh, dachte ich, das bedeutet, noch knapp zwei bis drei Tage für uns. Rosa hatte sich bis jetzt in der Kajüte aufgehalten und kam heraus.
„Ihr seid ja noch wahnsinniger als ich gedacht habe“, platzte der Spanier heraus. „So eine schöne Frau mit in den sicheren Tod zu nehmen, Senior.“
„Wir sind bisher ganz gut zurechtgekommen“, sagte ich. „Übrigens, einen guten Tag hinter uns“, ich zeigte in die Richtung, „ist ein Piratenschiff.“
„Das haben sie überlebt?“ Der Spanier schien beeindruckt.
„Wir waren einfach zu schnell für die lahme Bande“, sagte ich lächelnd. „Aber Kapitän, habt ihr etwas zu essen übrig? Wir haben da leichte Probleme“, log ich.
„Si, Si, ich kann eine so schöne Frau nicht verhungern lassen. Auch wenn sie wahrscheinlich ertrinken wird, dank eurer Konstruktion, Senior.“
„Das ist sehr nett, Kapitän. Kann ich euch dafür irgendwas anderes anbieten?“
„Dazu müsstet ihr schon Medikus sein, Senior.“
„Das bin ich Kapitän“, sagte ich. Jetzt entgleisten dem Kapitän sämtliche Gesichtszüge. Auch mir wurde etwas anders, war das noch ein Zufall?
„Mein 1. Maat ist schwer krank. Wir wissen nicht, was er hat“, sagte der Kapitän.
„Ich komme an Bord“, erwiderte ich. „Willst du mit?“, fragte ich Rosa.
„Nein“, sagte sie, „ich kümmere mich um das Essen.“
Ich nahm meine wenigen Arztutensilien und ging an Bord. In einer kleinen Kajüte lag ein Mann mittleren Alters in der Koje. Er hatte hohes Fieber und sah sehr schlecht aus.
„Das ist Carlos Minges, mein 1. Maat. Er klagt über Schmerzen in der Seite und hat starke Schmerzen.“
Schmerzen in der Seite? Das kannte ich doch irgendwie. Ich untersuchte den Mann und meine Vermutung war Blinddarmentzündung. Da segelt man nichts ahnend übers Mittelmeer und dann so etwas.
„Ich muss ihn zur Ader lassen, allerdings an der Bauchseite“, sagte ich. „Er hat die Seitenkrankheit oder wie wir Mediziner sagen, Blinddarmentzündung. Wie lange hat er schon die Schmerzen?“
„Gut zwei Tage“, sagte der Kapitän. Ich erklärte dem Kapitän, was ich brauchte und das, wenn ich ihn nicht zur Ader lassen würde, der Mann die Woche nicht überleben täte. Auch mit meiner Hilfe wäre es nicht sicher, ob er überlebt, aber er hätte wenigstens eine Chance, erklärte ich.
„Seid ihr auch Chirogikus?“, fragte Kapitän Querra. Ich nickte nur. Offiziell durfte ich den Mann nicht operieren, also musste ich ein bisschen improvisieren. Es wurde mir eine Art Zelt auf dem Deck aufgestellt. Unter Deck war es einfach zu dunkel. Ich bereitete in Ruhe alles vor. Nicht gerade vorsichtig wurde der Kranke ins Zelt gebracht.
Die Operation verlief gut. Es war fast ein Routineeingriff. Diesmal nahm ich zur Betäubung „Opium“. Er musste fast eine halbe Flasche inhalieren, danach war er so benebelt, dass er glaube ich, dem Nirwana einen Besuch abstattete. Gott sei Dank, gab es keine Komplikationen. Sollte ich das öfter machen müssen, sollte ich mir etwas für die Betäubung einfallen lassen. Kapitän de la Querra war sehr dankbar und wir kamen ins Gespräch.
„Wir sind auf dem Weg nach Athen. Dort wollen wir Handel treiben“, sagte er.
„Wir wollen nach Italien und weiter nach Germanien, unserem Zuhause“, antwortete ich.
„Ihr und eure Frau seit mutig, Senior“, sagte der Kapitän. „Von wo kommt ihr mit eurem Schiffchen?“
„Aus Alexandria“, antwortete ich. „Wir sind jetzt seit vier Tagen unterwegs.“
Der Kapitän strich sich durch den Bart und er lächelte. „Das ist nicht möglich, Senior. Alexandria ist mindestens 16 bis 20 Tage entfernt.“
„Nicht mit meinem Schiffchen, Kapitän“, sagte ich und grinste.
Rosa hatte inzwischen frisches Obst, Brot und etwas Trockenfleisch bekommen, sowie ein kleines Fass mit Wasser.
„Ich danke euch für eure Großzügigkeit, Kapitän“, sagte ich, als ich mich verabschiedete.
„Nichts zu danken, ihr habt mit eurer Arbeit mehr als genug dafür bezahlt.“
Ich ging von Bord, machte die Leinen los und dann setzte ich die Segel und den Spinnaker. Die Blicke der Spanier waren Gold wert, als wir mit Wahnsinnsgeschwindigkeit davonfuhren und den Spaniern zum Abschied ein Lächeln schenkten. Wenn er im nächsten Hafen davon erzählt, wird man es für Seemannsgarn halten, dachte ich.
An diesem Abend gab es ein richtiges Festmahl. Rosa hatte alles liebevoll zubereitet. Zum Nachtisch gab es saftige spanische Orangen. Wir hatten jetzt sogar Zitronen. Gut gegen Skorbut. Herz, was willst du mehr, dachte ich, nahm Rosa in den Arm und küsste sie. Der restliche Tag verlief ereignislos. Segeln, essen und mit Rosa reden.
Wir erzählten uns über unsere Wünsche, Hoffnungen, was wir von der Zukunft erwarteten. Wenn ich nun einmal hier in dieser Zeit gestrandet war, wollte ich das Beste daraus machen. Mit Rosa hatte ich die richtige Partnerin gefunden. Sie war so anschmiegsam, so wie ein Mann sich eben eine Frau wünscht. Sie konnte mit anpacken, war nicht so ein Modepüppchen, wie die meisten Frauen es in meiner Zeit gewesen waren. Rosa war irgendwie so natürlich. Mit ihr wollte ich hier mein Leben verbringen.
In der Nacht, ich hatte meine Wache übernommen, bemerkte ich, dass der Himmel schwarz war. Kein Mond war zu sehen. Der Wind hatte etwas zugenommen. Das bedeutete, der Himmel wurde von Wolken verdeckt. Der Wettergott wollte also für ein bisschen Abwechslung sorgen. Gegen Morgen, was hätte ich jetzt für eine Uhr gegeben, fing es an zu regnen.
Prima, das Wasser wurde aufgefangen und füllte unsere Spülwassertonne und unsere Duschtonne. Leider hörte es nicht auf zu regnen, im Gegenteil, es wurde richtig unangenehm. Da ich kein Ölzeug hatte, war ich sehr schnell bis auf die Knochen nass. Das war nicht nur unangenehm, sondern es war auch kalt. Hoffentlich erkälte ich mich nicht, dachte ich so bei mir. Da es scheinbar der Anfang von einem Sturm war, überlegte ich nicht lange. Wir mussten sehen, dass wir in Küstennähe kamen. Ich änderte den Kurs auf Richtung Nord. Wenn ich alles richtig berechnet hatte, so müsste die Küste von Kreta oder Griechenland bald auftauchen. Hoffte ich wenigstens. Dort könnten wir in eine Bucht fahren und waren etwas geschützt.
Wenn ich daran dachte, mit dem Schiff im Sturm und ich als Hobbysegler, na dann gute Nacht. Ich war bisher immer nur bei schönem Wetter gesegelt. Sturm, das kannte ich nur aus dem Fernsehen. Jetzt war es leider Realität. Die kündigte sich mit Donner und Blitzen an. Auch das noch, Gewitter! Mein Mast war bestimmt der perfekte Blitzableiter. Der Wind nahm zu. Ich musste das Hauptsegel einholen, sonst würde der Mast brechen oder das Schiff umkippen. Weder das eine noch das andere war gewünscht. Rosa wollte helfen.
„Bleib drinnen“, sagte ich. „Binde alles fest, was lose ist.“
Wir werden viel Glück brauchen, um das zu überstehen, dachte ich, sagte es aber Rosa nicht. Schließlich wollte ich sie nicht beunruhigen. Das Einholen des Segels war ein Kraftakt gewesen, ich sollte mehr für meine Kondition tun. Nachdem ich das Segel gesichert hatte, war nur das Vorsegel noch gesetzt. Das benötigte ich, um das Schiff noch steuern zu können. Aber wenn der Wind noch stärker würde, musste ich das auch einholen. Allerdings waren wir dann ein Spielball der Wellen.
Die hatten inzwischen ganz schön an Höhe gewonnen. So um die vier bis sechs Meter erreichten die wohl. Bisher machte der Katamaran das alles ohne Probleme mit. In Gedanken dankte ich Ibrahim für seine gute Arbeit. Wir machten immer noch gute Fahrt, nicht mehr so wie vorher, aber wir kamen noch voran. Wenigstens brauchte ich mir um Piraten keine Sorgen zu machen. Die hatten schließlich genauso mit dem Sturm zu kämpfen wie wir.
Der Sturm legte nun richtig los. Gewitter, Donner, Regen und der Wind machten mich ganz schön fertig. Aber am schlimmsten waren die Wellen. Rauf und runter und dann kam eine Welle einfach übers Schiff. Da ich mich festgebunden hatte, konnte ich wenigstens nicht über Bord gehen. Aber ich kam mir vor, als ob ich in der Waschmaschine im Vollwaschgang war. Sehen konnte ich außer Wasser nichts. Ich hatte das Ruder festgebunden und hoffte, dass die Richtung einigermaßen stimmte. Wasser, nichts als Wasser. Und die Krönung, von oben auch Wasser. Ab und zu wurde ich von dem da oben auch noch fotografiert. Wahrscheinlich lachte sich der Knabe oben gerade Tränen aus den Augen, die hier unten als Wasserladungen ankamen.
Es regnete mittlerweile, als ob jemand ständig Badewannen auskippt. Kann man auch im Regen ertrinken, fragte ich mich? Mir war gelinde gesagt, arschkalt. Wie lange sollte das weitergehen? Der Mast knackte ab und zu. Bleib bloß stehen, drohte ich ihm, sonst wirst du zu Feuerholz verarbeitet.
Ich weiß nicht, wie lange ich da gesessen habe, aber irgendwann flaute der Wind ab. Blaue Hände und Lippen zeugten von einer erstklassigen Unterkühlung. Mann war mir kalt! Nur konnte ich gar nicht so schnell zittern, wie mir kalt war. Rosa kam und schickte mich unter Deck. Das sagte sie so, dass keine Widerrede möglich war. Ich zog meine nassen Klamotten aus und wickelte mich in Decken ein. Trotzdem war mir kalt und ich war völlig fertig. Ich merkte nicht mehr, wie ich einschlief.
Als ich wieder aufwachte, war es hell. Wie lange hatte ich geschlafen? Was war mit Rosa? Ich stand auf, zog mir schnell was über und ging heraus. Rosa hatte sich am Ruder festgebunden und in eine Decke eingehüllt war sie eingeschlafen. Ich weckte sie zärtlich und küsste sie.
„Komm, geh in die Kabine und schlafe dich aus, ab jetzt bin ich wieder da.“
Rosa schaute mich an, dann rief sie plötzlich: „Rolf, schau!“
Ich drehte mich um und sah Land. Wir waren in der Nähe der Küste. Wir waren vielleicht noch 500 bis 600 Meter entfernt. Ich wusste nicht, welches Land es war. Das konnte Griechenland sein, aber eventuell auch eine Insel von Griechenland. Vielleicht Kreta, aber es konnte genauso gut Sizilien sein. Schließlich wusste ich nicht, wie weit der Sturm uns vom Kurs abgetrieben hatte. Aber egal, endlich wieder Land in Sicht. Allerdings bestand auch die Gefahr, dass wir von irgendjemand angegriffen würden.
Damit wir endlich mal ausschlafen und uns von den Strapazen des Sturms erholen konnten, wollte ich eine kleine Bucht finden und dort versteckt ankern. Ich setzte das Hauptsegel und wir segelten näher an Land. Vorsichtig segelten wir am Ufer entlang. Der Abstand zum Land war auf gut 100 Meter geschrumpft. So konnten wir Einzelheiten entdecken.
Nach der Vegetation zu urteilen, könnte es Griechenland oder Kreta sein. Im Geschichtsunterricht hatte ich nicht besonders gut aufgepasst. Aber wenn meine grauen Gehirnzellen sich nicht irrten, war 1148 hier das „Byzantinische Reich“. Es müsste zurzeit oder demnächst der vierte Kreuzzug gegen Konstantinopel im Gange sein. Allerdings wusste ich jetzt nicht genau, ob auch Kreta und Griechenland davon betroffen waren. Ich hatte keine Lust, mich irgendwo einzumischen. Als ich so vor mich hin grübelte, fiel mir plötzlich noch etwas ein.
Ich war am 03. August 2017 in Hurghada ins Flugzeug gestiegen, am 03. August 1148 aufgewacht. Anschließend fast vier Monate in Alexandria gewesen und nun mit dem Katamaran hier im Mittelmeer unterwegs. Wir hatten Dezember! Wir hatten heute den 18. oder 19. Dezember. Kurz vor Weihnachten. Aber was viel schlimmer war, wir hatten Winter. Daran hatte ich überhaupt nicht mehr gedacht. Wenn wir weiter Richtung Norden fuhren, würde uns der Winter erwischen. In Norditalien, Deutschland lag wahrscheinlich Schnee. Ich hatte weder Kleidung oder war dafür ausgerüstet.
Doch dann fiel mir der kleine Beutel von Rosa ein. Geld war ja da. Wir konnten also alles kaufen. Nun mussten wir uns entscheiden, wollten wir an der Küste Richtung Norden weitersegeln, so würden wir bald an Land weiterreisen müssen. Wir würden in Venedig überwintern müssen, bevor wir den Weg Richtung Deutschland in Angriff nehmen konnten. Oder segelten wir weiter Richtung Westen?
Dann hatten wir noch sehr lange Wasser vor uns. Das wollte ich nicht allein entscheiden. Aber erst einmal sollten wir uns einen Tag erholen, denn der Sturm hatte uns ganz schön geschafft. Es brachte nichts, weiter nach einer Bucht zu suchen, da wir bisher keine gefunden hatten. Also warf ich den Ankerstein. Die Sonne stand hoch am Himmel. Es musste so um die Mittagszeit sein, schätzte ich. Wir machten uns etwas zu essen und legten uns beide schlafen. Ich hoffte, dass hier nicht ausgerechnet heute jemand durch die Gegend segeln würde.
Als ich wieder wach wurde, war es noch hell oder war es schon wieder hell? Nach meinem Hunger zu urteilen, hatten wir durchgeschlafen. Rosa war immer noch im Traumland. Ich weckte sie nicht, sondern schlich nach draußen. Das Wetter war ruhig und sonnig. Nach dem Sonnenstand war es vormittags. Welcher Tag heute war, keine Ahnung. Man merkte erst jetzt so richtig, wie einem eine Uhr fehlte. Vor allem, wenn sie auch noch das Datum anzeigte. Nirgends war ein Schiff zu sehen, kein Mensch weit und breit. Prima, dachte ich, ging unter Deck und duschte ausgiebig. Das Wasser war zwar nur lauwarm, aber es war hervorragend. Anschließend bereitete ich Frühstück. Rosa war zwischendurch wach geworden und ging ebenfalls duschen. Wir frühstückten gemeinsam. Es ging uns beiden wieder gut. Das war die Hauptsache. Alles andere zählte in diesem Moment nicht.
Kapitel 6.
Ich hatte das Schiff überprüft und es war gut durch den Sturm gekommen. Keine Schäden waren zu sehen. Wasser war etwas in den Rümpfen, ob nun durch den Sturm oder durch andere Umstände, wusste ich nicht. Es war auch nicht viel, aber ich schöpfte so viel wie möglich heraus. Mann, wie gerne hätte ich jetzt einen Schlauch gehabt, dann wäre es etwas bequemer gewesen.
Nach getaner Arbeit setzte ich mich mit Rosa zusammen und erklärte ihr, welche Möglichkeiten zur Weiterreise wir hatten. Wir versuchten, eine Lösung zu finden. Es gab da einiges zu beachten und zu bedenken. Wenn wir Richtung Venedig fuhren, waren wir in ein paar Tagen da, könnten überwintern und im Frühjahr weiter Richtung Deutschland reisen. Sollten wir weiterfahren Richtung Westen, waren wir mindestens zwei bis drei Monate unterwegs, bis wir an der Küste von Deutschland ankamen, wenn das Wetter mitspielte. Es gab für beide Optionen ein Für und ein Wider. Irgendwie kamen wir nicht voran. Doch die Entscheidung wurde uns abgenommen. Es war so gegen früher Nachmittag, als Rosa plötzlich rief: „Rolf, schau Schiffe!“
In der Richtung in die Rosa zeigte, sah ich langsam eins, zwei und noch mehr Schiffe am Horizont auftauchen. Langsam wurden sie größer und es wurden sechs Schiffe. Als ich dann sah, unter welcher Flagge die Schiffe fuhren, wurde mir doch etwas mulmig. Es war die Flagge des Statthalters von Alexandria.
„Ich glaube ich spinne“ entfuhr es mir. Die waren nicht hinter mir her, dazu war ich zu unbedeutend.
Ich schaute Rosa an und fragte sie: „Wer bist du wirklich?“
Rosa war verlegen und sagte: „Lass uns schnell wegfahren, ich erzähle dir dann alles, bitte!“
Da waren sie wieder, diese treuen Dackelaugen. Ich holte den Ankerstein ein und setzte die Segel. Wir nahmen Fahrt auf und fuhren Richtung Westen.
„Und nun die Wahrheit“, sagte ich unabsichtlich etwas schroffer, als ich es beabsichtigt hatte.
„Mein Name ist Rosalinde Teuber, ich bin auch aus Germanien, mein Vater war ein reicher Händler, handelte mit Teppichen, er kaufte und verkaufte. Auch dem Statthalter von Alexandria verkaufte er besonders schöne Stücke. Es lief hervorragend. Aber irgendetwas musste passiert sein. Mein Vater wollte eines Abends Hals über Kopf aus Alexandria abreisen. Was genau vorgefallen war, wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wir kamen nicht weit. Am Stadtrand wurden wir von der Wache des Statthalters aufgegriffen und eingesperrt. Mein Vater wurde zwei Tage später öffentlich vor meinen Augen hingerichtet. Mir wurde selbst da nur mitgeteilt, es ging um den Sohn vom Statthalter. Der war wegen der Sache mit seinem Sohn äußerst verärgert und bestrafte meinen Vater mit dem Tod.
Der Besitz meines Vaters, seine beiden Truhen mit den Edelsteinen und den Goldstücken, wurde vom Statthalter einbehalten. Mir als angebliche Mitwisserin wurden dreißig Stockhiebe auf die Fußsohlen gegeben und anschließen wurde ich als Sklavin auf dem Basar verkauft.
Mein neuer Besitzer war ein reicher Ägypter. Er war hässlich, aber reich. Damit ich nicht fliehe, hatte ich Ketten an den Füßen. Meine Aufgaben bestanden darin das Haus sauber zu machen und nachts hatte ich ihm zu Diensten zu sein. Ich habe es reglos über mich ergehen lassen.“
Rosa liefen bei der Erzählung die Tränen über die Wangen. Es musste für sie schwer sein, über diese Dinge zu reden.
„Irgendwann hatte er mich über, da ich nur wie ein Stück Holz im Bett war, wie er sagte. Also wurde ich weiterverkauft. Mein nächster Herr bezahlte wesentlich weniger für mich, da ich nicht mehr „unbenutzt“ war. So wurde ich noch dreimal weiterverkauft. Immer musste ich meinen Herren nachts zu Diensten sein.
Bei meinem nächsten Herrn lernte ich Siri kennen. Auch eine Sklavin, so wie ich. Sie erklärte mir, was ich im Bett besser machen könnte, damit es schneller geht. So würde ich weniger Leiden. Siri war froh, dass ich jetzt da war. So musste sie nicht mehr so oft dem Herrn zur Verfügung stehen. Ich lernte von ihr eine Menge, was den Beischlaf angeht.“
Das konnte ich nur bestätigen, dachte ich, sagte aber nichts. In Gedanken dankte ich Siri für die hervorragende Ausbildung.
Rosa erzählte weiter: „Unser Herr starb und so wurden wir von einem neuen Herrn übernommen. Er war der oberste Verwalter für die Palastküche. Dadurch hatte er freien Zugang zum Palast, zumindest in den unteren Trakt für die Dienstlichen. Er erzählte bei einem Essen, dass er für Freunde gab, von meinem Vater. So erfuhr ich, dass der Statthalter meinen Vater hinrichten ließ, weil sein dreizehnjähriger Sohn über eine Teppichbrücke meines Vaters gelaufen war. Diese rutschte auf dem polierten Marmorboden weg und der Sohn brach sich ein Bein.
Der Statthalter war darüber so aufgebracht, dass er meinen Vater beschuldigte, Teppiche minderer Qualität für teures Gold an ihn verkauft zu haben. Darauf stand selbstverständlich der Tod. Mein Vater musste also wegen eines Bengels sterben, der zu blöd zum Laufen war. So kam ich auf den Gedanken, mich an den Leuten zu rächen.
Mein Herr hatte keine Angst, dass ich weglaufen würde. Ich hatte keine Fußketten mehr. Siri und ich wurden so weit gut behandelt. Ab und zu mussten wir einkaufen gehen. Dabei kam ich an unserem alten Haus vorbei. Mein Vater hatte ein Versteck für alle Fälle angelegt. Dort war der Beutel versteckt, den du jetzt hast. Er ist allerdings jetzt nicht mehr so voll. Ich konnte dank Siri den Beutel holen.“
„Lass mich raten, du hast die Steine in Gold eingetauscht?“, fragte ich.
„Ja, aber nicht alle. Mein Vater hatte viele Kaufleute und Goldschmiedeleute gekannt. Heimlich traf ich einen Freund meines Vaters. Allerdings musste ich feststellen, dass es mit der Freundschaft nicht weit her war. Er tauschte mir ein paar Steine und gab mir wesentlich weniger Gold, als sie wert waren. Aber das war mir egal. Es sollte ja nur zu einem Zweck reichen. Denn nach der Sache würde ich wahrscheinlich ebenfalls hingerichtet werden, wenn sie schiefging.“
„Du machst mich neugierig“, sagte ich.
„Mithilfe von einem anderen „Freund“ konnte ich ein paar Leute bezahlen, die für Gold alles machen. Sie sollten mit mir heimlich in den Palast eindringen und Vaters Kisten wiederholen. Denn ich wollte nicht, dass der Statthalter die Sachen bekommt. Außerdem wollte ich seinem Sohn eine Lektion erteilen.“
„Und wie bist du in den Palast hereingekommen, an den ganzen Wachen vorbei?“
„Das war das Leichteste. Ich klaute den Schlüssel zum Diensttrakt von meinem Herrn, als er mit Siri beschäftigt war. Wir sind rein und prompt ging fast alles schief.“
„Was passierte?“, fragte ich voller Spannung.
„Wir, das waren vier Männer und ich, haben uns eingeschlichen. Durch belauschte Gespräche meines Herrn wusste ich, dass die Truhen von meinem Vater in einem kleinen Lagerraum standen. Der Inhalt war wohl als nicht besonders wertvoll beurteilt worden und deshalb standen sie mehr oder weniger frei zugängig im Lagerraum. Wir schnappten Sie und brachten sie nach draußen.
Alles ging glatt, bis wir kurz vor dem Tor waren. Dort wurden wir von dem Sohn des Statthalters überrascht. Er hatte mit Pfeil und Bogen Schießübungen gemacht. Er fing sofort an nach der Wache zu schreien und schoss mir einen Pfeil in mein Bein. Ich schrie auf und meine Männer machten sich mit den Truhen aus dem Staub. Mit einem Schrei riss ich den Pfeil aus dem Bein und wollte ihn dem Sohn vom Statthalter, der jetzt auf mich zulief, in den Arm rammen. Der wich aus und der Pfeil bohrte sich in seinen Hals. Röchelnd brach er zusammen. Ich bin so schnell, wie ich konnte geflohen. Fast hätten mich die Wachen erwischt. Aber ich entkam nach einer wilden Verfolgungsjagd in den Gassen von Alexandria.“ Rosa schwieg.
Nun konnte ich mir denken, warum der Statthalter hinter ihr her war. Nicht ich war das Ziel, sondern sie. Sie hatte den Sohn des Statthalters schwer verletzt, wenn nicht sogar getötet.
„Ist der Sohn gestorben?“, fragte ich deshalb.
„Ja, er starb.“
„Wie lange ist das her? Wie ging es weiter?“, fragte ich Rosa.
„Das ist jetzt 15 Tage her, seitdem hatte ich mich versteckt. Die feigen Männer hatten die Truhen bei meinem „Freund“ abgegeben. Sie waren fast leer. Er bestand darauf, dass sie noch am selben Tag verschwinden mussten und er wollte nichts mehr mit mir zu tun haben. Er wollte mich sogar dem Statthalter ausliefern. Nur der Rest meines Goldes hielt ihn davon ab. Ich versteckte die Truhen in einem Versteck meines Vaters und ich selbst versteckte mich in den dunkelsten Ecken von Alexandria. Dort habe ich von dir gehört. Alles Weitere ist dir ja bekannt.“
„Das ist ja eine schöne Geschichte, in die du mich da hineingebracht hast“, sagte ich, nachdem Rosa ihre Erzählung beendet hatte.
„Damit hast du entschieden, wie wir weiterreisen.“
Rosa schaute mich fragend an.
„Wir können nicht nach Venedig und dort überwintern. Der Statthalter hat garantiert gute Beziehungen zu Italiens Statthaltern. Sie werden emsig Handel betreiben. Dadurch müssen wir die große, längere Route fahren. „Gibraltar, wir kommen“, sagte ich.
Rosa schaute mich an und sagte: „Du könntest mich auch an den Statthalter ausliefern und so deine Haut retten.“
„Schätzt du mich so ein?“, fragte ich.
„Ich kenne dich noch nicht lange, aber ich hoffe dich gut genug zu kennen, dass du es nicht tun willst“, sagte Rosa. „Immerhin könntest du dadurch reich werden. Der Statthalter hat auf meine Ergreifung eine hohe Belohnung ausgestellt.“
„Oh, wie hoch denn? Das könnte die Sache natürlich ändern“, sagte ich. Meinte es aber nicht ernst.