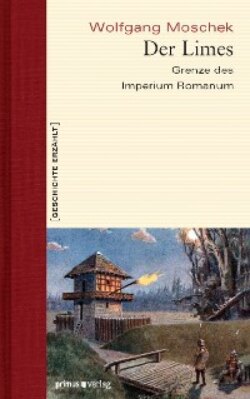Читать книгу Der Limes - Wolfgang Moschek - Страница 7
Apropos – Was denken die Römer über Grenzen?
ОглавлениеDieses Buch erzählt die Geschichte einer Grenze: des römischen Limes. Dabei handelt es sich nicht nur um das größte Bauwerk der Antike, sondern ebenso um eines der komplexesten und abwechslungsreichsten Monumente der römischen Kultur. Bis heute gilt den Grenzanlagen des Imperium Romanum in verschiedenster Hinsicht unser Interesse; so wurde der Hadrianswall 1987 zum UNESCO Weltkulturerbe der Menschheit ernannt; ergänzt 2005 durch den Obergermanisch-raetischen Limes (ORL) und den Antoninus-Wall 2008 als Erweiterung der Welterbestätte „Grenzen des römischen Reiches“ – „Frontiers of the Roman Empire“. Weitere Staaten mit Abschnitten der Limites planen die Aufnahme in diese Liste. Damit wird nach circa 1700 Jahren diese römische Grenze wieder zu einem verbindenden Element in Europa und darüber hinaus.
Der Begriff „limes“
Eine Geschichte sollte man am Anfang beginnen. Das gestaltet sich beim römischen Limes nicht einfach, denn schon der Begriff ist an und für sich irreführend. Was jahrzehntelang in vielen lateinisch-deutschen Schullexika unter dem Eintrag limes, itis, m. stand (und steht), ist genau genommen nämlich falsch bzw. höchst ungenau; für das, was wir heute unter dem römischen Grenzwall mit seinen Türmen, Palisaden oder Mauern und Gräben verstehen, kennen wir den zeitgenössischen lateinischen Ausdruck nicht. Was wir kennen, sind die Begriffe für die einzelnen Elemente: Wachtturm – turris oder burgus, Palisade – stipes oder palus, Mauer – murus, Graben – fossa und Erdwall – vallum.
Hätte man einen Römer im 2. Jahrhundert v. Chr. gefragt, was denn ein limes ist, hätte er vermutlich geantwortet, dies sei ein Feldrain, der einen Acker oder ein Feld mithilfe von heiligen Grenzsteinen (termini), mit Holzpfosten oder ganz einfach durch Bäume, große Steine, Bäche oder andere sichtbare Landmarken begrenze.1 Am wertigsten war die Einfriedung eines Feldes mittels der termini. Diese waren dem Gott Terminus geweiht, und ihre ungerechtfertigte Versetzung kam einem Sakrileg gleich und wurde schwer bestraft. Neben der sakralen Komponente spielte dabei ein ganz profaner Aspekt eine wesentliche Rolle, denn je nach Rechtsstatus (Eigentümer oder Pächter) mussten Steuern für die Landfläche bezahlt werden. Die Grenzsteine waren einmal im Frühjahr Zentrum für das Fest der Terminalia, bei dem man sich mit dem Nachbarn traf, die termini bekränzte, Opfer darbrachte und das Ende des Winters, des römischen Jahres und das beginnende Frühjahr feierte und sich gleichzeitig der Grenzen seines Besitzes versicherte. Für den Römer der Zeit der Republik war ein Limes darüber hinaus nicht viel mehr als eine quer laufende Bahn zwischen zwei Fixpunkten, konnte also auch ein Weg, ein Feldrain oder eine Waldschneise sein, die Besitz trennte.
Ein römischer Soldat zur Zeit des Julius Caesar oder des Kaisers Augustus hätte die Frage nach den Limites eindeutig mit einer Beschreibung von Heerwegen mit Wachtposten und/ oder Marschlagern auf einer Schneise oder provisorischen Straße kreuz und quer durch neu erobertes und zu sicherndes Gebiet beantwortet.2
Erst unter Hadrian und seinen Nachfolgern auf dem Kaiserthron Roms bis in die Mitte des 3. Jahrhunderts hätte ein Zeitgenosse mit dem Limes die genannten Begriffe für statische Befestigungen und Wehranlagen mit ihrer die (römische) Welt umspannenden Dimension verbunden. Doch hätte sich die Bedeutung damit nicht erschöpft. Für die Zeit der Soldatenkaiser ab etwa 235 n. Chr. bis auf Diocletian (284–305 n. Chr.), der grundlegend die Struktur des Reiches und seiner Grenzaufteilung umgestaltete, ist unter dem Limes vielmehr ein Gebietsabschnitt einer Provinz mit einer Grenze zum „Barbaricum“ zu verstehen. Diese Gebiete erlebten unruhige Zeiten, sowohl infolge innerer Probleme des Imperium Romanum als auch durch die schon langsam beginnende Wanderung der barbarischen Völker nach Westen.
Seit Kaiser Konstantin (306–337 n. Chr.) hätte ein Römer mit dem Begriff Limes wohl eher die limitanei oder ripensis in Verbindung gebracht: die neuen Grenzsoldaten des spätrömischen Heeres. Diese Einheiten hatten mit den Auxilia und Legionen des 1. bis 3. Jahrhunderts nicht mehr viel gemein, sowohl von ihren Aufgaben als auch von ihrer Struktur her gesehen. Auch gab es viel weniger feste Kastelle und Türme direkt an der Grenze, und die, die es noch gab, waren kleiner und stärker befestigt, um mit wenigen Soldaten besser und länger verteidigt werden zu können.
Festzuhalten ist, dass der Begriff Limes in den antiken Quellen im Unterschied zu unserem Verständnis zunächst nicht mit der Außengrenze des römischen Reiches gleichgesetzt wurde. Dass über fast hundert Jahre der Begriff Limes in Deutschland für die römische Außengrenze stand, hängt mit einer Fehlinterpretation des Wortes bei Tacitus im 19. Jahrhundert zusammen, und zwar im Kontext einer damals nicht exakt datierbaren Befundlage der Reste der Palisaden und Mauern des 2. Jahrhunderts n. Chr., und mit dem neuzeitlich-zeitgenössischen Verständnis von Grenze als Trennlinie, die Staaten und deren Territorien voneinander abgrenzt. Diese Grenzen der entstehenden Nationalstaaten erkannte man im Limes Roms wieder, was jedoch Römer und andere Völker der Antike nicht im Sinn hatten. „Limes“ steht im Folgenden der Einfachheit halber nichtsdestotrotz für diese Grenze.
Grenzen in der römischen Kultur
Der Limes stellt als Grenze des Weltreiches der Römer ein Sinnbild für ihre Kultur dar, denn folgt man dem Soziologen Georg Simmel, ist die „Grenze […] nicht eine räumliche Tatsache mit soziologischen Wirkungen, sondern eine soziologische Tatsache, die sich räumlich formt“.3 Das bedeutet zweierlei: Bevor eine Grenze gebaut wird, besteht sie in den Köpfen der Menschen. Und: Die Grenze ist immer auch ein Symbol für die Gesellschaft, die sie baut. Genau das ist es, was die Geschichte des römischen Limes so spannend macht.
Welche Bedeutung hatten also die Grenzen in der römischen Kultur? Schon die Gründungssage Roms bietet hier interessante Ansatzpunkte: Der Grieche Plutarch erzählt zu Beginn des 2. Jahrhunderts von der Gründung Roms:4 Nachdem sich Romulus und Remus entschlossen hatten, eine eigene Stadt zu gründen, gerieten sie bald in Streit über die richtige Lage der Stadt. Den Streit suchten die Zwillinge dadurch zu lösen, dass sie sich je ein bestimmtes Areal auf einem Hügel suchten, von dem aus sie göttliche Zeichen beobachten wollten. Die Zeichen sollten über die endgültige Lage der Stadt entscheiden. Remus wählte den Aventin, Romulus den Palatin. Jeder richtete auf seinem Hügel ein Areal zur Beobachtung der Vögel ein, ein templum, welches später im Gebiet der Stadt liegen sollte. Remus sah sechs Geier, Romulus zwölf, was von Ersterem jedoch angezweifelt wurde und worüber es wieder heftigen Streit gab. Romulus ließ sich jedoch nicht beirren und begann mit der Gründung der Stadt, zu der er Männer aus Etrurien als Ratgeber holte, um nach heiligen Anleitungen den Ritus zu begehen. Als ersten Akt brachten alle neuen Siedler Gegenstände des täglichen Lebens und Erde aus ihrem Ursprungsland, die sie in eine Grube, den sogenannten mundus, legten und dort durchmischten.
Romulus führte sodann mit einer eisernen Pflugschar, von einer Kuh und einem Stier gezogen, eine Furche um das zukünftige Stadtgebiet. Die aufgeworfene Scholle wurde von den Hinterhergehenden nach innen geworfen, damit keine außen liegen blieb. An den Stellen, wo später ein Stadttor entstehen sollte, hob Romulus den Pflug an und zog keine Furche (daher kommt der lateinische Ausdruck für Tor/Tür = porta von portare, dem Tragen des Pfluges über die Stelle des Einlasses). Danach begann der Bau der Stadtmauer entlang dieser ersten Furche, dem sulcus primigenius. Remus versuchte die Arbeiten an der Stadtmauer zu stören und sprang schließlich zum Hohn über die gerade errichtete Mauer. Das erzürnte den Romulus so sehr, dass er seinen Bruder erschlug.
Die Geschichte entwirft ein ganz bestimmtes Bild, das die Römer von der Stadtgründung hatten und von der Entstehung ihrer Sakraltopographie, d. h. der Erklärung, warum ihre Götter an welchem Ort ihre Heiligtümer hatten. Und sie verrät viel über Symbole und Riten bezüglich Grenzen, die eine immense Bedeutung für das tägliche Leben und Überleben der bäuerlichen Gemeinschaft der Menschen am Tiber hatten. Aus dem Gründungsmythos lassen sich grundlegende Elemente des römischen Denkens über Grenzen in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens herauslesen.
Die Grenzen der Stadt
Das pomerium mit dem sulcus primigenius – der ersten durch den Pflug gezogenen Furche – samt dazugehöriger späterer Kennzeichnung durch Graben (Ackerfurche), Erdwall (aufgeworfene Erdscholle), Grenzsteine oder Mauern galt als sakrales und deutliches Zeichen. Damit wurde aus dem wilden ungeordneten Raum der Natur ein Raum der Kultur abgegrenzt. Der nahezu höchste Status der sakralen ,Exklusivität‘ eines römischen Raumes wurde durch das pomerium erlangt – und damit natürlich das pomerium der Stadt Rom selbst. Die Furche im Boden, das kultische Umkreisen des künftigen Stadtraums mit dem Pflug, um den Graben (fossa) zu erzeugen, das beschreibt Tacitus mit „sulcus designati oppidi“.5 Der Graben definiert die sakrale Ausdehnung der Stadt. Das Innere und Kultivierte der Stadt wird vom Negativen der Außenwelt symbolisch durch das pomerium abgetrennt. Die aus der Ackerfurche geworfene Erdscholle stellt, ähnlich wie beim templum, eine weitere sichtbare Begrenzung dar, die gleichsam als erster symbolischer Schutzwall diente. Das pomerium trennt gewissermaßen gute Eigenschaften von bösen, z. B. den häuslichen Frieden vom „Krieg“ der Außenwelt. Dieser Raum wurde als Kern der Besiedlung für die Menschen geschaffen, damit sie im Innern geschützt vor den Gefahren der Umwelt leben und den Göttern gegenüber gerecht handeln können. Die Städte aber waren die Zentren der römischen Kultur und des römischen Imperiums. Innerhalb der Städte entwickelten sich – nicht nur bei den Römern – Kunst, Politik und Philosophie.
Die Gemeinschaft innerhalb des pomerium sollte nach römischer Idealvorstellung frei von Krieg sein. Kein Soldat oder General durfte sich innerhalb des pomerium bewaffnet aufhalten, die einzige Ausnahme war ein Triumphzug nach einem Feldzug, bei dem den Göttern gedankt und geopfert wurde. Jeder mit einem imperium ausgestattete Amtsträger, sei er Prokonsul oder General, verlor beim Überschreiten der heiligen Stadtgrenze seine Amtsgewalt und wurde wieder zum Privatmann, zum normalen römischen Bürger. Die wichtigsten Gebäude für Versammlungen des römischen Senats befanden sich innerhalb des pomerium, die Curia Hostilia und selbstverständlich das Forum Romanum. Außerhalb lagen der Tempel der Kriegsgöttin Bellona und das dem Kriegsgott Mars geweihte Feld, der Campus Martius. Wie bei den römischen Äckern wurde auch das pomerium der Stadt Rom mit einzelnen Terminus-Steinen markiert, die sich noch für die Zeit Hadrians nachweisen lassen. Gleichzeitig durfte das pomerium der Stadt Rom nur durch denjenigen vergrößert werden, der auch das gesamte Gebiet des Imperiums vermehrt hatte. Die Stadt (urbs) Rom war mit ihrer heiligen Grenze an dieser Stelle im römischen Denken mit der Grenze der römischen Welt (orbis romanus) eng verknüpft.
Das Ziehen eines pomerium galt für Städteneugründungen der Römer bis in das 2. Jahrhundert n. Chr. als einer der bedeutendsten Riten. Daran war nicht nur die sakrale Verbundenheit mit Rom und zu den römischen Göttern gekoppelt, sondern ebenso der künftige Status der Stadt mit römischem Bürgerrecht. Die Anlage des pomerium konnte die Voraussetzung für die Gründung einer colonia sein, wie z. B. Jerusalem, die in ihrer rechtlichen Bedeutung Rom und seinen Bürgern gleichgestellt war.
Die Grenzen des Tempels
Das Wort Tempel ist vom lateinischen templum (im Griechischen temenos) abgeleitet, welches ein besonderes, aus dem Profanen, Weltlichen herausgehobenes Gebiet beschreibt. Das Gebäude des Tempels (aedis) als Haus der Götter war dabei nur ein Teil, der nicht zwingend zu einem templum gehören musste. Es konnte mit Pfählen, Fahnen, Linien auf dem Boden durch einen Priester markiert werden. Nur innerhalb dieses templum war nach dem Vorbild des Romulus die Vogelschau möglich, die vor jeder Senatssitzung und anderen wichtigen Entscheidungen von den Auguren vollzogen wurde, um Vorzeichen für ein Ereignis zu deuten. Der Tempelbezirk konnte in unterschiedlichster Weise und an den verschiedensten Orten aus dem Profanen herausgehoben werden. Gräber, heilige Haine oder auch ganze Bereiche einer Stadt konnten, mit Mauern umgeben, ein templum ergeben.
Der Grund für den römischen Erfolg
Eine griechische Geisel des dritten Makedonischen Krieges, der Gelehrte Polybios (um 200 bis 120 v. Chr.), versucht zu ergründen, warum die Römer in solch kurzer Zeit fast die ganze Mittelmeerwelt erobern konnten, und kommt dabei unter anderem auf folgendes Erfolgsgeheimnis:
„Der größte Vorzug des römischen Gemeinwesens aber scheint mir in ihrer Ansicht von den Göttern zu liegen, und was bei anderen Völkern ein Vorwurf ist, eben dies scheint die Grundlage des römischen Staates zu bilden: eine beinahe abergläubische Götterfurcht. Die Religion spielt dort im privaten sowie im öffentlichem Leben eine solche Rolle und es wird so viel Wesens darum gemacht, wie man es sich kaum vorstellen kann.“
Historíai – Geschichte VI, 56.
Die Grenzen des Hauses
Das Haus des Bürgers bildete innerhalb der römischen Kultur einen Mikrokosmos für sich. Cicero6 beschrieb das Haus des Römers als einen heiligen Ort:
Was ist heiliger, was durch jede religiöse Rücksicht geschützter als das Haus des einzelnen Bürgers? Hier sind die Altäre, hier ist der Herd, hier sind die Penaten [Götter des Haushalts], hier wird das heilige, der Gottesdienst, die Zeremonien eingefasst: dies ist ein Zufluchtsort, der allen so heilig ist, dass jemanden von dort fortzureißen einen Frevel darstellt.
Beim Betreten des Hauses über die Türschwelle (lat. limen, gleicher Wortstamm wie Limes, von limus = quer) begab sich der Römer in einen eigenen Kosmos der römischen Familie. Hinter einer fast gänzlich geschlossenen Fassade war der Zugang oft nur durch die Haupttüre möglich. Wer ein Haus betrat, wurde je nach Verhältnis zum pater familias oder seines eigenen Ranges in der Gesellschaft nur in bestimmte Räume des Hauses vorgelassen. Ob Bittsteller oder Klient, gleichrangiger Bürger, naher Verwandter oder gar Ehrenperson eines Senators oder hohen Priesters, alle wussten um die Rangfolge der verschiedenen Räume. Niemand überschritt einfach so eine Schwelle zu einem anderen Raum. Im Tablinum standen beispielsweise die Hausaltäre, Bilder und Büsten der Vorfahren der Familie und repräsentierten den mos maiorum, die Sitte und Tradition. In dieses Zentrum des römischen Bürgerhauses durfte nicht jeder Besucher eintreten, denn es war der Raum des pater familias, des Familienoberhaupts.
Die Grenzen der römischen Republik
Aus republikanischer Zeit lassen sich über die Sicht auf die äußeren Grenzzonen Roms zwei bemerkenswerte Zitate von Cicero anführen. „Die Kolonien […] sind nicht nur Städte Italiens, sondern werden ebenso als Festungen des Reiches gesehen.“7 Und: „Das Ende der Provinzen ist immer dort, wo die Schwerter und Speere unserer Soldaten gewesen sind.“8 Die Grenzen im republikanischen Rom wurden von einer Reihe von Siedlungen und Städten mit der Reichweite einer zu dieser Zeit noch temporären Armee gestaltet. Keine Spur von festen Grenzanlagen in der Peripherie, sondern nur natürliche Grenzen wie Gebirge und Flüsse.
Dennoch kannten die Römer bedeutsame Grenzen ihrer Republik. Als Julius Caesar den kleinen Fluss Rubikon überschritt und sich (ohne sein imperium abzulegen) aus der Provinz nach Italien zurückbegab, war jedem Römer die Bedeutung dieses Grenzübertritts als Beginn eines Bürgerkriegs klar. Die Grenzen des römischen Kernlandes, das seit den Bundesgenossenkriegen zwischen 91 und 88 v. Chr. eine Einheit gegenüber den Provinzen Roms bildete, waren eindeutig gesetzt. In der Zeit der frühen Republik bis ins 3. Jahrhundert v. Chr. stellte der Übergang vom römischen Land zum Feindesland eine wichtige Marke bei der Kriegserklärung durch die Fetialen, die Priester der Römer, dar, die an der Grenze zum Feindesland die fremden Götter besänftigen sollten, da es im Konflikt nur um die Menschen ging. Die Fetialen schleuderten nach der Kriegseröffungszeremonie (bellicae ceremoniae) mit vielen Beschwörungen, der Prüfung, ob es ein gerechtfertigter Krieg sein würde, und einem Ultimatum von 30 Tagen eine Lanze (hasta fetialis) in das feindliche Gebiet, was einer Kriegserklärung gleichkam. Dieser Ritus war mit der Vergrößerung des Reiches im 2. und 1. Jahrhundert v. Chr. nicht mehr praktikabel, wurde aber dennoch vor jedem offiziellen Kriegszug durchgeführt. Noch unter Kaiser Mark Aurel und zu Beginn der Markomannenkriege wurde diese Lanze in ein Grundstück beim Bellonatempel, später beim Circus Flaminius, geschleudert, das von einem Kriegsgefangenen gekauft werden musste und damit als Feindesland galt. Die Beispiele zeigen, dass den Römern topographisch festgelegte und erkennbare Grenzen sehr wichtig waren, auch wenn sie sich von ihrer Größe und Alltäglichkeit weit von den Grenzen von Haus, Acker, Tempel und Stadt entfernt hatten.
Was dachten die Römer also über Grenzen?
Grenzen waren eine wichtige Orientierung im täglichen sozialen und kulturellen Miteinander. Jeden Tag sah man deutlich, wann, wie und ob die unterschiedlichsten Grenzen überschritten wurden. Beim Verlassen des Hauses, dem Betreten einer Stadt oder eines Tempelbezirks, beim Bestellen seines Feldes überquerte ein Römer Grenzen, die ihn selbst und sein Verhalten beeinflussten. Keine Villa Rustica ohne Mauer – und Gleiches galt für jede Stadt, die etwas auf sich hielt. Götter mussten dabei angesprochen und Opfer gebracht werden. Manche Grenzen wurden häufiger, manche seltener, einige aufgrund ihrer Exklusivität eventuell nie überschritten. Viele Feste und Riten, die mit den Grenzen zu tun hatten, füllten den römischen Kalender. Die Terminalia, das Fest der heiligen Grenzsteine und des Gottes Terminus, die Ambarvalia (von amb – um, herum und arvalia – Acker: um den Acker herum), ein festlicher Zug um das eigene Land zur Entsühnung, an dessen Ende das Opfer eines Stiers, eines Ebers und eines Widders (suovetaurilia) stand, welches eines der höchsten Reinigungsopfer (lustrum) der römischen Sakralhandlungen darstellte, oder das vergleichbare amburbium, welches um die Stadt herumführte.
Die römische Kultur war sich in vielen Bereichen und Lebenslagen einer Räumlichkeit und deren Begrenzung also sehr bewusst. Der Limes des Weltreiches der Römer ist ein System, das eine auf seine Topographie, auf seine Siedlungsumgebung, auf die Menschen, auf das Baumaterial und auf seine Funktion abgestimmte Grenze darstellt. Der Limes folgt keiner reichsweiten, einheitlichen Vorgabe. Weder in seiner Lage in der Landschaft noch in seiner baulichen Gestaltung scheint es feste Normen gegeben zu haben. Kein Turm ist exakt wie der andere, kein Abschnitt der Grenze ist vor einer Abweichung von einem scheinbaren Muster gefeit. So kann es 120 Meter Steinmauer inmitten der Holzpalisade im Odenwaldlimes geben, so wechseln Baumaterial, Höhe und Stärke des Hadrianswalls oder die Lage der dazugehörigen Kastelle verändert sich. Aus Holztürmen werden Steintürme; Holzpalisaden werden ersetzt, verdoppelt oder als Steinmauern neu gebaut oder durch Erdwall und Graben oder einen Flusslauf ersetzt. Manchmal bleibt es auch bei Wachttürmen und Kastellen an einem Fluss, oder es werden über Hunderte von Kilometern Gräben in steinigen und sandigen Boden gegraben wie z. B. im Norden der Sahara. Oft scheinen Zweck und Funktion bestimmter Teile und Abschnitte des Limes nicht den Umständen entsprechend oder angepasst, unverständlich für den, der das Gesamtbild einer „römischen Grenzkultur“ außer Acht lässt.
Der Limes war ein sehr flexibles und mit vielen Funktionen und Bedeutungen aufgeladenes System der Abgrenzung vom nicht-römischen, wilden und unkultivierten Raum der Barbaren. Er war ein Monument der Größe und gleichzeitig auch der Schwäche Roms. Seine Mauern, Palisaden, Wachttürme und Kastelle vermittelten ein Gefühl der Sicherheit (securitas), der Zusammengehörigkeit für diejenigen, die sich auf der römischen Seite befanden. Auf der anderen Seite weckte der Limes Bewunderung, Erstaunen, Neugierde und auch Begehrlichkeiten für das, was der Limes darstellte.