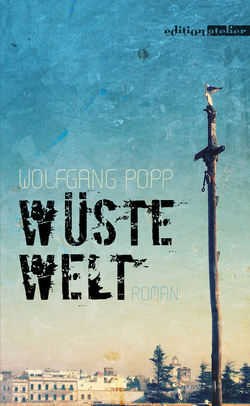Читать книгу Wüste Welt - Wolfgang Popp - Страница 5
ОглавлениеSchwarz. Ohne Zucker.
Die Stewardess schenkt den Kaffee ein und reicht mir die graue Plastiktasse.
Schlanke Finger, die Nägel kurz geschnitten, farblos lackiert. Menschen mit schönen Händen haben bei mir einen Vertrauensvorschuss.
Waren Sie vor einer Woche auch auf diesem Flug, frage ich sie.
Sie sieht mich an, versucht wohl abzuschätzen, ob das eine billige Anmache sein soll.
Nein. Bis letzte Woche bin ich Transatlantik geflogen, sagt sie. New York. Boston. Chicago. Ich bin heute das erste Mal nach Agadir im Einsatz. Warum?
Nicht so wichtig, sage ich. Es geht um einen Bekannten.
Sie nickt, löst die Bremse des Servierwagens und schiebt ihn eine Reihe weiter.
Ich greife zur Innentasche meiner Jacke. Spüre das Foto meines Bruders. Und lasse es, wo es ist.
Vier Stunden Flug bis Agadir. Die rote Erde im Norden Spaniens, die Turbulenzen, während wir an der Costa Brava entlangfliegen, die Windräder auf den Hügeln hinter Valencia. Und nur wenig später Berge, die aussehen wie Haufen aus Staub. Es ist mindestens zwei Jahre her, dass ich irgendetwas von meinem Bruder gehört oder gesehen habe. Und dann plötzlich vor einer Woche dieses geheimnisvolle SMS.
Der Flug vergeht überraschend schnell. Mich stört nur mein eingerissener rechter Daumennagel, passiert in der Früh beim Packen, und ich fahre unentwegt mit dem Zeigefinger über die Stelle. Als die Stewardess mit den schönen Händen vorbeikommt, bestelle ich noch einen Orangensaft.
Ich habe nachgefragt, sagt sie, als sie mir den Plastikbecher reicht. Keine meiner Kolleginnen ist heute vor einer Woche an Bord gewesen. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht weiterhelfen kann.
Wäre nicht notwendig gewesen, sage ich. Aber vielen Dank.
Hat schon seine Richtigkeit, dass Menschen mit schönen Händen bei mir einen Stein im Brett haben.
Wir drehen kurz vor der Küste und sinken dann langsam im Gegenwind. Die Wolken werden immer dichter. Als wir landen, ist der Himmel bedeckt. Die Grenzbeamten im Flughafengebäude agieren mit einer abweisenden Ernsthaftigkeit. Jeder einzelne von ihnen ein Gott, schwer damit beschäftigt, die Welt am Laufen zu halten. Keine Ahnung haben die, dass mein Bruder derjenige ist, der macht, dass die Welt sich dreht. Und zwar um ihn und ausschließlich um ihn.
Die Autovermietung befindet sich in einer winzigen Koje. Hinter dem Tresen sitzt ein Mann und liest Zeitung: Er ist Ende fünfzig, hat kurz geschnittenes, grau meliertes Haar und trägt einen gelben Pullover. Er schiebt mir ein Formular und einen Kugelschreiber herüber. Ich fülle das Blatt aus und drehe es dann so, dass er meine Angaben lesen kann. Tippe mit dem Kugelschreiber auf meinen Nachnamen.
Hat vor einer Woche ein Mann mit diesem Namen ein Auto bei Ihnen gemietet?
Ich bin sein Bruder, sage ich noch, als er mich zögernd ansieht.
Der Mann öffnet eine Schublade und holt einen Aktenordner heraus. Er blättert vor und zurück. Die gleiche rituelle Langsamkeit wie die Grenzbeamten vorhin. Schließlich bleibt er bei einer Seite hängen, an der er vorher bestimmt schon zweimal vorbeigeblättert hat.
Ach ja, sagt er, jetzt erinnere ich mich wieder. Übers Internet hat er den Wagen für zwei Wochen bestellt, aber als er dann hier war, hat er gemeint, er braucht den Wagen länger, vielleicht sogar bis zum Sommer.
Geht das denn, frage ich. Ein Auto zu mieten und kein genaues Rückgabedatum zu nennen.
Warum nicht, sagt der Mann, wir haben seine Kreditkartennummer, er kann das Auto haben, so lange er will.
Ist was mit Ihrem Bruder, fragt er dann noch.
Nein, sage ich und denke: nicht mehr als sonst.
Dann verlangt der Mann Pass und Führerschein von mir, beugt sich wieder über das Formular und vergleicht die Angaben. Er gibt mir die Ausweise zurück, zusammen mit dem Autoschlüssel und den Papieren, und erklärt mir den Weg zum Parkplatz.
Ich bedanke mich, nehme meine Tasche und gehe zum Ausgang. Gerade als sich die Schiebetür öffnet, höre ich, dass mir der Mann etwas nachruft. Er lehnt sich weit aus seiner Koje und winkt mit einem Buch in der Hand.
Das hat Ihr Bruder liegen gelassen. Als er den Wagen gemietet hat.
Er gibt mir das Buch. Ein Schritt ins Leere. Ein Agatha-Christie-Roman, von dem ich noch nie gehört habe.
Das ist nicht von meinem Bruder, sage ich.
Doch, bestimmt, sagt der Mann.
Nehme ich das Buch eben mit. Auch wenn ich mit Sicherheit weiß, dass es nicht meinem Bruder gehört. Der liest nämlich keine Romane. Hat er noch nie gemacht. Lieber sich in der Welt verlieren als zwischen zwei Buchdeckeln, das war immer sein Motto.
Danke, sage ich und rolle das Buch zusammen, sodass es in meine Jackentasche passt. Ich werde es wegwerfen, sobald ich außer Sichtweite bin.
Der Parkplatz ist klein, es gibt nur eine Reihe mit Mietautos. Ich finde den Wagen auf Anhieb und verstaue meine Tasche im Kofferraum, meinen kleinen Rucksack stelle ich auf den Beifahrersitz. Ich starte, und als ich den Gang einlege, spüre ich Agatha Christie in meiner Jackentasche. Ich stelle den Motor wieder ab, ziehe das Buch hervor und blättere die Seiten durch. Da ist nichts. Keine Notiz, kein eingelegter Kassenzettel, kein Foto. Doch dann finde ich hinten auf der Innenseite des Buchdeckels eine Eintragung. Hotel Salama, Tafraoute. Und es ist wirklich die Handschrift meines Bruders.
Ich suche die Straßenkarte aus meinem Rucksack, die ich in Wien noch gekauft habe. Ziehe mit dem Zeigefinger eine immer größer werdende Spirale um Agadir auf der Suche nach diesem Tafraoute. Da ist es, liegt mitten in einem Gebirge, das Antiatlas heißt. Antiatlas. Das passt so was von gut zu meinem Bruder. Der ist auch ein Anti. Ein Mann, der alles anders macht als die anderen. Einer, der aus Prinzip auf der anderen Seite steht, dort, wo das Gras grüner ist. Dieses Tafraoute liegt geschätzte hundertfünfzig Kilometer südlich von hier. Es ist erst früher Nachmittag. Selbst bei schlechten Straßenverhältnissen sollte ich es heute noch bis dorthin schaffen. Und wenn es tatsächlich ein Hotel Salama in diesem Tafraoute gibt, werde ich die Nacht dort verbringen. Und dann weitersehen.
Die Straße führt anfangs noch eben dahin. Es ist windig. In den Stacheln der Feigenkakteen hängen blaue und rosa Plastiksäckchen. Dann steigt das Land langsam an, die ersten zaghaften Serpentinen. Am Straßenrand niedere, gerade einmal kniehohe Steinmauern, dahinter vereinzelt Bäume, steinalt und knorrig, mit seltsam nadeligen Blättern. Ziegen stehen auf ihren Hinterhufen und versuchen, die olivenartigen Früchte an den Ästen zu erreichen. Dann tauchen am Horizont rote Granitfelsen auf, und die Straße wird immer schlechter. Einmal muss ich zwanzig Minuten warten, weil ein Bagger ein tiefes Loch im Asphalt zuschüttet.
Dann wird es wirklich steil, die Serpentinen immer enger, nach endlosen Kehren erreiche ich eine Passhöhe. Kein Baum, kein Strauch, eine Landschaft aus Stein und Erde, in Rot und Braun und allen Schattierungen dazwischen. Ich stelle den Wagen ab und steige aus. Aus irgendeinem Grund bin ich mir sicher, dass mein Bruder hier auch Halt gemacht hat und beginne deshalb den Boden abzusuchen. Mit den Schuhen schiebe ich Steine zur Seite, entdecke aber nur ein Stück Zeitung, alles auf Arabisch, sonst ist da nichts. Ich gehe vor zur Geländekante, wo der Hang steil abfällt. Die Sonne kommt heraus, und ich sehe vor mir etwas glitzern. Vorsichtig rutsche ich über das Geröll hinunter. Fehlt noch, dass ich mir hier den Knöchel breche. Kurz verliere ich wirklich das Gleichgewicht, fange mich aber im letzten Moment. Der glitzernde Gegenstand ist eine Sonnenbrille. Ein Glas fehlt, das andere ist gesprungen, aber ich erkenne sie trotzdem gleich wieder. Die Brille hat unserem Onkel gehört, und mein Bruder hat sie nach dessen Tod meiner Tante abgeschwatzt. Als Erinnerung, wie er damals zu ihr gemeint hat, obwohl ich wusste, dass unser Onkel meinem Bruder immer völlig gleichgültig gewesen ist. Ihm hat einfach die Brille gefallen. Meine Tante hat sie ihm geschenkt. Zusammen mit fünfhundert Euro, die sie ihm aus Rührung gleich dazugegeben hat. Ich habe ihr nichts abgeschwatzt, bin nur still dabeigestanden und habe dafür einen abschätzigen Blick von ihr geerntet. Stumm haben mir ihre Augen meine Kaltherzigkeit vorgeworfen, dass ich ohne ein Andenken an meinen Onkel auskommen konnte. Geld habe ich natürlich auch keines gesehen, dabei hätte ich es gut brauchen können damals. Mir war die Sache einfach zu blöd. Meinem Bruder nicht. Der versteht es, den Menschen das zu geben, was sie sich erwarten oder erhoffen, wenn er dafür das bekommt, was er will. Was gibt es Schöneres, als dass alle glücklich sind, hat er einmal gesagt, ganz ohne Ironie.
Für meinen Bruder war die Brille heilig. Sommer und Winter, Tag und Nacht, Sonne und Regen, er hat sie immer bei sich gehabt. Wenn er sie nicht getragen hat, dann steckte sie in der Brusttasche seines Hemds. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, ihn danach nur ein einziges Mal ohne diese Brille gesehen zu haben. Deshalb wundert es mich, dass sie hier zerbrochen auf dem Boden liegt. Eigentlich habe ich mir schon vor Jahren vorgenommen, mir keine Sorgen mehr um meinen Bruder zu machen. Weil ihm ohnehin nie etwas passiert. Die größten Dummheiten hat er schon angestellt, und nie ist etwas schiefgegangen. Das habe ich lange genug gemacht, ihm nachzulaufen, wenn er dabei war, etwas auszuhecken, um dann dieses unerträgliche Grinsen von ihm zu ernten und zu hören, dass er alles unter Kontrolle habe. Ich bin dann jedes Mal Flüche in mich hineinmurmelnd davon, habe mir geschworen, ihm nie wieder nachzurennen, bis zum nächsten Mal. Eigentlich hilft nur, nichts von ihm zu wissen. Nicht zu wissen, was er als nächstes vorhat, oder am besten gar keine Ahnung zu haben, wo er überhaupt war. Aber da bin ich nun einmal, die zerbrochene Brille bedeutet nichts Gutes, und so rutsche ich eben den Hang weiter hinunter, weil er ja da unten liegen könnte, gestolpert und abgestürzt, den Knöchel verstaucht, das Bein gebrochen, das Gesicht aufgeschlagen, und sehe zwar die Worte vor mir, verstaucht, gebrochen, aufgeschlagen, aber keine Bilder des blutenden oder Schmerzen leidenden Bruders, weil ich es ja selbst nicht glauben kann, weil es diese Bilder auch nirgendwo gibt, nicht in meinem Kopf und wahrscheinlich auch nicht in dem Kopf irgendeines anderen Menschen, eine Undenkbarkeit, mein Bruder verzweifelt oder hilflos.
Der Hang wird felsiger, und ich muss meine Hände zu Hilfe nehmen. Ein Stein bricht unter mir weg, und als ich den Sturz abfangen will, schürfe ich mir die Hand auf. Nur ein leichtes Brennen, aber als ich mir die Wunde ansehe, merke ich, dass sie doch einige Millimeter tief ist. Ich fingere ein Taschentuch aus meiner Hose und mache sie mir blutig dabei. Ich wickle es um den offenen Finger und klettere weiter bis zum Talboden. Wäre mein Bruder wirklich abgestürzt, dann müsste er hier irgendwo liegen. Da ist aber nichts. Auch keine Blutspuren oder Gewandfetzen sind zu sehen. Ich setze mich einige Minuten auf einen Felsblock und verschnaufe, weniger von der Anstrengung, mehr von dieser Situation, dass ich wieder einmal sein Was hast du, ist doch alles unter Kontrolle in meinem Kopf höre. Als die Stimme endlich wieder schweigt, mache ich mich auf den Rückweg. Oben angekommen, hole ich die Sonnenbrille meines Bruders aus der Jackentasche und setze sie auf. Durch die leere Öffnung und das gesprungene Glas lasse ich meinen Blick über die Landschaft schweifen, als könne ich auf diese Weise die Welt genauso sehen wie er. Aus den Augenwinkeln nehme ich eine kurze Bewegung wahr. Eine Eidechse sitzt auf einem Stein und schaut mich mit ihrem maskenhaften Grinsen an, als wäre sie eine Abgesandte meines Bruders, der hinter dem Horizont sitzt und lacht.
Das SMS kam an einem Montagmorgen knapp nach acht Uhr. Meine Freundin war im Bad, ich saß noch beim Frühstück, im Radio die Nachrichten, als das noch lautlos geschaltete Handy vibrierte. Es lag neben meinem Teller und kam seltsam schlingernd auf mich zu, das Geräusch, ein kurzes ersticktes Kichern. Und obwohl ich von meinem Bruder seit einer Ewigkeit nichts mehr gehört hatte, wusste ich sofort, dass er es war. Warum? Ich habe einmal gelesen, dass Quanten, obwohl weit voneinander entfernt, doch auf geheimnisvolle Weise miteinander kommunizieren. Für meinen Bruder und mich gilt Ähnliches. Und ich wäre glücklicher, würde es anders sein. Würde es da keinen Draht geben zwischen uns und keine Ahnungen und ich einmal nur mich selbst spüren können. Ich wischte über das Display meines Handys und wünschte, ich könnte das SMS dadurch zum Verschwinden bringen, es zurückschießen in den Dunst des Datennirwana, aus dem es zu mir gekommen war. Aber natürlich klappte die Nachricht auf, und ich las sie einmal, zweimal und dann noch ein drittes Mal, und obwohl der Text kurz war, blieb mir die Bedeutung völlig rätselhaft.
Waren das Tage bis jetzt. Mit Ideen gespielt und mit Menschen getanzt. Und jetzt in den Süden, damit die Dinge sich klären. HG 3734. Oh brother, where art thou?
Wollte da jemand aufräumen in seinem Leben? Ordnung schaffen? Oder sogar Reue zeigen? Und wenn ja, warum? War mein Bruder ernsthaft krank und wollte mit sich und mir ins Reine kommen? Oder war das wieder nur der gewohnte, fatale Lockruf, der verführerische Flötenpfiff des hinterlistigen Rattenfängers? Mein Daumen schwebte über dem Mistkübelsymbol, lag fast auf, da war kein Millimeter mehr zwischen dem Display und meiner Haut. Der Daumen blieb aber, wo er war, und genauso das SMS. Alles beim Alten. Mein Bruder wollte, dass ich ihm nachlaufe, und es funktionierte wie eh und je. Als meine Freundin mit nassen Haaren ins Wohnzimmer kam, hatte ich schon einen Direktflug nach Agadir gebucht, denn dorthin führte, so hatte es mir das Internet verraten, Flug HG 3734.
Tafraoute liegt in einer Talsenke, alle Häuser in der Farbe der Berge, als wären sie bewohnbare Felsen, die Fortsetzung der Landschaft. Das Hotel Salama befindet sich im Zentrum des Ortes, gleich am Marktplatz. Ich stelle den Wagen ab und gehe hinein. Die Lobby ist traditionell eingerichtet, es gibt zwei lange Diwane, darauf drapiert Dutzende Polster, dahinter ein offener Kamin. Dämmriges Licht dringt durch dunkelfarbige Glasfenster. Der Mann an der Rezeption lächelt zurückhaltend. Ich grüße und frage ihn nach einem Zimmer.
Für eine Nacht oder länger?
Weiß ich noch nicht, sage ich und gebe ihm meinen Pass.
Er trägt meine Daten in sein großes Buch ein. Als er fertig ist, ziehe ich das Foto aus der Innentasche meiner Jacke.
Das ist mein Bruder. War der vor ungefähr einer Woche hier?
Der Rezeptionist nimmt das Foto und geht einen Schritt zurück in den Lichtkegel seiner matt leuchtenden Deckenlampe. Zuerst scheint er unschlüssig, dann nickt er aber.
Ja, sagt er.
Könnten Sie nachsehen, wann das war und welches Zimmer er gehabt hat?
Der Rezeptionist blättert in seinem Buch. Es geht schnell. Viele Gäste scheint das Salama in letzter Zeit nicht gehabt zu haben.
Hier, sagt er, Ihr Bruder hat in Zimmer 118 gewohnt. Er dreht das Buch zu mir, sodass ich den Eintrag lesen kann. Da steht der Name meines Bruders und dahinter die Zimmernummer 118. Über der Spalte mit dem Datum hat aber jemand seinen Kaffee ausgeschüttet. Die Eintragung ist unleserlich.
Können Sie sich vielleicht noch daran erinnern, wann mein Bruder hier war, frage ich.
Ist schon einige Tage her, vielleicht sogar eine Woche, sagt er. Er ist aber nur zwei Nächte geblieben.
Ich frage ihn, ob Zimmer 118 frei ist, und er sucht das Bord hinter sich ab. Dann nimmt er einen Schlüssel vom Haken und reicht ihn mir. Die Stiegen hinauf und dann links. Es ist das letzte Zimmer auf der rechten Seite.
Alles Gute, sagt er dann noch, so als würde mein Bruder dort oben auf mich warten.
Der Gang ist nur schwach beleuchtet, die Zimmernummern sind kaum zu erkennen. Hinter keiner der Türen sind Stimmen zu hören. Ich scheine der einzige Gast zu sein. Als ich den Schlüssel ins Schloss stecke, bin ich nervös. Als könnte mein Bruder tatsächlich da drinnen auf dem Bett sitzen.
Ich bin seit fünfzehn Jahren mit meiner Freundin zusammen. Sie kennt meinen Bruder und sagt mir regelmäßig, dass sie ihn nicht leiden kann. Ich glaube ihr kein Wort. Sie will sich mir gegenüber einfach solidarisch zeigen, weil sie weiß, welche Schwierigkeiten ich mit ihm habe, aber natürlich kann sie sich seinem Charme genauso wenig entziehen wie alle anderen. Wenn er redet, hängt sie an seinen Lippen, und wenn er einen Scherz macht, lacht sie lauthals auf, aber was soll ich ihr das vorwerfen, mir geht es ja nicht viel anders. Jedenfalls wartete ich an dem Morgen, an dem das SMS kam, bis sie aus dem Haus war und versuchte dann erst, meinen Bruder zu erreichen, und dass ich ihm hinterherfliegen würde nach Marokko, das sagte ich ihr erst am Abend.
Natürlich ist da niemand in Zimmer 118, und ich werfe mich auf das leere Bett mit der grob gewebten rotorangen Überdecke. Lange hält es mich dort aber nicht, und so stehe ich wieder auf und beginne das Zimmer zu durchsuchen. Ich schaue unter der Matratze nach, hinter dem Bett und im Nachtkästchen. Nichts. Ich krieche auf allen Vieren über den Boden und unter den Schreibtisch. Jemand hat etwas unter eines der Tischbeine gesteckt. Es ist ein auf Briefmarkengröße zusammengefaltetes Blatt Papier. Ich hebe den Tisch mit meinem Rücken an und ziehe es heraus. An dem Tisch, der jetzt wackelt, falte ich das Papier auseinander. Es ist der Ausdruck eines Wikipedia-Eintrags über das Volk der Chleuh. Sie bewohnen den Antiatlas, steht da, gehören zu den Berbern, sind zwar Muslime, glauben aber an Geister, und ihre Frauen verfügen über zwei verschiedene Geheimsprachen. Die Wörter Geister und Geheimsprachen hat jemand mit einem gelben Leuchtstift markiert. Schon wieder Geister, die ich nicht gerufen habe, wie in dem SMS meines Bruders. Der Zettel stammt jedenfalls von ihm, da habe ich nicht den geringsten Zweifel. Ich falte ihn wieder zusammen und stecke ihn in die Hosentasche. Es ist knapp vor sieben, und ich habe Hunger. Ich gehe noch ins Bad und wasche mir das Gesicht mit kaltem Wasser. Mir hilft das, wenn eine unangenehme Stimmung sich mir auf die Haut zu legen beginnt. Zumindest bilde ich mir das ein.
Tafraoute sieht aus der Nähe nicht besonders einladend aus, genauso wenig seine Restaurants, die sich alle mehr oder weniger gleichen. Neonlicht, rostige Klappsessel, Plastiktischtücher. Und gähnende Leere. Vor dem Marrakesh sitzen zumindest drei ältere Männer, und so nehme ich am Nebentisch Platz. Die Männer haben einen Brotkorb vor sich stehen, Butter und eine Schüssel mit Oliven. Es nimmt aber nur ab und zu einer von ihnen einen Happen, in erster Linie rauchen sie eine nach der anderen. Alle drei tragen sie grob gewebte Kaftane, der eine, der seitlich zu mir sitzt, hat außerdem noch die Kapuze über den Kopf gezogen, sodass ich nur den glühenden Punkt seiner vorstehenden Zigarette sehe. Kaum dass ich sitze, kommt der Wirt mit der Speisekarte an. So rar wie die Gäste hier sind, will er offensichtlich nicht riskieren, dass ich es mir anders überlege und wieder aufstehe. Alkohol gibt es keinen, dafür frisch gepressten Orangensaft, ungewohnt um diese Tageszeit, aber warum nicht. Ist wahrscheinlich auch ganz vernünftig, weil ich gerade merke, dass ich den Tag über viel zu wenig getrunken habe. Der Wirt ist freundlich und spricht ganz passabel Englisch. Ich bestelle eine Tajine, Huhn mit Zitrone, das große Glas mit Orangensaft habe ich auf einen Zug ausgetrunken und bestelle gleich noch eines. Der Wirt lacht, als er das Glas vor mich hinstellt, und ich hole das Foto meines Bruders aus der Tasche.
Haben Sie diesen Mann schon einmal gesehen, frage ich. Ich suche ihn.
Der Wirt hält das Foto mit ausgestrecktem Arm, rückt seine Brille zurecht und kneift die Augen zusammen.
Ja, sagt er. Der war hier. Vor ungefähr einer Woche muss das gewesen sein.
Dann dreht er sich zum Nebentisch und spricht die drei Alten auf Arabisch an. Der Mann mit der Kapuze antwortet etwas und winkt dabei gleichzeitig mit einer betont lässigen Bewegung den Wirt zu sich. Er nimmt ihm das Foto aus der Hand und betrachtet es konzentriert. Sein Gesicht sehen kann ich immer noch nicht, aber ich merke, dass er einen tiefen Zug nimmt, weil die Glut seiner Zigarette sekundenlang aufglimmt. Dann nickt die Kapuze, der Mann steht auf und kommt herüber. Er zieht einen Stuhl heran und setzt sich zu mir an den Tisch. Jetzt sehe ich auch sein Gesicht, sonnengegerbt, faltig, unrasiert. Er könnte Ende fünfzig sein oder Anfang siebzig. Aber die Augen blitzen. Selbstbewusst, schalkhaft, schlau. Ein Mensch, der Fassaden bauen kann und deshalb auch weiß, wie man hinter sie blickt.
Ist Ihr Bruder, nicht?
Ich nicke.
Ist unschwer zu erkennen, sagt er, und fährt erst nach einer Pause fort. Ja, wir waren gemeinsam unterwegs.
Ach, ja? Und wann war das?
Der Mann zählt etwas an seinen Fingern ab.
Genau heute vor einer Woche hat er auch hier zu Abend gegessen. Da haben wir uns kennengelernt. Er hat mich gefragt, ob ich mich auskenne hier in der Gegend, und ich habe ihm gesagt, dass er den richtigen Mann gefunden hat.
Wo wollte er hin?
Die Geisterzeichnungen sehen.
Was für Zeichnungen, frage ich nach.
Sehr alte Felsritzzeichnungen aus der Steinzeit. Die Menschen hier sagen, dass sie von Geistern stammen.
Die wollte er sehen?
Ja, unbedingt. Er wäre am liebsten noch am Abend losgefahren. Ich habe ihm aber gesagt, das könne er sich aus dem Kopf schlagen. Die Straßen sind schlecht, und man muss mit dem Auto durch zwei Flüsse.
Da will ich auch hin, sage ich. Können Sie mich morgen hinbringen?
Der Mann sieht kurz in die Luft, so als müsse er überlegen.
Ja, morgen geht, sagt er schließlich.
Ich wohne im Salama, sage ich.
Ich bin um neun da, sagt er.
Als ich meinen Bruder vor einer Woche anrief, meldete sich sofort die Mailbox. Er musste das Handy ausgeschaltet haben. Ich schrieb ihm ein SMS und gab ihm meine Reisedaten durch. Geantwortet hat er nicht, und zurückgerufen hat er mich auch nicht, aber was habe ich mir auch erwartet? Wer sich auf meinen Bruder einlässt, weiß nie, woran er ist. Etwas mit ihm zu unternehmen, hat schon immer geheißen, keine Ahnung zu haben, was als nächstes passiert.
Am nächsten Morgen um neun ist nichts von meiner neuen Bekanntschaft zu sehen. Ich warte fünf Minuten, dann setze ich mich auf die Dachterrasse des Hotels und bestelle mir einen Kaffee. Von der Brüstung aus habe ich den Marktplatz und den Hoteleingang im Auge. Die noch tiefstehende Frühlingssonne taucht die umliegenden Berge in ein honiggelbes Licht, der Himmel indigoblau, der Kaffee stark. Kurz kann ich meinen Bruder vergessen und es kommt so etwas wie Urlaubsstimmung auf. Ich halte mein Gesicht in die Sonne, doch als ich die Augen schließe, ist er gleich wieder da, sein zufriedener Blick auf der orange leuchtenden Innenseite meiner Lider. Zwanzig Minuten nach neun taucht der Alte auf. Ich winke ihm zu und er winkt kurz mit seiner Zigarette zurück. Mein Bruder und er, sie haben einander bestimmt gut verstanden.
Anfangs ist die Straße noch gut, doch in einem kleinen Dorf lässt mich Ahmed auf eine unbefestigte Piste abbiegen, die zu einem Fluss hinunterführt.
Da müssen wir hinüber, sagt er.
Schaffen wir das mit dem Wagen?
Ahmed sagt nichts und deutet stattdessen hinüber zum anderen Ufer.
Ich bin kein guter Fahrer, im Gelände war ich überhaupt noch nie unterwegs und lasse den Wagen einfach langsam in das Kiesbett des Flusses rollen. Bald reicht das Wasser bis zur Bodenplatte, und wir bleiben fast stecken.
Mehr Gas, sagt Ahmed und hebt leicht die Füße an, so als würde das Wasser schon im Wagen stehen.
Die Räder drehen kurz durch, greifen schließlich, der Wagen macht einen Sprung, und dann sind wir draußen aus dem Fluss.
Auf der anderen Seite ist die Piste besser und ich habe wieder die Nerven, mich mit Ahmed zu unterhalten.
Warum sprechen Sie so gut Englisch, frage ich ihn.
Oxford, sagt er mit einer Engelsmiene.
Ich schaue ihn groß an, komme aber nicht dazu, nachzufragen, weil er gleich nachsetzt.
Ein Scherz, sagt er. Ich habe nie eine Universität von innen gesehen. Was ich an Fremdsprachen kann, habe ich von Touristen aufgeschnappt.
Nicht übel, sage ich.
Fast perfekt, sagt Ahmed und schmunzelt aus der Windschutzscheibe hinaus, dorthin, wo quer vor uns auf der Straße ein Baum liegt. Zum Glück ist er nicht besonders groß. Wir steigen aus und wuchten den Stamm zur Seite. Als wir zurückgehen zum Wagen, wischt sich Ahmed die Hände an seinem Kaftan ab.
Ist witzig, sagt er.
Was, frage ich.
Sie haben fast das gleiche Gesicht wie Ihr Bruder und auch eine ganz ähnliche Stimme, und trotzdem schauen Sie ganz anders aus und hören sich ganz anders an. Sie mögen Ihren Bruder nicht besonders, stimmt’s?
Ganz offensichtlich hat Ahmed als Reiseführer mehr als nur passables Englisch gelernt. Wenn man seit fast fünfzig Jahren mit Fremden durch diese Einöde fährt, kommt man wahrscheinlich mit den absonderlichsten Spielarten der menschlichen Psyche in Kontakt, und wenn man dann noch, so wie Ahmed zweifelsohne, über einen ungewöhnlichen Instinkt verfügt, gibt es wohl nur wenige Gesichter, hinter die man nicht blicken kann. Auch etwas, das er mit meinem Bruder gemeinsam hat.
Dass ich ihm nicht antworte, scheint Ahmed nicht weiter zu stören, ganz im Gegenteil, er macht einfach weiter mit seiner Fragerei.
Warum sind Sie eigentlich nicht gemeinsam unterwegs, ich meine, Ihr Bruder und Sie?
Etwas mit seinem Handy, sage ich. Ich konnte ihn nicht erreichen.
Ahmed nickt, und ich sehe ihm an, dass er mir kein Wort glaubt.
Ist ja auch egal, sagt er. Ich bin auch lieber allein.
Wieder kommen wir an einen Fluss. Dieses Mal ist das Wasser seichter und wir schaffen es ohne Probleme auf die andere Seite.
Jetzt ist es nicht mehr weit, sagt Ahmed und zeigt auf eine Handvoll Lehmhäuser vor uns. Wir stellen den Wagen ab und gehen zu Fuß weiter.
Wir folgen dem Fluss, balancieren über Steine und stapfen über eine lang gezogene Sandbank wie durch Schnee. Schwalben machen knapp über der Wasseroberfläche Jagd auf Insekten, und ich entdecke Hufspuren von Rehen an der Wasserlinie.
Warum interessiert sich Ihr Bruder eigentlich so für Geister, fragt mich Ahmed, der mit seinen gelben Lederpantoffeln immer wieder im Sand hängenbleibt.
Ach so, frage ich und schaue ihn an. Tut er das?
Ja, sagt Ahmed, er hat mich ausgefragt. Geisterlegenden, Geistergeschichten, Geistermärchen, er wollte alles wissen.
Keine Ahnung, was es damit auf sich hat, sage ich und überlege, und da fällt mir eine Sache ein, an die ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gedacht habe. In der Kindheit, wenn wir alleine zu Hause waren, wollte mein Bruder immer, dass wir Geister spielen. Wir haben uns Masken gebastelt aus Papiermaché und alle Jalousien zugezogen, sodass es stockdunkel war in der Wohnung. Ich habe immer recht rasch Angst bekommen, mein Bruder natürlich nicht, und als ich gemeint habe, es reicht, hat er die Jalousien nur widerwillig wieder aufgemacht. Er hat die Maske aber aufgelassen und sich sogar schlafen gelegt mit ihr, und am nächsten Morgen hat er die Abdrücke im Gesicht gehabt und ausgesehen, als wäre er über Nacht tatsächlich zum Geist geworden. Ahmed erzähle ich die Geschichte nicht. Wahrscheinlich kennt er sie ohnehin schon von meinem Bruder.
Stattdessen lasse ich den Blick über die Uferböschung wandern, auf der Suche nach den Felszeichnungen. Immer wieder glaube ich Tierköpfe zu entdecken, im Näherkommen stellen sie sich aber als Sprünge und Risse heraus. Dann steigt Ahmed zu einem knorrigen Baum hinauf, in dessen Schatten mehrere Felsblöcke stehen. Er zündet sich eine Zigarette an, lehnt sich an den alten Stamm und zeigt betont gleichgültig mit dem Daumen hinter sich.
Das erste, was ich sehe, ist ein Auto, das Kinder unbeholfen in den Stein geritzt haben. Erst im Näherkommen, entdecke ich darunter, völlig verblasst, die Darstellung zweier Rinder. Ein gescheckter Bulle und eine Kuh, und dazwischen taucht jetzt auch, kaum mehr zu erkennen, eine menschliche Figur auf, die Arme hoch in den Himmel gereckt. Auf einem Stein daneben ist ein Hirsch mit einem kapitalen Geweih zu sehen, aber mehr ist da nicht, und das wenige, was da ist, verliert durch die blöde Autozeichnung völlig an Wirkung.
Und, frage ich Ahmed. Wie hat es meinem Bruder gefallen?
Er war begeistert. Wir sind geschlagene zwei Stunden hier gewesen. Alle Touristen, die ich bisher hierhergebracht hatte, waren völlig enttäuscht und wollten gleich wieder gehen, aber Ihr Bruder hat gar nicht genug bekommen können von den Zeichnungen. Hat sie fotografiert, ist die Linien mit den Fingerkuppen nachgefahren, oder ist einfach nur dagesessen, hat den Kopf schräg gelegt, und sie angestarrt.
Sie haben vorher gemeint, dass mein Bruder Geistergeschichten hören wollte, sage ich. Erzählen Sie mir auch eine?
Kann ich gerne machen. Wollen Sie die hören, die Ihrem Bruder am besten gefallen hat?
Ich setze mich zu ihm unter den Baum, und als Ahmed anfangen will zu erzählen, frage ich ihn nach einer Zigarette. Eigentlich habe ich aufgehört, aber mein Bruder raucht nicht, und mit der Zigarette in der Hand komme ich mir nicht vor wie das um eine Woche zu spät gekommene Abziehbild von ihm.
Und, fragt Ahmed und schaut mir zu, wie ich einen tiefen Zug nehme. Soll ich anfangen?
Yep, sage ich, und wenn Ahmed etwas genauso gut kann wie Menschen zu entschlüsseln, dann ist das, Geschichten zu erzählen. Ich kann das nicht. Was ich hier wiedergebe, ist nur der Rumpf der Erzählung, die harten Fakten: Einen Mann hat es da gegeben, der sich in eine junge Frau verliebt hat, die hat so vollkommen ausgesehen wie eine der Jungfrauen aus dem Paradies. Seine Freunde beschworen ihn, er solle sich fernhalten von ihr. So eine Vollkommenheit gibt es auf Erden nicht, warnten sie ihn, die Frau ist ein Geist, anders kann es gar nicht sein. Der Mann entgegnete nichts darauf, und seine Freunde meinten schon, sie hätten ihn überzeugt, da lud er sie wenige Tage später zu einem großen Fest ein. Der Mann hatte keine Kosten und Mühen gescheut. Es gab die feinsten Speisen und Getränke, Musik und Tänzerinnen, und alle unterhielten sich prächtig. Immer wieder ging der Mann durch die Reihen seiner Freunde und fragte, ob irgendetwas fehle, und immer wieder versicherten sie ihm, dass die Feier keinen Wunsch offen lassen würde. Mehr als hier gibt es nicht auf Erden, sagte schließlich einer, und da lächelte der Mann und nickte in tiefer Zufriedenheit, und als sie ihn wenig später suchten, war er verschwunden, und danach hat man ihn und die geheimnisvolle Frau niemals wieder gesehen.
Ahmed sieht mich fragend an, als würde er wissen wollen, wie mir die Geschichte gefallen hat.
Du kannst gut erzählen, sage ich zu ihm.
Dass ich mit der Geschichte wenig anfangen kann, sage ich ihm nicht.
Hat mein Bruder gesagt, was ihm an der Geschichte so gut gefallen hat?
Ja, er meinte, dass er den Mann beneiden würde, weil er das auch gerne können würde.
Was, frage ich.
Mit Geistern sprechen, sagt Ahmed.
Zurück in Tafraoute trinken wir noch einen Tee zusammen. Ahmed versenkt einen großen Zuckerwürfel in seinem Glas. Ich schiebe meinen Zucker zur Seite.
Brauchen Sie den nicht, fragt er, und noch bevor ich antworten kann, lässt er den Würfel in seinen Tee gleiten.
Hat mein Bruder gesagt, wo er als nächstes hinwill?
Er hat mich gefragt, wo er die besten Chancen hätte, einen Geist zu treffen.
Und? Was haben Sie ihm gesagt?
Ich habe ihm von Sidi Ifni erzählt.
Sidi Ifni, frage ich, weil ich den Namen noch nie gehört habe.
Eine Stadt an der Küste, sagt Ahmed, südlich von hier. Die Spanier haben Sie in den 1930er-Jahren gebaut. Alles im europäischen Stil. War eine wichtige Handelsniederlassung für sie. Und natürlich ein sündiges Nest. Viele weibliche Dämonen, wenn Sie wissen, was ich meine. Als die Spanier gehen mussten, war es vorbei mit dem Glanz. Alles versank in einen tiefen Schlaf. Die Häuser stehen aber noch. Sieht alles aus wie vor achtzig Jahren. Und nachts ziehen noch immer die Geister von damals durch die Straßen.
Und was hat mein Bruder dazu gesagt?
Er hat gesagt, dass sich das gut anhört.
Nach Sidi Ifni sind es knapp hundertfünfzig Kilometer. Obwohl ich auf der Hauptstraße unterwegs bin, herrscht kaum Verkehr. Nur hin und wieder kommen mir Sammeltaxis entgegen, alte Peugeots und breite Mercedes-Limousinen, alle in diesem seltsamen Grünton lackiert. Die Straße windet sich wie eine satte Riesenschlange durch die Berge, silbrig-grau, gemustert mit den Rissen und Schlaglöchern im Asphalt. Die Sonnenbrille meines Bruders, die ich vor zwei Tagen auf der Passhöhe gefunden habe, liegt auf dem Armaturenbrett und beobachtet mich mit ihrem leeren und ihrem gesprungenen Auge.
Du Schuft, fahre ich sie wütend an, muss aber gleich darauf lachen und spüre im nächsten Moment, wie mir die Augen feucht werden. Mein Bruder hat mich regelmäßig in so einen Gefühlswirrwarr aus Wut und Traurigkeit geschickt, mit einem hysterischen Lachen dazwischen. Gar nicht absichtlich wahrscheinlich. Das ist einfach er. Und wenn er mich wieder ungewollt fertiggemacht hat, hat er mich angestarrt wie ein Verhaltensforscher seine Laborratte. Ausgenutzt hat er diese Situationen aber nie. Ganz im Gegenteil. Er ist ganz ruhig geworden, ungewohnt zurückhaltend war er in diesen Momenten und hat mich fast ergriffen beobachtet.
Die Landschaft weitet sich jetzt zu einer Hochebene, die Straße führt kerzengerade dahin. Schon von Weitem fällt mir ein knallroter Fleck auf, lässt sich auch gar nicht übersehen in dieser leeren Wüstenlandschaft, die nur aus Brauntönen besteht. Irgendein Stofffetzen, den jemand an einen Stock gehängt hat, der da allein und windschief neben der Straße im Boden steckt. Weil ich mir ohnehin ein wenig die Füße vertreten will, halte ich und sehe mir die Sache aus der Nähe an. Was da hängt, ist eine alte Wollhaube, an mehreren Stellen eingerissen und aufgetrennt, die Fäden hängen lose herunter. Ich nehme sie ab und wundere mich nicht schlecht, als ich darunter eine CD entdecke. Bonnie »Prince« Billy &The Cairo Gang, sagt mir nichts, noch nie gehört, hört sich nach einem dieser Weltmusik-Projekte an, für die sich ein bekannter westlicher Musiker mit einer unbekannten Band aus der Dritten Welt zusammentut. Die CD ist völlig zerkratzt, aber seltsam, die Kratzer sehen nicht wie gewöhnliche Abnutzungsspuren aus, mehr so, als hätte sie jemand absichtlich in die silberne Oberfläche geritzt. Ich stecke sie in den CD-Spieler im Auto, sie springt gleich weiter auf den zweiten Track. Teach me to bear you, heißt es im Refrain. Wer da wen auszuhalten hat, denke ich, weil ich mir sicher bin, dass mein Bruder die CD für mich hinterlassen hat. Die gehört zu der seltsamen Schnitzeljagd, die er für mich inszeniert, der Spinner.
Allzu viel verstehe ich nicht von dem Text, aber beim zweiten Anhören bleibt noch eine Zeile hängen. I want to read you a life of parties and wisdom. Ja, mit vollen Hosen lässt sich leicht stinken. Wem alles leicht von der Hand geht, der kann einem natürlich entspannt erzählen von einem Leben, das aus ausgelassenem Feiern und Weisheit besteht. Verdammter Alleskönner. Egal, womit er sich beschäftigt hat, ein paar Tage später hat er die Sache beherrscht. Ist natürlich ein Albtraum, wenn der eineinhalb Jahre jüngere Bruder ein Genie ist. Da bekommt man von seinen Eltern eine Menge Aufmerksamkeit ab und fühlt sich so richtig wohl. Angefangen hat das schon ganz früh, noch als wir Kleinkinder waren. Wenn wir mit Holzklötzen spielten, waren seine Türme immer höher als meine und fielen auch nicht gleich wieder um. Und wer beim Memory-Spielen gewinnen wird, stand auch immer von vornherein fest. Und das noch bevor er richtig sprechen konnte. Am schlimmsten war aber der Abend vor meinem ersten Schultag. Ich war ja auch nicht blöd und kannte damals schon alle Buchstaben, was ich meinen Eltern stolz präsentieren wollte. Mit einem Buch setzte ich mich zwischen sie auf die Couch und begann daraus vorzulesen. Da kam mein Bruder und hockte sich scheinbar ganz unbeteiligt dazu. Und gerade als ich umblättern wollte, fuhr er plötzlich fort und sagte die ganze nächste Seite auswendig auf. Wir glaubten zuerst, er hatte sich das alles durchs Zuhören gemerkt, aber mein Vater zog daraufhin die Zeitung aus seiner Aktentasche und hielt sie meinem Bruder hin, und der las daraus vor, als gäbe es nichts Einfacheres auf der Welt. Brauche ich jetzt nicht dazusagen, wohin die Aufmerksamkeit meiner Eltern gewandert ist und wo sie blieb und was mir sofort einfällt, wenn ich an meinen ersten Schultag denke.
Dabei bemühten sich meine Eltern, uns gleich zu behandeln. Wenn sie anderen von uns erzählten, begannen sie immer mit mir, es gab ja auch viel über mich zu sagen, ich war ja, wie gesagt, auch nicht blöd, aber eben kein Genie, und so war die Begeisterung gespielt, wenn sie von mir sprachen, und echt, wenn es um meinen Bruder ging. Das spürt man schon als Kind, und da will man natürlich raus, und mich hat das deshalb zum Getriebenen gemacht. Von da an war ich immer auf der Suche nach einer Sache, die unberührt war von meinem Bruder, nach etwas, das ich für mich allein hatte. Doch kaum begann ich, irgendetwas zu spielen oder mich für irgendetwas zu interessieren, tauchte mein Bruder auf, setzte sich dazu, ja, und dann war es nur mehr eine Frage der Zeit, bis er mich völlig in den Schatten stellte.
Die letzte Passhöhe, und von da an fällt das Land steil ab hinunter zur Küstenebene. Eine Serpentine folgt auf die nächste, weiß blühende Mandelbäume gleich hinter den rostigen Leitplanken, und in der Ferne, dort, wo wahrscheinlich das Meer liegt, blaugrauer Dunst. Ich habe mir den Weg gestern Abend noch auf der Karte angesehen. Es gibt eine größere Stadt auf der Route, Tiznit. Dort will ich zu Mittag essen. Tiznit und darunter 17 steht auf einem Kilometerstein neben der Straße, in zwanzig Minuten müsste ich da sein. Der Verkehr nimmt zu, und ich folge einer vierspurigen Straße ins Stadtzentrum. Männer auf Motorrädern fahren neben mir her, rufen mir etwas zu durch den Fahrtwind, erst langsam komme ich drauf, dass sie mir gegen Bakschisch den Weg in die Altstadt zeigen wollen. Ich winke ab, als würde ich mich auskennen hier, tatsächlich kann ich mich gar nicht verirren, ich bin wie ein Flugzeug, das einem unsichtbaren Leitstrahl folgt, von meinem Bruder auf Autopilot geschaltet. Ich erreiche einen großen Platz mitten in der Altstadt und stelle den Wagen ab. Gleich kommen junge Männer auf mich zu, die mir ihr Geschäft zeigen wollen. Mein Bruder wartet auf mich, sage ich und flüchte zusammen mit meiner Ausrede, die eigentlich nur eine halbe Ausrede ist, in ein verwinkeltes Gässchen, halbschattig die Luft mit einem Mal und halbschattig die Stimmen, fast so, als hätte ich einen Innenraum betreten. Rechts der Laden eines Uhrmachers, im Schaufenster alte silberne Taschenuhren und offene Räderwerke, gegenüber ein Süßwarenhändler, der selbst Zuckermandeln und Aschanti brennt, es riecht nach Kardamom und Karamell wie aus einem Märchenbuch, und dann, ein Stück weiter die Gasse hinunter, das Geschäft eines Fotografen. Innen, direkt ans Fensterglas geklebt, sind alle möglichen Aufnahmen zu sehen. Ansichten von Tiznit, kleine Mädchen in rosafarbenen Rüschenkleidern und junge Männer mit den Frisuren bekannter Fußballer. Und dann – und es wundert mich erstaunlich wenig – entdecke ich neben dem Eingang ein Foto meines Bruders. Völlig unverändert ist er, seit ich ihn zum letzten Mal gesehen habe vor zwei Jahren. Noch immer der unverwechselbare und laut Meinung vieler Frauen und auch einiger Männer unwiderstehliche, lausbübische Blick, die Wangen mit den leichten Grübchen, wenn er lacht, und die wild nach allen Seiten abstehenden blonden Haare. Wie Ahmed schon bemerkt hat, sehen wir einander ähnlich und auch wieder nicht, ich habe die gleichen Augen, aber einen anderen Blick, die gleichen Wangen, nur kann ich lachen, so viel ich will, es zeigt sich nicht auch nur der Anflug eines Grübchens, und meine Haare haben zwar die gleiche Farbe, fallen aber in einen biederen Scheitel, egal wie viel Gel ich verwende.
Ja, es stimmt natürlich. Viele meiner Freundinnen waren mit Sicherheit nur mit mir zusammen, weil sie es nicht geschafft hatten, sich meinen Bruder zu angeln. Ich war Ersatz, aber das war ich mit diesem Bruder ja immer, und letztendlich ist jeder doch immer nur irgendwie Ersatz, und außerdem gewöhnt man sich an alles. Unangenehmer war es mit den Mädchen, bei denen ich spürte, dass sie meinen Bruder noch nicht ganz aufgegeben hatten und nur mit mir zusammen waren, um in seine Nähe zu kommen. Zu seiner Ehrenrettung muss ich aber sagen, dass er nie etwas mit einer von ihnen angefangen hat, zumindest habe ich ihn nie dabei erwischt.
Der Fotograf ist ein wilder Typ, nicht mehr der Jüngste, vielleicht Mitte, Ende sechzig, gibt sich aber wie ein Künstler-Bohemien im Paris der 1960er-Jahre. Er begrüßt mich überschwänglich auf Französisch und palavert auch gleich drauflos, und es dauert einige Zeit, bis ich ihm beibringen kann, dass ich kein Wort verstehe. Er lässt sich aber nicht unterkriegen und erzählt sich in einen Rausch über Paris vor vierzig Jahren, als er dort studiert und Sartre auf der Straße zugehört hat.
Irgendwie schaffe ich es schließlich, seinen Redefluss zu unterbrechen und ihn mit mir auf die Straße zu ziehen. Wie er diesen Mann kennengelernt hat, will ich von ihm wissen und zeige auf das Bild meines Bruders.
Ach ja, sagt er, so als hätte er damit gerechnet, dass ich vorbeikomme.
Der ist vor vier, fünf Tagen hier gewesen und wollte, dass ich ihn mit dieser Kette fotografiere.
Eine Kette war mir gar nicht aufgefallen, und ich beuge mich noch einmal hinunter zu dem Bild. Mein Bruder trägt eine alte Münze um den Hals.
Er hat gesagt, dass die Münze auf jeden Fall scharf sein muss.
Ich sehe sie mir genauer an, die Nase fast am Glas. Die Prägung lässt sich gut lesen. Es ist eine spanische Münze aus den Dreißigerjahren, wahrscheinlich wollte mir mein Bruder damit einen weiteren Hinweis auf diese geheimnisvolle spanische Kolonialstadt, dieses Sidi Ifni, zukommen lassen. Nur für den Fall, dass ich in Tafraoute Ahmed nicht getroffen hätte, von dem ich mir mittlerweile sicher bin, dass er an dem Abend im Marrakesh auf mich gewartet hat.
Der Mann ist mein Bruder, sage ich, und wieder muss der Fotograf lachen.
Ich weiß, sagt er, und dabei grinst es nur so aus ihm heraus.
Ich bin es gewohnt, dass mein Bruder Scherze über mich macht. Früher hat mich das verunsichert, heute stört es mich nicht mehr. Gut, es stört mich, aber nicht mehr so wie noch vor zehn Jahren. Es fällt mir mittlerweile leichter, gewisse Dinge zu ignorieren. Mein Bruder meint es ja auch nicht böse, er ist einfach ein Spaßvogel. Erst ein Witz und dann alles andere, das ist seine Einstellung. Ja, ich verteidige meinen Bruder vor mir selbst. Eine Hälfte von mir versteht ihn besser als die andere. Dieses verdammte Lächeln. Wie soll man so einem auch böse sein.
Der Mann steckt das Foto in ein großes, braunes Kuvert. Umgerechnet zehn Euro verlangt er dafür. Ich versuche nicht einmal, den Preis herunterzuhandeln. Damit hat er seinen Tagesumsatz gemacht. Wenn ich in einer Stunde noch einmal vorbeikomme, wird der Laden geschlossen sein und er wird in einem Café sitzen und von Paris träumen. Soll sein. Ist doch eine gute Sache, einem alten Mann sein Träumen zu finanzieren. Die Vorstellung, wie er so zufrieden im Schatten sitzt und in seinem Tee rührt, hat etwas. Genauso geht es, das Leben. Kann aber nicht jeder. Die einen haben das in ihrer DNA, die anderen nicht. Mein Bruder gehört zusammen mit dem Fotografen zu Ersteren, ich zu Zweiteren. Aber man kann es ja immer wieder mal versuchen, und so beschließe ich hier und jetzt, mich von meinem Bruder und seinem albernen Foto nicht zur Eile antreiben zu lassen. Sidi Ifni kann warten, genauso wie diese alberne Schnitzeljagd. Ich will mich jetzt einfach treiben lassen durch diese Gassen und mich den Eindrücken hingeben. Da steigt mir auch schon ein intensiver Duft von Gebratenem in die Nase. An der nächsten Ecke entdecke ich einen Mann, der mit einem kleinen Holzkohlengrill auf der Straße steht, brutzelnde Spieße auf der Glut. Es sieht gut aus, die scharf angebratenen Fleischstücke, das Fett, das zischend auf die glühenden Kohlen tropft, hochzüngelnde Flammen, die der Mann gleich wieder mit seinem ölig glänzenden Strohfächer verweht, der Geruch nach Kreuzkümmel und Pfeffer. Ich habe ein wenig Ahnung von Gewürzen, habe sogar einige Kochkurse belegt, aber wieder aufgehört. Ja, genau, ein begnadeter Koch ist er auch, mein Bruder. Weit besser, als ich es je hätte werden können, also habe ich es wie so vieles andere auch bleiben lassen. Einer der unzähligen Grabsteine auf meinem Friedhof der ungenutzten Möglichkeiten.
Neben dem Holzkohlengrill stehen billige Campingmöbel, zwei Tische und ein paar Sessel aus schmutzigem, weißem Plastik. Der Verstand sagt nein und erzählt mir ein Dutzend Geschichten über Durchfall und Magenkrämpfe, aber dann sehe ich meinen Bruder, der über mich lacht, wie ich so dastehe und grüble und raufe mit meiner Vernunft, und setze mich aus Trotz hin. Bevor ich noch etwas sagen kann, kommt der Mann mit einem Brotkorb, und gleich darauf bringt er eine große silberne Platte mit sicherlich einem Dutzend Spießen darauf. Ich nicke ihm zu in glücklichem Ausgeliefertsein. Anscheinend bin ich doch so gestrickt, dass ich jemanden brauche, der mir sagt, wie es weitergeht. Ja, muss so sein, warum wäre ich sonst auch hier.
Zu viel, sage ich, und der Mann lacht, und wie schon mehrmals in Marokko bekomme ich diese federleichte Geste zu sehen, die Hände, die sanft die Luft nach unten drücken, oder alles, was sonst nach oben steigen und einem Lust und Zeit rauben könnte. Warte ab, sagen seine Hände, und so esse ich einfach ganz gemächlich unter seinem Lächeln dahin, und als die Platte sich tatsächlich langsam leert, da meinen seine Hände mit einem langsamen Bogen nach oben, na, habe ich es dir nicht gesagt?
Auf meinem Rückweg zum Parkplatz komme ich durch die Gasse mit den Parfümhändlern. Wilde Gerüche. Am dominantesten eine schwere, blumige Süße. Zäh wie Honig. Ein nuttiger Duft. Ich mache den Fehler und schaue in ein Schaufenster, in dem in Gläsern die Blüten, Hölzer und Früchte ausgestellt sind, aus denen die Aromen gewonnen werden. Der Ladeninhaber stürzt sich gleich auf mich, die linke Hand voller kleiner Flacons. Schon sprüht er mir den ersten Duft auf den Handrücken, ich rieche daran, rümpfe die Nase und winke ab. Zu schwer, versuche ich ihm begreiflich zu machen und schiebe mich gleichzeitig die Gasse weiter und glaube schon, ihn abgeschüttelt zu haben, als er plötzlich wieder neben mir auftaucht, dieses Mal auf der anderen Seite, und mir auch den zweiten Handrücken vollsprüht. Irgendetwas mit Jasmin. Nicht mehr so schwer wie der erste Duft, aber immer noch viel zu intensiv. Wieder winke ich ab, der Mann lässt aber nicht locker. Mittlerweile sind wir auf dem großen Platz, da vorne steht schon mein Wagen, no, thanks, sage ich noch einmal und taste in der Hosentasche nach dem Autoschlüssel. Ich drücke auf den Knopf, ich höre, wie die Zentralverriegelung aufschnappt und sehe die Warnblinkanlage kurz aufleuchten. Ich steige ein, werfe die Tür hinter mir zu und starte den Wagen. Es ist so unerträglich heiß, dass ich, noch bevor ich losfahre, das Fenster auf der Beifahrerseite herunterlasse. Der Mann bemerkt das und läuft herüber, und setzt plötzlich, als er sich herunterbeugt, einen ganz geheimnisvollen Blick auf. I don’t show everybody, sagt er und hält einen dunkelblauen Flacon hoch, this mixture is the secret of my family for many, many generations. The scent of ghosts, sagt er und sprüht mir seinen Geistergeruch in den Wagen, sodass ein paar feine Tropfen auf der Sonnenbrille meines Bruders landen. Die Brille sieht mich ohne Augen an, der Duft riecht nach nichts, was ich kenne.
Die Straße nach Sidi Ifni führt hoch über dem Atlantik entlang, aber so weit im Landesinneren, dass ich nichts sehe von Strand und Küste. Bei einer Abzweigung Richtung Meer biege ich deshalb kurzerhand ab und folge einer sandigen Piste, in die der Regen tiefe Rinnen gewaschen hat. Sand wirbelt auf, legt sich aufs Seitenfenster und auf die Rückspiegel, und bald habe ich ihn auch im Mund, weil ihn die Lüftung ins Wageninnere bläst. Dann taucht das Ende der Straße auf und ich stelle den Wagen auf einem kleinen Parkplatz ab. Rosa getünchte Stufen führen zum Strand hinunter, zu einem einfachen Hotel und einem Café, weiße Metalltische mit rostigen Scharnieren unter gelben Sonnenschirmen. Was hält mich eigentlich davon ab, einfach hier zu bleiben, zu lesen, zu baden und mich auszuruhen und an nichts zu denken. Kurz fällt alles von mir ab, die Gedanken an meinen Bruder segeln wie Laub zu Boden und ich weiß nur mehr, dass ich am Atlantik stehe, und selbst das hört sich an wie ein Märchen, unglaublich, dass da nichts sein soll außer Wasser und nach Tausenden Kilometern die Küste von Amerika. Mit einem Stolz, als wäre ich Gott am siebenten Schöpfungstag, sehe ich dem Atlantik dabei zu, wie er mit seinen wilden Wogen den schweren Uferkies zum Rollen bringt, ein fortwährendes Murmeln und Klicken. Wenige Dinge gibt es doch noch, bei denen mein Bruder seine Finger nicht im Spiel hat und die mich seitlich an ihm vorbeidenken lassen.
Ein guter Ort hier, jetzt noch ein starker Kaffee, und ich werde zufrieden sein wie schon lange nicht mehr. Ein Bursche in Bermudas, Anfang zwanzig, sitzt mit zwei jungen Frauen an einem Tisch, zwischen ihnen eine Platte mit Seafood, sie essen mit den Händen, puhlen die Garnelen aus ihren Schalen und wischen die fettigen Finger immer wieder ins Papiertischtuch. Ein grelles Scherzen mit vollem Mund ist da im Gang, anzügliche Blicke züngeln im Dreieck, ich lasse einen Sicherheitsabstand und setze mich zwei Tische weiter an den Rand der Terrasse. Zusätzlich drehe ich meinen Sessel so, dass ich das Geflirte hinter meiner kalten Schulter habe, und bestelle einen Espresso. Mein Blick wandert den Strand hinauf und bleibt an zwei Silhouetten hängen, die vor der Brandung tanzen. Eine Frau im Sommerkleid, und wenige Schritte vor ihr tollt ein Hund, und wie sie da versucht, ihm seinen Holzstock zu entwinden und dabei lacht, wirkt sie wie ausgedacht.
Ich habe meine Freundin in den fünfzehn Jahren, die wir zusammen sind, nie betrogen, ja nicht einmal daran gedacht habe ich, aber jetzt, bei dieser Frau in der Gischt und im Sonnenlicht, da beginnt hinter meinem hitzeflirrenden Blick ein Film abzulaufen, wie wir ins Gespräch kommen, sie dann hinaufzeigt zum Hotel und wir schließlich in ihrem Zimmer enden, das Meer im Viereck des Fensters.
Mein Bruder hat sich nie auf längere Beziehungen eingelassen. Wenn das erste Verliebtsein vorbei ist, dann geschieht etwas mit einem, und das will ich nicht, hat er mir einmal gesagt. Der Blick wird dann hart und unnachgiebig. Aber nicht im Umgang mit dem Partner, wie alle behaupten, sondern im Umgang mit sich selbst. Plötzlich stößt man an sich, wo man früher durch sich hindurchgegangen ist, und bevor man es mitbekommt, ist sie dahin, die Lebensgeschmeidigkeit.
Ein Bellen schubst mich aus meinen Gedanken, und als ich die Augen öffne und mir die Hand als Schirm an die Stirn halte, sitzt die Frau im Sommerkleid tatsächlich am Nebentisch, und der Hund zu ihren Füßen trinkt gierig aus einem Plastiknapf.
Hallo, sagt sie plötzlich, ohne aber wirklich zu mir herüberzuschauen. Stattdessen beugt sie sich zu ihrem Hund hinunter und krault ihm das Fell.
Gerade angekommen, fragt sie, ihr Blick immer noch auf dem Nacken ihres Hundes.
Ja, sage ich und schaue auch anstatt zu ihr, dem Hund beim Trinken zu.
Wie lange bleibst du?
Weiß nicht. Ich will eigentlich nach Sidi Ifni und bin nur zufällig hier gelandet.
Ein schöner Zufall, sagt sie und schaut die Küste hinauf, wo die roten Klippen aus dem Atlantik aufsteigen.
Yep. Bin auch ganz zufrieden mit dem Zufall, sage ich. Wie lange bist du schon hier?
Zehn Tage vielleicht. Ich müsste nachschauen. Der Wievielte ist heute?
Ich sage ihr das Datum.
Der Vierzehnte? Dann sind es doch schon zwei Wochen. Wenn das Meer dauernd rauscht, vergisst man die Tage. Wirklich. Je lauter die Umgebung, desto leiser die Zeit.
Möglich, sage ich.
Ist so, sagt sie.
Das ist ein Collie, oder, frage ich. Habe schon seit Ewigkeiten keinen mehr gesehen.
Ja, seit sie Lassie nicht mehr zeigen, sind die völlig aus der Mode. Sind auch nur noch schwer zu bekommen. Fast so, als könnten Haustiere aussterben.
Heile Lassie-Welt, sage ich, wo bist du hin?
Sie lacht, und in dem Moment weiß ich, dass wir miteinander im Bett landen werden.
Sie schaut mich ein wenig zu lange an, ohne etwas zu sagen, und da weiß ich, dass sie es auch weiß. Wie ein stummes Einverständnis steht dieses Wissen zwischen uns, und auf einmal reden wir los, als würden wir uns kennen.
Sie erzählt mir, dass ihr Freund sie nach sechs gemeinsamen Jahren verlassen hat, und ich erzähle ihr, dass mein Bruder verschwunden ist.
Nein, eigentlich versteckt er sich vor mir, sage ich. Also, es ist so eine Art Suche, die er da veranstaltet. Er hinterlässt mir Hinweise und will, dass ich ihn aufspüre.
Hört sich an, als würde er die Regeln aufstellen.
Zumindest versucht er es, sage ich, und meine Stimme klingt flach dabei. Wie wenn man einen Witz erzählt und mittendrin schon weiß, dass keiner lachen wird.
Und was machst du, wenn du deinen Bruder gefunden hast?
Reden. Er hat mir etwas zu sagen.
Was?
Keine Ahnung. Irgendetwas, das ich bisher anscheinend nicht verstanden habe.
Marie, sagt sie ganz unvermittelt, und ich verstehe sie nicht gleich und sehe sie deshalb fragend an.
Ich heiße Marie, sagt sie noch einmal, und ich sage ihr meinen Namen, und wir geben uns die Hand.
Und, was machst du, wenn du nicht gerade durch Marokko fährst?
Ich bin Sänger, sage ich.
Was? In einer Band?
Nein, klassisch. Bariton.
Opern und so?
Nein, nur Konzerte. Ich kann nicht schauspielern. Meistens singe ich im Chor, manchmal gebe ich auch Liederabende. Wir haben ein kleines Ensemble gegründet. Ein Geiger, eine Cellistin, ein Pianist und ich.
Sie zieht die Augenbrauen hoch und weiß offensichtlich nicht, was sie sagen soll, und ich bin mir auf einmal doch nicht mehr so sicher, dass wir miteinander im Bett landen werden.
Wie kommt man auf so etwas, ich meine, Gesang zu studieren?
Ich überlege, ob ich ihr die Geschichte erzählen soll und entscheide mich dagegen.
Ein Zufall, sage ich.
Schon wieder, sagt sie. Ganz schön viele Zufälle in deinem Leben. Ein Zufall, der dich zum Singen bringt, einer der dich ans Meer bringt. Wohin bringt dich der nächste?
Nach Sidi Ifni, sage ich und denke, dass der Zufall den Namen meines Bruders trägt.
Sie taucht einen Finger in ihr Cola und schreibt Sidi Ifni auf die Tischplatte.
Ich war dort, sagt sie. Eine gruselige Stadt. Mauern und Menschen passen nicht zusammen. Die Bewohner gehen durch ihre Straßen, als würden sie nicht hierhergehören. Ich fahre dort nicht noch einmal hin.
Wo würdest du hinfahren, frage ich.
Ich würde hierbleiben.
Ich meine, an meiner Stelle.
Ja, an deiner Stelle.
Mein Selbstvertrauen ist enden wollend, mein letzter Flirt liegt lange zurück, und so dauert es einige Momente, bis ich begreife, dass das jetzt die recht unverhohlene Einladung war, über Nacht hierzubleiben. Sogar als ich Marie später auf ihrem Bett das Sommerkleid über den Kopf ziehe, kann ich es immer noch nicht wirklich glauben. Wann passiert das schon, dass der Tagtraum, den man im Kopf wälzt, Wirklichkeit wird? Einer wie ich glaubt da natürlich, dass ihm seine Sinne einen Streich spielen. Dass er gleich aufwachen wird an seinem Tisch im Strandcafé, weil ein Hund ihm die Zehen abschleckt. Aber nein, der Hund liegt lang ausgestreckt und dösend am Boden neben dem Bett, im Viereck des Fensters das Meer, Lichtstaub, der durchs Zimmer tanzt wie voyeuristische Nymphen, die sich nichts entgehen lassen wollen, und sonst nichts als Haut und Laken.
Magenkrämpfe reißen mich mitten in der Nacht aus dem Schlaf. Ich schaffe es gerade noch auf das Gemeinschaftsklo. Ein fürchterlicher Durchfall. Mich räumt es völlig aus. Gleich darauf muss ich mich auch übergeben. Ich bin froh, dass die Toilette am anderen Ende des Gangs liegt und Marie deshalb nichts mitbekommt von diesem Desaster. Irgendwann hocke ich als völlig kraftloses Häufchen Elend in der Duschkabine und lasse mir lauwarmes Wasser über Kopf und Rücken tröpfeln, die Augen brennend und feucht, weil mir noch immer stechende Magenkrämpfe den Atem rauben. Von Marie ist zum Glück weiterhin nichts zu hören. Das wäre mein Horror, wenn sie jetzt an die Tür klopfen und fragen würde, was los sei. Die Übelkeit kommt zurück. Noch ein letztes, leeres Würgen in die Klomuschel, dann klappe ich den Deckel herunter, setze mich und wische mir Gesicht und Augen mit Klopapier trocken. Als ich gerade noch einmal zur Rolle greifen will, fällt mir an der Wand ein Graffito auf.
Ein Gespenst geht um am Atlantik, das Gespenst des …, mehr steht da nicht, das Wort dahinter ist weggekratzt. In dem Moment weiß ich, dass mein Bruder hier gewesen ist und dass dieses Graffito von ihm stammt. Und nicht nur das. Wenn er hier war, dann kennt er auch Marie, und das heißt, dass er auf irgendeine Weise bei alldem, was zwischen Marie und mir vorgefallen ist, die Hände im Spiel hat.
Ich will sofort weg von hier. Mein Gepäck ist im Wagen. Hemd und Hose habe ich an. Was fehlt, sind Schuhe und Socken, die liegen noch in Maries Zimmer. Ich schleiche schon den Gang hinunter, um sie zu holen, als mir der Hund einfällt. Der macht die Sache aussichtslos. Er würde sofort bellen und Marie wecken, und ich habe nicht die geringste Lust, sie noch einmal zu sehen und mit ihr zu sprechen. Also lasse ich Schuhe und Socken da. Fahren kann ich auch bloßfüßig und billige Sandalen kann ich mir im nächsten Ort kaufen.
Das Gespenst am Atlantik. Zuerst habe ich angenommen, mein Bruder meint sich selbst damit. Als ich jetzt barfuß, leichenblass und ausgezehrt im Mondlicht die Stiegen zu meinem Auto hinaufsteige, frage ich mich, ob das Gespenst nicht eher ich bin.
Ich fahre in die Nacht hinein, völlig leer, als hätte mir der Durchfall auch meinen Kopf ausgeräumt. Ein Schatten seiner selbst. Genauso fühle ich mich. Als wäre nichts mehr von mir übrig, nur diese graue Silhouette, die das Mondlicht auf den Beifahrersitz wirft. Dann fängt von einer Sekunde auf die nächste wieder mein Magen zu rebellieren an, und ich schaffe es gerade noch, den Wagen anzuhalten, auszusteigen, mir die Hosen herunterzureißen und mich in die steinige Landschaft zu hocken. Danach bin ich so kraftlos, dass es mir kaum gelingt, den Zündschlüssel herumzudrehen. Ich merke, dass es keinen Sinn mehr hat, weiterzufahren, stelle den Motor wieder ab, kippe den Sitz zurück und schlafe auf der Stelle ein.