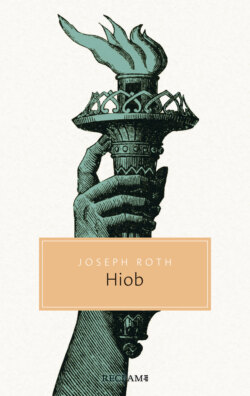Читать книгу Hiob. Roman eines einfachen Mannes - Йозеф Рот - Страница 7
IV
ОглавлениеNicht weit von den Kluczy´sker Verwandten Mendel Singers lebte Kapturak, ein Mann ohne Alter, ohne Familie, ohne Freunde, flink und vielbeschäftigt und mit den Behörden vertraut. Seine Hilfe zu erreichen bemühte sich Deborah. Von den siebzig Rubeln, die Kapturak einforderte, ehe er sich mit seinen Klienten in Verbindung setzte, besaß sie erst knapp fünfundzwanzig, geheim erspart in den langen Jahren der Mühsal, im haltbaren Lederbeutel aufbewahrt unter einem Dielenbrett, das ihr allein vertraut war. Jeden Freitag hob sie es sachte auf, wenn sie den Fußboden scheuerte. Ihrer mütterlichen Hoffnung erschien die Differenz von fünfundvierzig Rubeln geringer als die Summe, die sie bereits besaß. Denn zu dieser addierte sie die Jahre, in denen sich das Geld angehäuft hatte, die Entbehrungen, denen jeder halbe Rubel seine Dauer verdankte, und die vielen stillen und heißen Freuden des Nachzählens.
Vergeblich versuchte ihr Mendel Singer die Unzugänglichkeit Kapturaks zu schildern, sein hartes Herz und seinen hungrigen Beutel. »Was willst du, Deborah«, sagte Mendel Singer, »die Armen sind ohnmächtig, Gott wirft ihnen keine goldenen Steine vom Himmel, in der Lotterie gewinnen sie nicht, und ihr Los müssen sie in Ergebenheit tragen. Dem einen gibt Er und dem andern nimmt Er. Ich weiß nicht, wofür Er uns straft, zuerst mit dem kranken Menuchim und jetzt mit den gesunden Kindern. Ach, dem Armen geht es schlecht, wenn er gesündigt hat, und wenn er krank ist, geht es ihm schlecht. Man soll sein Schicksal tragen! Lass die Söhne einrücken, sie werden nicht verkommen! Gegen den Willen des Himmels gibt es keine Gewalt. ›Von ihm donnert es und blitzt es, er wölbt sich über die ganze Erde, vor ihm kann man nicht davonlaufen‹ – so steht es geschrieben.«
Deborah aber antwortete, die Hand in die Hüfte gestemmt, über den Bund rostiger Schlüssel: »Der Mensch muss sich zu helfen suchen, und Gott wird ihm helfen. So steht es geschrieben, Mendel! Immer weißt du die falschen Sätze auswendig. Viele tausend Sätze sind geschrieben worden, die überflüssigen merkst du dir alle! Du bist so töricht geworden, weil du Kinder unterrichtest! Du gibst ihnen dein bisschen Verstand, und sie lassen bei dir ihre ganze Dummheit. Ein Lehrer bist du, Mendel, ein Lehrer!«
Mendel Singer war nicht eitel auf seinen Verstand und auf seinen Beruf. Dennoch wurmten ihn die Reden Deborahs, ihre Vorwürfe zernagten langsam seine Gutmütigkeit, und in seinem Herzen züngelten bereits die weißen Stichflämmchen der Empörung. Er wandte sich ab, um das Angesicht seiner Frau nicht länger anzusehn. Es war ihm, als kannte er es schon lange, weit länger als seit der Hochzeit, seit der Kindheit vielleicht. Lange Jahre war es ihm gleich erschienen, wie am Tage seiner Heirat. Er hatte nicht gesehen, wie das Fleisch abbröckelte von den Wangen, schöngetünchter Mörtel von einer Wand, wie die Haut sich um die Nase spannte, um desto lockerer unter dem Kinn zu zerflattern, wie die Lider sich runzelten zu Netzen über den Augen und wie deren Schwärze ermattete zu einem kühlen und nüchternen Braun, kühl, verständig und hoffnungslos. Eines Tages, er erinnerte sich nicht, wann es gewesen sein konnte (vielleicht war es auch an jenem Morgen geschehen, an dem er selbst geschlafen und nur eines seiner Augen Deborah vor dem Spiegel überrascht hatte), eines Tages also war die Erkenntnis über ihn gekommen. Es war wie eine zweite, eine wiederholte Ehe, diesmal mit der Hässlichkeit, mit der Bitterkeit, mit dem fortschreitenden Alter seiner Frau. Näher empfand er sie zwar, beinahe ihm einverleibt, untrennbar und auf ewig, aber unerträglich, quälend und ein bisschen auch gehasst. Sie war aus einem Weib, mit dem man sich nur in der Finsternis verbindet, gleichsam eine Krankheit geworden, mit der man Tag und Nacht verbunden ist, die einem ganz angehört, die man nicht mehr mit der Welt zu teilen braucht und an deren treuer Feindschaft man zugrunde geht. Gewiss, er war nur ein Lehrer! Auch sein Vater war ein Lehrer gewesen, sein Großvater auch. Er selbst konnte eben nichts anderes sein. Man griff also sein Dasein an, wenn man seinen Beruf tadelte, man versuchte ihn auszulöschen aus der Liste der Welt. Dagegen wehrte sich Mendel Singer.
Eigentlich freute er sich, dass Deborah wegfuhr. Jetzt schon, während sie die Vorbereitungen zur Abreise traf, war das Haus leer, Jonas und Schemarjah trieben sich in den Gassen herum, Mirjam saß bei den Nachbarn oder ging spazieren. Zu Hause, um die Stunde des Mittags, bevor die Schüler wiederkamen, blieben nur Mendel und Menuchim. Mendel aß eine Graupensuppe, die er selbst gekocht hatte, und ließ in seinem irdenen Teller einen erheblichen Rest für Menuchim übrig. Er schob den Riegel vor, damit der Kleine nicht vor die Tür krieche, wie es seine Art war. Dann ging der Vater in die Ecke, hob das Kind hoch, setzte es auf seine Knie und begann es zu füttern.
Er liebte diese stillen Stunden. Er blieb gern allein mit seinem Sohn. Ja, manchmal überlegte er, ob es nicht besser wäre, wenn sie überhaupt zusammenblieben, ohne Mutter, ohne Geschwister. Nachdem Menuchim Löffel um Löffel die Graupensuppe verschluckt hatte, setzte ihn der Vater auf den Tisch, blieb hart vor ihm sitzen und vertiefte sich mit zärtlicher Neugier in das breite blassgelbe Angesicht mit den vielen Runzeln auf der Stirn, den vielfach gefältelten Augenlidern und dem schlaffen Doppelkinn. Er bemühte sich, zu erraten, was in diesem breiten Schädel vorgehn mochte, durch die Augen wie durch Fenster in das Gehirn hineinzusehen und durch ein bald leises, bald lautes Sprechen dem stumpfen Knaben irgendein Zeichen zu entlocken. Er nannte zehnmal hintereinander Menuchims Namen, mit langsamen Lippen zeichnete er die Laute in die Luft, damit Menuchim sie erblickte, wenn er sie schon nicht hören konnte. Aber Menuchim regte sich nicht. Dann ergriff Mendel seinen Löffel, schlug damit gegen ein Teeglas, und sofort wandte Menuchim den Kopf, und ein kleines Lichtlein flammte in seinen großen, grauen, hervorquellenden Augen auf. Mendel klingelte weiter, begann ein Liedchen zu singen und mit dem Löffel an das Glas den Takt zu läuten, und Menuchim offenbarte eine deutliche Unruhe, wendete den großen Kopf mit einiger Mühe und baumelte mit den Beinen. »Mama, Mama!« rief er dazwischen. Mendel stand auf, holte das schwarze Buch der Bibel, hielt die erste Seite aufgeschlagen vor Menuchims Angesicht und intonierte in der Melodie, in der er seine Schüler zu unterrichten pflegte, den ersten Satz: »Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.« Er wartete einen Augenblick, in der Hoffnung, dass Menuchim die Worte nachsprechen würde. Aber Menuchim regte sich nicht. Nur in seinen Augen stand noch das lauschende Licht. Da legte Mendel das Buch weg, blickte seinen Sohn traurig an und fuhr in dem monotonen Singsang fort:
»Hör mich, Menuchim, ich bin allein! Deine Brüder sind groß und fremd geworden, sie gehn zu den Soldaten. Deine Mutter ist ein Weib, was kann ich von ihr verlangen. Du bist mein jüngster Sohn, meine letzte und jüngste Hoffnung habe ich in dich gepflanzt. Warum schweigst du, Menuchim? Du bist mein wirklicher Sohn! Sieh her, Menuchim, und wiederhole die Worte: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde …«
Mendel wartete noch einen Augenblick. Menuchim rührte sich nicht. Da klingelte Mendel wieder mit dem Löffel an das Glas. Menuchim drehte sich um, und Mendel ergriff wie mit beiden Händen den Moment der Wachheit und sang wieder: »Hör mich, Menuchim! Ich bin alt, du bleibst mir allein von allen Kindern, Menuchim! Hör zu und sprich mir nach: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde …«
Aber Menuchim rührte sich nicht.
Da ließ Mendel mit einem schweren Seufzer Menuchim wieder auf den Boden. Er schob den Riegel zurück und trat vor die Tür, um seine Schüler zu erwarten. Menuchim kroch ihm nach und blieb auf der Schwelle hocken. Von der Turmuhr schlug es sieben Schläge, vier tiefe und drei helle. Da rief Menuchim: »Mama, Mama!« Und als Mendel sich zu ihm umwandte, sah er, dass der Kleine den Kopf in die Luft streckte, als atmete er den nachhallenden Gesang der Glocken ein.
»Wofür bin ich so gestraft?«, dachte Mendel. Und er durchforschte sein Gehirn nach irgendeiner Sünde und fand keine schwere.
Die Schüler kamen. Er kehrte mit ihnen ins Haus zurück, und während er auf und ab durch die Stube wanderte, den und jenen ermahnte, den auf die Finger schlug und jenem einen leichten Stoß in die Rippen versetzte, dachte er unaufhörlich: Wo ist die Sünde? Wo steckt die Sünde? –
Deborah ging indessen zum Fuhrmann Sameschkin und fragte ihn, ob er sie in der nächsten Zeit umsonst nach Kluczy´sk mitnehmen könnte.
»Ja«, sagte der Kutscher Sameschkin, er saß auf der blanken Ofenbank, ohne sich zu rühren, die Füße in graugelben Säcken, mit Stricken umwickelt, und er duftete nach selbstgebrautem Schnaps. Deborah roch den Branntwein wie einen Feind. Es war der gefährliche Geruch der Bauern, der Vorbote unbegreiflicher Leidenschaften und der Begleiter der Pogromstimmungen. »Ja«, sagte Sameschkin, »wenn die Wege besser wären!« – »Du hast mich einmal auch schon im Herbst mitgenommen, als die Wege noch schlechter waren.« – »Ich erinnere mich nicht«, sagte Sameschkin, »du irrst dich, es wird ein trockener Sommertag gewesen sein.« – »Keineswegs«, erwiderte Deborah, »es war Herbst, und es regnete, und ich fuhr zum Rabbi.« – »Siehst du«, sagte Sameschkin, und seine beiden Füße in den Säcken begannen sachte zu baumeln, denn die Ofenbank war ziemlich hoch und Sameschkin ziemlich klein von Wuchs, »siehst du«, sagte er, »damals fuhrst du zum Rabbi, es war vor euren hohen Feiertagen, und da nahm ich dich eben mit. Heute aber fährst du nicht zum Rabbi!« – »Ich fahre in einer wichtigen Angelegenheit«, sagte Deborah, »Jonas und Schemarjah sollen niemals Soldaten werden!« – »Auch ich war Soldat«, meinte Sameschkin –, »sieben Jahre, davon saß ich zwei im Zuchthaus, denn ich hatte gestohlen. Eine Kleinigkeit übrigens!« Er brachte Deborah zur Verzweiflung. Seine Erzählungen bewiesen ihr nur, wie fremd er ihr war, ihr und ihren Söhnen, die nicht stehlen und auch nicht im Zuchthaus sitzen sollten. Also entschloss sie sich, schnell zu handeln: »Wieviel soll ich dir zahlen?« – »Gar nichts! – Ich verlange kein Geld, ich will auch nicht fahren! Der Schimmel ist alt, der Braune hat gleich auf einmal zwei Hufeisen verloren. Übrigens frisst er den ganzen Tag Hafer, wenn er einmal nur zwei Werst gelaufen ist. Ich kann ihn nicht mehr halten, ich will ihn verkaufen. Es ist überhaupt kein Leben, Fuhrmann sein!« – »Jonas wird den Braunen selbst zum Schmied führen«, sagte beharrlich Deborah, »er wird selbst die Hufeisen bezahlen.« – »Vielleicht!« erwiderte Sameschkin. »Wenn Jonas das selbst machen will, dann muss er aber auch ein Rad beschlagen lassen.« – »Auch das!«, versprach Deborah. »Wir fahren also nächste Woche!«
Also reiste sie nach Kluczy´sk, zu dem unheimlichen Kapturak. Viel lieber wäre sie eigentlich beim Rabbi eingetreten, denn gewiss war ein Wort aus seinem heiligen dünnen Mund mehr wert als eine Protektion Kapturaks. Aber der Rabbi empfing nicht zwischen Ostern und Pfingsten, es sei denn in dringenden Fällen, in denen es sich um Leben und Tod handelte. Sie traf Kapturak in der Schenke, wo er umringt von Bauern und Juden in der Ecke am Fenster saß und schrieb. Seine offene Mütze, mit dem aufwärts gekehrten Unterfutter, lag auf dem Tisch, neben den Papieren, wie eine ausgestreckte Hand, und viele Silbermünzen ruhten bereits in der Mütze und zogen die Augen aller Umstehenden an. Kapturak kontrollierte sie von Zeit zu Zeit, obwohl er wusste, dass niemand wagen würde, ihm auch nur eine Kopeke zu entwenden. Er schrieb Gesuche, Liebesbriefe und Postanweisungen für jeden Analphabeten – (außerdem konnte er Zähne ziehen und Haare schneiden).
»Ich habe mit dir eine wichtige Sache zu besprechen« , sagte Deborah über die Köpfe der Umstehenden hinweg. Kapturak schob mit einem Ruck alle Papiere von sich, die Menschen zerstreuten sich, er langte nach der Mütze, schüttete das Geld in die hohle Hand und knüpfte es in ein Taschentuch. Dann lud er Deborah ein, sich zu setzen.
Sie sah in seine harten kleinen Augen, wie in starre helle Knöpfchen aus Horn. »Meine Söhne müssen einrücken!«, sagte sie. »Du bist eine arme Frau«, sagte Kapturak mit einer fernen singenden Stimme, als läse er aus den Karten. »Du hast kein Geld sparen können, und kein Mensch kann dir helfen.« »Doch, ich habe gespart.« »Wie viel?« »Vierundzwanzig Rubel und siebzig Kopeken. Davon habe ich schon einen Rubel ausgegeben, um dich zu sehn.« – »Das macht also nur dreiundzwanzig Rubel!« – »Dreiundzwanzig Rubel und siebzig Kopeken!«, verbesserte Deborah. Kapturak hob die rechte Hand, spreizte Mittel- und Zeigefinger und fragte: »Und zwei Söhne?« – »Zwei«, flüsterte Deborah. – »Fünfundzwanzig kostet schon ein einziger!« – »Für mich?« – »Auch für dich!«
Sie handelten eine halbe Stunde. Dann erklärte sich Kapturak mit fünfundzwanzig für einen zufrieden. »Wenigstens Einer!«, dachte Deborah.
Aber unterwegs, während sie auf der Fuhre Sameschkins saß, und die Räder durch ihre Eingeweide und ihren armen Kopf holperten, erschien ihr die Lage noch elender als zuvor. Wie konnte sie ihre Söhne voneinander unterscheiden? Jonas oder Schemarjah?, fragte sie sich unermüdlich. Besser einer als beide – sagte ihr Verstand, wehklagte ihr Herz.
Als sie nach Hause kam und ihren Söhnen das Urteil Kapturaks zu berichten anfing, unterbrach sie Jonas, der Ältere, mit den Worten: »Ich gehe gern zu den Soldaten!«
Deborah, die Tochter Mirjam, Schemarjah und Mendel Singer warteten, wie Hölzer. Endlich, da Jonas nichts weiter sprach, sagte Schemarjah:
»Du bist ein Bruder! Ein guter Bruder bist du!« »Nein«, erwiderte Jonas, »ich will zu den Soldaten!«
»Vielleicht kommst du ein halbes Jahr später frei!«, tröstete der Vater.
»Nein«, sagte Jonas, »ich will gar nicht freikommen! Ich bleibe bei den Soldaten!«
Alle murmelten das Nachtgebet. Schweigsam entkleideten sie sich. Dann ging Mirjam im Hemd und auf koketten Zehen zur Lampe und pustete sie aus. Sie legten sich schlafen.
*
Am nächsten Morgen war Jonas verschwunden. Sie suchten nach ihm, den ganzen Vormittag. Erst am späten Abend erblickte ihn Mirjam. Er ritt einen Schimmel, trug eine braune Joppe und eine Soldatenmütze.
»Bist du schon Soldat?«, rief Mirjam.
»Noch nicht«, sagte Jonas und hielt den Schimmel an. »Grüß’ Vater und Mutter. Ich bin bei Sameschkin, vorläufig, bis ich einrücke. Sag’, ich konnte es nicht bei euch aushalten, aber ich hab’ euch alle ganz gern!«
Er ließ daraufhin eine Weidengerte pfeifen, zog an den Zügeln und ritt weiter.
Von nun an war er Pferdeknecht beim Fuhrmann Sameschkin. Er striegelte den Schimmel und den Braunen, schlief bei ihnen im Stall, sog mit offenen genießenden Nasenlöchern ihren beizenden Urinduft ein und den sauren Schweiß. Er besorgte den Hafer und den Tränkeimer, flickte die Koppeln, beschnitt die Schwänze, hängte neue Glöckchen an das Joch, füllte die Tröge, wechselte das faule Heu in den zwei Fuhren gegen trockenes aus, trank Samogonka mit Sameschkin, war betrunken und befruchtete die Mägde.
Man beweinte ihn zu Hause als einen Verlorenen, aber man vergaß ihn nicht. Der Sommer brach an, heiß und trocken. Die Abende sanken spät und golden über das Land. Vor der Hütte Sameschkins saß Jonas und spielte Ziehharmonika. Er war sehr betrunken und er erkannte seinen eigenen Vater nicht, der manchmal zögernd vorbeischlich, ein Schatten, der sich vor sich selbst fürchtet, ein Vater, der nicht aufhörte zu staunen, dass dieser Sohn seinen eigenen Lenden entsprossen war.