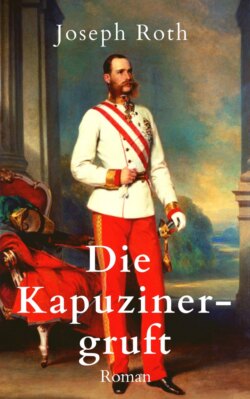Читать книгу Die Kapuzinergruft - Йозеф Рот - Страница 8
V
ОглавлениеEin paar Tage noch sprachen wir in unserer heiteren Gesellschaft von meinem Vetter Joseph Branco. Dann vergaßen wir ihn wieder – das heißt: wir legten ihn gleichsam vorläufig ab. Denn die aktuellen Torheiten unseres Lebens wollten besprochen und gewürdigt werden.
Erst im Spätsommer, gegen den zwanzigsten August, erhielt ich von Joseph Branco in slowenischer Sprache einen Brief, den ich meinen Freunden noch am gleichen Abend übersetzte. Er beschrieb die Kaiser-Geburtstagsfeier in Sipolje, die Feier des Veteranenvereins. Er selbst war noch ein zu junger Reservist, um den Veteranen anzugehören. Dennoch marschierte er mit ihnen aus, in die Waldwiese, wo sie an jedem achtzehnten August ein Volksfest veranstalteten, einfach, weil keiner von den alten Leuten noch so kräftig war, die große Kesselpauke zu tragen. Es gab fünf Hornisten und drei Klarinettbläser. Aber was ist eine Marschkapelle ohne Kesselpauke?
»Merkwürdig«, sagte der junge Festetics, »diese Slowenen! Die Ungarn nehmen ihnen die primitivsten nationalen Rechte, sie wehren sich, sie rebellieren sogar gelegentlich oder haben zumindest den Anschein zu rebellieren, aber sie feiern den Geburtstag des Königs.«
»In dieser Monarchie«, erwiderte Graf Chojnicki, er war der älteste unter uns, »ist nichts merkwürdig. Ohne unsere Regierungstrottel« (er liebte starke Ausdrücke) »wäre ganz gewiß auch dem äußerlichen Anschein nach gar nichts merkwürdig. Ich will damit sagen, daß das sogenannte Merkwürdige für Österreich-Ungarn das Selbstverständliche ist. Ich will zugleich damit auch sagen, daß nur diesem verrückten Europa der Nationalstaaten und der Nationalismen das Selbstverständliche sonderbar erscheint. Freilich sind es die Slowenen, die polnischen und ruthenischen Galizianer, die Kaftanjuden aus Boryslaw, die Pferdehändler aus der Bacska, die Moslems aus Sarajevo, die Maronibrater aus Mostar, die ›Gott erhalte‹ singen. Aber die deutschen Studenten aus Brunn und Eger, die Zahnärzte, Apotheker, Friseurgehilfen, Kunstphotographen aus Linz, Graz, Knittelfeld, die Kröpfe aus den Alpentälern, sie alle singen ›Die Wacht am Rhein›. Österreich wird an dieser Nibelungentreue zugrunde gehn, meine Herren! Das Wesen Österreichs ist nicht Zentrum, sondern Peripherie. Österreich ist nicht in den Alpen zu finden, Gemsen gibt es dort und Edelweiß und Enzian, aber kaum eine Ahnung von einem Doppeladler. Die österreichische Substanz wird genährt und immer wieder aufgefüllt von den Kronländern.« Baron Kovacs, junger Militäradel ungarischer Nationalität, klemmte das Monokel ein, wie es immer seine Gewohnheit war, wenn er etwas besonders Wichtiges sagen zu müssen glaubte. Er sprach das harte und singende Deutsch der Ungarn, nicht so sehr aus Notwendigkeit wie aus Koketterie und Protest. Dabei rötete sich sein eingefallenes Gesicht, das an unreifes, zu wenig gegorenes Brot erinnerte, heftig und unnatürlich. »Die Ungarn leiden am meisten von allen in dieser Doppelmonarchie«, sagte er. Es war sein Glaubensbekenntnis, unverrückbar standen die Worte in diesem Satz. Er langweilte uns alle, Chojnicki, den Temperamentvollsten, wenngleich ältesten unter uns, erzürnte es sogar. Die ständige Antwort Chojnickis konnte nicht ausbleiben. Wie gewohnt, wiederholte er: »Die Ungarn, lieber Kovacs, unterdrücken nicht weniger als folgende Völker: Slowaken, Rumänen, Kroaten, Serben, Ruthenen, Bosniaken, Schwaben aus der Bacska und Siebenbürger Sachsen.« Er zählte die Völker an gespreizten Fingern seiner schönen, schlanken, kräftigen Hände auf.
Kovacs legte das Monokel auf den Tisch. Chojnickis Worte schienen ihn gar nicht zu erreichen. Ich weiß, was ich weiß – dachte er wie immer. Manchmal sagte er es auch.
Er war im übrigen ein harmloser, sogar zeitweilig guter junger Mann, ich konnte ihn nicht leiden. Dennoch bemühte ich mich redlich um ein freundliches Gefühl für ihn. Ich litt geradezu darunter, daß ich ihn nicht leiden mochte, und dies hatte seinen guten Grund: Ich war nämlich in Kovacs' Schwester verliebt; Elisabeth hieß sie; neunzehn Jahre war sie alt.
Ich kämpfte lange Zeit vergebens gegen diese Liebe, nicht so sehr deshalb, weil ich mich gefährdet glaubte, sondern weil ich den stillen Spott meiner skeptischen Freunde fürchtete. Es war damals, kurz vor dem großen Kriege, ein höhnischer Hochmut in Schwung, ein eitles Bekenntnis zur sogenannten »Dekadenz«, zu einer halb gespielten und outrierten Müdigkeit und einer Gelangweiltheit ohne Grund. In dieser Atmosphäre verlebte ich meine besten Jahre. In dieser Atmosphäre hatten Gefühle kaum einen Platz, Leidenschaften gar waren verpönt. Meine Freunde hatten kleine, ja unbedeutende »Liaisons«, Frauen, die man ablegte, manchmal sogar herlieh wie Überzieher; Frauen, die man vergaß wie Regenschirme oder absichtlich liegenließ wie lästige Pakete, nach denen man sich nicht umsieht, aus Angst, sie könnten einem nachgetragen werden. In dem Kreis, in dem ich verkehrte, galt die Liebe als eine Verirrung, ein Verlöbnis war so etwas wie eine Apoplexie und eine Ehe ein Siechtum. Wir waren jung. An eine Heirat dachte man zwar als eine unausbleibliche Folge des Lebens, aber ähnlich, wie man an eine Sklerose denkt, die wahrscheinlich in zwanzig oder dreißig Jahren notwendig eintreten muß. Ich hätte viele Gelegenheiten finden können, um mit dem Mädchen allein zu sein, obwohl es in jener Zeit noch nicht zu den Selbstverständlichkeiten gehörte, daß junge Damen allein in Gesellschaft junger Herren ohne einen schicklichen, geradezu legitimen Vorwand länger als eine Stunde bleiben konnten. Nur einige wenige solcher Gelegenheiten nahm ich wahr. Alle auszunützen, schämte ich mich, wie gesagt, vor meinen Freunden. Ja, ich gab peinlich darauf acht, daß von meinem Gefühl nichts bemerkt wurde, und oft fürchtete ich, der und jener aus meinem Kreise wüßte bereits etwas davon, hier oder dort hätte ich mich vielleicht schon verraten. Wenn ich manchmal unerwartet zu meinen Freunden stieß, glaubte ich aus ihrem plötzlichen Schweigen schließen zu müssen, daß sie soeben, vor meiner Ankunft, von meiner Liebe zu Elisabeth Kovacs gesprochen hatten, und ich war verdüstert, als hätte man eine verfemte, geheime Schwäche bei mir entdeckt. In den wenigen Stunden aber, in denen ich mit Elisabeth allein war, glaubte ich zu spüren, wie sinnlos und sogar frevlerisch der Spott meiner Freunde war, ihre Skepsis und ihre hochmütige »Dekadenz«. Zugleich aber auch hatte ich eine Art Gewissensbisse, als hätte ich mir einen Verrat an den heiligen Prinzipien meiner Freunde vorzuwerfen. Ich führte also in einem gewissen Sinn ein Doppelleben, und es war mir gar nicht wohl dabei.
Elisabeth war damals schön, weich und zärtlich und mir ohne Zweifel zugeneigt. Die kleinste, die geringste ihrer Handlungen und Gesten rührte mich tief, denn ich fand, daß jede Bewegung ihrer Hand, jedes Kopfnicken, jedes Wippen ihres Fußes, ein Glätten des Rocks, ein leises Hochheben des Schleiers, das Nippen an der Kaffeetasse, eine unerwartete Blume am Kleid, ein Abstreifen des Handschuhs eine deutliche, unmittelbare Beziehung zu mir verrieten – und nur zu mir. Ja, aus manchen Anzeichen, die zu jener Zeit wohl schon zur Gattung der sogenannten »kühnen Avancen« gezählt werden mochten, glaubte ich mit einigem Recht entnehmen zu müssen, daß die Zärtlichkeit, mit der sie mich anblickte, die scheinbar unwillkürliche und höchst zufällige Berührung meines Handrückens oder meiner Schulter bindende Versprechungen waren, Versprechungen großer, köstlicher Zärtlichkeiten, die mir noch bevorstünden, wenn ich nur mochte, Vorabende von Festen, an deren kalendarischer Sicherheit gar nicht mehr zu zweifeln war. Sie hatte eine tiefe und weiche Stimme. (Ich kann die hellen und hohen Frauenstimmen nicht leiden.) Ihr Sprechen erinnerte mich an eine Art gedämpftes, gezähmtes, keusches und dennoch schwüles Gurren, an ein Murmeln unterirdischer Quellen, an das ferne Rollen ferner Züge, die man manchmal in schlaflosen Nächten vernimmt, und jedes ihrer banalsten Worte bekam für mich dank dieser Tiefe des Klangs, in der es ausgesprochen ward, die bedeutungsvolle, gesättigte Kraft einer weiten, und zwar nicht genau verständlichen, wohl aber deutlich erahnbaren verschollenen, vielleicht einmal in Träumen vage erlauschten Ursprache.
War ich nicht bei ihr, kehrte ich in die Gesellschaft meiner Freunde zurück, so war ich wohl versucht, ihnen im ersten Augenblick von Elisabeth zu erzählen; ja sogar von ihr zu schwärmen. Aber im Anblick ihrer müden, schlaffen und höhnischen Gesichter, ihrer sichtbaren und sogar aufdringlichen Spottsucht, deren Opfer zu werden ich nicht nur fürchtete, sondern deren allgemein anerkannter Teilhaber ich zu sein wünschte, verfiel ich sofort in eine stupide, wortlose Schamhaftigkeit, um kaum ein paar Minuten später jener hochmütigen »Dekadenz« zu verfallen, deren verlorene und stolze Söhne wir alle waren.
In solch einem törichten Zwiespalt befand ich mich, und ich wußte wahrhaftig nicht, zu wem mich flüchten. Ich dachte zeitweilig daran, meine Mutter zu meiner Vertrauten zu machen. Aber ich hielt sie damals, als ich noch jung war und weil ich so jung war, für unfähig, meine Sorgen zu verstehen. Die Beziehung, die ich zu meiner Mutter unterhielt, war nämlich ebenfalls keine echte und ursprüngliche, sondern der kümmerliche Versuch, das Verhältnis nachzuahmen, das die jungen Männer zu ihren Müttern hatten. In ihren Augen waren es nämlich gar keine wirklichen Mütter, sondern eine Art von Brutstätten, denen sie ihre Gereiftheit und ihr Leben zu verdanken hatten, oder, im besten Fall, so etwas wie heimatliche Landschaften, in denen man zufallsmäßig zur Welt gekommen ist und denen man nichts anderes mehr widmete als ein Gedenken und eine Rührung. Ich aber empfand zeit meines Lebens eine fast heilige Scheu vor meiner Mutter; ich unterdrückte dieses Gefühl nur. Ich aß nur mittags zu Hause. Wir saßen einander still gegenüber, an dem großen Tisch im geräumigen Speisezimmer, der Platz meines verstorbenen Vaters blieb leer, am Kopfende des Tisches, und jeden Tag wurde, den Anweisungen meiner Mutter zufolge, ein leerer Teller und ein Besteck für den für alle Zeiten Abwesenden aufgetragen. Man kann sagen, meine Mutter sei zur Rechten des Verstorbenen gesessen, ich zu seiner Linken. Sie trank einen goldenen Muskatwein, ich eine halbe Flasche Vöslauer. Er schmeckte mir nicht. Ich hätte Burgunder vorgezogen. Aber meine Mutter hatte es so bestimmt. Unser alter Diener Jacques bediente, mit seinen zitternden Greisenhänden, in schneeweißen Handschuhen. Sein dichtes Haar war fast von dem gleichen Weiß. Meine Mutter aß wenig, schnell, aber würdig. Sooft ich den Blick zu ihr erhob, senkte sie den ihrigen auf den Teller – und einen Augenblick vorher hatte ich ihn doch auf mir ruhen gefühlt. Ach, ich spürte damals wohl, daß sie viele Fragen an mich zu richten hatte und daß sie diese Fragen nur unterdrückte, um sich die Beschämung zu ersparen, von ihrem Kind, ihrem einzigen, angelogen zu werden. Sie faltete sorgsam die Serviette zusammen. Das waren die einzigen Augenblicke, während deren ich ungehindert ihr breites, etwas schwammig gewordenes Gesicht genau anschauen konnte und ihre schlaffen Hängebacken und ihre runzeligen, schweren Lider. Ich sah auf ihren Schoß, auf dem sie die Serviette zusammenfaltete, und ich dachte daran, andächtig, aber auch zugleich vorwurfsvoll, daß dort der Ursprung meines Lebens war, der warme Schoß, das Mütterlichste meiner Mutter, und ich verwunderte mich darüber, daß ich so stumm ihr gegenüberzusitzen vermochte, so hartnäckig, ja, so hartgesotten, und daß auch sie, meine Mutter, kein Wort für mich fand und daß sie sich offenbar vor ihrem erwachsenen, allzu schnell erwachsenen Sohn ebenso schämte wie ich mich vor ihr, der alt gewordenen, zu schnell alt gewordenen, die mir das Leben geschenkt hatte. Wie gern hätte ich zu ihr von meiner Zwiespältigkeit gesprochen, von meinem Doppelleben, von Elisabeth, von meinen Freunden! Aber sie wollte offenbar nichts hören von all dem, was sie ahnte, um nicht laut mißbilligen zu müssen, was sie im stillen geringschätzte. Vielleicht, wahrscheinlich, hatte sie sich auch mit dem ewigen, grausamen Gesetz der Natur abgefunden, das die Söhne zwingt, ihren Ursprung bald zu vergessen; ihre Mütter als ältere Damen anzusehen; der Brüste nicht mehr zu gedenken, an denen sie ihre erste Nahrung empfangen haben; stetes Gesetz, das auch die Mütter zwingt, die Früchte ihres Leibes groß und größer, fremd und fremder werden zu sehen; mit Schmerz zuerst, mit Bitterkeit sodann und schließlich mit Entsagung. Ich fühlte, daß meine Mutter mit mir deshalb so wenig sprach, weil sie mich nicht Dinge sagen lassen wollte, wegen deren sie mir hätte grollen müssen. Aber hätte ich die Freiheit besessen, mit ihr über Elisabeth zu sprechen und von meiner Liebe zu diesem Mädchen, so hätte ich wahrscheinlich sie, meine Mutter, und mich selbst sozusagen entehrt. Manchmal wollte ich in der Tat von meiner Liebe zu sprechen anfangen. Aber ich dachte an meine Freunde. Auch an ihre Beziehungen zu ihren Müttern. Ich hatte das kindische Gefühl, ich könnte mich durch ein Geständnis verraten. Als wäre es überhaupt ein Verrat an sich selbst, vor seiner Mutter etwas zu verschweigen, und überdies ein Verrat an dieser Mutter. Wenn meine Freunde von ihren Müttern sprachen, schämte ich mich dreifach: nämlich meiner Freunde, meiner Mutter und meiner selbst wegen. Sie sprachen von ihren Müttern beinahe wie von jenen »Liaisons«, die sie sitzen- oder liegengelassen hatten, als wären es allzu früh gealterte Mätressen, und noch schlimmer, als wären die Mütter wenig würdig ihrer Söhne.
Meine Freunde also waren es, die mich hinderten, der Stimme der Natur und der Vernunft zu gehorchen und meinem Gefühl für die geliebte Elisabeth ebenso freien Ausdruck zu verleihen wie meiner kindlichen Liebe zu meiner Mutter.
Aber es sollte sich ja auch darauf zeigen, daß diese Sünden, die meine Freunde und ich auf unsere Häupter luden, gar nicht unsere persönlichen waren, sondern nur die schwachen Vorzeichen der kommenden Vernichtung, von der ich bald erzählen werde.