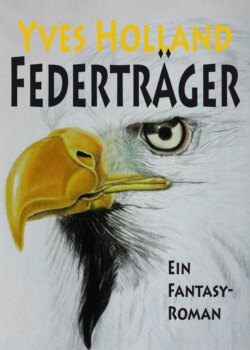Читать книгу Federträger - Yves Holland - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 1 Die Steppe der Freien Reiter
ОглавлениеPatak-Ghira stieß einen lauten, langgezogenen Schrei aus. Der weiße Milan war sehr zufrieden mit sich. Er hatte seine Aufgabe erfüllt. Lautlos breitete er seine mächtigen Flugschwingen aus und stieß sich elegant vom Boden ab. Die Steppe unter ihm wurde schnell weiter, je höher er sich in den Himmel schraubte. In alle Richtungen breitete sie sich aus, und der Wind, hier oben stärker und wesentlich kälter als noch vor wenigen Sekunden am Boden, zauste an seinem prächtigen Gefieder. Weit im Norden sah Patak-Ghira mit seinen messerscharfen Augen einen einzelnen Reiter auf einem der typischen kleinen, sandbraunen Steppenpferde langsam einen Bach entlangreiten. Der imposante Vogel, weißer als frisch gefallener Schnee, schrie noch einmal ein weithin hörbares „Ghirrr“ aus, als er auf dem Wind dahingleitend in Richtung Norden weite Kreise zog.
Der Reiter, verloren klein in der grün-braunen Steppe, hielt sein Pferd an und suchte den wolkenlosen Himmel ab. Er beschattete seine Augen und drehte sich im Sattel, um den schönen Vogel zu bewundern.
Patak-Ghira bewegte mit einer Lässigkeit, von den Menschen seit jeher bewundert und beneidet, zweimal seine Flügel kraftvoll auf und ab und gewann rasch an Höhe. Der Reiter hatte ihn schon lange aus den Augen verloren, als Patak-Ghira, der ihn noch eine Weile begleitete, endlich abdrehte und die Geschichte ihrem Schicksal überließ.
Aufzeichnungen aus dem Buch der Geschichte von Thorn Jhaerhune von Wolff:
Der Tag, an dem Fandor Ellson gefunden wurde, war der 11. Mars des Jahres 512 von Arloks Herrschaft, und es war ein denkwürdiger Tag. Mein Vater, Prakh von Wolff, Oberster Clanführer der Freien Reiter, ritt durch die östliche Steppe - wie er es immer tat - um zu jagen und zu kundschaften, als er Fandor, oder besser gesagt ein kleines Bündel im Gras, auf einer Anhöhe liegen sah. Niemand sonst war zu sehen, und Fandor lag still da und schaute neugierig meinem Vater entgegen.
Man findet nicht alle Tage ein Neugeborenes im Gras, gebettet in Moos und mit einer kleinen silbernen Flöte an einer silbernen Kette um den winzigen Hals. Aber so war es damals an jenem 11. Mars.
Mein Vater suchte den ganzen Tag in der Steppe nach den Eltern des Kleinen, aber es tauchte niemand auf, und als der Abend sich dämmernd in die Ebene schlich und die Temperaturen empfindlich zurückgingen, da nahm er ihn mit sich, eine seltsame Trophäe für einen Freien Reiter, der es sonst gewohnt ist, Gunas zu jagen und Hasen und anderes Wild.
„Du bist tot!“ – „Bin ich nicht!“ ächzte Fandor kirschrot im Gesicht aus dem Schwitzkasten hervor. Thorn lachte laut. „Doch, das bist du, und zwar schon mindestens dreimal.“
Leicht angesäuert machte sich Fandor mit einem Ruck frei, rollte sich unter Thorn hervor und stand hastig auf. Gesicht und Nacken, eben noch rot vor Luftmangel und Anstrengung, änderten die Farbe eine Nuance ins Dunklere – nunmehr allerdings vor Zorn und Scham. Er ärgerte sich. Niemals würde er es lernen, so wie die anderen Jungen zu kämpfen! Er konnte es einfach nicht. Er war ein Versager. Er würde sich wahrscheinlich eher selbst in einem Kampf töten, als anderen auch nur den Hauch eines Kratzers zuzufügen, und das wussten alle. Voller Unmut zog er die Stirn in tiefe Querfalten.
„Komm schon, Findel, schmoll nicht. Wir üben es eben so lange, bis du es kannst.“ Thorn von Wolff beobachtete seinen Bruder aufmerksam und legte ihm beschwichtigend und aufmunternd die Hand auf die Schulter, doch Fandor schüttelte sie ab. „Nenn mich nicht so, ja?“, brauste er auf.
„Ist ja schon gut. Lass uns den Ausfallschritt nochmal üben, in Ordnung? Dieses Mal hast du es schon viel besser gemacht als vorhin“, schwindelte Thorn, der weiterkämpfen wollte. Flink sprang er auf und schwang das Holzschwert, dass es nur so durch die Luft sirrte. Eine träge dahinsummende Hummel konnte dem ungezielten Hieb gerade noch ausweichen und brummte verärgert, während sie auf der Suche nach dem nächsten Blütenkelch in Schräglage durch die Luft schlingerte. Thorn, dem dies natürlich völlig entgangen war, mähte ungestüm mit seinem Schwert ein Feld von Margeriten ab und biss sich dabei leicht auf die Unterlippe - ein Zeichen höchster Konzentration und Präzision in der Führungsarbeit an seiner selbst geschnitzten Waffe, ganz, wie er es seinem älteren Bruder Mjörk abgeschaut hatte. Seine schwarzen, halblangen Haare hingen ihm dabei wild in die Stirn. Die Köpfe der Blumen regneten auf die beiden Freunde nieder.
„Vater sagt, wenn wir fleißig mit den Holzschwertern üben, bekommen wir richtige zum Sonnwendfeuer.“ Er ließ sich breit grinsend und leicht außer Atem wieder ins Gras fallen und piekste Fandor in die Rippen. „Willst du das nicht auch?“
„Doch, schon“, kam es halbherzig von Fandor, der erst vorsichtig den Boden beäugte, ehe er sich neben Thorn setzte. Er schaute griesgrämig vor sich hin. „Ich werde nie gut genug sein, um ein Schwert zu führen. Pope Prakh hat bestimmt nicht vor, mir eins zu geben.“ Fandor schien voller Interesse einen Punkt neben seinem linken Fuß zu betrachten, an dem Thorn nichts Bemerkenswertes fand außer Gras. Und das gab es hier überall.
Thorn schob nachlässig die Haare aus den Augen und schaute seinen Freund an. Fandor war so ziemlich der seltsamste Mensch, den Thorn überhaupt kannte. Sicher, es kamen alle paar Wochen befreundete Reiter der Nachbarstämme vorbei, und Thorn kannte bereits eine Menge Leute. Aber keiner war wie Fandor.
Schon äußerlich unterschied er sich vollkommen von den Freien Reitern, zu denen Thorn gehörte. In Thorns Familie hatten alle olivgrüne Haut, wirre schwarze Haare, breite Wangenknochen und schmale dunkle Mandelaugen. Seine älteren Brüder Larsso, Mjörk und er selbst waren ihrem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Die Frauen der Freien Reiter, auch Mome Ira, hatten ähnlich dunkle Haut wie die Männer, und eigentlich sahen alle Familien im Lager mehr oder weniger so aus wie seine eigene, wenn er darüber nachdachte.
Nur Fandor nicht. Fandor war in jeder Hinsicht anders. Nicht nur, dass er es nicht verstand, das Schwert zu führen, nicht einmal nach Jahren des Schwertspiels mit Thorn und den anderen Kindern. Fandor sah auch vollkommen anders aus. Seine hellgrünen Augen und seine haferblonden lockigen Haare, das lange Kinn, seine schmächtige Gestalt und sein sanftes Wesen standen in krassem Gegensatz zu den Eigenheiten der Freien Reiter.
Und immer hatte er diesen entrückten Blick, als ob er ständig mit seinen Gedanken woanders wäre.
Da war es wieder! Fandor schaute in die Ferne, und Thorn, der das schon kannte, fiel nicht mehr darauf herein. Fandor tat nur so, als ob er in die Ferne blickte. Wenn er, Thorn, seinem Blick folgen würde, wäre da nichts Interessantes zu sehen. Fandor schaute einfach Dinge, die sonst niemand sah.
Thorn seufzte theatralisch. „Natürlich wird er dir ein Schwert geben. Alle Jungen bekommen ein Schwert.“ Das war doch klar. „Und jetzt lass uns noch eine Runde kämpfen!“ Rau rempelte er Fandor an, sprang auf und ging mit seinem Schwert in Kampfstellung. Behände kam auch Fandor wieder auf die Beine und machte sich bereit für eine neue Niederlage.
„Was sollen wir nur mit dem Jungen machen?“ Prakh von Wolff, Oberster Clanführer der Freien Reiter und von imposanter Gestalt, raufte sich wild die Haare und ließ sich seiner Frau Ira gegenüber auf die Sitzfelle im Zelt fallen. Ira war vertieft in Näharbeiten. Bei vier Söhnen gab es viele Näharbeiten zu erledigen, und sie hatte immer irgendetwas zum Flicken bereitliegen, wenn das Vieh versorgt und das Essen gekocht war.
„Wie meinst du das, Prakh?“ Irritiert sah sie auf, ließ aber nicht die feine Hornnadel sinken, die sich auch ohne Augenkontakt flugs durch das Leder arbeitete.
Prakh strich sich gedankenverloren über eine große Narbe auf seiner linken Wange, eine Erinnerung an eine gefährliche Jagd, bei der er nur knapp mit dem Leben davongekommen war. Die Großkatze war eine hart erkämpfte Jagdtrophäe gewesen. „In einem Mond ist Sonnwendfeuer, und da sollten Thorn und Fandor ihre Schwerter bekommen. Aber Fandor ist noch nicht so weit, und ich bezweifle, dass er es je sein wird.“ Seine Stimme wurde lauter, denn das Thema erregte ihn, ohne dass er es selbst merkte. Prakh tat einen langen Schluck aus seinem Krug Dinkelmet. „Er ist ein seltsamer Kauz, der Junge.“
Ira blitzte ihn aus dunklen Augen verärgert an. „Prakh von Wolff, du hast diesen Jungen an Vater statt angenommen, und ich will nie wieder aus deinem Munde hören, dass er ein seltsamer Kauz ist!“ Iras Stimme war scharf geworden, und ihr schon von einzelnen grauen Strähnen durchzogener Dutt begann sich unter ihrem Unmut aufzulösen, als sie temperamentvoll mit den Händen vor Prakhs Gesicht herumfuchtelte. Ihr korpulenter Brustkorb hob und senkte sich drohend vor Prakh, der mit großen Augen zu ihr herübersah. Was ereiferte sie sich so?
„Zugegeben, er ist anders als die anderen Jungen, aber es fehlt ihm nicht an Mut und Geschick. Er reitet wie der Teufel, und er ist ein prächtiger Bogenschütze. Er ist der einzige, der es fertigbringt, Honig von den wilden Bienen zu holen, ohne hinterher auszusehen, als hätte er die Blattern, und er ist ein geschickter Schwimmer. Er findet Beeren, an denen alle anderen vorbeilaufen, als seien sie blind wie die Erdwühler, und – vergiss das nie, Prakh! – er hat deinem Sohn letzten Sum das Leben gerettet.“
Prakh sah erstaunt auf. „Du hast ja recht, Ira, aber er ist so...“ Er fuchtelte fahrig mit einer Hand durch die Luft, „so ... so anders!“ Iras Augen verengten sich gefährlich, aber Prakh, der schon weiterredete, sah es nicht.
„Du solltest dir einmal ansehen, wie er das Schwert führt! Da wird mir jedes Mal angst und bange! Und wie er mit dem Rund umgeht! Er kann den Rund noch nicht einmal fangen, geschweige denn werfen oder treten!“ Prakh war wieder laut geworden, ohne es zu merken. „Ein Junge, der einen Rund nicht treten kann!“
Ira von Wolff blickte immer noch starr auf ihren Mann.
„Ja, und?“, fragte sie nun kühl. „Ein Junge, der den Rund nicht treten kann. Prakh, ist das so schlimm? Ein Rund! Was zum Donner willst du mir damit sagen? Dieser Junge ist etwas ganz Besonderes, und das weißt du auch. Gut, er kann den Rund nicht fangen. Aber dafür hat er andere Qualitäten. Da, wo er herkommt, kann vielleicht keiner den Rund treten oder fangen. Vielleicht kennt da, wo er herkommt, überhaupt niemand einen Rund? Vielleicht kann dafür da, wo er herkommt, jeder Honig finden und jeder Wachträume haben und jeder die Tiere mit einer Flöte beschwören.“
Prakh sah mit hohlem Blick in seinen Krug. Menschen, die womöglich keinen Rund kannten? So ein Unfug. So etwas konnte es doch gar nicht geben. Ein Rund war ein Rund! Jeder kannte das! Unvorstellbar, was Ira da sagte. Er schüttelte leicht den Kopf.
Seine Frau schaute ihn immer noch an und sagte mit etwas weicherer Stimme: „Und wenn er nun gar kein Schwert haben will? Hast du daran schon einmal gedacht? Er trägt eine Flöte in Form einer Feder um den Hals. Vielleicht ist er nicht dafür gemacht, auch noch ein Schwert zu tragen? Für dich wäre es eine Schande, kein Schwert zu tragen. Für Fandor wäre es vielleicht eine Schande, eins zu führen. Wir wissen so wenig über ihn.“ Gedankenverloren nähte sie weiter an dem aufgerissenen Hosenbein, das zu einer von Thorns arg mitgenommenen Hosen gehörte. Einen Moment kehrte Stille ein.
„Weißt du, Prakh, eventuell solltest Du den Jungen bald einmal mitnehmen nach Grüntal. Dort leben doch auch diese Brüder vom Orden der Bewahrer. Bruder Pak, von dem du schon oft erzählt hast, soll doch sehr viel wissen über die Völker und die Geschichte der nördlichen Welten. Fandor könnte dort womöglich einiges über sein Volk und seine Herkunft erfahren. Und auch wir würden ihn dann vielleicht besser verstehen.“
Ihre letzten Worte hingen noch in der Luft, als Prakh von Wolff mit nachdenklichem Blick und ohne weitere Worte das Zelt verließ.
Aufzeichnungen aus dem Buch der Geschichte von Thorn Jhaerhune von Wolff:
Wie Fandor Ellson zu seinem Namen kam.
Findel, wie meine Familie den kleinen Ausgesetzten nannte, war anders als wir anderen Kinder. Er schrie nicht so viel, er beobachtete dafür alles und jeden und war auf eine stille Art äußerst neugierig. Er begann früh zu sprechen, und seine ersten Worte waren Vogel und Biene, nicht etwa Mome oder Pope.
Er war vier Winter alt, als er Mome Ira erzählte, er habe einen Traum gehabt, in dem ihm eine Elfenkönigin mit blauem Haar erschienen sei und ihm mitgeteilt habe, er heiße Fandor Ellson und sei ein Federträger. Ab diesem Tag hörte er nur noch auf den Namen Fandor. Mome Ira nahm ihn erstaunlicherweise sehr ernst, obwohl er noch ein kleines Kind war, und ließ ihm seinen Willen.
Leise plätscherte der kleine Bachlauf, und eine Wasseramsel tauchte elegant und mit großer Geschwindigkeit in das klare kalte Wasser. Fandor saß an seinem Lieblingsplatz, unter einer großen, schattenspendenden Weide, ein Stück weit vom Lager der Freien Reiter entfernt, und beobachtete die Natur um sich herum. Er kam gerne hierher, und noch nicht einmal Thorn wusste, wohin er sich manchmal zurückzog. Er seufzte und ließ einen kleinen Kiesel ins Wasser hüpfen.
Er erzählte es den anderen erst gar nicht. Er erzählte ihnen vieles nicht. Immer wieder hatte er diese Wachträume, und die einzige, der er sich ab und zu anvertraute, war Mome Ira. Die lachte ihn wenigstens nicht aus. Aber auch mit Mome Ira war er vorsichtig. Eigentlich behielt er das meiste für sich.
Die namenlose Elfenkönigin, die ihm immer wieder im Traum erschien, so schön und kühl, mit alabasterweißer Haut und blau schimmerndem Haar, sie begleitete ihn nun schon seit vielen Jahre. Zuerst war er erschrocken über diese Träume gewesen, aber sie waren nie gewalttätig oder zerstörerisch oder anders schlimm. Aber sie kamen immer wieder, und er lernte sie zu mögen und sich auf sie zu freuen.
Kaum ein Mond verging, ohne dass er von ihr träumte. Sie hatte eine glockenreine Stimme, wie der Bach, an dem er so gerne saß und die scheuen schwarz-weißen Amseln beobachtete, und ihr Lachen war so rein, dass es ihm beinahe das Herz vor Freude und Glück zerriss. Eigentlich sang sie mehr als sie zu ihm redete, und er liebte ihre hochgewachsene Erscheinung, ihre schwebenden Gesten, ihre blasslila farbenen Augen und den verträumten melancholischen Ausdruck darin. Sie war ihm fast so sehr eine Mome wie Ira, obwohl er sie doch gar nicht kannte. So etwas durfte er Mome Ira natürlich nicht erzählen.
Die Elfenkönigin – und er wusste einfach, dass es eine Elfenkönigin war – begleitete ihn durch seine ganze Kindheit, und endlich hatte er auch gelernt, wie er mit ihr in Kontakt treten konnte.
Immer, wenn er sich an den kleinen Bach zurückzog und seine silberne Flöte hervorzog, die er seit seinem Auffinden um den Hals trug, und dann an die Elfenkönigin dachte und auf seiner Flöte spielte, sah er sie. Mal klappte es besser, mal schlechter, aber immer, wenn er die Augen zumachte und fest an sie dachte, während er kleine Melodien spielte, erschien sie ihm und lächelte ihm zu.
Nicht, dass sie ihm jedes Mal etwas zu sagen hatte, aber immerhin, er konnte sie durch sein Flötenspiel herbeilocken. Das war sein Geheimnis, und er bewahrte es für sich.
So war es auch an jenem Tag im letzten Sum gewesen, als er wieder einmal im kühlen Schatten des großen Baums am Bach saß, die klare süßliche Luft atmete und die Füße ins Wasser hängen ließ. Er verspürte einen starken Drang, die Elfenkönigin zu sehen und holte seine Flöte unter dem Hemd hervor.
Doch dieses Mal war etwas anders. Ganz anders als sonst. Er brauchte sich nicht großartig zu konzentrieren, und kaum hatte er die Flöte an die Lippen gesetzt, tauchte die Elfenkönigin aus einem geheimnisvollen Nebel heraus auf, als habe sie nur darauf gewartet, dass er sie endlich mit der Flöte rufen würde. Sie lächelte nicht so entspannt wie sonst. Sie winkte ihm sorgenvoll zu und sagte eindringlich in ihrem hellen Singsang: „Fandor Ellson, eile schnell zum Fuß des gelben Berges. Du wirst dort gebraucht. Lauf!“ Daraufhin verschwand sie wieder im Nebel, und Fandor ließ die Flöte sinken.
Fandor war so verdattert, dass er noch einige Sekunden mit weit aufgerissenen Augen am Bachrand sitzen blieb und das eben Gehörte in sich einsickern ließ, als ihn das laute „Ghirrr“ eines Milans aus seinen Gedanken riss. Erschrocken zuckte er zusammen und versuchte, unter dem dichten Blätterdach hervor den Himmel nach dem großen Vogel, den er soeben gehört hatte, abzusuchen.
Dann wurde ihm langsam klar, dass die Elfenkönigin ihm einen Auftrag erteilt hatte. Sie hatte sogar von dem gelben Berg gewusst, den sein Bruder Thorn und er vor einigen Tagen erkundet hatten! Wie war das möglich?
Hastig rappelte er sich auf und rannte los. Noch im Laufen dachte er über diesen irrwitzigen Wachtraum nach. War er jetzt völlig übergeschnappt?
Nein. Fandor spürte, dass die Gefahr real war. Er lief so schnell er konnte, und er war ein guter Läufer. Er spürte Zweige ins Gesicht klatschen, darunter auch stachelige Rosenzweige und dornige Alosen, aber er rannte weiter. Irgendetwas sagte ihm, dass das Ganze keiner seiner gewöhnlichen Träume gewesen war, sondern ein wirklicher Hilferuf. Er hörte einen seiner Hemdsärmel einreißen, als er sich eng an einem Gebüsch vorbeischob, um keine Zeit zu verlieren, und dachte augenblicklich an den Blick, den ihm Mome Ira am Abend wohl zuwerfen würde, wenn sie den Riss entdeckte. Mome Ira konnte einen wirklich böse anschauen, wenn sie wollte. Dann streifte er diesen Gedanken eilig ab.
Seine Lungen brannten schon, als er endlich nach einer Viertelstunde am Fuß des gelben Berges ankam und den Anstieg vor sich sah. Staub stieg ihm in die Augen, und einmal strauchelte er sogar und fing sich gerade noch mit den Knien ab, doch er rannte weiter den Berg hinauf, blutig und verschrammt und mittlerweile laut keuchend.
Dann sah er sie. Beide zugleich. Abrupt blieb er stehen, schnaufend und gierig Luft in seine Lungen pumpend. In einiger Entfernung vor ihm stand Thorn, und dieser rührte sich nicht. Sein Freund hielt mit einer Hand einen Bogen umklammert, aber die andere bewegte sich nicht zu dem geschulterten Köcher, in dem mehrere selbst geschnitzte Pfeile staken. Thorn stand nur da und schien nicht einmal zu atmen. Und Fandor sah mit einem Blick warum.
Thorn gegenüber stand der größte braune Bär, den Fandor je zu Gesicht bekommen hatte. Er schien sehr unruhig zu sein und richtete sich wieder und wieder zu seiner vollen Höhe von mehr als einem ausgewachsenen Mann auf. Dabei brummte er so tief wie ein Gewitterdonner. Der Bär schien eine Höhle zu bewachen, deren Eingang dicht hinter ihm im Halbdunkel des mit einem Vogelbeerbaum bewachsenen Hügels lag. Obwohl Fandor viele Meter unterhalb von Thorn und dem großen Bären zum Stehen gekommen war, konnte er den bedrohlichen Atem und den scharfen Geruch des wilden Tieres riechen. Der Boden schien unter ihm zu beben, so laut dröhnte der gewaltige Bärenruf den Berg hinunter.
Fandor kam in den Sinn, dass der Bär sicher ein Junges in der Höhle bewachte, und es fiel ihm ein, wie Pope Prakh sie ermahnt hatte, dass es nichts Bedrohlicheres gäbe als ein Tier, das sein Junges verteidigte.
Fandor überlegte voller Hast, was zu tun war. Er musste Pope Prakh holen. Oder einen der anderen Männer. Oder wenigstens einen seiner großen Brüder, Larsso oder Mjörk. Ihm schoss ein ganzer Schwarm von Ideen gleichzeitig durch den Kopf, doch keine wollte die richtige sein. Wenn ihm jetzt nichts einfiele, hätte er heute Abend keinen Freund mehr, das wurde Fandor in diesem Moment klar, und die Gewissheit über diese Tatsache kroch ihm kribbelnd den Rücken hinauf, heiß wie ein Heer roter Ameisen. Dieser Bär würde nicht mehr lange fackeln. Und Thorn stand vor ihm wie ein delikates Abendessen auf einer von Mome Iras Essensplatten.
Fandor wusste nicht, wie er auf die Idee kam. Er sollte sich auch später nicht mehr daran erinnern. Es war ein Reflex.
Der Bär verbreitete einen starken Gestank nach Moschus, Aas und Nervosität. Er begann nun langsam auf Thorn zuzulaufen, sich von links nach rechts und wieder zurück wiegend, wobei er immer wieder dieses gefährliche donnernde Brummen ausstieß und mit den Augen rollte, so dass selbst Fandor von seiner Position aus das Weiße darin sehen konnte.
Thorn bewegte sich nicht, es wäre sein sicherer Tod gewesen. Die beiden trennten noch ungefähr fünf Manneslängen, als Fandor anfing seine Flöte zu spielen. Erst leise und zaghaft, dann lauter und sicherer, stand er im Hintergrund und flötete eine Melodie, die er im gleichen Moment erfand, als er sie blies.
Thorns Gesicht, sonst gut durchblutet, war bleich und fleckig wie ein schlecht ausgebackener Mehlfladen, und Schweiß lief ihm in Bächen über die Stirn. Er schluckte schwer. Fandor, ganz in seine Melodie und sein Spiel vertieft, trat vorsichtig auf die beiden zu.
Der Bär war nun stehengeblieben und ließ seinen Blick wandern zwischen Thorn, der eine sichere Beute zu sein schien, und Fandor, der sich ihm Schritt für Schritt näherte.
Fandor hatte später, als er mit seiner Familie am Feuer saß und Thorn mit leuchtenden Augen und glühenden Wangen von seiner Heldentat berichtete, nicht einmal mehr sagen können, was für eine Melodie er denn gespielt hatte, und er wusste auch nicht mehr zu sagen, wie lange er gespielt hatte oder ob die Sonne schien oder es anfing zu regnen oder der Wind zunahm oder dass die Sonne den Rand der Steppe berührte. Teile der Welt um ihn herum standen still und hörten auf zu existieren.
Dafür war ihm sehr bewusst, dass der Hang nach den süßen Blüten von Akazien roch und dass er Hummeln und wilde Bienen hörte, die emsig von Blüte zu Blüte flogen, um den süßen Nektar darin zu trinken.
Er spielte wie im Traum und spielte und spielte, und der Bär fing langsam an sich zu beruhigen. Von einem Moment auf den anderen schien der große Braune das Interesse an Thorn und Fandor zu verlieren, drehte ab und verschwand plötzlich in der Höhle.
Fandors Mund war trocken wie altes Eichenlaub im Frühling, so dass ihm die Flöte an den Lippen kleben blieb, als er aufhörte sie zu spielen. Sein Hals kratzte, und er konnte nicht einmal mehr schlucken. Mit einem Mal hörte er sein Herz rasen, in seinen Ohren rauschte hämmernd das Blut. Ihm wurde schwarz vor Augen, und das letzte, was er sah, waren Thorns weit aufgerissene Augen, als dieser sich langsam umdrehte und den Berg hinab auf ihn zutorkelte, wackelig in den Knien und schweißgebadet.
Aufzeichnungen aus dem Buch der Geschichte von Thorn Jhaerhune von Wolff:
Geschrieben ward der 24. Jul im Jahre 526 von Arloks Herrschaft, als Fandor Ellson mir das Leben vor dem Angriff des größten braunen Bärs rettete, dessen je ein Freier Reiter gewahr wurde. Es war eine Tat, von der noch heute in Liedern berichtet wird, denn Fandor rettete mir allein durch das Spielen seiner Flöte mein junges Leben. Mit eben dieser Flöte, durch die er sich so oft den Spott aller Kinder zugezogen hatte, mit eben dieser Flöte, die er um seinen Hals trug, als er gefunden wurde.
Seit jenem Tag verspottete ihn niemand mehr wegen seiner Art die Flöte zu spielen und seiner Art Wachträume zu haben. Fandor Ellson rettete mein Leben, und wir vollzogen am nächsten Tag den heiligen Blutschwur, der mich fortan an ihn binden würde bis in den Tod. Damals ahnte ich freilich noch nicht, dass der vollzogene Blutschwur nur der Beginn einer Reihe von Abenteuern sein sollte, die uns beide bis an den Rand der Welt bringen würden. Damals nahm alles seinen Anfang.
Fast genau ein Jahr war seitdem vergangen, ein Jahr, in dem Fandor und Thorn langsam aber sicher zu jungen Männern gereift waren. Sie spürten schon seit einiger Zeit eine immer stärker werdende Nervosität in sich aufsteigen, je näher die Sonnwende kam. Sie übten weiter den Kampf mit den Holzschwertern, und Fandor, der sich wirklich alle Mühe gab, fand, dass selbst er endlich Fortschritte machte. Er starb nun höchstens noch zweimal pro Kampfrunde.
Doch die Nervosität erfasste langsam aber sicher alle. Die Frauen der Steppenreiter begannen allmählich mit den Festvorbereitungen für die große Sonnwendfeier, was sich auch darin äußerte, dass sie ihre Männer und die Heranwachsenden mit Aufgaben überhäuften. Es mussten Wild gejagt, Beeren, Wurzeln und Unmengen Holz gesammelt und ein großer Festplatz angelegt werden. Alle halfen mit. Das Wetter war sehr mild für die Jahreszeit, und die anderen Clans der Freien Reiter hatten ihre Kunde geschickt, dass sie alle in der Woche der Sonnwende eintreffen würden. Es versprach ein großartiges Fest zu werden und ein großartiger Sum.
Tief im Süden jedoch, weit hinter den unendlichen Treibsanden, inmitten der toten Berge, begannen gänzlich andere Vorbereitungen auf ein Ereignis, das die nördlichen Welten noch im selben Sum in ihren Festen erschüttern sollte. Gramlodawik von Arlok, der schwarze Herrscher über die Lande jenseits der Berge, richtete seinen Blick gen Norden, und die wenigen, die von ihren Eltern und Alteltern Geschichten über Arlok den Schwarzen gehört hatten, würden bald zu ahnen beginnen, dass diese Erzählungen keineswegs frei erfunden waren, um kleine Kinder zu ängstigen und in ihre Schranken zu weisen. Ein kalter Schauer durchzog das Land, als Arlok der Schreckliche, wie ihn andere Legenden nannten, seinen Hass erbarmungslos auf die nördlichen Welten lenkte. Denn Arlok hatte einen Traum, der den Norden nach Jahrhunderten wieder in seinen Blickpunkt rücken ließ.
Arlok der Schwarze, der Große, der Schreckliche war trotz seiner allüberragenden Herrschaft nervös in letzter Zeit. Er hatte einen bedrohlichen Alptraum gehabt, die Prophezeiung betreffend, die er schon beinahe vergessen hatte, so lange war das her. Und doch wusste er um ihren Inhalt, hatte er sie doch einst selbst geschaut.
Er fasste sich ans Kinn, seine stahlgrauen Augen blickten quer durch den Saal, die lebensgroßen Büsten aus grauem Stein entlang, die auf den Längsseiten des Saals standen, bis zum hinteren Ende des langen Raums, wo eine riesige Landkarte an der Wand hing, die einen Großteil der gesamten Querseite einnahm. Dann weiter die zweite Längsseite entlang, bis sie endlich auf seinem schwarzen Schwert zur Ruhe kamen, das an seiner linken Seite hing.
Hinter ihm brannte ein merkwürdig grün schimmerndes Feuer, das keine Wärme verbreitete, und so lag der lange Raum in Kälte und flackerndem Licht, was ihn unheimlich grünlich leuchten ließ.
Was war das nur für ein seltsamer Traum gewesen? Er hatte mitten in die Augen eines Mönchs geschaut, er hatte ihn sozusagen entdeckt, als dieser sich Gedanken über die Prophezeiung gemacht hatte. Wie konnte das sein? Wo kam dieser Betbruder her? Es gab doch gar keine Kloster mehr.
Jahrhunderte hatte er damit zugebracht, alle Abschriften der Prophezeiung zu suchen und zu vernichten und die zu morden, die von ihr wussten. Er hatte seine Armeen landauf landab geschickt, seine Befehle auszuführen, und sie hatten keinen Stein auf dem anderen gelassen, ihrem Herrn zu Diensten zu sein und seine Wünsche zu befriedigen. Er hatte sie vollkommen unter Kontrolle, durch seine magischen Fähigkeiten und ihre Einschwörung im Feuer des Todes, das manche von ihnen nicht überlebt hatten. Aber was machte das schon?
Donnernd krachte seine Faust auf die Armlehnen des Steinthrons. „M’r’welik, schickt mir M’r‘welik!“, schrie er so laut heraus, dass es in den Mauern des Thronsaals als Echo hin- und hergeworfen wurde. Eine dicke Ader an seinem Hals quoll aus seiner schwarzen glänzenden Rüstung deutlich hervor.
Augenblicklich rannte eine der zwei an der Tür zum Saal postierten Wachen aus dem Raum, um den Auftrag auszuführen. Die andere blieb genauso reglos stehen wie die steinernen Statuen.
Ein Ruck lief durch Arloks riesigen und schweren Körper, als er aufstand und mit großen Schritten den Saal durchmaß, bis er vor der Landkarte zum Stehen kam.
Konnte er etwas übersehen haben? Das Land war vollkommen unter seiner Kontrolle, schon seit Jahrhunderten. Im Westen lag das stürmische Eismeer, wo nichts und niemand leben konnte, mit solcher Brachialgewalt tobten dort die Stürme über das Wasser. Einzig dieses kleine Fleckchen im Norden, das hinter den tödlichen Treibsanden und über den Himmelsbergen lag, hatte er noch nicht vollständig unterjocht. Es war ein Nichts, ein Klecks Tinte auf der Karte, und Ordalik, sein alter Rabe, flog dort ab und zu Patrouille und berichtete von Bauern und dunkelhäutigen Webern, die vereinzelt dort vegetierten.
Arlok überlegte, warum er es so viele Jahre aus den Augen verloren haben mochte. Er würde es ausradieren, obwohl es einem Fliegendreck glich, so winzig lag es da.
Ja, das war wohl das Beste. Die Zeit der Prophezeiung nahte, und von ihm aus konnte sie sich erfüllen, er war vorbereitet. Aber der Traum irritierte ihn nach wie vor. Wer war dieser Mönch, und warum dachte er an die Prophezeiung? War es ein Zufall? Wohl kaum. Arlok würde keine Zufälle gelten lassen. Er würde ihn finden und töten.
Die Tür des Thronsaals öffnete sich, und einer der schwarzen Reiter trat ein, M’r’welik, sein oberster Heerführer, der seit einigen Tagen in der Burg war, um Bericht über die Lage im Süden zu geben.
M’r’welik, selbst kein kleiner Mann, sah im Vergleich zu Gramlodawik, dem größten der Dämonenmagier, aus wie ein kleines Kind.
„Herr, Ihr habt gerufen?“ M’r’welik lief ein Schauer über den Rücken, als er den eisigen Saal betrat und, demütig den Kopf geneigt, auf Arlok zuging. In gebührendem Abstand blieb er stehen. Man konnte nie wissen. Arlok war für seine üblen Launen bekannt, und obwohl M’r’welik nicht irgendjemand war, so wusste er doch, dass Vorsicht allemal besser war als ein unvorhergesehener rascher Tod, wie er viele seiner Vorgänger ereilt hatte.
Er schluckte hart und versuchte, die Gedanken an den Tod zu verdrängen, die sich immer in wilder Panik auf ihn stürzten, wenn er seinem Herrn so nahe war wie jetzt.
Er spürte, wie Arlok in seine Gedanken eindrang und zwang sich, an seine Krieger zu denken, an die Pferde, den Lagebericht über die Bauern und Leibeigenen im Süden, an alltägliche Dinge, mit denen er sich zu beschäftigen hatte. Schweiß, gemischt aus Angst und Anstrengung, lief ihm über die Stirn und tropfte von seinem Kinn, trotz der Eiseskälte im Thronsaal. Sein Atem ging stoßweise, als wäre er gerade eine steile Treppenflucht hinaufgerannt.
Arloks Blick schweifte gedankenverloren über seinen Heeresführer, dann wandte er sich wieder der Karte zu.
M’r’welik zuckte zusammen, als Arloks gewaltiger Bass durch den Raum dröhnte. „Schick Ordalik auf Kundschaft in den Norden. Und sag ihm, er soll sich beeilen. Ich erwarte Bericht über diesen Flecken Land, dieses winzige Stück dort über den Treibsanden.“ Er drehte sich wieder zu M’r’welik um, und eine leichte Unmutsfalte teilte seine Stirn in zwei Hälften, die im Schein des grünen Feuers weit auseinanderzuklaffen schienen.
„Was stehst du da noch rum? Los, mach schon!“
M’r’welik war schon an der Tür, als er noch einmal die Stimme seines Herrn vernahm und ein gleißender Schmerz sich in seinen Kopf bohrte. „Und, M’r’welik? Schick ein paar mehr Kundschafter durch die Treibsande nach Norden. Damit es schneller geht. Ich erwarte Deinen Bericht.“
Der Schmerz löste sich augenblicklich in nichts auf, gerade noch rechtzeitig, so dass M’r’welik nicht ohnmächtig wurde. Der Herr war nicht besonders gut gelaunt heute.
Bruder Pak, Erster Gelehrter der Bruderschaft der Bewahrer im Kloster El Om, starrte auf die Papyrusrolle, die er vorsichtig auf seinem Studiertisch ausgebreitet hatte. Er schnaubte leise durch die Nase, fasste sich an die Nasenflügel und rieb gedankenverloren daran entlang. Huson, Novize im ersten Jahr und Bruder Pak zugewiesen, sah von seinem Platz am Ende des überlangen Studiertisches auf und hob fragend den blonden, fast kahl rasierten Kopf. Seine blauen Augen blickten wach und intelligent auf den Bruder Bibliothekar.
Pak reagierte nicht. Huson kannte das schon. Bruder Pak hatte so seine kleinen Macken, wie er es für sich nannte. Dazu gehörten seine fortwährenden Schnaufer und seine merkwürdige Angewohnheit Selbstgespräche zu führen. Gerade jetzt hörte er vom gegenüberliegenden Ende des Tisches ein fast unverständliches Murmeln.
„I-Brik – was mag das heißen? Sollte es eine Konjugation sein oder etwa doch...“ Bruder Pak, ein Mann von mittlerem Alter und korpulentem Aussehen, dessen breites gutmütiges Gesicht eingerahmt war von einem dunklen Vollbart, blies die Backen auf und streckte sich ächzend. Wie lange saß er wohl schon hier? „Huson, hol mir bitte das Vergrößerungsokular aus meiner Studierkammer. Es muss auf meinem Tisch am Fenster liegen.“
Pak sah bei dieser Anweisung nicht auf, und Huson wartete auch nicht darauf. Er stand auf und ging lautlos zur Tür. „Und bring mir die Rolle mit, die auch auf dem Tisch liegen muss.“
Huson entfernte sich, und Pak kniff die Augen zusammen, während er sich tief über den Papyrus beugte. „Oder doch kbtik? Ich kann es einfach nicht entziffern... Aber was gibt das für einen Sinn?“
Bruder Pak stand auf und stieß verärgert den Stuhl zurück, auf dem er gesessen hatte. Schon viele Stunden hatte er damit zugebracht, diese Rolle zu lesen, die er vergangenen Mond tief unten in der Bibliothek entdeckt hatte, aber er kam nicht richtig voran mit seiner Übersetzung. Nicht nur, dass das Kata, in dem die Rolle geschrieben war, ein Uraltes war, auch die Tinte, einst wohl schwarz, war so verblasst, dass es fast unmöglich war, das Dokument zu lesen.
Er ging langsam zum Ausblick, von dem man das ganze Grüntal und die große befestigte Stadt Grünberg am Hang der Himmelsberge überblicken konnte, und starrte gedankenvoll auf die Silhouetten der ineinander verschachtelten Türme und Dächer. Wieder fasste er sich an die Nasenflügel und rieb sie.
„Ich sollte die Edle Malvea bitten, die Rolle mit mir zu untersuchen“, brummte er in seinen langen Bart. „Einen Versuch ist es wert. Ja, das mache ich.“ Sein Gesichtsausdruck entspannte sich ein bisschen. Malvea von Grünberg, seine gelehrigste Schülerin für alte Sprachen, insbesondere der alten Kata-Dialekte, wäre vielleicht eine echte Hilfe bei der Übersetzung des Schriftstücks. Sie hatte Talent und gute Augen, einen scharfen Verstand, Ehrgeiz und einen starken Willen. Ja, Malvea war die Richtige für diese Arbeit.
Als Huson mit geröteten Wangen ein paar Minuten später wieder die große Bibliothek des Klosters betrat, und die schwere Eichentür mit einem hörbaren Laut ins Schloss krachte, was Bruder Pak immer sehr missfiel, stand dieser immer noch am Ausblick. Seine Laune schien sich während Husons Abwesenheit wesentlich gebessert zu haben, und er erwähnte das Zufallen der Türe mit keinem Wort. Huson legte die gewünschten Gegenstände hastig neben die alte Rolle und setzte sich leise wieder an seinen Platz, um weiter Papyrusrollen zu säubern.
Er hatte noch eine ganze Menge zu tun bis zur Hochsonnandacht. Und danach wahrscheinlich auch, wenn er die Schriftstücke wirklich so penibel säubern sollte, wie Bruder Pak es von ihm erwartete. Huson runzelte leicht die Stirn und atmete einmal heftig ein und wieder aus. Novize sein war anders, als er sich das vorgestellt hatte und wahrlich nicht immer leicht. Und er hatte erst eins der zwei Jahre hinter sich gebracht. Im Reflex strich er über seine blonden Stoppeln auf dem Kopf und nahm sich dann eine der Rollen aus dem großen Stapel, der vor ihm lag.
„Fandor, träum nicht! Bist Du endlich fertig mit dem Säubern der Zelthäute für das Thingzelt?“, schreckte ihn Mome Iras Stimme aus seinen Gedanken. „Beeilung, Beeilung, ich kann nicht den ganzen Tag warten! Ich muss noch die Risse vom letzten Thing flicken, bevor wir das Zelt aufstellen.“ Ira stemmte die Hände in die ausladenden Hüften. „Und wo ist überhaupt Thorn? THORN!“, rief sie donnernd, ohne auf Fandors Antwort zu warten. „Bestimmt hat sich der Lümmel wieder davongemacht und reitet durch die Gegend, gerade jetzt, wo ich ihn doch dringend bräuchte.“ Auf Iras Stirn trat deutlich eine pulsierende, rot flackernde Ader hervor. Das hieß, sie war auf dem besten Wege, wütend zu werden. Wenn sie es nicht schon war.
Fandor beugte sich hastig über die Lederhäute und schrubbte sie mit aller Kraft ab. Jetzt war es besser, nichts zu sagen, denn alles konnte Mome Iras Zorn nur noch mehr anfachen, aber bestimmt nicht besänftigen. Er blickte verbissen nach unten und bearbeitete mit aller Gewalt einen hässlichen matschigen Fleck, von dem er unmöglich ausmachen konnte, was ihn verursacht hatte. Eigentlich wollte er es auch gar nicht so genau wissen. Ihm wurde leicht übel, und er machte die Augen zu, während er den Fleck aufweichte.
Das Thingzelt würde riesengroß werden, wenn es denn endlich zum Stehen käme, und sie waren spät dran mit dem Aufbau, zugegeben, aber alles würde rechtzeitig fertig werden, wie immer.
Mome Ira, sonst die Ruhe selbst, war vor dem Sonnwendfeuer, der großen Feier und dem gleichzeitig stattfindenden Thing wie eine rasende Bussardmutter. Sie plante wie ein ganzer Ameisenstaat, hatte alles und alle im Griff und bewies wie jeden Sum ein Organisationstalent, um das sie mancher der Clanobersten beneidete. Mome Ira war das heimliche Stammesoberhaupt diese Woche, und sie genoss es. Wenn sie bloß nicht so schroff und übellaunig wäre, wenn mal nicht alles nach ihrem exakt ausgetüftelten Plan verlief.
Fandor machte sich so unsichtbar, wie es eben ging und arbeitete weiter. Die Sonnwendfeier! Das Thing! Alle waren aufgeregt, aber Thorn und Fandor, die beide dieses Mal ihr Schwert überreicht bekommen sollten, ganz besonders.
Sie waren fast gleich alt, aber Thorn hatte schon Schultern breit wie der Stamm einer Roteiche und Muskeln sehnig wie Bogenholz, mit denen Fandor nicht im Geringsten mithalten konnte. Auch hatte sich bei Thorn schon ein schattiger Flaum im Gesicht eingenistet, der auf baldigen Bartwuchs schließen ließ.
Fandor seufzte. Und wie sah er aus? Klein und schmächtig wie ein Tschilp, glatt wie ein Bachkiesel, hellhäutig, nur seine Stimme war, Jooba sei Dank, schon die eines Mannes. Wenigstens etwas. Auch wenn sie sich hin und wieder noch überschlug wie der Roller eines Steppenhahns. Aber das würde vergehen, und wenn es ihm passierte, was nicht mehr so oft vorkam, räusperte er sich immer schnell, als wenn er etwas in die falsche Kehle bekommen hätte.
„Fandor! Ja, ist es denn die Möglichkeit! Was habe ich gerade zu dir gesagt?“ Mome Ira musste sich wieder angeschlichen haben. „Wir sind in Eile! Bist du bald fertig mit dem bisschen Sauberwischen?“ Sie baute sich dräuend wie eine Gewitterwand vor ihm auf. „Ich kann doch nicht die ganze Zeit auf alle aufpassen. So werden wir nie rechtzeitig fertig!“
Fandor zuckte schuldbewusst zusammen. Er schrubbte doch tatsächlich immer noch an diesem unansehnlichen Fleck herum und war keinen Fuß weitergekommen mit der Plane. „Entschuldige, Mome Ira“, murmelte er stotternd, „ich bin gleich fertig.“
Ira blickte ihren Sohn lange mit einem sonderbaren Blick an, seufzte dann leise, schüttelte den Kopf und ging, ohne einen weiteren Rüffel verteilt zu haben, ihrer Wege. Fandor sah ihr erstaunt nach. Er hatte bei Jooba keine Ahnung, was das nun wieder bedeuten sollte.
Huson war dem eintönigen Restaurieren und Säubern der Papyrusrollen entkommen! Er konnte es noch gar nicht fassen, dies war ein echter Glückstag für ihn. Bruder Pak hatte den Novizen nach der Hochsonnandacht mit der Aufgabe betraut, der Edlen Malvea von Grünberg eine Botschaft zu überbringen.
Huson, dessen Augen verräterisch zu leuchten begannen, als Bruder Pak ihm den Brief für Malvea übergab, senkte rasch den Blick, damit Pak nicht sehen konnte, wie sehr er sich über diesen Auftrag freute. Dabei war sich Huson nicht einmal sicher, ob Pak daran überhaupt etwas schlimm gefunden haben würde. Es war Husons eigene Ansicht, dass ihm als Novizen keine Vergnügungen zustünden, und er legte sich gleich zur Buße eine halbe Stunde mehr Kampftraining für den Abend auf. Und daran würde er festhalten. Aber später. Jetzt ging es zuerst in die Stadt!
Leichtfüßig sprang Huson den in der Nachmittagssonne liegenden Berg hinunter, auf dessen Gipfel die Klostermauern steil und beeindruckend gen Himmel ragten. Die Klosteranlage lag auf einem einzeln vorgelagerten Berg, der zwar schon zur Kette der Himmelsberge gehörte, diese jedoch nach Norden hin begrenzte, und zur Stadt durch einen kleinen Taleinschnitt getrennt war. Grünberg selbst lag auf dem ersten der dicht aneinander gedrängten Felsen, welche das eigentliche Himmelsmassiv bildeten.
Huson hatte die Kutte etwas gerafft, um schneller laufen zu können, denn er wollte keine Zeit in der Natur verlieren, die ihn nicht so sehr interessierte wie die Stadt, in der es immer etwas Interessantes zu sehen und zu entdecken gab. Er war schon leicht außer Atem, als er über die Brücke rannte, die über das Grüntal führte, aber er nahm den erneuten Anstieg zur Stadt in Angriff, ohne eine Pause eingelegt zu haben.
Hier vor den Stadtmauern war die Straße schon ziemlich voll. Überall rollten Fuhrwerke mit allerlei Gütern, die reisende Händler in die Stadt brachten oder aus Grünberg ausführten, um mit ihnen in andere Städte zu fahren oder entlegene Bauerngüter oder Bergdörfer zu besuchen.
Huson half einem Mann mit Fuhrwerk, dessen Pferd kaum die Bergstraße hinaufkam, den Wagen zu ziehen, denn die letzten fünfhundert Fuß vor dem nördlichen Stadttor waren sehr steil. Der Mann, ein einfacher, schlicht in braunes Tuch gekleideter Bauer von einem der Stadt vorgelagerten Höfe im Grüntal, freute sich sichtlich, dass Huson ihm seine Hilfe anbot. Er knurrte aber trotzdem nur einen mageren Dank in seinen Bart, über den Huson sicher enttäuscht gewesen wäre, wenn er nicht bereits von seinen diversen Ausflügen in die Stadt gewusst hätte, wie wortkarg die Bauern des oberen Grüntals eben nun einmal waren. Ein geknurrter Dank aus einem Bauernmund war schon eine kleine Ehrerbietung, das war Huson klar, und so lächelte er, als sie oben angekommen waren und der Bauer mit seinem Karren wieder seiner eigenen Wege ging.
Huson überlegte schnell, was er nun machen sollte.
Er entschied sich, zuerst die Botschaft zu Malvea von Grünberg zu bringen und dann ein wenig durch die verlockend riechenden Gassen und über die bunten Marktplätze mit ihren Gauklern und Sängern zu gehen.
Nachdem Huson die mürrische Stadtwache passiert hatte, die ihm leicht zunickte, ging er die Anhöhe zum Hause derer von Grünbergs hinauf, wo er noch einmal nachlässig kontrolliert wurde. Man kannte ihn hier bereits. Er wurde in die Halle vorgelassen, wo er nach einigen Momenten des Wartens von der jungen Malvea von Grünberg, der Tochter des Stadtherren Olerich von Grünberg, begrüßt wurde. Sie kam wenig damenhaft die große Treppe heruntergesprungen und rief schon von ganz oben: „Huson, schön dich zu sehen.“
Ihre langen, glatten, offen getragenen braunen Haare wehten hinter ihr her, und ein aufrichtiges Lächeln spielte um ihre edlen Gesichtszüge, die denen des Stadtherrn, Olerich von Grünberg, so ähnlich waren. Huson strahlte sie an. Er kam gerne hierher, um Botengänge zu machen, denn die Edle Malvea behandelte ihn immer sehr nett. Er fühlte sich willkommen in ihrer Nähe.
Sie winkte ihm näher zu kommen, und in ihren hellbraunen, fast bernsteinfarbenen Augen blitzte der Schalk. „Setz dich und trink einen Krug Wein mit mir.“ Huson strahlte noch breiter. Dankbar setzte er sich. Das Haus des Stadtherren war prächtig eingerichtet, und die Stühle waren weich gepolstert, luden ein zu Gemütlichkeit und Muße, nicht so wie die harten Holzbänke im Kloster. Der Raum war angenehm kühl.
Malvea bot ihm immer Wein an, denn sie wusste, dass Huson im Kloster öfter mit Wasser als mit Wein verköstigt wurde. Hier, so fand sie, sollte er es sich gut gehen lassen. Im Kloster konnte er dann wieder karger leben, so wie sich das für einen Novizen gehörte.
Huson übergab Malvea den Brief von Bruder Pak. Malvea schlug ihn sofort auf und las ihn rasch. Interesse war in ihren Augen zu sehen. „Eine alte Rolle? So, so...“, murmelte sie vor sich hin und strich sich gedankenverloren mit der Schreibfeder, die auf dem Tisch bereitlag, über die Lippen. Dann schrieb sie gleich eine Antwort auf die Rückseite des Briefs, wedelte die nasse Tinte trocken und gab ihn Huson zurück. „Ich komme morgen früh. Die Sache interessiert mich. Ein Schriftstück, das Bruder Pak alleine nicht entziffern und übersetzen kann? Das muss ja etwas ganz Besonderes sein!“
Huson trank gerade einen Schluck von seinem wirklich vorzüglichen Wein – er hatte auch nicht anderes erwartet im Hause des Stadtherren –, als sie beide gleichzeitig den Tumult draußen bemerkten.
Sie standen hastig auf und liefen in die Vorhalle, wo ihnen Brom von Bordur, der hünenhafte, breitschultrige Erste Wachmann der Stadtgarde, entgegeneilte. Er grüßte hastig nickend Malvea zu und stürmte sogleich in Richtung Olerichs Arbeitszimmer. Das Schwert an seiner linken Seite klapperte heftig bei jedem seiner großen Schritte, und das Metall an seiner Uniform blitzte kurz auf, als er durch einen Sonnenkegel lief. Ein leichter Geruch von Schweiß blieb in der Luft hängen, als der große, flachsblonde Mann fast gleichzeitig an die Tür des Arbeitszimmers des Stadtherrn klopfte, sie öffnete und ohne zu zögern mit seiner wichtigen Botschaft herausplatzte:
„Herr, es werden Kämpfe weit draußen im Süden vor der Stadt gemeldet.“ Sein sonst volltönender Bass dröhnte etwas heiser vor Aufregung aus dem Raum hinaus durch die Halle. „Man sagt, es seien schwarze Reiter gesichtet worden, die auf Grünberg zureiten!“
Thorn und Fandor waren in edlen, leuchtend blau gefärbten Stoff gekleidet worden, ebenso die Handvoll anderer Halbwüchsiger, die wie die beiden in dieser Nacht ihre Schwerter überreicht bekommen würden. Stolz und unsagbar nervös standen sie abseits des Getümmels, das auf dem Festplatz inmitten des Clanlagers während der letzten Tage entstanden war. Große Familien waren angeritten gekommen, alle prächtig gewandet und mit Geschenken im Gepäck für die anderen Clans sowie für die Götterbeschwörung heute zur Mittnacht.
Fandor und Thorn hatten zwar schon viele Sonnwendfeiern mitgemacht, aber dieses war ihr Sonnwendfeuer, es war ihre Weihe, es war ihre Nacht!
Das für die nächsten Tage angesetzte Thing interessierte sie heute nur sehr am Rande, denn in dem Stammes-Thing waren sie sowieso nicht geduldet. Da durften nur die Obersten, ihre ältesten Söhne und die Stellvertreter teilnehmen.
Fandor und Thorn wollten feiern, und mit ihnen wollten das alle der etwa fünftausend gekommenen Gäste. Die Politik überließen sie gerne den Clanführern, denn heute und die nächsten Tage würde es Habermet, gegorenen Traubensaft, Hamlfleisch überm offenen Feuer geröstet, Honiggebäck und eine Menge anderer Leckereien geben, die die Frauen schon seit Wochen vorbereitet und für diese Feierlichkeiten auch streng unter Verschluss gehalten hatten.
Manche der Männer standen in Gruppen herum und führten ernste Gespräche, aber die Mehrheit der Anwesenden freute sich erst einmal auf die Sonnwendfeier am Abend.
„Was denkst du schon wieder?“, grinste Thorn seinen besten Freund und Bruder an. „Ich hab dir ja gesagt, du würdest es bekommen.“ Er strich zum sicherlich hundertsten Mal seine schwarzen Haare zurück, die ihm wie üblich ins Gesicht hingen und sich auch heute nicht bändigen lassen wollten. Sofort löste sich eine Strähne aus seiner für das Sonnwendfeuer etwas gestutzten Mähne und legte sich ihm wieder übers linke Auge. Er merkte es nicht einmal und schob sie reflexartig erneut zurück.
Fandor, der neben ihm stand und an seinem grünen Festtagsumhang nestelte, schaute Thorn abwesend mit großen Augen an.
„Das Schwert, Mensch!“ Thorn konnte es nicht fassen. Da hatten sie geübt und gekämpft und gerackert und geschwitzt, und Fandor wusste noch nicht einmal, worüber Thorn gerade sprach!
„Weißt du, ich sprach gerade von der Sonnwendfeier“, sagte Thorn sehr ernst und langsam, und tat so, als ob Fandor ein sabbernder Altelter wäre, der nicht mehr so recht folgen konnte. „Du erinnerst Dich? Deine Schwertgabe ist heute Nacht. Oder hast du heute schon was anderes vor?“ Er grinste hämisch. Fandor hieb ihm den Ellbogen hart in die Rippen, so dass Thorn scharf ausatmete. Ehe Thorn wieder zu Atem kam, lag er schon auf dem Boden, über ihm Fandor, geschmeidig wie eine Tigra, der ihn mit einem stählernen Jagdgriff überrascht hatte. Thorn konnte sich kaum bewegen, so sehr er auch versuchte sich frei zu winden.
Ihre blauen Gewänder bedeckten sich mit dem feinen gelblichen Staub, der überall im Lager anzufinden war, aber sie hatten beide keine Augen dafür, viel zu aufgeregt waren sie seit Tagen, als dass sie solche Alltäglichkeiten überhaupt wahrnehmen konnten.
Thorn nieste laut, als Fandor ihn einmal ohne Ansatz blitzschnell überrollte, und beide kugelten quer über den Platz, sehr zur Belustigung einiger kleinerer Kinder, die alle gespannt dem Abend entgegenfieberten und nun vor Entzücken laut quietschten.
Die beiden Jungen bemerkten plötzlich die Traube der schaulustigen Kinder, die sich um sie herum gebildet hatte.
Sie stutzten, lachten dann aber ungestüm und befreit auf, während sich ihre immense Spannung im Staub des Festplatzes entlud.
Die Feierlichkeiten waren den Freien Reitern heilig. Während Prakh von Wolff das riesige, zwanzig Fuß hohe Sonnwendfeuer entzündete, ebbte ein immer stärker werdender Gesang aus fünftausend Kehlen übers Feuer, brandete auf, toste gewaltig über das Land und lobte die Götter der Steppe, Jooba und Donner, für das Überstehen des vergangenen Winters und die reichlichen Gaben der östlichen Steppe.
Im Rausch des Gesangs, des Mets, der strengen Gerüche des eigens hierfür entzündeten Myrholzes, der großen Hitze des Feuers, das so manchem die Barthaare absengte, und im rituellen Schwertkampf um die Vorherrschaft der Reiter über die Steppe erfuhren Fandor und Thorn gemeinsam ihre Mannwerdung im Kreise der Clans und unter den verstohlenen, stolzen Tränen von Mome Ira, die ihre beiden Jüngsten in dieser Nacht in die raue Erwachsenenwelt entließ.
Und während im Ritus der geheiligten Nacht unter Donners Sternenzelt Joobas Schwerter übergeben wurden, trugen viele Meilen weiter südlich andere Schwerter mit entsetzlichem Klang den Tod in die östliche Steppe der Freien Reiter hinein.
Bruder Pak hatte es jetzt auch gesehen. Die Glocken des Stadtturms hatten ihn aus seinem Studierzimmer getrieben, wo er doch tatsächlich von einem kleinen Nickerchen überrumpelt worden war. Er war äußerst irritiert. Die Glocken von Grünberg hatten schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr geläutet, das letzte Mal zur Geburt der Zwillinge des Stadtherrn Olerichs von Grünberg, Malvin und Malvea. Und das war lange vor der Geburt seines Novizen Huson gewesen, der die Glocken heute wohl zum ersten Mal hörte.
Wo war Huson überhaupt? Bruder Pak runzelte leicht die Stirn und rieb sich langsam über den Nasenrücken. Ach ja, er hatte ihn ja in die Stadt geschickt mit der Nachricht für die Edle Malvea.
Pak kniff die Augen zusammen und schaute noch einmal aus dem Ausblick heraus nach Süden. Da, ganz weit hinten, sah er eine kleine Rauchsäule über den Bergen aufsteigen. Eins der kleinen Bergdörfer, die sich an die bis zu elftausend Fuß hohen Berge des Himmelsmassivs anschmiegten, musste brennen.
Was mochte dort wohl geschehen sein? Ein eisiger Schauer überlief Pak. Die Papyrusrolle! Er musste sie unbedingt weiter übersetzen. Hoffentlich hatte die Edle Malvea Zeit für ihn. In der Rolle hieß es doch, dass Rauch über die Berge kommen würde!
Bruder Paks Blick wurde hart. Er musste dringend noch heute Abend den Bruder Abt aufsuchen, um ihm von seiner Entdeckung zu berichten. Aber vorher würde er noch einmal versuchen, das Manuskript zu entschlüsseln.
In dieser Nacht wurde noch lange gefeiert in der Steppe, und kurz bevor der Morgen zu dämmern begann, machte sich langsam Stille um den Festplatz herum breit. Viele Zelte waren aufgeschlagen worden, so dass alle einen Schlafplatz fanden, und endlich lagen auch Thorn und Fandor in ihren Betten aus Fell.
Neben sich hatten sie ihre neuen Schwerter gebettet, jedes geschützt in einer Scheide aus feinstem Yukleder. Die Schwerter selbst waren reich verziert mit den Schriftzeichen ihrer Sprache, besetzt mit heiligen Sprüchen über Jagdglück und Kampfesmut.
Fandor, der immer noch nicht ganz davon zu überzeugen war, dass er des Schwerttragens würdig sei, war gegen Ende der Feier sehr schweigsam geworden und hatte immer wieder mit seiner rechten Hand nach dem ihm noch sehr unvertraut auf der Hüfte liegenden Metallgriff getastet.
Auf dem Rücken in seinem Schlafzelt liegend, hörte er Thorn neben sich schwer und gleichmäßig atmen, konnte aber selbst keinen Schlaf finden. Sie hatten ihm tatsächlich ein Schwert gegeben! Er hatte ein eigenes Schwert. Es ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Er spürte ein leichtes Rauschen in den Ohren, und es drehte sich ihm alles ein wenig. Der gegorene Traubensaft vor dem Zubettgehen war wohl doch des Guten zu viel gewesen.
Er tastete im Dunkeln nach seinen Schuhen, stand behände auf und schlich so leise aus dem Zelt, dass nicht einmal ein Schuhu etwas von ihm gehört hätte.
Im Mondlicht lag das Lager groß und gespenstisch vor ihm. Während er so dastand und den Geräuschen lauschte, und abgestandener Geruch von Schweiß und altem Met vermischt mit den schon taufrischen Gerüchen des Morgens seine Nase umwehte, beschloss er, zum Bach zu gehen und sich dort ein wenig hinzulegen, um endlich etwas Ruhe zu finden. Instinktiv tastete er nach seiner Flöte. Sie war, wo sie immer lag, auf seiner Brust, dicht unter seinem Halsansatz.
Fandor wurde beim Gehen nun doch immer schläfriger, und das leise Plätschern des nahen Wassers beruhigte ihn schon von weitem. Hier, weiter draußen, war die Luft klarer. Dunkelheit hüllte ihn ein, je näher er dem mit Büschen und Bäumen bestandenen Ufer kam. Kaum war er am Bachrand angekommen, unter der großen Weide mit dem bemoosten Boden, legte er sich, den Kopf an den Stamm gelehnt, in eine bequeme Position und fiel sofort in einen unruhigen Schlaf.
Plötzlich schreckte er hoch. Sein Herz machte einen Satz. War da ein Geräusch gewesen? Ein kleiner, dunkler, vierbeiniger Jäger huschte ins Schwarz der Nacht, vielleicht ein Marder. Fandor benötigte einen Augenblick, bis er gewahr wurde, wo er war. Er schwebte eine Sekunde zwischen Traum und Erwachen. Ihm war schwindelig. Er wusste nicht, wie lange er geschlafen hatte.
Da sah er sie. Vor ihm stand, im fahlen Mondlicht noch unwirklicher als sonst, die Elfenkönigin. Sie beugte sich über ihn und sah ihn mit ihren helllila, fast durchsichtig schimmernden Augen an, dann nahm sie ihm die Kette mit der Flöte vom Hals, und er spürte einen angenehm kühlen Hauch, als ihre Hände ihn fast streiften.
Sie war ihm so nahe, dass er ein kleines trauriges Lächeln um ihre Mundwinkel zu entdecken glaubte, aber da war der kurze Augenblick auch schon wieder vorüber, und die schlanke hochgewachsene Gestalt mit der unglaublich hellen Haut richtete sich auf und setzte seine Flöte an die kaum zu sehenden Lippen. Das Mondlicht spiegelte sich in ihren auf Fandor gerichteten Augen und in der silbernen Federflöte, die wie gemacht für ihre langen schlanken Finger zu sein schien.
Während sie ihn unverwandt betrachtete, blies sie eine Melodie für ihn, die so schön und betörend und alles verdrängend war, dass Fandor ein dicker Kloß den Hals hinaufstieg. Fandor vergaß sogar zu atmen und lauschte entzückt. Als die Melodie zu Ende war, setzte sie mit einer weichen Bewegung die Flöte ab und neigte den Kopf langsam zur Seite.
Leicht verzerrt, wie eine sich an den Felsen brechende Stimme in einer großen Höhle, drangen ihre Worte an Fandors Ohren.
„Dies ist das Lied der Ahnen. Vergiss diese Melodie nie, Fandor Ellson, denn du bist auserwählt, sie für dein Volk zu bewahren und sie heimzutragen zu den deinen in die Dünen von Kanda’al. Du wirst bald aufbrechen auf eine Reise, die dich zu ihnen bringen soll. Dein Leben und das deiner Freunde wird in großer Gefahr sein, aber ich werde alles tun, dich zu schützen auf deinem Weg. Trotz allem weiß ich nicht, ob deine Aufgabe zur rechten Zeit bestanden sein wird. Das Schicksal der nördlichen Welten liegt nun in deiner Hand. Achte unterwegs auf den weißen Milan. Die Erfüllung der Prophezeiung hat begonnen.“
Dann lächelte sie ihn noch einmal traurig an und hob die linke Hand zum Gruß, und wie ein hohl klingender Hall dröhnte es durch Fandors Ohren und direkt in sein Herz, als er sie noch einmal die Lippen bewegen sah. „Viel Glück dir, Fandor Ellson, Federträger und Freund der Elfen.“
Fandor erwachte unter der Weide, als neben ihm eine Fleckendrossel laut und keckernd den Tag begrüßte. Tau bedeckte seine Haare, und er schüttelte ihn mit einer unbewussten Geste ab, während er mit steifen Gliedern aus dem Moos aufstand und sich reckte. Sofort fiel ihm sein Erlebnis mit der Elfenkönigin wieder ein. Er tastete nach der Flöte, aber die hing wie immer um seinen Hals. Er hatte gar nicht gemerkt, wie die Elfenkönigin ihm die Flöte wieder umgehängt hatte.
Fandor starrte gedankenverloren in den kieseligen, nassen Grund und schöpfte eine Handvoll klaren Wassers aus dem Bach, seine Augen schmal vor Anstrengung bei dem Versuch, sich zu erinnern, was passiert war, nachdem die Elfenkönigin zu ihm gesprochen hatte. Hatte er ihr geantwortet? Hatte sie sich von ihm verabschiedet? Er wusste es nicht. Sollte er das alles nur geträumt haben? Es war etwas Wichtiges geschehen, aber was? Da fiel es ihm plötzlich wieder ein. Das Lied der Ahnen! Er durfte die Melodie nicht vergessen! Voller Aufregung setzte er mit zittrigen Fingern die Flöte an die Lippen, schloss in voller Konzentration die Augen und spielte die Melodie. Erleichtert atmete er aus. Er hatte sie nicht vergessen. Zumindest dessen war er sich gewiss.
Worüber er völlig im Unklaren war, war die Frage, ob er das alles jemandem erzählen sollte oder nicht. Wenn es stimmte, würde er bald auf eine Reise gehen. Eine lange, gefährliche Reise.
Fandor stand noch einige Minuten am Bachrand und starrte auf die Flöte, die er mit einer neuen Mischung aus Verzücken und Ehrfurcht betrachtete. Es würde etwas geschehen, er spürte es.
Malvea von Grünberg, die Tochter des Stadtherrn Olerichs, war so wütend, dass ihr glatter, zu einem einfachen Zopf gebundener Haarschopf fast waagerecht hinter ihr herflatterte, als sie durch den Raum stürmte. Sie musste sich beherrschen, um nicht laut ihren Ärger und Zorn herauszuschreien, so wie sie das als kleines Kind oft getan hatte. Malvea zwang sich, ruhiger zu atmen und erinnerte sich mühsam an eines der kleinen Gebete, das laut Bruder Pak den Geist reinigen sollte und einen Zustand der Ausgeglichenheit herstellen würde. Ihre Finger krampften sich um eine Stuhllehne, als sie sich unter den lautlos gedachten Worten etwas entspannte.
Ihr Blick fiel auf ihren Vater, der ruhig dasaß und sie keines Blickes würdigte. Erneut stieg ohnmächtige Wut in ihr hoch. Es war so ungerecht! Man ließ sie nicht mit der Stadtgarde in die Berge reiten! Ihr um zwei Minuten jüngerer Zwillingsbruder Malvin durfte natürlich mit, das war ja klar. Aber sie, die Mutigere, Stärkere, sie sollte zu Hause sitzen bleiben und aus dem Ausblick schauen, der Stadtgarde unter der Führung ihres Ersten Wachmanns, Brom von Bordur, und ihrem Bruder, dem Erben der Herren von Grünberg, hinterherwinken.
Sie wollte nicht hierbleiben. Der Zorn ließ sich nun nicht mehr besänftigen, und ehe sie darüber nachdenken konnte, hatte sie einen halb gefüllten Weinkrug ergriffen, der vor Olerich auf dem Tisch stand, und an die Mauer geworfen, so dass er in unzählige Teile zerbarst.
„Vater, ich will nicht hier sitzen und zugucken, wie draußen die Stadt verteidigt wird! Lass mich mit ausreiten, bitte!“ Sie schrie es beinahe heraus.
Ihr Vater, Olerich von Grünberg, saß an seinem Schreibtisch und schaute sie ebenso böse an wie sie ihn. Er war nicht einmal zusammengezuckt, als der Krug mit lautem Knall zerschellte. Er kannte seine Tochter gut. Sein Körper spannte sich drohend unter seinem leuchtend grünen Gewand mit Goldbesatz, den Farben derer von Grünberg.
„Kein Wort mehr, Malvea! Du bleibst hier! So weit kommt es noch, dass Frauen unsere Stadt verteidigen müssen. Überlass das den Männern.“ Seine Stimme war ein einziges Donnern, sein massiger Brustkasten hob und senkte sich mit jedem Atemzug.
„Geh du deine Studien betreiben, und wenn du willst, hilf der Amma dabei, die Vorräte abzuzählen, oder mach dich sonstwie im Haus nützlich.“ Er starrte sie eisig an, ein Blick, der bei jedem anderen als Malvea zu sofortiger Kapitulation geführt hätte. Malvea starrte finster zurück.
Es klopfte an der Tür, und Sadraigh von Bordur, der Zweite Wachmann der Stadtgarde von Grünberg, steckte den Kopf herein. Er war der jüngere Bruder des Ersten Wachmanns, Brom, und das sah man auch. Die große, breitschultrige Gestalt, die flachsblonden kurzen Haare und die seltsam farblos erscheinenden, hellblauen Augen ließen sofort auf dieselbe Herkunft schließen.
„Störe ich?“, fragte er mit hörbarem Zögern in der melodischen tiefen Stimme, Olerich mit gesenktem Kopf zunickend. Dabei warf er einen nicht zu übersehenden Seitenblick auf Malvea und den zerbrochenen Krug auf dem Steinboden.
Olerich stand nun auf, eine imposante Gestalt voller Autorität und Willensstärke, und kam einige Schritte auf den jungen Gardisten zu, wobei er die Hand nach dessen Schulter ausstreckte und Sadraigh weiter in den Raum hineinschob.
„Nein, natürlich nicht. Kommt herein, Sadraigh.“ Kühl glitt sein Blick kurz über seine Tochter, die mit rotem Gesicht dastand und ihn weiterhin scharf anstarrte.
„Und du, Malvea, richtest Bruder Pak und dem Abt einen Gruß von mir aus.“ Damit wandte er sich endgültig von ihr ab und ignorierte Malvea, der nichts übrig blieb, als vor Wut schäumend den Raum zu verlassen. Die Tür knallte laut ins Schloss, als sie wenigstens mit dieser kleinen Genugtuung noch einmal ihren Unwillen bekundete.
Olerich, der Sadraigh in einen Stuhl gedrückt hatte, schloss für einen kurzen, unbemerkten Augenblick die Augen und seufzte innerlich. „Meiner Treu“, dachte er grollend, „das Mädchen wächst mir über den Kopf. Es wird langsam Zeit, sie zu verheiraten, damit sie ihre Flausen verliert.“ Er ging um den großen Schreibtisch herum und setzte sich Sadraigh gegenüber. Wieder schweiften seine Gedanken ab.
„Wenn nur Malvin ein wenig mehr von Malveas starkem Charakter hätte“, schoss es ihm durch den Kopf, und unweigerlich stieg ein ungutes Gefühl in ihm auf. „Der Junge ist wie seine Mutter, Gott hab sie selig, und das Mädchen hat mehr Mumm in den Knochen als ihr Bruder.“ Sorgenfalten kräuselten seine gewaltige hohe Stirn.
Olerich reckte sich und streifte die unliebsamen Gedanken ab. Er war der Stadtherr. Er hatte wahrlich andere Sorgen als häuslichen Kram.
Erstaunt bemerkte er, dass er eine Schreibfeder in der Hand hielt, die in der Mitte zerbrochen war. Seine rechte Hand war schwarz von Tintenflecken. Rasch hob er den Blick. Ihm gegenüber saß der junge Sadraigh und wusste sichtlich nicht, wohin er blicken sollte. Olerich fasste sich schnell. Er musste einen Moment seinen privaten Gedanken nachgehangen haben. Mit festem Blick wandte er sich dem jungen, gut aussehenden Gardisten zu. Die Stadtgeschäfte riefen.
Das Thing begann pünktlich an Hochsonn. Nach einer langen Nacht des Feierns und der Schwertübergabe an die jungen Männer war am Morgen nur zögerlich Leben in das riesige Lager eingekehrt. Alle waren gut gelaunt, und schon bald saßen überall Menschen beim Frühstück und redeten miteinander über das Sonnwendfeuer, den vergangenen Winter, Familienneuigkeiten, und was sonst noch so alles passiert war in den vergangenen kalten Monden, in denen es keine Clantreffen gegeben hatte.
Während die Kinder, Frauen, Alteltern und Jäger der Freien Reiter sich in kleinen und größeren Gruppen um die Feuer versammelten, Essen bereiteten, ihre stämmigen sandbraunen Steppenpferde versorgten oder einfach nur durchs Lager schlenderten, um bekannte Gesichter zu erspähen, bereiteten sich die Clanführer mit dem Anlegen ihrer Festkleidung und der Schwerter auf das wichtige Frühsommerthing vor, das für sie fast noch wichtiger war als das Sonnwendfeuer.
Hochsonn kam, und etwa zwei Dutzend Hornbläser hatten sich vor dem Thingzelt in eine lange Reihe aufgestellt und bliesen den traditionellen Thing-Ruf.
Alle Clanführer und ihre Vertreter sowie auch einige der ältesten Söhne der Clanführer versammelten sich daraufhin vor dem großen Thingzelt, das frisch geputzt in der Sonne glänzte.
Die ausgelassene Stimmung der vergangenen Nacht schien vergessen, als die Männer rund um Prakh von Wolff, der ernst, aber mit sichtlich stolzgeschwellter Brust über das große Lager seines Volkes blickte, mit einem rituellen Spruch das Zelt betraten. Prakh, auf dessen Boden das Thing abgehalten wurde, begrüßte alle anwesenden Clanführer, an seiner linken Seite Larsso, sein Erstgeborener, an seiner Rechten Urso, Prakhs Stellvertreter.
Das Innere des Thingzeltes war nur mit Fellen bedeckt, und die Männer setzten sich in den Kreis, den Ira ihnen mit den weichen Sitzgelegenheiten eigenhändig ausgelegt hatte.
Prakh ließ den Blick über die Männer gleiten. Es gab Wichtiges zu bereden. Seine Miene wurde ernst, als er seine Rechte hob und sie ausgestreckt langsam von links nach rechts in Augenhöhe durch den Raum gleiten ließ, um das Gemurmel, das im Zelt angesetzt hatte, zum Schweigen zu bringen.
Thorn versuchte, nicht zu niesen. Wie das juckte. Seine Nase kitzelte vom Staub. Hastig rieb er sich durchs Gesicht und hielt den Atem an, bis er rot anlief. Fandor neben ihm kicherte leise und ermahnte ihn dann flüsternd: „Thorn, wenn sie uns hier erwischen, war die ganze Anschleicherei der letzten Stunde für die Fliegen.“
Sie hatten sich äußerst behutsam von hinten an den nunmehr verlassenen Schlafzelten vorbei bis an den Rand des großen Thingzelts herangerobbt, und lagen nun, fast vollkommen mit dem trockenen Staub der Lagerstatt bedeckt, genau unter dem Rand der riesigen Plane, die den Boden nicht ganz erreichte. Leider hatten sie hierfür ihre neuen Schwerter abschnallen müssen, denn zum Kriechen waren sie denkbar ungeeignet.
Der Plan war simpel gewesen, aber sie hatten lange dafür gebraucht ihn auszuführen. Das Lager war voller Menschen, und es war nicht einfach gewesen, einen Moment abzupassen, in dem niemand zu ihnen herüberschaute, und so hatten sie wesentlich mehr Zeit benötigt als angenommen. Das Thing hatte schon vor einer ganzen Weile begonnen.
Thorn ächzte ein wenig, als er versuchte, sein eingeschlafenes linkes Bein ein wenig zu entlasten. Das Anrobben war noch der gemütlichste Teil ihres Unterfangens gewesen. Hier ruhig zu liegen ohne sich viel zu bewegen, wurde von Minute zu Minute schwieriger, denn die Plane setzte nur wenige Fingerbreit über dem Boden an, und sie mussten sich so klein wie möglich machen.
Von drinnen hörten sie ernste Wortfetzen. Alle Clanführer berichteten nacheinander über den Zustand ihrer Stämme, ihrer Familien, ihrer Pferde und der Steppe im Allgemeinen. Es ging um Hochzeiten, Ernten, Berichte durchziehender Gaukler und Handelsmänner, das Wetter und alles, was sich seit dem letzten Thing ereignet hatte. Doch in den letzten Minuten schien das Gespräch eine dramatischere Wendung anzunehmen.
„Scht, sei doch mal still.“ Fandor rempelte Thorn an, der damit beschäftigt gewesen war, eine Saugmücke von seinem Arm zu schlagen.
„Immer mehr von ihnen scheinen unterwegs zu sein. Vor einem Mond haben sie einen meiner Männer getötet, der gerade auf Kundschaftsritt in den südlichen Steppenregionen war“, hörten sie eine kehlige Stimme aus dem Thingzelt.
„Bist du sicher, dass es die schwarzen Reiter waren?“, ließ sich Prakh ernst vernehmen.
„Ja, meine Männer ritten zu zweit aus. Pitar konnte entkommen, weil er gerade ein Guna jagte. Aber als er ans Lager zurückkehrte, fand er Sham tot am Feuer liegend. Man hatte ihm den Schädel gespalten.“
Ein Raunen lief durchs Zelt. Die Jungen hielten den Atem an, und Schauerwellen liefen ohne Ankündigung über ihre Rücken. Fandor schaute erschrocken. Seine Augen weiteten sich wenig hilfreich bei dem Unterfangen, das Gehörte zu verarbeiten.
Sie konnten nicht in das Zelt hineinschauen, denn dafür hing die Plane zu niedrig, aber sie konnten gut hören, wie drinnen der schreckliche Bericht weiter erzählt wurde.
Fandor und Thorn starrten sich an. Dies war ein Spiel für sie gewesen, in das sie ihren ganzen jugendlichen Ehrgeiz gesteckt hatten. Sie wollten insgeheim bei dem Thing dabei sein. Aber sie hatten nicht erwartet, solche Dinge zu hören.
„Pitar stieg auf einen Felsen und sah in einiger Entfernung vier Schwarze nach Osten reiten. Sonst war niemand in der Nähe. Sie müssen die Mörder Shams sein. Auch die Art, wie sie töten, verrät sie“, führte die erste, kehlige Stimme weiter aus.
„Sie benutzen grobe Beile und schlagen ihren Opfern die Köpfe ein“, warf jemand bestätigend ein, und seine Stimme hatte einen aufgeregten heiseren Klang.
„Und das ist nicht der erste Todesfall, den es zu beklagen gibt. Weiter südlich, kurz bevor die Steppe in die langen Treibsande übergeht, lebt ein kleines Volk von Webern, die Usuru. Wir halten losen Kontakt zu ihnen, handeln hin und wieder etwas, wenn wir vorbeikommen. Auch sie haben von neuen Vorstößen der schwarzen Reiter berichtet und von Morden, die auf die gleiche Weise begangen wurden.“
Stille machte sich breit, vereinzelt kamen leise Gespräche mit Sitznachbarn im Zelt in Gang.
„Ruhe, Männer. Lasst Fas weiter erzählen“, schaltete sich Prakh von Wolff wieder ein. „Wir werden alle nacheinander berichten, was es zu diesem Thema zu sagen gibt und dann gemeinsam diskutieren und beratschlagen, wie immer.“
„Hmja“, räusperte sich der, den die Jungen an der seltsam kehligen Stimme nun als Fas erkannten. „Das war eigentlich schon alles. Unruhen im Süden, vereinzelte Morde, immer werden die Schwarzen gesehen, und niemand weiß, was sie hier wollen.“
Kurz wurde es wieder ruhig im Zelt.
„Wie lange ist es eigentlich her, dass schwarze Reiter in unserer Gegend waren?“ fragte einer der Clanführer.
Ein Mann mit einer sehr alten Stimme antwortete nachdenklich: „Mein Altvater erzählte mir so manches Mal davon, wie die Schwarzen über unser Land gefegt sind. Es ist lange her. Das Wenige, das ich von Arlok persönlich weiß, ist, dass unsere Zeitrechnung auf seiner Herrschaftszeit beruht. Niemand weiß, wie alt Arlok wirklich ist, aber wenn die Lieder stimmen...“ Er zögerte.
„Wenn die alten Lieder auch nur annähernd stimmen, so ist Gramlodawik von Arlok schon mindestens sechs Jahrhunderte alt.“ Ein trockener Hustenanfall unterbrach ihn. „Und seine Herrschaft im Süden muss schrecklich sein.“
Fandor wagte kaum zu atmen. Arlok! Wie oft hatten sie ihm als kleinem Kind die schrecklichen Geschichten von Arlok erzählt, seiner barbarischen Herrschaft über die Südlande weit hinter den Treibsanden, von den finsteren Verliesen in seiner Burg, in denen er seine Feinde Jahr um Jahr folterte. Er hatte diese Geschichten immer für Märchen gehalten, um kleine aufsässige Buben etwas gefügiger zu machen, und er hatte sich oft und gerne bei diesen Erzählungen am Lagerfeuer gegruselt. Und nun hörte er, dass es diesen Arlok tatsächlich geben sollte!
Ungläubig schaute er Thorn ins Gesicht, der nur eine Nasenspitze neben ihm im Staub lag. Thorn, das linke Ohr fest an die Plane gepresst, schien gefesselt von dem Gehörten und achtete nicht weiter auf Fandor.
Die Berichte im Thingzelt begannen sich mehr und mehr zu ähneln. Weitere Teilnehmer erzählten von Reiterüberfällen oder auch von fahrenden Händlern, die mit diesen oder ähnlichen Geschichten zu ihnen gekommen waren. Je mehr Clanführer ihre Meldungen machten, desto gedrückter wurde die Stimmung im Zelt.
„Gramlodawik von Arlok“, ließ sich Prakhs Stimme gedehnt und nachdenklich vernehmen. „Arlok“, wiederholte er, und Fandor und Thorn hörten ihn scharf ausatmen, wie er das immer tat, wenn er am Überlegen war. „Was wissen wir eigentlich wirklich von ihm?“
Der Mann mit der alten Stimme hüstelte wieder, bevor er zaghaft zu sprechen ansetzte. „Man sagt, Arlok sei einer der mächtigsten Dämonenmagier, die jemals existiert haben.“ Sein Atem rasselte, als er heftig einatmete, um weiter zu berichten.
„Es gibt ein Lied, das von einem großen magischen Kampf berichtet, der vor Jahrhunderten zwischen Arlok und einigen anderen Dämonenmagiern und auch Elfen stattgefunden haben soll. Arlok der Schreckliche soll aus diesem Kampf, unterstützt von den dunklen Mächten des ewig Bösen, als Sieger hervorgegangen sein.“
Ein Raunen zog sich durchs Zelt, das anschwoll und gleich darauf wieder abebbte, als der alte Mann weitererzählte.
„Es heißt weiter, Arlok sitzt in seiner Burg und beherrscht seine riesige Armee allein mit seinen magischen Fähigkeiten. Er herrscht über ein gewaltiges Reich, das sich südlich der ewigen Treibsande über tausende von Meilen erstreckt. Seine Herrschaft ist grausam, und sein Herz ist kalt. Wer sich ihm nicht beugt, stirbt einen grauenvollen Tod.“
Der Alte hielt inne.
„Aber das“, er zögerte hörbar. „Aber das“, setzte er rasselnd wieder an, „sind alles nur Geschichten. Ich weiß nicht, ob sie sich so zutragen oder zugetragen haben. Die nördlichen Welten sind seit Jahrhunderten vollkommen abgeschnitten von den riesigen Südlanden. Arloks graue Berge sind unpassierbar, und die Treibsande sollen es auch sein. Obwohl früher immer wieder fahrende Händler und wandernde Stämme Informationen aus dem Süden zu uns gebracht haben, hört man nun nur noch hin und wieder von schwarzen Reitern, die vereinzelt in die Steppe gelangen.“
Wieder musste der Alte einen Moment innehalten, um Luft zu schnappen. Das laute Reden schien ihn viel Kraft zu kosten.
„Die Schwarzen sind dem Leben in den Treibsanden nicht gewachsen. Ihre schweren Pferde, ihre schweren Uniformen, das alles ist nicht geeignet für ein Leben im heißen Sand. Zudem kennen sie auch heute die Treibsande noch nicht zu einem Bruchteil. Die Treibsande verändern sich täglich, und Karten über dieses riesige Gebiet gibt es keine. Die Usuru, die dort leben, haben keine Karten. Sie kennen ihre Heimat auch so. Jooba weiß, wie sie das machen, aber sie laufen über die Treibsande, als ob es Wege aus Fels dort gäbe.“
„Das heißt“, fiel der Mann namens Fas ihm ins Wort, „dass Arlok sich den Norden nie unterworfen hat, weil er so klein und unbedeutend für ihn ist, und er die großen Verluste seiner Armeen scheut.“ Sie hörten Fas laut atmen. „Wenn es nicht nur alles Geschichten sind.“ Fas hörte sich hin- und hergerissen an.
Thorn und Fandor erkannten Larssos Stimme sofort, als er sie im Zelt erhob. „Und warum schickt Arlok seine Männer nun doch durch die gefährlichen Treibsande zu uns?“
Gemurmel drang aus dem Thingzelt zu den beiden Jungen heraus.
„Larssos Frage ist wichtig“, ließ sich nun wieder Prakh von Wolff vernehmen. „Aber wir finden keine Antwort darauf, wenn wir hier sitzen und reden. Wir werden noch auf diesem Thing eine Entscheidung treffen, wie wir weiter vorgehen werden. Doch nun lasst uns eine Pause machen. Der Tag ist weit vorangeschritten, und ich rieche bereits das Abendessen. Das Thing wird morgen fortgeführt.“ Und mit einigen rituellen Worten hob er die Versammlung auf.
In der Tat war es schon spät, und die Dämmerung setzte langsam ein, aber weder Fandor noch Thorn hatten darauf geachtet, so gespannt hatten sie unter der Zelthaut gelegen und gelauscht. Hastig rappelten sie sich auf und humpelten schnell hinter die am nächsten gelegenen Schlafzelte. Fandor war ein Bein eingeschlafen, aber das war wahrhaftig das einzige, was an ihm schlief. „Thorn, hast Du gewusst, dass es diesen Arlok wirklich gibt?“
Die beiden klopften sich den Staub aus den Kleidern und reihten sich unauffällig in die Reihen der Männer und Frauen ein, die sich langsam auf dem Festplatz einfanden, um die lecker duftenden üppigen Reste des gestrigen Festessens zu verspeisen.
Plötzlich merkte auch Fandor, wie hungrig er war. Das Thing musste Stunden gedauert haben, aber sie waren wie gebannt unter der Plane gelegen und hatten nur Ohren für die Clanberichte gehabt.
„Nein, eigentlich nicht. Ich habe ... nun ja, ich dachte immer, es gab ihn einmal, aber er wäre schon seit Urzeiten tot.“ Thorns Augen leuchteten. „Und nun heißt es, er lebt, und seine Männer fallen in unser Land ein!“
Sie ließen sich etwas von dem gegrillten Haml auftun und streckten sich mit ihrem Essen ein Stück abseits auf einer Wiese aus.
Thorn kaute und redete gleichzeitig. „Weißt du, was das heißt, Fandor?“ Fandor machte nicht den Eindruck, als ob er irgendetwas wüsste. Thorn fuchtelte aufgeregt mit einer vor Fett triefenden Keule dicht vor Fandors Gesicht herum. „Das heißt, dass du und ich, wir beide, bald in den Krieg ziehen werden!“ Fandor starrte seinen Freund an.
Bruder Pak schob das Gespräch mit dem Abt nun schon einen geschlagenen Tag vor sich her. Er wollte einfach nicht mit einem solch stümperhaft übersetzten Stück Papyrus vor seinen Ordens-Oberen treten. Schließlich war er, Pak, hier der Experte für die alten Kata-Dialekte. Da sollte die Rolle schon einwandfrei übersetzt sein, bevor sein Abt sie zu sehen bekam. Das war er sich schuldig.
Bruder Pak war sehr erfreut gewesen, als die Edle Malvea an diesem Vormittag in die Bibliothek gestürmt war. Sie schien sehr aufgebracht zu sein, teilte ihm jedoch nicht mit, weswegen. Er fragte auch nicht nach, da er über ihr Kommen so erfreut war, dass er sie sogleich mit der Papyrusrolle überrumpelte. Und Malvea schien mindestens genauso interessiert und ehrgeizig zu sein wie er, was dieses muffige Stück alter Schrift anging.
Pak lehnte sich zurück und sah erstaunt, dass es schon auf den Abend zuging. Malvea und er mussten den ganzen Tag die Rolle studiert haben, ohne eine Pause zu machen, ohne etwas zu essen und ohne auch nur einmal aus dem Ausblick zu sehen. Die Stadt und das Kloster lagen ruhig da. Niemand hatte heute die Glocken geläutet, und der ausgeschickte Teil der Stadtgarde, der gegen Mittag die Stadtmauern hinter sich gelassen hatte, wurde frühestens in drei Tagen zurückerwartet. Bruder Pak hatte noch nicht einmal die Zeit gefunden, sich mit Malvea über die Angriffe und was man in der Stadt darüber redete, auszutauschen.
Malvea blickte nun ebenfalls von der Schriftrolle auf. Auch sie schien überrascht, wie spät es schon war. Sie lächelt befreit.
„Bruder Pak, mit dieser Rolle habt Ihr mir den Tag zum Guten gerettet. Ich war heute früh so erbost, dass mein Vater Malvin mit der Stadtgarde ausgeschickt hat und es mir verwehrt hat mitzureiten, dass ich sogar einen Weinkrug an die Wand seines Arbeitszimmers geschleudert habe.“ Sie lachte hell, und ihre schönen Augen funkelten.
„Und nun seht selbst! Gebt mir ein altes vergammeltes Stück Papyrus, und ich habe keinen Grund mehr, mit der Welt zu hadern.“ Bruder Pak lachte laut auf. „Nun, Edle Malvea, unsere wahre Leidenschaft scheint in den alten Schriften zu liegen und doch nicht im Hier und Jetzt.“
Malveas Gesicht verfinsterte sich leicht. „Das stimmt nicht ganz, Bruder Pak, und Ihr wisst es. Mein Vater lässt mich bei Euch studieren, was ich will, und der Kampfunterricht bei Bruder Timme liegt mir genauso sehr am Herzen wie das Studium der alten Sprachen.“
Bruder Paks Lippen zuckten leicht. „Na ja. Ich weiß nicht, ob Euer Vater es so gern sähe, dass Ihr zur Kämpferin ausgebildet werdet...“
„Er hat mir gesagt, ich könne mir die Gebiete selbst aussuchen, die mich interessieren“, unterbrach Malvea störrisch und aufbrausend.
„Ob er aber damit rechnet, dass Ihr gerade Schwertkampf, Bogen und Speer trainiert, und nicht Kräuter und Heilpflanzen, da bin ich mir nicht sicher.“ Pak musste nun doch schmunzeln, versuchte aber, dies hinter seiner Hand zu verbergen, die wie von selbst in seinen Bart griff und damit seine verräterisch zuckenden Mundwinkel umschloss.
„Wenn er sich so wenig mit mir befasst, dass ihm nicht klar ist, wo meine Interessen liegen, dann ist das sein Problem.“ Malvea verschränkte die Arme vor der Brust, und leichte Wut kochte in ihr hoch, wie so oft, wenn das Gespräch auf ihren Vater kam.
Sie blickte trotzig Richtung Himmelsmassiv. „Malvin würde nur zu gerne seine Kampfübungen zugunsten von anderen Studien aufgeben, aber Vater würde das nie zulassen. Von Malvin als Erbe der Herren von Grünberg wird erwartet, dass er ein guter Kämpfer und streitbar ist, von mir wird im Gegenteil erwartet, dass ich mich in alles füge. Warum ist das so? Warum kann man nicht jeden so leben lassen, wie er es für richtig hält? Malvin wäre sicher ein sehr guter Heiler geworden.“
Ihre Stimme bebte vor unterdrücktem Zorn, und nur mühsam konnte sie ihre Lautstärke kontrollieren. Sie hasste es, wie dieses Thema sie immer wieder aufzuwühlen imstande war.
„Manche Dinge, Edle Malvea, sind eben einfach so, wie sie sind.“ Pak trat näher an sie heran, seine Stimme beruhigend und beneidenswert kühl angesichts ihrer erhitzten Wangen.
„Malvin wird eines Tages Herrscher, und Ihr werdet Euch verheiraten und ein paar reizende Kinder gebären, die Euch in der Art nachschlagen werden.“ Bruder Pak betrachtete die junge Frau sinnend, die Augenbrauen ein wenig zusammengezogen.
„Zumindest was das Interesse für alte Sprachen angeht, will ich hoffen“, fügte er seiner Rede hastig hinzu und fühlte, wie es schon wieder um seine Mundwinkel zu zucken begann. Die junge Edle hatte in der Tat ein hitziges Gemüt und viel Temperament, das es ihr nicht immer leicht machte, sich mit ihrer Situation zufriedenzugeben.
„Was meint Ihr, Bruder Pak“, wechselte Malvea abrupt das Thema, „werden wir die Rolle morgen entschlüsseln?“
Pak starrte auf den Tisch. „Das hoffe ich doch. Ich habe so eine Ahnung, dass ihr Inhalt mehr mit unserer jetzigen Situation zu tun hat, als uns lieb sein wird. Sobald wir mit der Übersetzung fertig sind, muss ich sie dem Abt zeigen. Und das wird morgen oder aber spätestens an dem Tag passieren müssen, an dem die Garde von ihrer Erkundung zurückkehrt.“
Malvea straffte sich. „Dann lasst uns gleich morgen früh weiterarbeiten. Wir sollten noch einmal in der Bibliothek nach den noch älteren Übersetzungsschlüsseln sehen. Wenn die Schrift so alt ist, wie ich denke, dann ist sie in dem ältesten Kata geschrieben, das ich je gesehen habe.“ Malvea stand auf. „Und nun gute Nacht, Bruder Pak. Huson.“ Sie nickte dem jungen Novizen zu.
Bruder Pak begleitete sie durch die große Bibliothek und öffnete ihr die Tür. „Huson, geleite Malvea noch bis nach Hause.“
Huson, der glücklich war, von seinem Berg Arbeit wegzukommen, kniff die ermüdeten Augen zusammen, erhob sich hastig und nickte dankbar. Er ging hinter Malvea die breite Treppe zur Klosterpforte hinunter, wieder höchst erfreut über seinen Auftrag und mit den Gedanken schon auf dem Gauklerplatz von Grünberg, der ihm so sehr gefiel.
Zum wiederholten Male fragte er sich, ob er mit seiner Wahl zum Ordensleben im Kloster El Om nicht vielleicht doch einen Fehler begangen hatte, oder ob nur die zwei Sum Noviziat so hart waren und ihm der Rest seines Lebens hier oben am Rande der Himmelsberge gut gefallen würde.
Wenn er an die Gaukler und ihr freies, unbeschwertes Leben dachte, wurde ihm weh ums Herz. Aber seine Mutter hätte ihm die Ohren langgezogen wie einem wilden Karnuk, wenn er ihr letzten Sum diesen Wunsch vorgetragen hätte. Vielleicht war der Orden doch nicht so übel. Bei Bruder Pak war das Noviziat auf alle Fälle nicht so hart, wie er es von dem Novizen, der Bruder Timme zugeordnet war, gehört hatte.
Nun doch ganz zufrieden mit seinem Schicksal und der Welt, schloss er die Klosterpforte hinter sich und der Edlen Malvea von Grünberg und trat in die kühle Abendluft hinaus.
Der laue Wind trieb einen leichten Geruch nach Kohlenfeuer von der nahen Stadt herbei, von den vielen Essensdüften, die um diese Zeit durch die Straßen Grünbergs wehten. Zwiebelgeruch mischte sich mit dem von Gegrilltem, und er meinte sogar den Duft von Gemüsesuppe aus der Luft herausfiltern zu können, als sie sich dem Stadttor näherten. Dann legte sich schlagartig der Gestank einer Schafherde auf seine Nasenflügel, als er zusammen mit der Edlen einem Schäfer und seinem tierischen Gefolge ausweichen musste, das die Straße nach Grünberg heraufkam.
Sie lachten und hielten sich die Nasen zu. Die Tiere waren alle feucht und rochen dementsprechend, es musste am Nachmittag geregnet haben. Huson hatte davon, genau wie Bruder Pak und Malvea, nichts mitbekommen. Ihre Arbeit in der Bibliothek hatte sie vollkommen gefangen genommen.
Eine erste Schwarzamsel schmetterte ihr Abendlied aus einem Apfelbaum heraus, als Huson und Malvea die Stadtwache passierten. Huson brachte Malvea noch bis zum Eingang des prächtigen Stadthauses, dann machte er auf der Stelle kehrt und gönnte sich ein paar wenige Minuten Stadtleben. Erste Feuer wurden auf einem der Marktplätze entzündet, und die Gaukler begannen mit ihren akrobatischen Übungen. Gebannt beobachtete er die bunten Gestalten.
Eine Glocke ertönte, und Huson seufzte abgrundtief. Das Abendgebet. Er musste sich beeilen, es nicht zu verpassen. Mit schwerem Herzen löste er sich aus dem lauten Treiben und machte sich auf den Rückweg zum Kloster, dessen Silhouette sich im Abendlicht beeindruckend vor ihm auftürmte. Er blieb kurz stehen und dachte zum bestimmt tausendsten Male: „Hier werde ich für den Rest meines Lebens zu Hause sein.“
Nichts regte sich in ihm.
Was war bloß mit ihm los? Er hatte sich doch für diesen Weg entschieden! Ein leiser Schmerz beengte ihm die Brust, als er die Pforte des Klosters leise hinter sich schloss und hinter den Brüdern hertrottete, die sich zum Abendgebet sammelten.
Thorn träumte wild in dieser Nacht, von Kampf und Blut und Ehre und Ruhm, von der Befreiung der Steppen seiner Altväter und von der glorreichen Vernichtung Arloks des Finsteren. Er warf sich so unruhig auf seiner Bettstatt herum, dass Fandor neben ihm aufwachte und verwirrt um sich blickte.
Als er sah, dass sich Thorn völlig in seine Zudecke aus Yukfell verheddert hatte, weckte er ihn mit sanftem Rütteln. „Thorn!“
Thorn murmelte etwas völlig Unverständliches, öffnete aber dabei die Augen. „Thorn, wach auf. Du träumst laut“, flüsterte Fandor.
Thorn setzte sich auf. „Ich habe gerade die Schlacht gewonnen, Fandor. Ich habe Arlok mein Schwert genau ins Herz gejagt!“, triumphierte er aufgeregt.
„Thorn?“, Fandor saß nun auch auf seinem Lager. „Ich muss dir was sagen.“ Sein Freund, nunmehr aufmerksam wie ein Schuhu am Nachthimmel, sah ihn irritiert an. „Ja?“
Fandor räusperte sich leicht. Es schien ihm schwerzufallen, das zu sagen, was ihm auf dem Herzen lag. „Es ist...“, begann er. „Ach, nichts“, raunzte er mit leichter Verärgerung in der Stimme und rollte sich weg von Thorn. „Schlaf weiter. Ich kann's dir auch morgen sagen.“ Doch Fandor wusste, am Morgen würde er Thorn bestimmt nichts mehr erzählen wollen über den Traum, der ihn in solcher Verwirrung hinterlassen hatte.
Thorn beugte sich über ihn. „Hast du Angst?“ wollte er wissen. „Möchtest du nicht mitreiten und unser Volk von den Schwarzen befreien?“ Fandor schluckte. Ein paar Atemzüge sagte keiner der beiden etwas, dann hörte Thorn Fandors leise Worte.
„Sie hat mich Federträger genannt. Sie sagte, ich würde auf eine Reise gehen und mein Volk finden. Und dass ich eine wichtige Aufgabe zu erledigen hätte, die über das Schicksal der nördlichen Welten entscheiden wird.“
Thorn sog scharf die Luft ein. „War das wieder so ein Traum von der Elfenkönigin?“
„Sie spielte mir eine Melodie vor, Thorn. Auf meiner Flöte. Und sie hat gesagt, die Melodie wäre wichtig für mein Volk.“
Thorn überlegte und knetete dabei seine Lippen. „Fandor, ich weiß nicht. Bist du sicher, dass diese Träume wirklich sind? Ich meine, dass sie eine reale Bedeutung haben?“
Fandors Herz setzte einen Augenblick aus. Schmerz griff nach ihm und legte sich so erbarmungslos um ihn wie ein metallener Schraubstock.
„Ich habs ja gewusst. Nicht mal du glaubst mir.“ Fandors Stimme unter der Yuk-Decke klang erstickt. „Vergiss es, ja?“ Thorn rührte sich nicht.
Fandors Stimme klang tonlos und kalt zu Thorn herüber. „Und, Thorn. Sag nichts davon Pope oder Mome, hörst du? Kein Wort! Das ist allein meine Sache.“
Die beiden Jungen lagen da und rührten sich nicht, und Fandor meinte schon, Thorn sei wieder eingeschlafen, weil der Atem des Jungen neben ihm so gleichmäßig ging, als Thorn sich mit einem Ruck aufsetzte und heiser flüsterte: „Ich glaube dir, Fandor. Und wenn du meinst, du könntest alleine auf diese Reise gehen, dann täuschst du dich.“ Er fuchtelte erregt mit seinen Händen in der Luft herum.
„Du bist mein Bruder und mein Freund, und ich habe dir den heiligen Blutschwur geleistet. Wenn du schon von einer blauhaarigen Elfenkönigin in ein Abenteuer geschickt wirst, dann auf keinen Fall ohne mich!“
Er rempelte Fandor mit dem Ellbogen an. „Und jetzt erzähl mir alles nochmal, aber von Anfang an.“
Der Morgen brachte kaum Wärme in die Knochen der Männer der Stadtgarde von Grünberg, die sich tief in die Berge des Himmelsmassivs vorangetastet hatten. Der Weg nach Süden war beschwerlich, und sie hatten bereits am gestrigen Tag ein Pferd verloren, das sich den Knöchel auf dem immer steiler werdenden Bergpfad gebrochen hatte.
Zudem war dies eine Gegend, die sie nicht gut kannten. Die Stadtgarde war zwar des Öfteren auch außerhalb der Stadtmauern unterwegs, aber dann meistens im Grüntal.
Brom von Bordur, Erster Wachmann und Leiter dieser Erkundungstruppe, schaute grimmig in die Dämmerung, als seine Männer langsam auf die Füße kamen und sich nach einer unbequemen Nacht auf dem harten Felsboden streckten.
Auch der Edle Malvin war unter den Reitern. Brom warf einen nachdenklichen Blick auf den unglücklich wirkenden schlanken jungen Mann mit dem hageren ernsten Gesicht.
Für einen Erben der Herren von Grünberg schien er sich auf dem Rücken eines Pferdes und an der Spitze seiner Garde wenig wohlzufühlen. Nicht, dass Malvin sich beklagen würde, nein, aber Brom sah, dass der Edle mit dem Herzen nicht bei der Sache war. In der Stadt war man sich darüber einig, dass Malvin, Sohn des Olerich von Grünberg, Stadtherr und souveräner Lenker seiner Bürger, nicht seinem Vater nachschlug.
Der junge Mann, so hieß es, wäre ein ausgezeichneter Kräuterkenner und Heiler, der schon in jungen Jahren mehr von diesen Dingen verstand als der Erste Heiler der Stadt, der kraft der Erfahrungen seines Alters einen enormen Schatz an Genesungstränken, Kräuterumschlägen und Wurzelsuden zu bereiten in der Lage war.
Brom von Bordur dreht sich unwirsch gen Süden. Was nützte das alles? Malvin von Grünberg würde seine Aufgabe erfüllen müssen, seinen Männern ein gutes Beispiel zu geben und an der Seite von ihm, Brom, auch und gerade in schlechten Zeiten die Stadtgarde zu führen. Und wenn er es nicht schaffte, dann würde Brom eben leise mit geschickter Hand hier und da eingreifen und die Dinge für den jungen Edlen erledigen müssen. Die Politik wollte es so und der Edle Olerich auch. Malvin war wirklich kein schlechter Kerl. Nur der eiserne Wille derer von Grünberg schien ihm nicht in die Wiege gelegt worden zu sein.
Brom, noch kalt in den Knochen, schüttelte die unwillkommenen Gedanken ab und kletterte auf eine kleine Anhöhe. Er kniff die Augen zusammen. Die Rauchsäulen, die vor zwei Tagen von der Stadt aus so gut zu sehen gewesen waren, waren jetzt beinahe verschwunden. Sie mussten im Laufe des Tages endlich das Bergdorf erreichen, wo sie den Brandherd vermuteten, also war keine Zeit zu verlieren. Wer wusste schon, was sie dort erwartete? Brom ließ zum Weiterritt blasen.
Ira war sehr besorgt. Als der erste Tag des Things vorüber war und sie endlich mit Prakh das Nachtlager teilte, hatte er sie über die ernste Lage informiert. Wohl waren schon die ganze Woche, seit die Freien Reiter sich in der Steppe zur Sonnwendfeier versammelt hatten, Gerüchte von Mund zu Ohr getragen worden, schreckliche Gerüchte, von denen natürlich kaum eine Handvoll wahr sein konnte, aber auch diese Handvoll reichte aus, um die Besorgnis in Ira zu schüren.
Als Prakh ihr nun in knappen Worten von den Übergriffen der schwarzen Reiter berichtete, wurde ihr das Herz schwer und gleichzeitig kalt wie ein Eisblock. Ihr erster Gedanke galt den beiden Jungen, die, kaum dass sie ihre Schwerter erhalten hatten, einer solchen Gefahr würden trotzen müssen.
Ira war bewusst, dass mit dem Tag der Schwertübergabe ihre beiden jüngsten Söhne mit allen Pflichten zu Männern geworden waren, und dass ihnen womöglich in kürzester Zeit ein Krieg die sowieso kurz bemessene jugendliche Unbeschwertheit abringen würde. Sie lag lange wach in der Nacht und überlegte und grübelte.
„Ihr werdet wohl nach Grünberg reiten müssen, um die hier gesammelten Berichte weiterzutragen“, murmelte Ira am Morgen wie in Gedanken versunken. „Man sagt, nicht nur die Stadt verfügt über eine große Garde, sondern auch das benachbarte Kloster El Om. Sie sollen dort die besten Kämpfer der ganzen nördlichen Welten ausbilden.“
Prakh sah sie erstaunt an. Er hatte gar nicht gewusst, wie informiert seine Frau über solche Dinge war. Die Gerüchteküche musste wohl schwer brodeln, wenn selbst die Frauen, die man, so wie er fand, nicht mit diesen Dingen belasten sollte, schon über einen hereinbrechenden Krieg nachdachten. Er räusperte sich.
„Ja, das waren auch meine Gedanken“, bekannte er mürrisch. „Wenn es wirklich zu einem Krieg kommen sollte, und Jooba bewahre uns davor, dann müssen wir uns alle zusammentun. Es heißt, die Armeen Arloks seien übermächtig und skrupellos. Ich weiß nur nicht, warum er nach Jahrhunderten seiner Herrschaft in den südlichen Landen plötzlich auf die Idee gekommen ist, in den Norden einzufallen. Wir sind ein so kleines Land, gemessen an dem seinen, dass er uns noch nie Aufmerksamkeit geschenkt hat.“
Ira strich die Schlafdecken glatt. „Weißt du, Prakh, wir hatten doch neulich schon einmal darüber geredet.“ Prakh runzelte die Stirn. „Über was?“ Seine Frau überreichte ihm sein prächtiges Thinggewand. „Darüber, die Jungen mit nach Grünberg zu nehmen. Fandor ist nun alt genug, um etwas über seine Wurzeln zu erfahren, und die Bibliothek im Kloster El Om wird sicher Aufschluss geben können.“ Sie half Prakh, das Gewand überzustreifen.
„Wenn du mit Larsso und den anderen Clanführern sowieso nach Grünberg reitest, um dich mit dem Edlen Olerich zu treffen und über die Vorkommnisse zu beraten, dann könnten die beiden Jungen doch auch mitkommen. Eine Reise würde ihnen guttun, und nun, da sie Männer geworden sind, musst du auch daran denken sie zu fordern. Junge Männer müssen sich beweisen. Auf so einer Reise, die womöglich gefährlicher ist, als wir auch nur ahnen, wird es allerlei für sie zu lernen und zu tun geben, das ihnen helfen wird, sich in ihrer neuen Rolle zurechtzufinden.“
Prakh, der sein Weib mit neuem Respekt ansah, ließ den Unterkiefer wenig anmutig herabhängen. „Ira, diese Beschlüsse werden die Clanführer auf dem Thing zu treffen haben. Bleib du bei deinen häuslichen Entscheidungen. In die mische ich mich auch nicht ein“, brauste er wenig überzeugend auf. „Natürlich werde ich Thorn und Fandor mitnehmen. Als Männer müssen sie die harte Wirklichkeit kennenlernen, je eher, desto besser. Das ist ihre Aufgabe im Leben.“
Ira blickte zu Boden, fast ein wenig demütig. „Ja, natürlich, Prakh“, murmelte sie kaum hörbar.
Und „Genau“, dachte sie leise für sich, „nimm die beiden Jungen mit nach Norden, Prakh von Wolff. Dann sind sie wenigstens hier unten im Süden nicht den schwarzen Reitern ausgeliefert.“ Sie drehte sich um, und ein kleines Siegeslächeln huschte um ihre Mundwinkel.
Gegen Mittag erreichten sie eine Weggabelung. Den Männern fiel das Atmen immer schwerer, denn die Luft wurde zunehmend dünner, je höher sie kamen. Hier und da lagen kleine Schneefelder auf der schattigen Seite des Hangs, die Stunde um Stunde größer wurden.
Der Edle Malvin hatte mit Kennerblick am Wegesrand einige Blätter von einzeln stehenden Pflanzen gezupft und diese an die Reiter verteilt. Die Blätter, gut gekaut, hatten etwas die beklemmende Atemnot lindern können. Brom von Bordur ließ anhalten. Sie waren nicht so weit gekommen, wie er gehofft hatte. Aber der Pfad war eng, und sie konnten das Risiko nicht eingehen, schneller zu reiten und noch ein Pferd zu verlieren.
„Wir machen eine kurze Rast“, rief er sich umdrehend. Sein jüngerer Bruder Sadraigh, der die Gruppe nach hinten absicherte, ritt an ihn heran. „Eine Weggabelung. Auch das noch.“
„Ja, wir werden uns wohl aufteilen müssen.“ Brom blickte auf die Kreuzung. „Der große Pfad scheint in Richtung des Dorfs zu führen. Der kleine geht mehr gen Südosten." Sadraigh, noch voller Energie, hatte bereits einen Plan. „Gib mir drei Männer mit, Brom, und wir werden den kleinen Pfad eine Tageslänge weit hineinreiten. Wenn wir nichts finden, kehren wir morgen wieder um.“
Brom überlegte und sah seinen hünenhaften Bruder abschätzend an. Der Kleine, wie er ihn immer noch frotzelnd nannte, war voller Tatendrang. Das war schon immer so gewesen, selbst als kleines Kind.
Sadraigh und Brom sahen sich zwar äußerlich sehr ähnlich, beide breitschultrig, flachsblond, gute Kämpfer und Strategen, aber innerlich waren sie sehr verschieden. Brom war besonnen, nachdenklich und hatte auch schon im elterlichen Heim nach dem Tod des Vaters die Position des Abwägenden, des Beschützers innegehabt.
Sadraigh hingegen war stürmisch, aufbrausend, ein Kraftbündel ohnegleichen.
Brom nickte kurz. Die Idee war ohne Frage gut. „Wir machen es so. Nimm dir die drei Männer, die du brauchst, und reitet den linken Pfad. Wenn ihr bis morgen Abend nichts gefunden habt, kehrt ihr um. Wir treffen uns dann wieder in Grünberg.“
Sadraighs Augen strahlten. Das war der erste Auftrag außerhalb der Stadtmauern, den Brom ihm alleine übertragen hatte. Er umarmte kurz den älteren Bruder, der ihm etwas steif überrascht auf die Schulter klopfte, dann sah er sich um, die Gardisten auszuwählen, die ihn begleiten sollten.
Ehre und Ruhm würde er einst erringen, die Stadt beschützen und sein Leben lassen für seine Aufgabe, wenn nötig. Er würde Brom zeigen, dass auf ihn unbedingt Verlass war. Dies war seine Stunde!
Die Sonne stand hoch am Himmel, als Sadraigh mit seinen Mannen um eine Pfadkehre ritt und aus dem Blickfeld der übrigen Reiter verschwand.
Das Thing endete noch am selben Tag. Wieder versuchten Fandor und Thorn dem Treffen beizuwohnen, aber sie hatten kein Glück. Mome Ira erwischte sie, bevor sie sich davonmachen konnten, und verlangte einige unliebsame Arbeiten von ihnen, wie das Säubern der großen Feuerstellen, das Häuten einiger Gunas und peinlicherweise auch, dass sie den Festplatz mit großen Reisigbündeln von den Überresten der Feier befreien sollten.
Ihre lautstark vorgebrachten Proteste halfen nichts, und so entging ihnen an diesem zweiten Tag des Things die Gelegenheit, sich vor allen anderen Stammesleuten zu informieren.
Die Ergebnisse des Treffens der Clanführer wurden am Abend allen Freien Reitern auf dem Festplatz verkündet, und sofort machten sich Geschäftigkeit und Reisefieber breit unter den tausenden, die zum Aufbruch rüsteten.
Es war beschlossen worden, eine Abordnung von zwölf Clanführern nach Grünberg und zum Kloster El Om zu entsenden, um ein Treffen einzuberaumen, das über das weitere Vorgehen der Menschen im Norden im Kampf gegen die schwarzen Reiter entscheiden sollte. Die Clans selber sollten sofort wieder in ihre Heimatregionen aufbrechen. Das Fest war so schnell vorüber wie noch nie.
Fandor und Thorn, die vor lauter Aufregung nicht wussten, wohin mit sich, standen Mome Ira nur im Weg, die mit stoischer Ruhe Reisevorbereitungen tätigte.
Dies würde ihr erster Ritt werden, der sie aus der Steppe, ihrer Heimat seit Kindesbeinen, herausführen würde. Noch nie waren sie in der Stadt Grünberg gewesen, und ein Kloster kannten sie bislang nur aus den Erzählungen der Großen.
Sie hatten tausend Fragen, doch wen auch immer sie ansprachen, alle waren mit wichtigen Dingen und noch wichtigeren Gesprächen beschäftigt und ließen sie einfach stehen. Thorn war aufgebracht deswegen, denn auch seine Brüder Larsso und Mjörk taten so, als hätten sie viel zu viel zu tun, um ihnen Rede und Antwort zu stehen.
„Ich hasse das“, tobte Thorn, der soeben von Larsso eine Abfuhr kassiert hatte, der voller Wichtigkeit etwas von Pferde bereitmachen gemurmelt hatte. „Wieso reden sie nicht mit uns?“
„Was wollt ihr denn so Wichtiges wissen?“ Hinter ihnen stand plötzlich der junge, drahtige kleine Pitar, der Mann, der den Schwarzen entkommen war.
„Ich“, stotterte Thorn, völlig überrumpelt von der Tatsache, dass sich nun doch jemand bereitgefunden hatte, ihnen Auskunft zu geben.
„Wir“, sprang Fandor seinem Freund bei, „wissen noch nicht einmal, ob wir auch unsere Bogen mitnehmen sollen.“ „Bekommen wir ein eigenes Reisezelt?“, wollte Thorn wissen, der den Augenblick der Fassungslosigkeit schnell überwunden hatte.
„Wie ist es in Grünberg? Sprechen sie da auch unsere Sprache?“ Fandor wusste gar nicht, wo er anfangen sollte mit dem Fragen. „Und wieso lernen diese Brüder im Kloster Schwert- und Stockkampf? Ich dachte immer, in einem Kloster wird gebetet!“
Pitar schaute belustigt von einem zum anderen. „Na, das ist ja ein Haufen Fragen auf einmal.“ Er lachte laut auf und legte den beiden je eine Hand auf die Schulter.
„Wisst ihr was? Eure Bogen nehmt ihr natürlich mit, die Zeltausrüstung lasst ihr eure Mome einpacken, und was die Fragen zur Stadt und zum Kloster angehen – wir werden auf dem Weg dorthin noch Gelegenheit genug haben, über alles zu sprechen.“ Er grinste sie breit an.
„Und jetzt zieht los und bringt eure Schwerter und Bogen auf Vordermann.“ Damit drehte sich Pitar um und ließ die Jungen mit heißen Wangen auf dem Platz zurück, wo sich ihre Gedanken weiter in wilden Sprüngen überschlugen.
Es hatte wiederum länger gedauert, als Brom erwartet hatte. Die Schneefelder lagen jetzt auch dick und weich auf dem Pfad, der Anstieg wurde immer mühseliger, und die Männer hatten Schwierigkeiten, den Pfad selbst nicht zu verlieren, der sich unter dem Schnee versteckte wie eine Schlange im Laub.
Der Boden wurde immer glitschiger, und als der Abend sich mit einem aufkommenden harten, kalten Wind auf die Berge herabsenkte, hatten sie das Bergdorf noch immer nicht erreicht. Brom von Bordur, an dessen Seite tapfer und ohne zu klagen der Edle Malvin von Grünberg mit verbissenem, blassen Gesichtsausdruck ritt, ließ das Nachtlager aufschlagen.
Brom schaute sich um und betrachtete aufmerksam seine Männer. Sorgen zeichneten sich auf seinem Gesicht ab. Die Stadtgardisten waren in keinem guten Zustand. Sie froren, obwohl sie sich gut eingekleidet hatten. Hier oben schien das Wetter trotz des Hochsums, in dem sie sich eigentlich befanden, zu bocken wie eine Bergziege.
Die Stimmung im provisorischen Lager war gedrückt, und es wurde nicht viel geredet. Brom ließ Wachen für die Nacht aufstellen, denn das Dorf, von dem man sagte, es sei von den schwarzen Reitern überfallen worden, konnte nicht mehr weit sein.
Malvin fand in dieser Nacht hoch in den Bergen kaum Schlaf. Die meisten der Männer hatten dunkle Ringe unter den Augen, was die langen Schatten des Lagerfeuers im Wind nur noch unterstrichen. Die Blätter, die er gesammelt hatte, gingen zur Neige, und der unheimliche Wintereinbruch, der hier oben mitten im Sum zu herrschen schien, machte es unmöglich, noch mehr davon zu finden. Er hätte weiter unten daran denken sollen, einen weiteren Sack voll zu pflücken und einzupacken.
Malvin ärgerte sich. Er hatte die Verantwortung für diese Männer, und weil er nicht richtig darüber nachgedacht hatte, mussten sie nun alle unter der dünnen, kaum atembaren Luft leiden. Malvea kam ihm in den Sinn, und er seufzte leise. Für seine Schwester wäre dieser Ritt ein willkommenes Abenteuer gewesen. Für ihn, Malvin den Versager, war er eine Qual.
Er drehte sich zu Brom um, der den ganzen Tag über sehr wortkarg gewesen war und mit Malvin nicht mehr als die notwendigsten Worte gewechselt hatte. Malvin überraschte das nicht, aber es schmerzte ihn mehr, als er gedacht hatte.
Eine der wenigen Fragen, die Brom ihm gestellt hatte, war die nach mehr von diesen Blättern gegen die Höhenübelkeit gewesen, und Malvin war doch tatsächlich hochrot angelaufen, als er murmelnd und stotternd antworten musste, dass er kaum mehr welche hatte. Daraufhin, so kam es Malvin vor, hatte Brom ihn keines Blickes mehr gewürdigt.
Malvin schaute verbittert in die Flammen des winzigen Feuers, das in seiner Nähe entzündet worden war, und wickelte sich enger in seine Reisedecke ein. Ihm war kalt und leicht übel. Was war er doch für ein Jammerlappen.
Er hasste die Ausritte mit der Stadtgarde, und diesmal war es besonders schlimm.
Malvin wünschte sich sehnlich ins Heilhaus zurück, wo er einige Versuche mit Heilkräutern angesetzt hatte, die er in wechselnden Kombinationen zu Pasten und Tränken verarbeitet hatte. Das war seine Welt, nicht dies hier, diese nach Schweiß stinkenden Männer in ihren mittlerweile dreckigen, feuchten Uniformen, die ihre Arbeit liebten und in ihr aufgingen. Und doch war dies die Welt, die ihm vorbestimmt war, die einzige Lebensweise, die sein Vater achtete und von Malvin akzeptieren würde.
Malvin war sich nicht sicher, inwieweit Olerich von seinen Ausflügen ins Heilhaus unterrichtet war, er erwähnte sie nicht in seinem Beisein. Und Malvin sprach auch nicht darüber, wohl wissend, dass er damit einen Disput auslösen würde, aus dem Olerich als Sieger hervorgehen würde, nicht er.
Malvins Blick wurde noch finsterer. Nicht nur, dass er sich schwertat mit seinen Verpflichtungen seiner Stadt und seiner Familie gegenüber, nein, er war auch noch zu feige, seinem Vater gegenüberzutreten und zu seinen eigentlichen Neigungen zu stehen. Ein schöner Sohn seines Vaters war er.
Und mit diesen quälenden Gedanken fiel er in einen kurzen, bleiernen Schlaf der Erschöpfung.
Sadraigh war mit seinen Männern für die Nacht unter einem schützenden Felsüberhang untergekommen, der wenigstens den Wind davon abhielt, ihnen die Füße abzufrieren. Da sie nur zu viert waren, lösten sie sich mit der Wache am Feuer ab, das mehr beißenden, rußigen Rauch als Wärme abgab.
Es war während der dritten Wache, als der junge Hammat ein Geräusch hörte, das ihn aus dem Schlaf aufschreckte. Er saß am Feuer, und es war an ihm, auf die kleine Gruppe aufzupassen.
Es ist fraglich, ob Hammat, wäre er nicht eingeschlafen, noch etwas hätte tun können. So aber war alles, was ihm noch zu tun blieb, die Augen aufzureißen. Das Letzte, was Hammat, der Stadtgardist, in diesem Leben sah, waren die Umrisse eines schwarzen Reiters, der gefährlich nahe über ihm stand und mit einem großen Beil kraftvoll ausholte.
Sie waren umzingelt von schwarzen Reitern und hatten keine Chance.
Der ungleiche Kampf war nur von kurzer Dauer.
Aufzeichnungen aus dem Buch der Geschichte von Thorn Jhaerhune von Wolff:
Geschrieben ward der 23. Juno im Jahre 527 von Arloks Herrschaft, als Fandor Ellson und Thorn von Wolff zusammen mit ihrem Vater und einigen ausgewählten Clanführern der Freien Reiter aufbrachen nach der Stadt Grünberg, die am nördlichen Ende der Himmelberge sich befindet. Dies war der Beginn ihrer langen Reise, und dies war die Zeit des Beginns des großen Krieges zwischen Arlok dem Schwarzen und den Bewohnern der nördlichen Welten.
Kaum dass die Sonne den Horizont berührte, ritten Fandor und Thorn am Ende der kleinen Gruppe der Freien Reiter aus dem Lager heraus. Prakh von Wolff hatte zur Eile gedrängt und wollte keine Zeit verschenken. Er ließ die seinen unter der Obhut seines Stellvertreters Urso, eines großen, geschickten Mannes, und seines zweiten Sohnes Mjörk zurück, nicht ohne ein ungutes Ziehen im Bauch zu verspüren. Die Reise nach Grünberg sollte zwar keine lange werden, aber die Steppe war unsicher geworden, und am liebsten hätte er sich zweigeteilt, um an beiden Orten zugleich sein zu können.
Prakh warf noch einen letzten Blick über das Lager, strich sich gedankenlos über die Narbe auf seiner Wange und gab das Kommando zum Aufbruch. Die Männer bliesen in ihre Hörner, ein altes Reiselied, das immer angestimmt wurde, wenn die Clans oder Gruppen von ihnen eine längere Zeit weg sein würden.
Er hasste die Situation, und er fühlte sich ohnmächtig. Sein Sohn Mjörk war zwar ein guter Stratege und kein Hitzkopf, und auf Urso war auch hundertprozentig Verlass, aber so viel Verantwortung hatten sie noch nie zu tragen gehabt. Beide hatten zwar voller Stolz verkündet, sie kämen schon zurecht, aber was wussten sie schon.
Es war Ira gewesen, die mit Prakh zusammen entschieden hatte, dass Mjörk bleiben und Larsso, ihr erster Sohn, mit Prakh nach Grünberg reiten sollte. Er würde das den anderen Clanführern natürlich nicht sagen, aber er verließ sich in diesen Dingen immer auf seine Frau. Sie hatte die Jungen schließlich aufgezogen und kannte sie in- und auswendig.
Er war stolz auf sie, was er ihr auch eines Tages sagen würde, aber wahrscheinlich wusste sie das ohnehin, warum also sollte er es ihr gegenüber erwähnen? Sie verstanden sich nach all ihren gemeinsamen Jahren blind. Sie waren eine gute Verbindung. Und die Jungen waren ihr ganzer Stolz.
„Mjörk hat einen guten Blick für das Lagerleben und die Bevorratung, die Einteilung, die Pferde, und er hat auch ein gutes Händchen für das Regeln von Streitigkeiten. Er ist der beste für diese Arbeit, wenn du unterwegs bist, Prakh“, hatte sie ihm im Zelt gesagt, als er ihr von seinen Plänen erzählt hatte, Larsso das Lager zu überlassen und Mjörk mitzunehmen.
„Larsso hingegen ist ein guter Reiter, Jäger, Fährtenleser, er ist gerne unterwegs, und selten hält es ihn länger als ein paar Augenblicke am selben Ort“, hatte sie die Eigenschaften ihrer beiden ältesten Söhne für ihn zusammengefasst.
Prakh war wie so oft überrascht, wie treffend sie Menschen zu beobachten verstand. Ihm selbst wäre es nie in den Sinn gekommen, dass seine Söhne derart unterschiedlich veranlagt sein könnten. Er war auch überrascht, wie groß sie schon waren. Waren sie nicht neulich noch zwischen seinen Beinen herumgetollt? Wo war bloß die Zeit geblieben?
Er hatte sich am Kinn gekratzt, seinen Krug geleert, kurz genickt, und es war entschieden. Mjörk würde bleiben, Larsso würde mitreiten.
Die Hornbläser hatten geendet und hängten ihre Instrumente an ihre Sättel. Prakh nickte noch einmal in die Runde, sah Fas ernst in die Augen, der das Pferd neben seins lenkte, und trieb grimmig sein stämmiges Reittier an.
Fandor und Thorn, beide wie im Rausch, saßen aufgeregt auf ihren kleinen sandfarbenen Steppenpferden und ritten hinter den Clanführern und übrigen Reitern her. Als der Weg hinter dem Lager eine erste Biegung machte, drehten sie sich noch einmal nach Mome Ira um. Ira und viele andere standen da und winkten ihnen hinterher. Sie lächelten ihr zu, und dann winkten sie zurück, was ihnen zwar etwas unmännlich vorkam, aber es war geschehen, noch ehe sie richtig darüber nachdenken konnten.
Ira war froh, dass die Gruppe schon so weit entfernt war, denn Wasser stand ihr in den Augen, als sie die beiden Jungen im Staub entschwinden sah.
Ihre Söhne Thorn, der Heißsporn, und Fandor, der Vorsichtige, ritten in die Welt hinaus. Als was würden sie wohl heimkehren?
Am Morgen war Neuschnee gefallen in den mächtigen Bergen des Himmelsmassivs, und Brom von Bordur ließ den Männern kaum Zeit zu frühstücken. Sie hatten sowieso nur noch wenige Vorräte dabei, die Brote wurden knapp und das Dörrfleisch auch. Es war an der Zeit, das zu finden, weswegen sie diese beschwerliche Reise auf sich genommen hatten.
Malvin, der schlecht geschlafen hatte, schritt, ein wenig besser gelaunt als am Abend zuvor, auf Brom zu. „Glaubt Ihr, wir stoßen heute auf das Dorf?“
Brom nickte. „Ja, es kann nicht mehr weit sein. Ich denke, wir werden noch vor Hochsonn dort sein.“
Malvin sah Brom ins ernste Gesicht. Dann wandte er seinen Blick zu Boden. „Was erwartet Ihr dort zu finden, Brom? Ich meine, im Ernst.“
Der Wachmann zuckte die Achseln, sein Blick verfinsterte sich. „Auf jeden Fall ein zerstörtes Dorf. Vielleicht ein paar Tote. Wir werden es bald wissen, Edler Malvin.“ Er verbeugte sich leicht. „Wir sollten aufbrechen, es sieht nach noch mehr Schnee aus. Und das im Jul“, brummte er, schon sein Pferd sattelnd.
Malvin folgte ohne weitere Worte. Brom leitete die Stadtgarde. Dass Malvin hier mitritt, war bloße Politik. Zu glauben, dass er tatsächlich dazu in der Lage sei, einen solchen Kundschafterritt anzuführen, war der blanke Hohn. Er war Brom dankbar, dass ihn dieser nicht offen spüren ließ, was er von Malvin und seinen Führungsqualitäten hielt. Sie saßen auf.
Gegen Mittag erreichten sie, wie Brom vorhergesagt hatte, das Bergdorf. Es hätte nicht schlimmer sein können. Langsam ritten sie Mann hinter Mann den schmalen Pfad in das Dorf hinein. Es stand keine Hütte mehr. Die ehemaligen Dorfbewohner waren allesamt überrascht worden. Sie bargen knapp fünfzig Tote von den Pfaden und aus den niedergebrannten Häusern. Es gab keinen Zweifel mehr. Die Gerüchte besagten alle die Wahrheit. Die schwarzen Reiter waren wieder unterwegs.
Die Männer waren äußerst schweigsam, und die Stimmung war sehr gedrückt. Keiner von den Stadtgardisten hatte in seinem Leben schon an einem echten Kampf teilgenommen, geschweige denn gewaltsam vergossenes Blut gesehen. Sie alle hatten die ausgezeichnete Kampfausbildung im Kloster El Om durchlaufen und waren die Besten ihrer Ausbildungseinheiten gewesen. Aber das war etwas ganz anderes als echter Krieg mit echten Toten.
Keiner, der an jenem Tag das schreckliche Gemetzel im Bergdorf sah, würde es je wieder vergessen können.
Schweigend setzten sie die geborgenen Leichen auf dem Dorffriedhof unter den wortkargen Anweisungen Brom von Bordurs in einer großen Gruft aus aufgeschichteten Steinen bei.
Malvin hielt sich heraus. Er hätte sowieso kein Wort über die Lippen gebracht, seine Kehle war wie zugeschnürt. Nachdem die Männer der Stadtgarde den Bewohnern die letzte Ehre erwiesen und ein kurzes Gebet gesungen hatten, verließen sie, so schnell es ging, wieder die Berge. Der Abstieg würde noch lange genug dauern, und außerdem waren alle mehr als nervös.
Irgendwo hier draußen waren die schwarzen Reiter, und sie waren nicht gekommen, um Frieden zu bringen. Brom gemahnte seine Männer zu größter Wachsamkeit und Eile. In diesen Bergen wütete ein gnadenloser Tod.