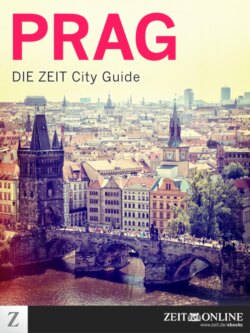Читать книгу Prag - ZEIT ONLINE - Страница 3
Als hätte man auf uns gewartet In Prag lauert der Zauber hinter jeder Ecke. Eine Tramfahrt vom Hradschin bis in die Bierkaschemme.
VON STEFANIE FLAMM
ОглавлениеWas sind das für Menschen, die behaupten, Prag sei die Magie abhandengekommen? Sind sie blind oder blöd oder einfach so verliebt in die alten Schwarz-Weiß-Fotos von der zerbröckelnden Stadt, dass sie gar nicht merken, was da unter den Gerüsten zum Vorschein kam?
Die lebensgroße Steinmutter, die auf einer Säule an der Spálená-Straße mit entblößter Brust ein Still-in veranstaltet, könnte man noch als frivole Entgleisung abtun. Doch was ist mit dem heiligen Hubertus, der drüben auf der Malá Strana, der Kleinseite, so comichaft seinen Hirsch anbetet, dass es schon an Blasphemie grenzt? Mit den Totenköpfen auf dem Jugendstilhaus in Vinohrady, den riesenhaften Stuckbabys, die wohlgenährt auf einem Fassadenvorsprung in der Národní třída herumtanzen?
Jugendstil, klar, bombastisches Ornament dito, Kafka, Golem, spitze Türme und alte Friedhöfe, das erwartet man von der Stadt, die sich seit Jahren erfolgreich als in Schönheit gestorbene Metropole vermarktet. Doch irgendwie scheint da noch was hinter den prächtigen Fassaden zu lauern, angenehm verrückt, ein leises Augenzwinkern, das einem zu verstehen gibt, dass das alles so ernst nun auch nicht gemeint ist.
Am großen, in Zeiten von easyJet viel zu großen Prager Hauptbahnhof treffe ich Jaroslav Rudiš, den Mitteleuropäer unter den jüngeren Prager Schriftstellern. Er liebt es, in das versunkene Universum Österreich-Ungarns einzutauchen, um zu schauen, was davon heute noch Bestand hat. Vielleicht kann er mir erklären, was mit dieser Stadt los ist? Rudiš schlägt vor, eine Runde mit der Straßenbahn zu fahren.
Er ist ein leidenschaftlicher Nutzer des öffentlichen Personenverkehrs. Die meisten seiner Romane spielen in Bussen und Bahnen. »Meine Welt ist ein riesiges Schienennetzwerk, in dem alles mit allem verbunden ist, obwohl es längst nicht mehr richtig zusammenpasst«, sagt er, während wir unter der Bahnhofsrotunde stehen, die jeder Kirche Ehre machen würden.
Jugendstil klettert die Säulen hinauf, Licht fällt durch schmale Fensterspalten hinab. In dem Lokal an der Stirnseite trifft der Held aus seiner auch auf Deutsch erschienenen Graphic Novel Alois Nebel (Zeichnungen: Jaromir 99) die Liebe seines Lebens. Leider ist es geschlossen. Bewirtschaftungswechsel. Egal, wir wollen sowieso los.
Zwischen dem Nationaltheater und dem Haus mit den Riesenbabys steigen wir in die Linie 22. Zwischen Hostivař und Bílá Hora, dem ganz neuen und dem ganz alten Prag, verkehren noch immer die alten roten Bahnen aus den sechziger Jahren; die Stadt scheint zu wissen, wie sehr wir Touristen das mögen.
Drinnen zieht Rudiš sich erst mal den Mantel aus. Unter jedem der rot-grauen Schalensitze gibt es eine kleine Heizung, die es nicht kümmert, dass der Sommer zurückgekehrt ist. Über die Moldau schippern noch die letzten Tretboote. Dann taucht die Bahn auch schon ein in das Gassengewirr der Kleinseite. Oft beschrieben, oft verhöhnt, diese Mischung aus Klimbim und Kitsch und Knödeln. Doch als sich dann die zackige Silhouette des Hradschin vorm Horizont aufbaut, versuche auch ich, ein Foto zu machen. Vergeblich. Die größte zusammenhängende Burganlage Europas sprengt jedes Display.
In der ehemaligen Schaltzentrale des Heiligen Römischen Reiches kamen schon andere auf dumme Gedanken. Gold im Reagenzglas züchten, kaiserliche Beamte aus dem Fenster stürzen und so weiter. Der aktuelle Bewohner der Prager Burg, Präsident Klaus, hat nach seinem Einzug erst mal die Europaflagge einholen lassen, um der Welt zu zeigen, dass Brüssel einem Prager Burgherrn gestohlen bleiben kann.
Die letzten Touristen verlassen die Bahn, doch Rudiš und ich wollen weiter hinaus. Nach der nächsten Schleife können wir dem tschechischen Präsidenten fast aufs Dach gucken. Das ganze Ausmaß der goldenen Herrlichkeit wird einem hier erst so richtig klar. Und ein bisschen kann ich verstehen, dass man selbstherrlich wird, wenn man jeden Tag so ein Panorama hat.
Rudiš ist da strenger. Wie Tschechen, die sehr jung waren, als die Freiheit kam, ist er noch ein Bewunderer von Václav Havel. Dem, wie er sagt »einzigen Rock ’n’ Roller, der je ein Staatsamt bekleidet hat«. Als Havel Anfang der neunziger Jahre die Rolling Stones zu sich einlud, hatte Rudiš das Gefühl, endlich angeschlossen zu sein an die globale Popkultur, die er so lange nur aus der Ferne beobachtet hatte. In die Keller Prags zogen Clubs und Kneipen, die alten Cafés wurde restauriert. Und wenn man Rudiš so reden hört, bekommt man den Eindruck, als habe die Stadt eine lange, rauschhafte Party gefeiert; die Gäste kamen aus aller Welt, darunter viele Amerikaner. »Weil Prag so schön war, so alt – und so billig.«
Als dann auch noch die Briten Prag für ihre Sauftouren entdeckten, wurde es Rudiš allerdings zu viel. »Ich habe mir oft vorgestellt, dass sich alle ein Stück Prag abschneiden, bis es verschwunden ist.« Er floh nach Berlin, und als er zurückkam, war Prag zu seiner Verwunderung immer noch da – und dabei, seinen Kater auszukurieren. Der Überschwang war verflogen und der Tourismus auch nur ein Wirtschaftszweig neben vielen.
In der 22 ist es inzwischen so still, dass wir automatisch die Stimme senken. Die einzigen Passagiere starren so konzentriert auf ihre Laptops, dass sie gar nicht mitbekommen, wie grün Prag von hier an wird, wie großzügig. Die Villen von Střešovice rauschen vorbei, schließlich Dörfer. An der Endstation Bílá Hora hört man nur das Klappern einer Heckenschere.
Wir schauen auf Felder, dahinter ein Tal, Plattenbauten, Firmenzentralen. Eine Gewitterwolke schiebt sich ins Bild, und auf dem Rückweg passiert das, wovor ich mich schon die ganze Zeit gefürchtet habe: Plötzlich wirkt die Stadt düster und, ich traue mich nicht, es laut zu sagen, ein wenig kafkaesk. So enge Gassen, so viele Türme, Schatten. Wenig später stehen wir vor einem grauen Eckhaus in der Innenstadt. Die Fenster sind mit bunten Folien verklebt. Dahinter, sagt Rudiš, habe einmal das berühmte Café Arco gelegen. Alle seien sie hier gewesen, Kisch, Werfel, Max Brod und natürlich Kafka, einer von Rudiš’ »absoluten Lieblingen«.
Als die Tür sich öffnet, schlüpfen wir hinein und stehen, ja, wo eigentlich? »In einer Kantine der Prager Polizei.« Wie bitte? Dunkles Holz an den Wänden, weißes Tuch auf den Tischen. An der Essensausgabe laden sich trainierte junge Männer die Teller voll und tragen sie zur Kasse.
Kafka, in dessen Augen jeder Gesetzeshüter ein Willkürherrscher war, würde sich vermutlich im Grabe noch gruseln. Und auch Rudiš, der oft mit Besuch hierher geht, aber es heute zum ersten Mal durch die Tür geschafft hat, sucht kurz nach Worten. »Krass«, sagt er dann. Prag schafft es, seine eigenen Schriftsteller sprachlos zu machen. Langsam finde ich das neue Arco richtig toll. Jedes zweite Prager Kaffeehaus versucht, einem weiszumachen, dass Kafka dort gesessen hat, doch hier, wo er am liebsten war, fragt die dicke Kassiererin: »Wollen Sie essen?«
»Eigentlich wollten wir nur gucken. Wegen Kafka, Sie wissen schon.«
»Weiß ich, aber Sie können ja trotzdem essen. Ich würde eine Ausnahme machen.«
Leider haben wir keine Zeit. Rudiš muss gleich eine Literatursendung moderieren. Wir verabreden uns für den Abend in Žižkov, einem ehemaligen Arbeiterviertel. Dort, sagt er, lägen seine punkigen Anfänge. So richtig kann ich mir das nicht vorstellen, als ich hinter dem Náměstí Míru, Friedensplatz, so lange den Berg hinauflaufe, bis die Pracht nachlässt. Žižkov ist abgerockt, ein ruinöses Idyll wie Prenzlauer Berg vor 15 Jahren. Abblätternde Fassaden, viele Kneipen und Kinderboutiquen, als Vorboten der Gentrifizierung. Aber punkig?
Wir treffen uns vor dem Fernsehturm, einer spätsozialistischen Alu-Rakete, die nach Sonnenuntergang angestrahlt wird, als wolle die Stadt zeigen, dass sie auch ein scheußliches Gebäude hat. Unser Ziel ist eine Kneipe mit dem beunruhigenden Namen Zum Ausgeschossenen Auge.
Also noch weiter den Berg hinauf, bis wir in einer winzigen Stichstraße vor einem windschiefen Häuschen stehen. Drinnen stoßen wir gegen eine Rauchwand, hinter der hünenhafte Kellner immer neue Halbliterkrüge auf die Holztische hämmern. Joints machen die Runde, Männer, die heute wohl nicht im Büro waren, prosten einander zu. Viele Dreadlocks, Kapuzenpullis, rasierte Schädel. Obwohl wir hier wirken müssen wie Besuch von einem anderen Planetensystem, rücken sie zusammen, als hätten sie auf uns gewartet.
In solchen Momenten erinnere ihn das Ausgeschossene Auge an die Kleinstadtkneipen in seiner nordböhmischen Heimat, sagt Rudiš. »Dort war auch für jeden Platz.« Auch mir gefällt die düstere Romantik dieser Trinkergemeinschaft. Doch nach dem zweiten Bier mache ich schlapp.
Im Bus drehen die Leute sich nach mir um, vermutlich rieche ich wie ein Aschenbecher. Am Friedensplatz dann Umsteigen in die 22er Tram, die noch voller ist als am Tag. Wo die alle herkommen? Nicht aus dem Ausgeschossenen Auge, so viel ist klar. Ein Mann trägt Bügelwäsche über dem Arm.
Auch drüben auf der Kleinseite brennt noch immer Licht, die Straßen aber sind wie leer gesaugt. Ein eisiger Wind fegt Mülltonnen die Gassen hinab, die ich nun hinaufmuss. Höre ich Stimmen? Kurz vor meinem Hotel begegnen mir drei Mütter, die ihre schlafenden Säuglinge durch die Nacht schieben, in der einen Hand den Kinderwagenbügel, in der anderen einen Rotweinpokal. So ist Prag, denke ich und höre zum Einschlafen die Platte, die mir Rudiš geschenkt hat. Ich verstehe nur ein einziges Wort: Halleluja!