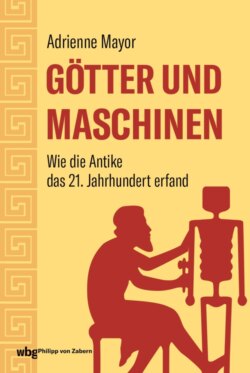Читать книгу Götter und Maschinen - Adrienne Mayor - Страница 7
Einführung
Geschaffen, nicht geboren
ОглавлениеWer kam als Erster auf die Idee von Robotern, Automata, von Ergänzungen des Menschen und Künstlicher Intelligenz? Historiker führen die Idee des Automaton gern auf Handwerker des Mittelalters zurück, die selbstbewegende Maschinen entwickelten. Werfen wir aber unseren Blick noch weiter zurück, nämlich mehr als 2000 Jahre, so finden wir in der Mythologie eine ungewöhnliche Fülle an entsprechenden Ideen und Vorstellungen. Diese Geschichten zeigen, wie man das natürliche Leben nachahmen, steigern und sogar übertreffen kann – durch Hilfsmittel, die man als Biotechne bezeichnen könnte, als „handwerklich geschaffenes Leben“. Wir finden also in der griechischen Antike die frühesten Andeutungen auf unsere heutige Biotechnologie.
Lange, bevor im Mittelalter die ersten Uhrwerke und im frühmodernen Europa die ersten Automata aufkamen, und selbst Jahrhunderte vor den technologischen Innovationen aus dem Zeitalter des Hellenismus in Gestalt raffinierter, selbstbewegender Apparate, existierten in griechischen Mythen bereits Vorstellungen über die Herstellung künstlichen Lebens – und auch Skrupel deswegen. Wesen, die geschaffen, nicht geboren waren, tauchten in den Erzählungen über Iason und die Argonauten auf, in denen über den bronzenen Roboter Talos, die „Techno-Hexe“ Medea, den genialen Erfinder Daedalus (in Transkription des Griechischen eigentlich: Medeia und Daidalos), den Feuerbringer Prometheus und Pandora, den von Hephaistos – dem Gott der Erfindung – geschaffenen bösen, humanoiden, weiblichen Roboter. Diese Mythen sind der früheste Ausdruck des zeitlosen Strebens, künstliches Leben zu entwickeln. Die antiken „Science-Fiction“-Kreationen zeigen, wie die Macht der Phantasie den Menschen seit den Zeiten Homers bis zu Aristoteles dazu brachte, darüber nachzusinnen, wie die Natur durch Handwerk nachgebildet werden könnte. Ideen hatte es schon lange gegeben, ehe die Technologie ein derartiges Unternehmen überhaupt erst möglich machte. Die Erzählungen dieser Zeit stützen die Vorstellung, dass es die Phantasie ist, die Mythos und Wissenschaft miteinander verbindet. Viele der Automata und mechanischen Geräte, die in der griechisch-römischen Antike entworfen und hergestellt wurden, greifen auf Mythen zurück: Sie zeigen Götter und Heroen bzw. spielen auf sie an.
Wissenschaftshistoriker glauben gern, dass antike Mythen über künstliches Leben im Grunde nur leblose Materie schildern, die durch den Befehl eines Gottes oder den Spruch eines Zauberers zum Leben erweckt wurde. Solche Erzählungen finden wir in den Mythologien vieler Kulturen. Zu den zahlreichen berühmten Beispielen gehören Adam und Eva im Alten Testament oder Pygmalions Statue der Galatea im klassischen griechischen Mythos. Doch viele der in den Mythen Griechenlands und Roms – bzw. in vergleichbaren Überlieferungen aus dem antiken Indien und China – beschriebenen, selbstbewegenden Geräte und Automata unterscheiden sich deutlich von leblosen Dingen, die erst durch magisches oder göttliches Gebot belebt wurden. Diese besonderen Wesen galten als künstlich erschaffene Technologien. Sie wurden von Grund auf entworfen und aus den gleichen Materialien und mit denselben Methoden gebaut, mit denen Künstler und Handwerker ihre Arbeitsgeräte, Kunstwerke, Gebäude und Statuen herstellten. Dabei sind die in den Mythen beschriebenen Roboter, künstlichen Menschen und sich selbst bewegenden Objekte erstaunlich – weit phantastischer als alles, was von gewöhnlichen Sterblichen ersonnen wurde –, und sie sind mit den großartigen Fähigkeiten von Göttern und legendären Erfindern wie Daedalus ausgestattet. Man kann die antiken Mythen über künstliches Leben also als Gedankenexperimente ansehen, als „Was-wäre-wenn“-Szenarien in einer alternativen Welt der Möglichkeiten, in einem imaginären Raum, in dem Technologie bis zu einem eindrucksvollen Maß vorangetrieben wurde.
Der gemeinsame Nenner aller mythischen Automata in Gestalt von Tieren oder Androiden wie Talos oder Pandora ist der, dass sie geschaffen, nicht geboren wurden. In der Antike aber waren die großen Helden, Monster und sogar die unsterblichen olympischen Götter eigentlich genau das Gegenteil: Sie waren allesamt wie gewöhnliche Sterbliche „geboren, nicht geschaffen“. Dieser Unterschied war auch für das frühe christliche Dogma entscheidend, nach dem – so konservative Überzeugungen – Jesus wie ein Mensch natürlich empfangen und geboren worden sei. Dieses Motiv finden wir auch in der modernen Science-Fiction, etwa in dem Film Blade Runner 2049 aus dem Jahr 2017. Darin geht es um die Frage, ob einige der Charaktere Replikanten (also künstliche, menschenähnliche Wesen), Faksimiles echter Menschen oder aber tatsächlich echte Menschen sind. Seit uralten Zeiten kennzeichnet der Unterschied zwischen biologisch geborenem und künstlich hergestelltem Ursprung die Grenze zwischen Menschen und Nichtmenschen, zwischen natürlich und unnatürlich. Und auch in den hier versammelten Geschichten über künstliches Leben ist die erläuternde Kategorie geschaffen, nicht geboren eine wichtige Unterscheidung. Sie trennt die hergestellten Automata von leblosen Objekten, die aufgrund eines bloßen Befehls oder mithilfe von Magie belebt wurden.
Zwei Götter – der göttliche Schmied Hephaistos und der Titan Prometheus – und zwei irdische Erfinder – Medea und Daedalus – tauchen in griechischen, etruskischen und römischen Erzählungen über künstliches Leben auf. Diese vier Gestalten verfügen über übermenschlichen Einfallsreichtum, außerordentliche Schöpferkraft, technische Virtuosität und hervorragendes künstlerisches Geschick. Die Techniken, Künste, Handwerke, Methoden und Werkzeuge, die sie benutzen, entsprechen denen, die man aus dem wirklichen Leben kennt. Doch die mythischen Erfinder erzielen damit spektakuläre Ergebnisse und übertreffen die Fähigkeiten und Technologien der gewöhnlichen Sterblichen bei Weitem.
Mit wenigen Ausnahmen werden in den Mythen, die seit der Antike überlebt haben, die inneren Mechanismen und Energiequellen von Automata nicht beschrieben, sondern bleiben unserer Phantasie überlassen. Diese fehlende Transparenz macht die göttlich geschaffenen Erfindungen zu einer Blackbox-Technologie, zu Maschinen, deren innere Abläufe unerklärt bleiben. Dazu passt der berühmte Ausspruch des britischen Science-Fiction-Schriftstellers Arthur C. Clarke: Je fortgeschrittener die Technologie, desto magischer scheint sie. In unserer heutigen Technologiekultur sind ironischerweise die meisten von uns tatsächlich um eine Erklärung dazu verlegen, wie die Geräte in ihrem Alltagsleben funktionieren – von Smartphones und Laptops bis zu Fahrzeugen, ganz zu schweigen von atomgetriebenen U-Booten oder Raketen. Wir wissen, dass es sich um mechanisch hergestellte Gegenstände handelt, von geistreichen Erfindern ersonnen und in Fabriken zusammengebaut, doch sie könnten ebenso gut Produkte der Magie sein. Oft wird behauptet, die menschliche Intelligenz selbst sei eine Art Blackbox. Und derzeit erreichen wir einen weiteren Grad an allgegenwärtiger Blackbox-Technologie: Maschinen lernen, und ihr Fortschritt wird schon bald dazu führen, dass Produkte mit Künstlicher Intelligenz ohne jegliches menschliches Eingreifen bzw. überhaupt Verständnis dieser Prozesse gewaltige Datenmengen sammeln, auswählen und interpretieren, um Entscheidungen zu fällen und von sich aus zu handeln. Nicht nur werden die Nutzer im Dunkeln gelassen, sondern nicht einmal die Urheber Künstlicher Intelligenz selbst verstehen die Arbeit ihrer Schöpfungen noch gänzlich. In gewisser Hinsicht kehren wir damit zu den frühesten Mythen um phantastisches, undurchschaubares künstliches Leben und Biotechne zurück.
Die Suche nach einer treffenden und passenden Sprache, um das Spektrum der Automaten und unnatürlichen Wesen zu beschreiben, die in der antiken Mythologie als geschaffen, nicht geboren bezeichnet werden, gestaltet sich schwierig und entmutigend. In den Geschichten um künstliches Leben, in der Sprache des Mythos formuliert, überlappen sich oft das Magische und das Mechanische. Selbst heute erkennen Wissenschafts- und Technologiehistoriker an, dass Roboter, Automat, Cyborg, Android, KI, Maschine und dergleichen im Grunde aalglatte Begriffe ohne festgelegte Definitionen sind. Auch ich benutze hier informelle, konventionelle Begriffe, doch für die nötige Klarheit gebe ich technische Definitionen im Text, in den Anmerkungen und im Glossar an.
Dieses Buch umreißt das große Kapitel von Formen künstlichen Lebens in der Mythologie. Dazu gehören auch Geschichten über die Suche nach einem langen Leben und Unsterblichkeit, Erzählungen über übermenschliche Kräfte, die von Göttern und Tieren entlehnt wurden, sowie über Automata und lebensähnliche Replikanten, die über die Möglichkeit zur selbstständigen Bewegung und einen Verstand verfügen. Der Fokus liegt auf der mediterranen Welt, aber ich habe auch einige Berichte aus dem antiken Indien und China mit aufgenommen. Und obwohl die Beispiele belebter Statuen, sich bewegender Geräte und Abbilder der Natur aus Mythen, Legenden und anderen antiken Berichten nicht direkt Maschinen, Roboter oder KI im modernen Sinne sind, glaube ich dennoch, dass die hier zusammengetragenen Geschichten „gut zum Denken“ sind, wie es Claude Lévi-Strauss in seiner Studie zum Ende des Totemismus formulierte. Sie zeichnen das Aufkeimen der Begriffe und Vorstellungen von künstlichem Leben nach, das den technologischen Gegebenheiten vorranging.
Wir sollten allerdings unsere heutigen Auffassungen von Mechanik und Technologie nicht auf die Antike projizieren, vor allem angesichts der fragmentarischen Natur der Quellenlage zur Antike. In diesem Buch wird nicht behauptet, es gäbe direkte Einflüsse von Mythos oder antiker Geschichte auf moderne Technologie, auch wenn ich auf Nachklänge in der modernen Wissenschaft hinweise. Hier und da erwähne ich aber ähnliche Themen in moderner Fiktion, in Film und Popkultur und ziehe Parallelen zur Wissenschaftsgeschichte. Damit möchte ich das natürliche Wissen und die Voraussicht aufzeigen, die das mythische Material enthält. Nebenbei haben diese uralten Geschichten – manche noch heute sehr bekannt, andere schon längst vergessen – Fragen nach dem freien Willen aufkommen lassen, nach Sklaverei, dem Ursprung des Bösen, den Grenzen des Menschen und auch danach, was es heißt, ein Mensch zu sein. Wie der böse Roboter Tik-Tok 1983 in John Sladeks gleichnamigem Science-Fiction-Roman anmerkte, führt schon die Idee eines Automatons in „tiefe philosophische Gewässer“, weil aus ihr Fragen folgen zu Existenz, Denken, Kreativität, Wahrnehmung und Wirklichkeit. Im reichen Fundus der Geschichten aus der antiken mythischen Vorstellungswelt können wir die frühesten Spuren des Bewusstwerdens darüber erkennen, dass es eine Flut an ethischen und praktischen Dilemmata auslösen kann, die Natur zu manipulieren und das Leben nachzubilden. Diese Spuren verfolge ich im Epilog weiter.
Ein Großteil des literarischen und künstlerischen Schatzes der Antike ist im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen; ein Großteil des erhaltenen Materials ist unvollständig und zudem vom ursprünglichen Kontext isoliert. Man kann nur schwer abschätzen, wie viel von der antiken Literatur und Kunst verloren gegangen ist. Die schriftlichen Zeugnisse, die noch existieren – Gedichte, Epen, Abhandlungen, Geschichten und andere Texte –, sind nur ein winziges Bruchstück im Vergleich zu dem Reichtum, den es einst gab. Tausende von Kunstwerken haben sich bis heute erhalten, doch ist auch das nur ein kleiner Prozentsatz der Millionen Objekte, die es einst gegeben hat. Einige Archäologen vermuten, dass wir nur noch etwa ein Prozent der jemals entstandenen griechischen Vasenmalerei besitzen. Und das Wenige an Literatur und Kunst, das blieb, wurde oft nur durch Zufall bewahrt.
Die Tatsache, dass vieles verloren und etliches nur zufällig bewahrt wurde, macht das, was wir tatsächlich haben, umso kostbarer. Das bestimmt auch den Ansatz und den Weg, diese Dinge zu finden und zu interpretieren. In einer Studie wie der vorliegenden können wir nur das analysieren, was sich über die Jahrhunderte erhalten hat, als würden wir in einem tiefen, dunklen Wald einer Spur aus Brotkrümeln folgen: Vögel haben die meisten Krümel längst gefressen. Und um eine weitere Analogie für das, was verschwunden ist und was überlebt hat, anzuführen: Verheerende Waldbrände haben Pfade der Zerstörung geschlagen, und sie werden angetrieben von Winden, die über Gras- und Baumlandschaften pfeifen. Was nach solch schrecklichen Feuersbrünsten bleibt, nennen die Förster einen „Mosaik-Effekt“: breite Streifen verbrannter Gebiete, durchsetzt von Flecken blumiger Wiesen und Dickicht mit immer noch grünen Bäumen. Auch die zufälligen Verwüstungen der Jahrhunderte innerhalb jener griechischen und römischen Literatur und Kunst, die sich auf künstliches Leben bezieht, haben einen Flickenteppich hinterlassen, dominiert von geschwärzten leeren Räumen, in den hier und da entscheidende Abschnitte und Bilder aus der Antike eingestreut sind. Ein solches Mosaik braucht einen Pfad zwischen den immergrünen Oasen, die zufällig über Hunderte von Jahren erhalten und gepflegt wurden. Wenn wir diesem Pfad folgen, können wir uns vielleicht die ursprüngliche kulturelle Landschaft vorstellen. Eine ähnliche Annäherung, die „Mosaik-Theorie“, nutzen auch Geheimdienstanalysten, wenn sie ein großes Bild zusammenzusetzen versuchen, indem sie kleine Informationsstücke zusammenführen. Für dieses Buch habe ich auf alle Texte und jedes Stückchen antiker Poesie und Mythen, Geschichte, Kunst und Philosophie zurückgegriffen, die ich finden konnte und die mit künstlichen Leben im Zusammenhang stehen. Und es finden sich genügend überzeugende Beweise, die den Schluss nahelegen, dass die Menschen der Antike von Geschichten über die künstliche Erschaffung von Leben und die Verstärkung natürlicher Kräfte fasziniert, ja sogar besessen waren.
Die Leser mögen also nicht erwarten, in diesen Kapiteln einen einfachen, geradlinigen Weg vorzufinden. Wie Theseus, der einem Faden folgte, um den Weg durch das von Daedalus entworfene Labyrinth zu finden, und wie Daedalus’ Ameise, die durch eine Schneckenmuschel auf dem Weg zu ihrer Belohnung in Form von Honig kroch, folgen wir dem mäandernden, vor- und zurückgehenden Pfad voller Geschichten und Bildern, um zu begreifen, wie die antiken Kulturen über künstliches Leben dachten. Es gibt einen narrativen Bogen quer durch die Kapitel, doch die Handlungsstränge sind vielschichtig und miteinander verflochten. Wir durchqueren das, was der Zukunftsforscher George Karkadakis, der sich mit der Künstlichen Intelligenz befasst, das „große Flussnetz mythischer Erzählungen mit all seinen Nebenflüssen, Zusammenflüssen und Rückflüssen“ nennt, auf dem Weg zu bekannten Gestalten und Geschichten. Und im Voranschreiten gewinnen wir neue Einsichten.
Nachdem wir dann unseren Weg durch den gewaltigen Erinnerungspalast der Mythen gebahnt haben, mag es einigen wie eine Erlösung vorkommen, dass sich das Schlusskapitel endlich der wirklichen, historischen Chronologie von Erfindern und technologischen Erfindungen der Antike widmet. Dieses Kapitel endet mit der Schilderung davon, wie sich selbstbewegende Geräte und Automata während des Hellenismus vom ägyptischen Alexandria her ausbreiteten, diesem ultimativen Ort der Phantasie und Erfindungen.
Insgesamt zeigen diese Geschichten, die mythischen wie die wahren, wie überraschend weit die Suche der Menschen nach einem Leben zurückreicht, das geschaffen, nicht geboren wurde. Dieser Suche wollen wir uns nun anschließen.