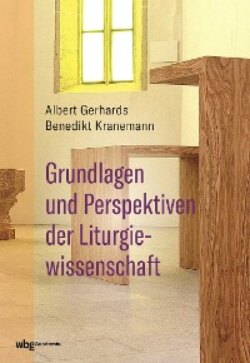Читать книгу Grundlagen und Perspektiven der Liturgiewissenschaft - Albert Gerhards - Страница 22
2.2.5.1 Methodenvielfalt in der Liturgiegeschichtsforschung
ОглавлениеFür die Liturgiegeschichtsforschung wurden um die Wende zum 20. Jahrhundert umfangreiche Forschungsprogramme ausgearbeitet, die eine systematische Erschließung der historischen Quellen vorsahen (Kranemann/210: 356–372). In ihnen präsentierte sich die Liturgiewissenschaft als eine philologisch-kritisch arbeitende Wissenschaft. Drei unterschiedliche methodische Ansätze versuchten, diesem Wissenschaftsverständnis zu genügen. Die historisch-genetische Methode, die komparative Liturgiegeschichtsforschung und ein stärker geistesgeschichtlich interessierter Frageansatz gelten auch heute noch als richtunggebend, sind allerdings kritisch weiterzuführen und um neue Quellen und Methoden zu ergänzen.
Die historisch-genetische Methode verbindet sich mit dem Namen von Josef Andreas Jungmann (1889–1975); sein bis heute maßgebliches Werk zur Geschichte der Eucharistiefeier »Missarum Sollemnia«, das den Untertitel »Eine genetische Erklärung der römischen Messe« trägt, ist von diesem Ansatz geprägt. Es geht der Frage nach: Wie haben sich die liturgischen Formen aus den Anfängen zu immer komplexeren Feiern hin entwickelt?
Im Vorwort zur Erstauflage seines Buches beschreibt Jungmann seine Arbeitstechnik, eine Zusammenschau der Quellen in historischer Abfolge, die es ermöglicht, die Entwicklung der Messe nachzuzeichnen, und die schließlich zu einem Gesamtbild führt:
»Besonders die mittelalterliche Entwicklung mußte neu aus den Quellen geschöpft werden. Denn sosehr im großen und ganzen eine gemeinsame Linie alle Erscheinungen verband, konnte doch ein genauerer Einblick in Ursprünge und Triebkräfte nur gewonnen werden durch möglichste territoriale Scheidung und zeitliche Aufreihung der überlieferten Texte, die im einzelnen ja immer wieder in starker Streuung ihrer Formen auseinandergingen. Was hier die Quellen boten, … mußte übersichtlich exzerpiert werden. So reihten sich bei verschiedenen Kapiteln immer wieder in Meterbreite die Parallelkolumnen aneinander, Dutzende und bis an die hundert schmaler Streifen, die dann, um die Feststellung von Gemeinsamkeiten und Grundformen zu ermöglichen, alsbald in allen Farben des Regenbogens schimmerten, bis sich wieder die Erkenntnis eines Stückes Entwicklung ergab« (Jungmann/340: I, VIf.).
Die Analyse der Strukturen liturgischer Formulare unter Berücksichtigung ihrer Entwicklung war das eigentliche Anliegen. Am Frageraster, das Jungmann für die Geschichte des Kyrie eleison abarbeitet, wird dies deutlich: Warum wiederholt man die Kyrie-Rufe, warum geschieht dies neun Mal? Woher kommt dieses Flehen, warum geschieht es in griechischer Sprache? Wer ruft eigentlich? (Jungmann/340: I, 430) Aus den Quellen zeigt Jungmann auf, wie dieser Huldigungs- und Bittruf seit der Frühzeit seine Gegenwartsgestalt und -bedeutung erhalten hat. Dabei bezieht er die verschiedenen Liturgiefamilien ein, weist auf die entscheidenden Umbrüche zur Zeit Gregors d. Gr. hin, erläutert den Prozess der musikalischen Entwicklung des Kyrie usw. Ein Kapitel über das Agnus Dei beginnt mit gegensätzlichen Beobachtungen zur gegenwärtigen Praxis und mündet in die Frage: »Welches ist der ursprüngliche Sinn des Agnus Dei?« (Jungmann/340: II, 413).
Jungmanns eigentliches Anliegen war nicht die Rekonstruktion von Geschichte, sondern die Offenlegung der Strukturen und des inneren Planes der Liturgie: »Wir wollen … mehr historisch-genetisch vorgehen, zusehen, wie liturgische Formen gewachsen sind und wachsen, von einfachen Anfängen zu immer reicherer Entfaltung« (Jungmann/198: 54).
Letztlich verfolgte Jungmann ein im weitesten Sinne pastorales Interesse. Sein Anliegen war eine Erneuerung der Glaubenspraxis, wofür die Kenntnis der Geschichte und damit der Fundamente der Liturgie unverzichtbar war. Man kann von einem historischen Ansatz mit liturgiepraktischen Konsequenzen sprechen (Jungmann/199).
Den liturgiegenetischen Ansatz Jungmanns griffen auch andere Autoren auf (u.a. Alois Stenzel und Bruno Kleinheyer); er prägt liturgiegeschichtliche Studien bis heute. Wenn auch manche Details und Einzelurteile seiner Studien zur Liturgiegeschichte mittlerweile zu revidieren sind, ist der überragende Beitrag Jungmanns zur Liturgiereform des 20. Jahrhunderts doch unübersehbar. Die historisch-genetische Methode stellte insofern eine Revolutionierung der Liturgiegeschichtsforschung dar, als sie die Varianten und Varietäten innerhalb der römischen Liturgietradition nachdrücklich vor Augen führte, dadurch einen reinen Geschichtspositivismus überstieg und die Liturgiehistorie – zunächst innerhalb der Liturgiewissenschaft, dann der Theologie, schließlich aller Geisteswissenschaften – diskursfähig hielt. Jungmann beschreibt die Liturgiegeschichte als ein prozesshaftes Geschehen, in dem Kontinuität und Wandel miteinander verbunden sind. Das eröffnete für Theologie und Kirche neue Handlungsoptionen, weil deutlich wurde, dass die jetzige Gestalt der Liturgie Ergebnis einer langen Geschichte, mithin veränderbar war und ist.
Allerdings liegen mittlerweile auch die Grenzen dieser Methode offen zutage. Sie konzentriert sich zu sehr auf Text- und Ereignisgeschichte. Wahrgenommen werden die Veränderungen in den schriftlichen liturgischen Quellen; die dahinterstehenden Mentalitäten, gesellschaftlichen und kirchlichen Voraussetzungen, die Rezeption des gottesdienstlichen Geschehens, seine Performanz u. Ä. hingegen befragt diese Methode kaum oder gar nicht.
Nachdrücklicher als Josef Andreas Jungmann hat Anton Baumstark (1872–1948) seinen wissenschaftlichen Ansatz als Methode formuliert: die vergleichende Liturgiegeschichtsforschung. Während sich Jungmann in der Regel auf eine Ritenfamilie konzentriert und – so ein Buchtitel – die »Gewordene Liturgie« erklären will, widmet sich Baumstark dem Prozess der Evolution von Liturgie in den unterschiedlichen Liturgiefamilien. Durch Strukturanalysen, philologische Untersuchungen und Vergleich der verschiedenen Ritenfamilien sollen die Entwicklungsstränge des Gottesdienstes offengelegt werden. Komparatistik und Zusammenschau, der Einbezug paganer Kulte und jüdischer Liturgie, die Berücksichtigung ethnisch-kultureller Kontexte prägen diesen Forschungsansatz. Baumstark und seine Schüler versuchten sogar Gesetzmäßigkeiten zu formulieren, die im Evolutionsprozess der Liturgie wirksam gewesen seien.
»In ihrer eigenen Schichtung bietet die heutige Erdkruste die Denkmäler der gewaltigen Umwälzungen dar, deren Ergebnis sie ist, und liefert an ihnen der geologischen Wissenschaft das Urkundenmaterial, das ihr die Archivalien diplomatischer Geschichtsforschung ersetzt. Ähnlich weist auch die Liturgie in ihrer heutigen wie in derjenigen Gestalt, die irgend ein älteres Liturgiedenkmal bezeugt, selbst die Spuren ihres Werdeprozesses auf. Auch diese Spuren gilt es sorgfältigst zu verfolgen und mit den äußern Quellenzeugnissen vergleichend zu verbinden. Zu prüfen gilt es sodann vor allem, ob nicht und wieweit an dem so bereicherten Beobachtungsstoffe eine innere Gesetzmäßigkeit auch liturgischer Entwicklung sich nachweisen läßt, vermöge deren diese mehr oder weniger in eine Linie mit sprachlicher und biologischer Entwicklung träte« (Baumstark/163: 4).
Baumstarks Werke sind historiographisch und philologisch bedeutend. Hervorzuheben sind neben »Liturgie comparee« (1939 [Baumstark/160]; 31953; engl. 1958 [Baumstark/159]) seine kleine Schrift »Vom geschichtlichen Werden der Liturgie« (1923 [Baumstark/163]), eine Monographie über das »Missale Romanum« (1929 [Baumstark/161]) und »Nocturna laus« (1957 [Baumstark/162]), eine Studie zur christlichen Vigilfeier. Diese Werke sind für die Liturgiegeschichtsforschung auch deshalb wichtig, weil sie intensiv das liturgische Leben der orientalischen Kirchen untersuchen. Nicht zuletzt haben sie das philologische Instrumentarium des Faches stark geprägt (Comparative Liturgy/294).
Baumstarks Methodik hat zu einer regelrechten Schulbildung geführt, wie beispielsweise Studien zu Hochgebeten von Hieronymus Engberding und Fritz Hamm zeigen.
Allerdings erfuhr Baumstarks Ansatz auch Kritik. Man wies auf die Gefahr hin, dass ein historischer Ansatz, der die Liturgiegeschichte als evolutionären Prozess zu sehr der Naturgeschichte gleichstelle, die besonderen Entwicklungsdeterminanten des kulturellen Systems der Liturgie übersehe (West/268). Historische Realität und gedankliche Konstruktion dürften gerade in der Geschichtsschreibung nicht verwechselt werden. Das gilt auch in Bezug auf die Anwendung der textkritischen Methode auf Textgattungen, die den Gesetzen liturgischer Überlieferung gehorchen (Budde/594: 50f.). Aus heutiger liturgiewissenschaftlicher Sicht ist kein wissenschaftlicher Ansatz mehr akzeptabel, der wie bei Baumstark die Liturgiegeschichte der Kirchen der Reformation unberücksichtigt lässt. Baumstark hat sie gar nicht wahrnehmen können, weil sie innerhalb seines Modells einer kontinuierlich wachsenden Liturgie keinen Platz haben, sondern einen Umbruch darstellen (Lurz/374). Die philosophischen Prämissen des von Baumstark vertretenen Ansatzes sind demnach kritisch zu reflektieren. Das stellt aber seinen vergleichenden Ansatz keineswegs grundsätzlich in Frage. Im Hinblick auf die notwendige ökumenische Fundierung der Liturgiewissenschaft ist die Liturgie comparee methodisch und hermeneutisch unverzichtbar.
Weiter führen Überlegungen, die Robert Taft (1932–2018) zur Methodologie der Liturgiewissenschaft und zur vergleichenden Liturgiewissenschaft vorgelegt hat. Er sieht Letztere vor allem mit der Aufgabe betraut, alle Entwicklungsmöglichkeiten der Liturgiegeschichte aufzudecken und unterstreicht dabei stark die ökumenische Bedeutung eines solchen Ansatzes, durch den man unter anderem die Kontroverstheologie der Vergangenheit überwinden könne (Taft/261: 248).
Anton Ludwig Mayer (1891–1982) geht in seinen Arbeiten von der These aus, jegliche Veränderung und Entwicklung der Liturgie habe unter dem Einfluss geistesgeschichtlicher Kräfte stattgefunden. Liturgie wird deshalb im geistesgeschichtlichen Zusammenhang untersucht. Anders als bei der komparatistischen oder der an der Liturgiegenese orientierten Methodik fragt Mayer nach Formation und Deformation der Liturgie im kulturellen Umfeld. In seinem zuerst 1955 erschienenen Aufsatz »Die geistesgeschichtliche Situation der Liturgischen Erneuerung in der Gegenwart« (in: Mayer/227: 388–438) wird sein Ansatz sichtbar:
»Läßt sich die Liturgische Erneuerung wie die Frömmigkeitshaltungen und Kultgesinnungen früherer Perioden des Abendlandes in einen großen geistesgeschichtlichen Komplex einfügen – als Symptom und Teilphänomen dieses Komplexes – und sich damit als ein überindividueller, motorischer oder kompensatorischer Kulturfaktor erweisen? Mit anderen Worten: Gibt es im Bereich der geistigen Kultur Erscheinungen, Entsprechungen und Parallelen, die uns zeigen und uns davon überzeugen können, daß die Liturgische Erneuerung gerade in dieser Zeit und in dieser kulturellen Umgebung aus ihrer lange währenden Vorgeschichte, aus ihrem esoterischen, monastischen und wissenschaftlichen Stadium in die Offenheit der Welt, in das Leben der Kirche und des einzelnen eintreten und dieses Leben mitbilden und miterfüllen konnte? Was geschah also in den Bezirken, die für uns eine geistige Kultur bestimmen, in der Kunst, in der Literatur, im wissenschaftlichen und weltanschaulichen Denken?« (Mayer/227: 389).
Die Themen, mit denen Mayer sich in seinen Veröffentlichungen beschäftigte, verdeutlichen sein wissenschaftliches Programm: »Renaissance, Humanismus und Liturgie«, »Die geistesgeschichtliche Situation der liturgischen Erneuerung in der Gegenwart«, »Der Wandel des Kirchenbildes in der abendländischen Kulturgeschichte« (Eine Aufsatzsammlung bietet Mayer/227). Kunst und Literatur etwa werden zu Quellen, um den Wandel der Liturgie im Rahmen der abendländischen Kulturgeschichte erfassen und deuten zu können. Dieser Zugang zur Liturgiegeschichte vernetzt die Liturgiewissenschaft mit anderen Geisteswissenschaften, wurde aber leider nicht weitergeführt. Viele Ergebnisse und Positionen Mayers, insbesondere seine Beschreibung verschiedener historischer Epochen müssen aufgrund der nachfolgenden Forschung als überholt gelten (dazu Angenendt/156: 64f., 171), doch bleibt der Anspruch auf ein geistes- (und kultur-)wissenschaftliches Profil der Liturgiewissenschaft bestehen.
Kulturgeschichte und Volkskunde hat auch Peter Browe (1876–1949) in seine Forschungen zur Frömmigkeits- und Liturgiegeschichte einbezogen. Er leistete damit Beiträge gleichermaßen für die Theologie wie für kulturwissenschaftliche Forschung. Ihn interessierte beispielsweise nicht allein die Entwicklung der Dogmengeschichte zur Eucharistie, sondern insbesondere die Relevanz, die diese für das Leben von Menschen hatte. Er befasste sich u.a. für das Mittelalter mit der Kommunion von Laien, der Eucharistie als Zaubermittel, eucharistischen Prozessionen, der Verbreitung des Fronleichnamsfestes (Browe/289).