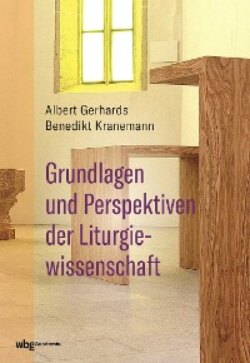Читать книгу Grundlagen und Perspektiven der Liturgiewissenschaft - Albert Gerhards - Страница 30
Praktisch-theologische Liturgiewissenschaft
ОглавлениеDas Fach Liturgiewissenschaft ist heute vorwiegend in der Praktischen Theologie angesiedelt. Daraus ergibt sich eine besondere Aufgabenstellung: Liturgiewissenschaft reflektiert den christlichen Glauben in Hinblick auf den kirchlichen Grundvollzug Liturgie (Odenthal/237). Wie schon im Falle der Pastoralliturgik geht es dabei also nicht um Praxisgestaltung, sondern um die Entwicklung einer Kriteriologie, die der Praxisbegleitung dienen kann. Die anthropologisch gewendete Theologie, die sich mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil zum prägenden theologischen Paradigma entwickelt hat, versucht, die Offenbarung Gottes vom Menschen her zu verstehen. Mit der Anthropologie hat innerhalb der Theologie die Beachtung der Humanwissenschaften zugenommen. Auch die Liturgiewissenschaft fragt stärker als zuvor nach dem Menschen, der in der Liturgiefeier vor Gott tritt. Liturgie wird als Kommunikation zwischen Gott und den Menschen sowie zwischen den versammelten Menschen verstanden, wobei humanwissenschaftliche Kommunikationsmodelle aus theologischen Gründen nur in einem analogen Sinne aussagekräftig sind. Der Mensch und seine Teilnahme an der Liturgie werden sogar als Paradigma der Liturgiereform bezeichnet (Häußling/190: 41–43). Damit hat zugleich ein intensiver Dialog mit verschiedenen Kultur- und Humanwissenschaften eingesetzt, so in der Vergangenheit mit der Soziologie, der Linguistik und der Psychologie. Die menschliche Erfahrung wird als Dimension des Gottesdienstes entdeckt und mithilfe unterschiedlicher wissenschaftlicher Erkenntnisse reflektiert. Gefragt wird nach den Bedingungen menschlichen Feierns, religiösen Sprechens, menschlicher Versammlung, nach der Theorie der Zeichen usw. Allgemeiner kann man sagen, dass im interdisziplinären Dialog Kriterien zur Untersuchung der Liturgiefähigkeit des Menschen sowie zu Möglichkeiten und Voraussetzungen einer Liturgie, die Gebetsordnung der Gegenwart sein soll, formuliert werden. Erkenntnisse für den Gottesdienst können gewonnen werden, die mit historischen oder theologischen Fragestellungen allein nicht zu erbringen wären. Diese Heuristik ist aber nur dann als im engeren Sinne liturgiewissenschaftlich zu bezeichnen, wenn sie das liturgietheologische Grundgeschehen berücksichtigt, da nur so das Spezifikum der Liturgie, zuerst Geschehen von Gott her zu sein, zur Geltung gebracht werden kann.
Die praktisch-theologische Liturgiewissenschaft konnte in der jüngeren Vergangenheit unter anderem die Relevanz von Symbolik und Zeichenhaftigkeit für die Liturgie neu aufweisen, Kriterien für die Gestaltung liturgischer Räume und ihren Erhalt in der multireligiösen bzw. religiös indifferenten Gesellschaft der Gegenwart erarbeiten und Modelle für die Inkulturation der Liturgie vorlegen. Hierbei flossen Erkenntnisse der Human- und Kulturwissenschaften ins Gespräch mit der Liturgietheologie ein.
Die heutige Aufgabenstellung der praktisch-theologischen Liturgiewissenschaft besteht darin, den fortwährenden Inkulturationsprozess der Liturgie zu analysieren, vor dem Hintergrund von Liturgiegeschichte und -theologie zu reflektieren und seine Umsetzung in der Gegenwart wissenschaftlich zu begleiten. Die Aufgabe besteht demnach in der Reflexion der aktuellen gottesdienstlichen Vollzüge und in der Erarbeitung von Kriteriologien für die Gestaltgebung und Revision der Liturgie und liturgienaher Feiern und Rituale. Man untersucht Kommunikationsebenen, Handlungskompetenzen, die Ästhetik der Liturgie, das Verhältnis von Kultur und Liturgie und die Rolle der Liturgie im kirchlichen Leben. Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bediente man sich verstärkt sozial- und humanwissenschaftlicher Ansätze und Instrumentarien, um die theologische und die anthropologische Dimension des Handlungsfeldes Gottesdienst angemessen reflektieren zu können. Man nutzt auch die Empirik, um zu Aussagen über die feiernde Gemeinde, ihr Verhalten und ihre Erwartungen zu gelangen (Meffert/228; Rentsch/245). Um Sprachgestalten und Sprachprozesse in der Liturgie analysieren zu können, greift man auf Methoden der Linguistik zurück (Merz/229) und erschließt mit den Mitteln der Semiotik die nonverbale Kommunikation (Bieritz/31). Unter Einbezug psychoanalytischer Überlegungen untersucht man das Symbolgeschehen des Gottesdienstes und fragt nach Konvergenzen von Gottesdienst und menschlicher Lebenswirklichkeit (Odenthal/138 u. 139). Der Methodenpluralismus korrespondiert mit dem der Praktischen Theologie. Er hängt mit dem Anspruch zusammen, als wesentliche Dimension gottesdienstlicher Feiern menschliche Erfahrungen zu untersuchen. Das Ziel besteht darin, überlieferte, also vorgängige Erfahrungen (Tradition) und empirisch fassbare und beschreibbare Erfahrungen der Gegenwart (Situation) zum Zweck innovativer Gestaltung auf neue Erfahrungen hin zu reflektieren (Gärtner – Merz/176).
Das Problem, vor dem die praktisch-theologische Liturgiewissenschaft bei ihrem Rückgriff auf nichttheologische Methoden und Ansätze steht, ist deren Verhältnis zur Theologie. Verschiedene Verhältnisbestimmungen sind möglich: Die nichttheologischen Wissenschaften werden der Theologie untergeordnet (»Ancilla«-Paradigma) oder als ganzes Theoriegebäude durch die Theologie rezipiert (»Fremdprophetie«-Paradigma). Alternativ versucht man mit dem Paradigma der »konvergierenden Optionen«, das auf Gleichberechtigung, Dialogfähigkeit und Annäherung zwischen Theologie und Humanwissenschaften zielt, durch Integration verschiedener Wissenschaften Interdisziplinarität zu ermöglichen. So könne die Liturgiewissenschaft als Teil der Praktischen Theologie der Liturgie als symbolischer Vermittlung von Offenbarung Gottes und menschlicher Erfahrung wissenschaftlich gerecht werden (Gerhards – Odenthal/181). Demgegenüber wurde eine vorgängige Klärung des theologischen Propriums der Liturgiewissenschaft eingefordert, die als solche für die Interdisziplinarität mit den Humanwissenschaften konstitutiv sei. Als Glaubenswissenschaft reflektiert das Fach die Liturgie als Glaubensvollzug, der sich auf die Selbstoffenbarung Gottes in Christus bezieht. Der damit verbundene Wahrheitsanspruch müsse auch in der Interdisziplinarität zum Tragen kommen (Stuflesser – Winter/260). Das widerspricht dem Prinzip der konvergierenden Optionen aber nicht, da sich diese auf die Wahrnehmung und Beschreibung symbolischer Vermittlung beziehen (Odenthal/138).