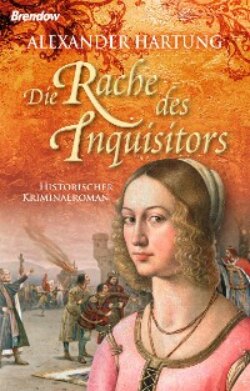Читать книгу Die Rache des Inquisitors - Alexander Hartung - Страница 7
1
Dunkle Zeiten
ОглавлениеIch grüße Euch, holde Schönheit«, sagte Peter und machte eine tiefe Verbeugung. Dabei schwenkte er elegant den Hut, bevor er für einen Moment in ehrfürchtiger Haltung verharrte. »Wohin des Weges?«, fragte er grinsend und setzte seine Kopfbedeckung wieder auf.
»Es hätte so ein schöner Tag werden können«, erwiderte Klara und ließ den jungen Mann stehen. »Nicht einmal auf den Wegen ist man vor Sittenstrolchen wie dir sicher.«
»Ihr tut mir unrecht«, antwortete Peter mit einem verletzten Gesichtsausdruck. »Wie könnt Ihr mich so schmähen?«, fuhr er fort. »Ich, der auf nichts anderes als die Bewahrung Eurer Reinheit bedacht ist.«
Klara blieb einen Moment stehen und blickte Peter ungehalten an. »Du meinst dieselbe Reinheit, die du Maria Kolrater bewahrt hast.«
»Das war etwas anderes«, sagte Peter abwehrend. »Die junge Maria hat mich in einem schwachen Moment verführt. Bevor ich wieder Herr meiner Sinne wurde, war es schon geschehen.«
»Du hast mein volles Mitleid.«
»Das habe ich auch verdient. Marias Vater hätte mich beinahe totgeschlagen.«
»Marias Vater ist altersschwach und kann kaum noch laufen, seit er sich beim Holzen das Bein gebrochen hat«, antwortete Klara ungnädig.
»Ja, aber wenn er mich erwischt hätte, dann hätte er mich sicher dennoch verprügelt«, verteidigte sich Peter.
»Das hätte dir nicht geschadet«, murmelte die junge Frau leise und ging weiter. Peter lief einen Schritt neben ihr.
»Hast du nichts Besseres zu tun, als mir nachzustellen?«
»Nein«, antwortete Peter nach kurzem Zögern. »Ich sah dich allein durch den Wald laufen und dachte, du könntest gewiss einen Beschützer gebrauchen.«
»Ja, ein starker Beschützer wäre wirklich gut«, sagte Klara. Wie immer entging Peter die Ironie hinter ihren Worten. Ermutigt von dieser scheinbaren Aufforderung richtete er sich ein wenig mehr auf, straffte die Schultern und suchte den Waldrand mit wachsamen Augen ab.
Klara musste lächeln. Sie und Peter kannten sich schon seit der Kindheit. Sie konnte sich stundenlang über seine schlechten Eigenschaften und seine Faulheit aufregen. Es gab keinen Tag, an dem sie sich nicht über sein Verhalten ärgerte, trotzdem fühlte sie sich in seiner Nähe wohl. Er brachte sie zum Lachen, und in Reheim gab es ansonsten zu wenig, was sie in fröhliche Stimmung versetzte.
Peter blickte weiter angestrengt in den Wald hinein, fast als erwartete er jeden Augenblick eine Räuberbande, die schreiend aus dem Wald gerannt kam.
Wie immer war sein braunes Haar viel zu lang. Seine Kleidung war ein buntes Sammelsurium, und sein alter Hut hatte wahrscheinlich schon den Kopf seines Großvaters geziert. Peter war ein Taugenichts, der den ganzen Tag nur durch die Gegend streifte und Unsinn ausheckte.
Manchmal fragte sich Klara, ob Peters Vater auch wirklich sein leiblicher Vater war. Friedrich Birsch war Stadtrat in Reheim. Er war höflich, gebildet und verantwortungsvoll. Seine Klugheit wurde von vielen geschätzt, und sein Urteil wurde geachtet. Vielleicht war er etwas zu ernsthaft, aber er kümmerte sich stets um die Probleme der Bürger.
Die Birschs waren wohlhabend, obwohl sie weder Felder noch Viehherden besaßen. Peter hatte nie viel über ihren Reichtum erzählt. Immer wenn sie mit diesem Thema begonnen hatte, hatte er nur zögerlich geantwortet. Anscheinend war Peters Großvater ein wichtiger Händler in Mainz, der es dort zu großem Wohlstand gebracht hatte. Selbst König Maximilian sollte schon seine Dienste in Anspruch genommen haben. Ein Streit hatte dazu geführt, dass Friedrich Mainz verlassen hatte und in dieses kleine Dorf im Taunus gezogen war. Dies war noch vor Peters Geburt geschehen, daher kannte er seinen Großvater nicht. Auch den Grund für diesen Streit hatte er nie erfahren. Peters Vater redete nicht darüber.
Das Geld, das Friedrich aus Mainz mitgenommen hatte, hatte aber ausgereicht, um ein kleines Landhaus zu bauen und einen unmanierlichen Sohn zu versorgen, der sich beharrlich weigerte, einer anständigen Arbeit nachzugehen.
»Gehst du zur alten Kräuterhexe?«, fragte Peter beiläufig.
»Du sollst sie nicht Hexe nennen«, fuhr Klara ihn an. »Ihr Name ist Agnes, und ihr Wissen über Kräuter hat auch dir schon geholfen, als du vom großen Felsen gestürzt bist und dir den Kopf aufgeschlagen hattest.«
Peter verzog in gespielten Schmerzen das Gesicht.
»Keine schöne Erinnerung«, sagte er. »Aber da war ich sieben Jahre alt. Das ist wirklich schon lange her.«
»Trotzdem verdient sie es nicht, Hexe genannt zu werden.«
Peter brummelte etwas Unverständliches und blickte missmutig zu Boden.
Eine Weile liefen sie schweigend nebeneinander her, bis die Hütte von Agnes auf einer kleinen Anhöhe sichtbar wurde. Die Unterkunft war in den Wald gebaut, und hätte der Rauch des Kamins sie nicht verraten, hätte man sie leicht übersehen können. Vor der Hütte befand sich ein kleiner Garten mit Gemüse und Kräutern, in dem eine ältere Frau mit einem Korb und einem Messer auf dem Boden kniete und kleine Zweige eines Strauches abschnitt.
Klaras Gesicht hellte sich sofort auf, und ihre Schritte beschleunigten sich.
»Warum besuchst du Agnes so oft?«, fragte Peter.
»Weil es bei ihr so viel zu lernen gibt.«
»Wie man Gemüse anpflanzt?«
»Sie lehrt mich die Heilkraft der Pflanzen«, antwortete Klara.
Bevor Peter weitersprechen konnte, sprang Klara auf einen kleinen Felsen und lief dann die letzten Meter zur Hütte. Peter musste sich anstrengen, um ihr zu folgen, und kam wenige Schritte hinter ihr beim Gatter des Gartens an. Klara rannte zu der alten Frau und umarmte sie überschwänglich.
Das ernste Gesicht der Frau hellte sich für einen Moment auf. Agnes löste sich von Klara und blickte sie lächelnd an. Dann schob sie eine Strähne ihres weißen Haares zur Seite und wandte sich ihrem zweiten Besucher zu.
»Hallo Peter. Was bietest du mir heute an, damit ich dir einen Liebestrank für Anna Bernheimer braue?«, fragte Agnes unschuldig.
Klara drehte sich ruckartig zu Peter herum und funkelte ihn böse an. Peter lächelte verlegen und machte einen Schritt vom Gatter weg.
»Ich habe heute noch wirklich viel zu tun, daher muss ich euch leider allein lassen.«
Bevor Klara etwas erwidern konnte, war er schon in Richtung Dorf losgelaufen. Seine Schritte waren so schnell, dass er seinen Hut festhalten musste.
»Was für ein Heuchler«, sagte Klara erbost. »Man hat ihn wohl noch nicht oft genug verprügelt.«
»Er ist ein guter Junge, Klara«, antwortete Agnes mit ruhiger Stimme, nahm den Korb auf und ging zur Hütte.
»Er ist ein Weiberheld, ein Nichtsnutz und ein Tagträumer. Den ganzen Tag stellt er den Röcken im Dorf nach und ärgert andere mit seinen dummen Streichen.«
»Er hat ein ehrliches Herz, und er mag dich, Klara.«
»Er mag jede junge Frau.«
»Bei dir ist es etwas Besonderes.«
»Das kann nicht dein Ernst sein«, antwortete Klara erstaunt.
»Warum nicht?«
»Weil er Spaß daran hat, mich zu ärgern. Wäre er nicht längst aus dem Alter heraus, würde er mir wohl wie früher einen großen Frosch in mein Bett legen und andere Streiche spielen.«
»Ich sagte doch, er mag dich«, sagte Agnes, öffnete die Tür und ging lächelnd hinein.
Klara blieb verwundert stehen und versuchte, die Worte der alten Frau zu verstehen. Nach einem Moment des Überlegens gab sie es auf und folgte Agnes in die Hütte.
Peter drehte sich um. Er wollte sicher sein, dass Klara ihn nicht mehr beobachtete. Warum musste die alte Kräuterhexe ihn immer wieder vor Klara bloßstellen? Anna Bernheimer war ein hartnäckiger Fall. Sie hatte bisher alle seine Annäherungsversuche zurückgewiesen. Erst hatte er es mit Schmeicheleien und Liebesschwüren versucht. Oft genügte das, um das Herz einer Frau weich werden zu lassen. Dann hatte er Blumen gepflückt und ihr eine Kette gekauft. Die Blumen hatte er am nächsten Morgen auf dem Misthaufen gefunden. Wo die Kette abgeblieben war, wollte er sich nicht ausmalen.
Im Dorf sagte man sich, dass die alte Kräuterfrau über besondere, beinahe magische Fertigkeiten verfügte. Ihre Tränke konnten Schmerz lindern, Wunden verheilen lassen und Fieber senken. Was war also schon groß dabei, wenn er einen Trank wollte, der das harte Herz von Anna Bernheimer erweichen würde?
Verdrossen trat Peter einen Stein von dem festgetretenen Weg hinunter, als er lautes Pferdegetrappel vernahm. Gewandt sprang er von der Straße, nahm seinen Hut ab und verbarg sich unter einem kleinen Gebüsch. Diese Gewohnheit hatte er schon von Kindesbeinen an. Oft hatten ihn seine schnellen Reaktionen und ein gutes Versteck vor dem Zorn eines wütenden Vaters oder einer enttäuschten Magd geschützt. Außerdem bereitete es ihm Vergnügen, die Leute heimlich zu belauschen.
Die Geräusche wurden lauter, und Peter entdeckte einen Trupp von acht Soldaten, die den Weg zum Dorf entlanggaloppierten. Sie eskortierten eine Kutsche, die ein schwarzweiß geständertes Lilienkreuz auf einem ebenso geständerten Schild an der Seite trug.
Peter begann zu zittern. Er versuchte, sich zur Ruhe zu zwingen, doch die Gedanken in seinem Kopf rasten.
Die Kutsche barg einen Inquisitor. Er hatte schon Schreckensgeschichten von diesen Geistlichen gehört, doch diese waren ihm stets weit entfernt und unwirklich vorgekommen. Tagelange Folter, demütigende Prozesse und ganze Familien, die auf dem Scheiterhaufen den Tod fanden, davon sprach man hinter vorgehaltener Hand. Jetzt war der Schrecken aus den Geschichten zu ihnen gekommen. Peters Zittern verstärkte sich. Das Gebüsch raschelte leise. Er schloss die Augen und krümmte sich zusammen, in der Hoffnung, dass der Reitertross an ihm vorbeiziehen würde. Die Augenblicke schienen sich zu Stunden zu dehnen, bis die Geräusche endlich verstummt waren. Peter öffnete die Augen. Die Reiter waren fort. Die Kutsche hatte eine tiefe Furche im Boden hinterlassen.
Die Starre fiel von ihm ab, und er begann zu laufen. Er kannte eine Abkürzung nach Reheim und hoffte, dass er noch vor den Männern das Dorf erreichen würde. Er musste die Bürger warnen, dass die Inquisitoren auf dem Weg waren. Der Pfad war steil, aber Peter rannte, als hinge sein Leben davon ab. Schon bald kam sein Atem keuchend, und Schweiß bildete sich auf seiner Stirn.
Bestimmt wollten die Männer nur Rast in Reheim machen, versuchte er sich einzureden. Sie waren auf der Durchreise und suchten in einem anderen Dorf nach Ketzern.
Peter war auf der Hügelkuppe angekommen, aber er gönnte sich keinen Moment des Verschnaufens. Der Weg nach unten war steil und führte ihn durch dichtes Unterholz. Dornen rissen an seinen Hosen, und Wurzeln ließen ihn stolpern, doch die Angst trieb ihn weiter.
Mit einem Satz über einen kleinen Bach erreichte er die Dorfstraße und rannte zum Marktplatz. Er hörte kein Hufgetrappel, und für einen Augenblick glaubte er, dass er die Männer überholt hatte. Doch als er den Platz betrat, erblickte er die dunkle Kutsche, die dort wie ein Vorbote des Schreckens stand.
Mit einer vorsichtigen Kreisbewegung fuhr Agnes der kleinen Ziege über den Bauch.
»Es ist wichtig, dass du die entsprechende Stelle sanft reibst«, sagte Agnes und schmierte sich etwas von der gelblichen Paste auf die Finger. »Die Salbe entfaltet ihre Wirkung, wenn sie warm ist. Achte darauf, dass die Masse nicht zu dünn wird. Sie sollte zäh und fest sein.«
Klara beobachtete jede Bewegung von Agnes. Die Ziege stand ruhig in der Hütte und ließ die Behandlung ohne Angst über sich ergehen. In den letzten Tagen hatte das Tier kaum noch etwas gefressen, daher vermutete Agnes, dass die Ziege Probleme mit ihrer Verdauung haben musste. Die Kamille würde die Schmerzen lindern.
»Heute Morgen habe ich ihr noch etwas gelben Enzian in das Wasser gemischt. Das müsste ihren Appetit anregen. Wenn die Schmerzen weg sind, wird sie bald wieder ganz die Alte sein.«
Agnes lächelte bei ihren Worten und strich der Ziege sanft über den Kopf.
Klara beobachtete die Alte gebannt. Zwischen Agnes und den Tieren schien ein unsichtbares Band zu bestehen. Es dauerte nie lange, bis sie wusste, warum eine Kuh keine Milch mehr gab, die Hühner keine Eier mehr legten oder die Schweine nicht mehr fressen wollten. Ähnlich leicht fiel es ihr, die Krankheiten von Menschen zu erkennen, doch diese Arbeit verrichtete sie weniger gern. Wurde sie zu einem Dorfbewohner gerufen, verschaffte sie sich meist nur einen kurzen Eindruck von dem Kranken. Oft händigte sie ihm ein paar ihrer Kräuter aus und verließ die Behausung wieder, so schnell sie konnte. In den meisten Fällen wirkten ihre Tinkturen und Salben, doch manchmal konnte auch sie nicht mehr helfen. Dann ging sie mit den Angehörigen des Kranken hinaus und sagte: »Holt Vater Liborius.«
Klara hatte Agnes einmal darauf angesprochen, warum sie allein lebte, abseits des Dorfes, nie verheiratet gewesen war und jedem Dorffest fernblieb. Die alte Frau hatte mürrisch auf diese Frage reagiert. Für einen winzigen Moment war in ihren Augen Bedauern aufgeblitzt, und ihr Gesicht hatte großen Schmerz gezeigt. Agnes schien in ihrem langen Leben schon harte Zeiten überstanden zu haben.
»Hörst du mir überhaupt zu?«, fragte die Alte nun und riss Klara damit aus ihren Gedanken.
»Entschuldigung«, murmelte sie und richtete sich auf ihrem Stuhl auf.
»Reibe die Paste weiter ein, bis sie ganz eingezogen ist«, fuhr Agnes fort. »Ich füttere solange meine Hühner und versuche, die schadhafte Stelle im Zaun auszubessern, die mir der Besuch eines Keilers eingebracht hat.«
Klara stand auf und nahm die Schüssel mit der gekochten Kamille entgegen. Sie lächelte, als sie das aufgeregte Gackern der Hühner aus dem Stall hörte.
Friedrich Birsch war auf dem Weg zum Rathaus, als die Kutsche der Inquisitoren in die Straße zum Marktplatz einbog. Das Klappern der Räder hallte laut durch die Gassen und ließ jeden Bürger in seiner Arbeit innehalten. Für einen Augenblick sah er dem großen Tross fasziniert nach. Dann riss er sich von dem Anblick los und lief der Kutsche, so schnell es sich gerade noch geziemte, hinterher. Am Marktplatz angekommen, hielt das große Gefährt an.
Ein Soldat saß von seinem Pferd ab und öffnete die Tür. Ein junger Mann stieg aus. Sein Gesicht war rosig und sein braunes Haar kurz geschoren. Er trug ein helles Habit, das mit einer dunklen Kordel geschnürt war. Der Priester wandte sich der offenen Tür zu und half einem älteren Mann hinaus, dessen Gesicht von einem langen Leben gezeichnet war. Sein Körper war hager, und nur noch wenige graue Haare zierten seinen Hinterkopf. Über seine helle Tunika hatte er einen schwarzen Überwurf gelegt, der ihm fast bis zu den Füßen reichte. Er streckte seine Hände nach vorne und ließ sich von dem Soldaten und dem jungen Priester aus der Kutsche helfen. Dann blieb der Alte stehen und hob seinen Kopf, fast als wollte er die Witterung des Dorfes aufnehmen.
Friedrich drängte sich durch die Zuschauer, die unsicher in der Nähe standen. Er stellte sich vor den älteren Geistlichen und verneigte sich, während er mit nervösen Fingern die Strähnen seines grauweißen Haares über die hohe Stirn kämmte.
»Willkommen in Reheim, Eminenz. Mein Name ist Friedrich Birsch, und ich gehöre zum Stadtrat. Wie kann ich Euch helfen?«
»Gottes Segen, Herr Birsch«, grüßte ihn der jüngere Inquisitor. »Mein Name ist Pater Thomas. Ich bin der Gehilfe von Prior Baselius vom Kloster St. Bonifaz. Wir haben eine lange Reise hinter uns und benötigen ein Mahl ebenso wie eine Unterkunft.«
»Sehr wohl«, entgegnete Friedrich und wandte sich dem jungen Priester zu. »Bitte geht in unser Wirtshaus auf der anderen Seite des Marktplatzes. Dort werden wir uns um alles kümmern.«
Der Geistliche verneigte sich höflich und wollte schon weitergehen, als Friedrich erneut das Wort erhob.
»Wie lange gedenkt Ihr zu bleiben?«
»Solange es notwendig ist.«
»Ich verstehe nicht«, antwortete Friedrich unsicher.
»Es wurden Anschuldigungen gegen Bürger dieses Dorfes erhoben«, erklärte der Priester scheinbar ungerührt. »Wir sind hier, um deren Wahrheitsgehalt zu überprüfen.«
»Es muss sich um einen Irrtum handeln. Wer hat diese Anschuldigungen geäußert?«
»Dazu kann ich nichts sagen.«
»Wir sind ein ehrbares und gottesfürchtiges Dorf. Wir haben uns keiner Ketzerei schuldig gemacht.«
»Das haben wir schon oft gehört.«
»Ich verbürge mich mit meinem Leben für die Einwohner von Reheim.«
»Das werdet Ihr in der Tat«, sagte daraufhin der ältere Mann. Der Prior erhob zum ersten Mal die Stimme und richtete seine trüben, grauen Augen auf den Stadtrat. »Schickt sofort Euren Pfarrer zu mir«, sprach er weiter. »Wenn wir Eure Hilfe brauchen, rufen wir nach Euch. Ansonsten möchten wir nicht weiter gestört werden.«
Friedrich verneigte sich ein wenig unsicher und ging in Richtung Kirche davon.
Thomas führte Baselius zum Wirtshaus. Anscheinend war Markttag, denn der kleine Platz war voller Stände. Er erblickte Fleisch, Wurst, Käse, eine Auslage mit Töpfen und einen Messerschleifer. Die Händler trugen alte Schürzen und zerschlissene Hosen. Wären sie nicht in das Habit der Dominikaner gekleidet gewesen, hätten die Männer und Frauen lautstark ihre Waren angepriesen, aber angesichts der Kirchenmänner waren ihre Gespräche verstummt. Alle Augen waren unsicher auf die beiden Inquisitoren gerichtet. Thomas ging unbeirrt weiter und richtete seine Aufmerksamkeit auf das Wirtshaus. Ein verwittertes Schild mit einem Krug hing über der Tür. Es roch nach verbranntem Fett und altem Bier. Der Boden war mit Sägespänen ausgelegt, und der Rauch eines großen Kaminfeuers machte den Raum stickig.
»Das Gebäude sieht nicht aus, als würde es über geräumige oder auch nur saubere Zimmer verfügen«, flüsterte der junge Priester Baselius zu. »Seid ihr sicher, dass ihr hier absteigen möchtet?«
»Es wird meinen Ansprüchen genügen«, antwortete der ältere Mann und tätschelte die Hand von Thomas.
Sie hatten den Marktplatz noch nicht ganz überquert, als ein dicker, älterer Mann mit einer schmutzigen Schürze aus dem Wirtshaus gelaufen kam. Seine Haare standen in fettigen Strähnen ab, und er trug einen ungepflegten Vollbart. Er hielt die Tür auf und verbeugte sich unterwürfig.
»Willkommen im Schäumenden Krug, meine Herren, willkommen!«, sagte er und deutete in den Schankraum. »Darf ich Euch etwas zu essen reichen?«
»Etwas Fleisch und Gemüse«, antwortete Thomas, ohne den Wirt eines Grußes zu würdigen. »Richtet bitte ein Zimmer für mich und den Prior her, und sorgt dafür, dass unsere Männer gut untergebracht sind. Über alles Weitere werden wir Euch unterrichten, wenn wir die Zeit für gekommen erachten.«
Der Wirt verneigte sich wieder und ging in die Küche. Thomas führte den älteren Inquisitor zu einem Tisch in der Mitte und brachte ihm einen Stuhl. Dann setzte auch er sich und wartete auf das Essen.
Der Wirt lief durch die Gaststube, so schnell es seine kurzen Beine erlaubten. Er herrschte eine ältere Frau an, sich mit dem Schneiden des Fleischs zu beeilen, während er einen Krug mit Wein abfüllte. Eilig polierte er noch zwei Tonbecher, bevor er diese zum Tisch trug und vor den beiden Inquisitoren abstellte.
»Keinen Wein, Rainald«, sagte Thomas ungehalten und scheuchte den Mann mit einer schroffen Handbewegung weg. »Wir wollen nur etwas essen.«
Der Wirt zog sich, eine Entschuldigung stammelnd, zurück. Dann hastete er in die Küche und half der Frau mit dem Essen.
Baselius richtete seine Augen auf den jungen Pater. »Wart Ihr schon einmal in Reheim?«, fragte er interessiert.
»Nein«, antwortete Thomas. »Wie kommt Ihr darauf?«
»Ihr habt den Wirt mit seinem Namen angesprochen.«
»Ich habe ihn aufgeschnappt, als wir hereingekommen sind«, antwortete Thomas.
Baselius wollte darauf etwas erwidern, aber die Frau kam zum Tisch geeilt und stellte zwei große Teller mit Fleisch und einem großen Stück warmen Brotes ab. Als der Wirt noch eine Schüssel mit Gemüse brachte, unterbrachen die beiden Inquisitoren ihre Unterhaltung endgültig und begannen zu essen.
Friedrich spürte noch immer die Angst, die ihn nach dem Gespräch mit den Dominikanern erfasst hatte. Eilig ging er die Straße zur Kirche entlang. Er brauchte den Rat von Vater Liborius. Der Pfarrer war schon viele Jahre sein geistlicher Beistand und ihm immer ein guter Freund gewesen.
An der Kirche angekommen, hätte Friedrich vor Freude beinahe gejubelt, als er Vater Liborius auf dem kleinen Vorplatz erblickte. Er hatte eine alte braune Kutte übergezogen und fegte die Treppen vor dem Eingang. Als er Friedrich gewahr wurde, hielt er in seiner Arbeit inne und blickte den Stadtrat lächelnd an.
»Vater Liborius«, sagte Friedrich außer Atem.
»Was ist los?«, fragte Liborius besorgt. Sein Lächeln war einem ernsten Ausdruck gewichen. »Warum seid Ihr so in Eile?«
»Die Inquisition ist in Reheim«, antwortete Friedrich, »und die Männer wollen Euch sofort sehen.«
Vater Liborius hielt die Luft an. In seinem sonst so sanften und sicheren Blick zeigte sich Überraschung.
»Habt Ihr eine Ahnung, was die Männer hier wollen?«, hakte Friedrich nach.
»Nein«, sagte Liborius abwehrend. »Ich habe damit nichts zu tun«, stammelte er weiter. »Ich bin ebenso verwundert wie Ihr.«
Für einen Moment hingen beide Männer schweigend ihren Gedanken nach.
»Wir sollten die Inquisitoren nicht warten lassen«, drängte Friedrich. »Vielleicht erfahrt Ihr mehr über den Grund ihrer Anwesenheit.«
»Wartet einen Moment«, sagte Liborius und ließ den Besen fallen. »Ich ziehe eine andere Kutte an. Dann können wir gehen.«
Friedrich kam wieder zu Atem. Es hatte keinen Sinn, sich über die Anwesenheit der Dominikaner Sorgen zu machen. Sicher war alles nur ein Missverständnis, aber die Furcht, die ihn seit der Ankunft der Inquisitoren erfasst hatte, ließ ihn noch immer zittern.
Nachdem sie von Agnes zurückgekommen war, hatte Klara ihre langen, blonden Haare aufgesteckt und ihren Korb genommen, um noch etwas Gemüse bei einem Bauern zu holen. Es dämmerte schon, als sie das Dorf erreichte. Auf dem Marktplatz hatten die Menschen kleine Gruppen gebildet und unterhielten sich leise flüsternd. Es war voller als an einem Markttag, doch die Stimmung war gedrückt und düster. Klara konnte kaum etwas verstehen, daher ging sie näher heran. Sie wollte gerade den Krämer des Dorfes ansprechen, als jemand ihren Arm ergriff und sie unsanft zur nächsten Ecke zog.
»Lieber Himmel, was soll das denn jetzt?«, rief Klara erbost, während sie versuchte, sich aus dem Griff zu lösen. Im Zwielicht der Dämmerung erkannte sie Peter. Sie ließ sich noch ein paar Schritte mitziehen, bevor sie ungehalten stehen blieb.
»Sei leise«, flüsterte Peter.
»Was ist hier los?«, murmelte Klara. »Warum ziehst du mich in die Gasse wie einen gemeinen Räuber? Warum haben sich alle auf dem Marktplatz versammelt und zittern wie Schafe vor dem Wolf?«
»Sprich nicht so laut und beruhige dich«, antwortete Peter. »Dann erzähle ich dir alles.«
Ihre Neugier siegte, also atmete sie tief durch und strahlte Peter mit einem gezwungenen Lächeln erwartungsvoll an.
»Schon besser. Setz dich hin«, sagte Peter und ließ sich auf einer Stufe nieder. Klara nahm neben ihm Platz.
»Heute Mittag ist die Inquisition in Reheim angekommen.«
»Die Inquisition?«, rief Klara und sprang wieder auf.
»Zum letzten Mal, sei endlich leise«, sagte Peter mit zorniger Stimme. Er zog Klara am Arm, die sich daraufhin wieder hinsetzte.
»Heute Mittag kam eine Kutsche in Begleitung von acht Soldaten hierher. Aus der Kutsche stiegen zwei Priester des Dominikanerordens. Sie haben kurz mit meinem Vater geredet. Scheinbar wird jemand im Dorf der Ketzerei bezichtigt.«
Klaras Hände krallten sich nervös in ihren Rock, während sie weiter den Worten Peters lauschte.
»Sie haben Vater Liborius zu sich kommen lassen. Er ist noch immer bei den Dominikanern.«
»Was wollen sie von ihm?«
»Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich suchen sie jemanden, der ihnen den Namen eines Ketzers verrät.«
»Das kann nicht sein«, fuhr Klara auf. »Vater Liborius ist ein freundlicher, ehrlicher Mann. Er würde niemals einen von uns verraten, selbst wenn er sich der Ketzerei schuldig gemacht hätte.«
»Wach auf, Klara«, sagte Peter und winkte mit der Hand vor ihrem Gesicht. »Die Inquisition ist im Dorf. Die Dominikaner sind nicht ohne Grund hier. Einer von uns ist ein Verräter.«
»Das glaube ich nicht.«
Peter richtete seine Augen gen Himmel.
»Deine Unschuld in allen Ehren, Klara, aber du bist einfältig.«
Klara wollte eben eine bissige Bemerkung machen, als sich Stimmen in der Menschenmenge vor dem Wirtshaus erhoben. Sie stand auf. Peter kletterte auf einen Heuwagen und zog Klara mit sich. Von dort konnten sie über die Köpfe der Leute hinwegsehen.
Die Tür des Wirtshauses hatte sich geöffnet. Von einem Soldaten begleitet, trat Vater Liborius hinaus. Sein Kopf war nach unten gebeugt, als schämte er sich, den Bürgern von Reheim in die Augen zu blicken.
»Was wollen die Inquisitoren von uns?«, rief ein Mann aus der Menge.
»Sag uns, was passiert ist«, verlangte eine ältere Frau.
»Warum warst du so lange bei ihnen?«
»Was habt ihr besprochen?«
Vater Liborius wich vor den Fragen zurück. Er wollte schon wieder in das Wirtshaus hineingehen, als Thomas aus dem Haus trat. Er hob seine Hände, und die Menge wurde ruhig.
»Wir werden alle eure Fragen beantworten. Morgen, bei der Versammlung.«
»Was für eine Versammlung?«, rief der ältere Mann dazwischen.
»Morgen, zur Nona, gebieten wir, dass sich alle Bürger von Reheim im Festsaal zu versammeln haben. Ein Fernbleiben müssen wir als Missachtung der Kirche ansehen und somit als Ungehorsam gegenüber Gott.«
Für einen Moment hatten seine Augen einen harten Ausdruck angenommen. Dann sprach er mit ruhiger Stimme weiter: »Geht nach Hause. Morgen werdet ihr alles erfahren. Wir wünschen keine weiteren Störungen.«
Dann drehte sich Thomas um und ging in das Wirtshaus zurück.
Vater Liborius blieb allein vor dem Haus zurück. Als er die Blicke der Bürger auf sich spürte, lief er zu seiner Kirche am Dorfrand zurück.
Viele Bürger blickten ihrem geistlichen Beistand überrascht oder erschreckt nach, doch dann zerstreuten sich die Menschen auf dem Marktplatz langsam und gingen nach Hause. Klara blieb bis zuletzt auf dem Wagen stehen. Dann nahm sie Peters Hand und drückte sie fest, als suchte sie Halt, bevor sie ohne ein weiteres Wort zu verlieren vom Wagen hinunterkletterte und nach Hause ging.
Peter sah ihr noch lange nach. Als er sie nicht mehr ausmachen konnte, verbarg er sein Gesicht in den Händen und schüttelte den Kopf. Zum ersten Mal in seinem Leben verspürte er echte Angst. Nicht die Furcht vor dem prügelnden Vater, dessen Tochter er verführt hatte. Diese Angst ging tiefer. Es war die Furcht vor Folter, vor Demütigung und dem qualvollen Tod auf dem Scheiterhaufen. Peter war nie ein besonders gläubiger Mensch gewesen, doch in dieser Nacht würde er zu Gott beten und seine Gnade erflehen.
Die Dunkelheit hatte die letzten Strahlen der Sonne vertrieben. Wolken bedeckten den Himmel und ließen kaum das Licht des Mondes hindurch. Pater Thomas zog den Saum seiner Kutte über seinen Kopf und trat vor das Wirtshaus. Er nickte einer Wache zu, ihm zu folgen, und lief über den Marktplatz. Sein Weg führte ihn durch die Gassen des Dorfes, vorbei an stinkenden Hühnerställen, dampfenden Misthaufen und heruntergekommenen Fuhrwerken. Die Straßen waren eng, die Häuser schief, und der Dreck an seinen Stiefeln ließ ihn würgen.
Thomas versuchte, die trüben Pfützen zu meiden, bis er an einem kleinen Haus angekommen war. Er gab dem Soldaten ein Zeichen, der daraufhin nach vorne trat und zweimal fest an die Tür klopfte. Einen Augenblick später waren aufgeregte Schritte zu vernehmen. Ein wenig Licht drang durch den Türschlitz, als sich jemand dem Eingang näherte. Ein Riegel wurde hochgeschoben, und die Tür öffnete sich einen Spaltbreit.
Thomas erblickte eine alte, ergraute Frau, deren Haare ihr in einem wilden Durcheinander über den Rücken fielen. Sie trug ein zerschlissenes Nachtgewand, das an vielen Stellen geflickt war. Der Geruch von Knoblauch, Dung und Exkrementen drang durch die Tür. Thomas musste sich beherrschen, um nicht den Kopf vor Ekel abzuwenden.
»Maria Höfner?«, fragte Thomas.
»Jawohl«, antwortete die Frau leise und zog sich ängstlich einen Schritt zurück.
»Prior Baselius vom heiligen Orden der Dominikaner möchte mit Euch reden. Kleidet Euch an und kommt mit uns.«
»Was möchte der Prior denn von mir?«, fragte Maria mit leiser Stimme.
»Das wird er Euch selbst sagen«, antwortete Thomas und rang sich ein Lächeln ab.
Die Frau nickte kurz und lief dann, so schnell es ihre alten Beine erlaubten, in das Haus hinein. Thomas musste nicht lange warten. Als sie zurückkam, hatte sie ein langes, ergrautes Kleid an, das ein wenig nach Kamille duftete. Ihre Haare fielen noch immer strähnig über ihre Schultern, doch während sie zurück zum Wirtshaus liefen, schaffte sie es, sie zu bändigen und zu einem Knoten auf dem Kopf zusammenzustecken.
Thomas wunderte sich über die schweigsame Frau. Meist schworen die Leute schon bei seinem Anblick, dass sie sich keiner Ketzerei schuldig gemacht hatten. Sie erklärten, dass alle Vorwürfe gegen sie falsch waren, noch bevor er ein Wort der Anklage geäußert hatte. Maria schien sich keiner Schuld bewusst zu sein. Schweigsam gingen sie zum Wirtshaus. Thomas lief voraus. Maria folgte mit dem Soldaten einen Schritt dahinter.
Am Wirtshaus angekommen, führte Thomas die alte Frau ohne ein weiteres Wort nach oben. Er klopfte an die Tür von Pater Baselius und öffnete diese nach einem Augenblick. Dann winkte er Maria hinein. Die Frau lächelte den jungen Inquisitor freundlich an. Thomas blickte ihr verwundert nach. Anscheinend wusste sie wirklich nicht, was hier passieren würde.
Vater Liborius nahm eine Lampe zur Hand und schlich aus der Kirche. Das letzte Licht versank hinter dem Horizont, aber die Ankunft der Inquisitoren ließ ihn nicht schlafen. Seine Kirche war ihm noch nie so beengt vorgekommen. Er musste mit jemandem reden, denn selbst die Einkehr im Gebet hatte ihm nicht den Frieden gebracht, den er sonst aus der Anrufung Gottes erhielt.
Liborius ließ die Lampe noch verdeckt, bis er die Häuser Reheims hinter sich gelassen und den Wald betreten hatte. Er war den Weg noch nie in der Nacht gelaufen, aber er kannte sich gut genug aus, dass er sein Ziel auch im Dunkeln erreichen würde.
Der alte Mann war das Laufen nicht mehr gewohnt. Er war noch nicht lange unterwegs, als sein Knie zu schmerzen begann. Schweiß bildete sich auf seiner Stirn, und er atmete keuchend. Trotzdem weigerte sich Liborius, auf seinen Körper zu hören und stehen zu bleiben. Die Lampe vor sich, hielt er den Kopf gesenkt und den Blick auf den Boden vor sich gerichtet. Sehen konnte er nur noch ein kleines Stück Weg. Beinahe hatte er das Gefühl, seine Welt ende hinter dem Ausschnitt, den er überblicken konnte. Aber er marschierte Schritt um Schritt voran. Seine Kutte war schweißdurchnässt, als er auf einer kleinen Erhebung anhielt und den Kopf hob. Er drehte sich in alle Richtungen und hielt die Lampe hoch über seinen Kopf. Die Bäume verschluckten das wenige Licht des Mondes. Unsicher ging er umher, bis er einer alten Eiche gewahr wurde, deren knorrigen Äste wie Krallen in den Himmel strebten. Der Baum hatte schon alle Blätter verloren, und sein Stamm war eigenartig verdreht.
Liborius seufzte zufrieden. Jetzt wusste er wieder, wo er war. Bald darauf kam er an einen mit Efeu überwucherten Zaun. Einzig ein kleines Gatter war von den Pflanzen befreit und führte in einen gepflegten Vorgarten, in dem Gemüse und Kräuter wuchsen. Ohne zu zögern, betrat Liborius das kleine Anwesen und blieb vor einer Hütte stehen. Er stellte seine Lampe ab und begann, an die Tür zu klopfen. Das Geräusch hallte laut durch den stillen Wald, aber der alte Mann hämmerte weiter an das Holz, bis er innen Schritte hören konnte.
Kurz darauf öffnete sich die Tür, und die Lampe beschien das Gesicht einer alten Frau, die den Mann vor ihrer Tür verwirrt und müde anblinzelte. Als sie Vater Liborius erkannte, machte sie ein verärgertes Gesicht.
»Liborius, ich hoffe, du raubst mir nicht nur wegen deiner Schmerzen im Knie den Schlaf, ansonsten …«
»Ich muss mit dir reden, Agnes«, unterbrach der Priester die Frau und drängte sich an ihr vorbei in die kleine Hütte. Drinnen angekommen, setzte er die Lampe auf einen Tisch und begann, unruhig auf und ab zu gehen.
Noch bevor Agnes die Tür ganz geschlossen hatte, sprach er weiter. »Die Inquisition ist in Reheim angekommen«, sagte er und rieb sich nervös die Hände. Ganz offensichtlich hatte er die Frau mit dieser Ankündigung überrascht, denn ihr Blick wurde ernst. Sie schien viele Fragen zu haben, aber sie ließ den alten Mann weitererzählen.
»Sie waren kaum eingetroffen, als sie mich schon zu ihnen gerufen haben«, fuhr Liborius fort. Der Priester sprach sehr schnell, was er nur tat, wenn er aufgeregt war. Agnes setzte sich auf einen Stuhl und lauschte den Worten im Schein der Lampe.
»Sie haben sich im Wirtshaus beim alten Rainald niedergelassen. Ich war kaum eingetreten, als sie mich über die Bürger Reheims ausfragten. Zuerst sehr allgemein. Ob es Vorfälle von Hexerei oder Ketzerei gegeben hat. Ob es Einwohner gibt, die schlecht über die Kirche reden, den Namen Gottes beschmutzen oder den Gottesdiensten fernbleiben. Ich habe alles verneint und gesagt, dass hier nur ehrenwerte Bürger wohnen, die sich keine Freidenkerei zuschulden haben kommen lassen. Trotzdem fragten sie weiter. Sie wollten alles über den Stadtrat wissen und über die alleinstehenden, unverheirateten Frauen in Reheim.«
»Hast du ihnen denn Namen genannt?«, fuhr Agnes dazwischen.
»Nein«, antwortete Liborius. »Das musste ich gar nicht. Sie kannten unseren Stadtrat und wussten, welche Frauen in Reheim allein leben.«
Agnes rieb sich müde über die Augen. »Das sind beunruhigende Nachrichten, Liborius, aber warum kommst du damit mitten in der Nacht zu mir?«
»Sie haben mich auch nach dir gefragt«, antwortete Liborius ernst.
Wenn Agnes überrascht war, ließ sie es sich nicht anmerken. »Nun, das ist nicht verwunderlich, denn wie du weißt, bin ich alleinstehend und war auch nie verheiratet. Also, warum wunderst du dich, dass sie auch nach mir fragen?«
»Dein Name fiel als erster, und ich musste ihnen alles sagen, was ich über dich weiß.«
Agnes wollte zu einer Frage ansetzen, aber Liborius sprach schnell weiter.
»Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich habe ihnen erzählt, dass du eine ehrbare Frau bist, deren Heilkünste schon viele Leben gerettet haben.«
Agnes grunzte nur mürrisch, enthielt sich aber eines Kommentars.
»Natürlich habe ich von deiner Arbeit im Mainzer Hospiz berichtet und von der Unterweisung, die du in dieser Zeit von den Schwestern erhalten hast.«
»Und du denkst, das hat die Inquisition von meiner Reinheit überzeugt?«, fragte Agnes scharfzüngig.
»Es gibt keinen Grund, an meinem Wort zu zweifeln«, sagte Liborius etwas beleidigt.
Agnes richtete kurz die Augen zum Himmel und schüttelte den Kopf.
»Du glaubst also, dass sich die Inquisitoren ausschließlich auf deine Aussagen verlassen, wenn es um die Beurteilung des Gottesglaubens der Bürger Reheims geht?«
»Wem sonst sollten sie vertrauen? Auch wenn sie noch andere befragen, sie werden kaum zu einem anderen Urteil kommen.«
»Du redest von den gleichen Bürgern, die mich als verrückte Einsiedlerin und alte Hexe bezeichnen?«
»Du kennst doch die Leute. Das ist nicht ernst gemeint. Auch wissen längst nicht alle so gut wie ich um deine Fähigkeiten und dass du nicht schlecht über Gott und die Kirche sprichst.«
Agnes lächelte verschmitzt und schien sich eine bissige Bemerkung nur mit Mühe verkneifen zu können.
»Und wenn du dir so sicher bist, dass deine Meinung wesentlich für die Inquisitoren ist, dann frage ich dich, woher sie so viel über die Bürger Reheims wissen?«
»Sie werden vorher Erkundigungen eingezogen haben …«
»Erkundigungen bei wem?«, fuhr Agnes dazwischen. »Ich habe in den letzten Wochen keinen Inquisitor hier herumlaufen und Leute befragen sehen. Dich haben sie nicht aufgesucht und sicher auch niemanden vom Stadtrat, daher frage ich dich, wer hat die Inquisition auf uns hingewiesen? Woher wissen sie, was sie wissen?«
»Ich habe keine Ahnung«, antwortete Liborius unsicher.
»Wer immer die Inquisition aufgesucht hat, hatte nichts Gutes im Sinn. Es geht doch niemand einfach so zu diesen Männern und erzählt ihnen, wie sehr oder nicht so sehr ehrfürchtig und gottesgläubig die Menschen in Reheim sind.«
Liborius schwieg einen Moment, doch dann straffte er die Schultern und fuhr fort.
»Hier leben nur anständige Leute«, sagte er selbstsicher. »Selbst wenn die Inquisitoren böswillig ausgesprochenen Beschuldigungen nachgehen, so werden sie nichts finden, was ihren Unmut erregen wird.«
Agnes seufzte. Dann stand sie auf und fachte das Feuer in dem kleinen Ofen an.
»Ich habe deine Meinung schon immer geschätzt«, sagte Agnes und stocherte mit einem Stock in der Glut herum, »aber ich bin überrascht, wie groß dein Vertrauen in die Redlichkeit der Inquisition ist.«
»Es sind Männer Gottes«, versuchte Liborius, sich zu rechtfertigen.
»Aber sie wären nicht gekommen, wenn sie nicht schon jemanden der Ketzerei verdächtigen würden. Deine Befragung diente bestenfalls zur Bestätigung ihrer Vermutungen. Wahrscheinlich haben sie dich nur gerufen, um den Schein zu wahren.«
»Aber es gab hier keine Fälle von Ketzerei, Unzucht oder Hexentum …«
»Ich fürchte, es ist im Grunde nicht wichtig, ob es diese Fälle wirklich gibt. Die Beschuldigungen, die der Inquisition zugetragen wurden, waren schwerwiegend genug, dass sie hierhergekommen sind. Glaubst du denn tatsächlich, dass sie einfach unverrichteter Dinge wieder wegfahren, nur weil sie auf den ersten Blick keine ketzerischen Umtriebe entdecken?«
»Aber hier gibt es keine Häresie«, fuhr Liborius auf.
»Schon gut«, unterbrach Agnes den Priester kopfschüttelnd. Sie rieb sich müde über die Augen. Dann wurde ihr Gesichtsausdruck wieder milder. »Wenn du schon den langen Weg auf dich genommen hast, um mitten in der Nacht zu einer allein lebenden Frau in den Wald zu schleichen, dann kann ich uns auch gleich einen Kräuteraufguss machen.«
Liborius stand noch immer sichtlich angespannt vor dem Tisch.
»Jetzt setz dich endlich, Liborius, und werde wieder ruhiger«, sagte sie milde. »Wir alten Leute brauchen sowieso wenig Schlaf, und wenn du mich jetzt schon aus dem Bett geholt hast, dann können wir uns auch weiter unterhalten.«
Liborius lächelte die Frau an und setzte sich an den Tisch. Seine Aufregung legte sich, als er Agnes zusah, wie sie Kräuter in ein kleines Gefäß gab und mit dem Stößel zerrieb. Er wollte bald wieder zurückgehen, aber für einen Schluck von Agnes’ wohlschmeckendem Kräuteraufguss würde er sich noch Zeit nehmen.
Rainald rannte mit seiner Frau und dem Stallburschen hektisch im Stall umher. Sie hatten sich schon zu Bett begeben, als die Soldaten an seine Tür gehämmert hatten. Er hatte den Stall öffnen und den Soldaten beim Satteln ihrer Pferde helfen müssen. Der Wirt konnte sich vor Müdigkeit kaum auf den Beinen halten, aber die Angst vor einer möglichen Bestrafung ließ ihn jeden Wunsch der Soldaten mit größter Eile befolgen.
Rainald hatte keine Ahnung, wohin die Männer mitten in der Nacht aufbrachen. Einer von ihnen hatte eine grob gezeichnete Karte dabei, die er aufmerksam im Licht einer Lampe studierte, während die anderen Soldaten ihre Pferde sattelten. Der Wirt unterdrückte den Drang, einen Blick auf die Karte zu werfen, und hielt die Augen gesenkt. Er wollte sich nicht in die Arbeit der Inquisition einmischen, aber er ahnte schon, dass der eilige Aufbruch in der Nacht kein gutes Zeichen war.
Klara blieb lange auf. Ihr Onkel hatte den Kamin befeuert, während sie einen Kräuteraufguss gekocht hatte. Seit Sonnenuntergang saßen sie schon auf den alten Holzstühlen und sprachen über die Ereignisse des Tages.
»Aber es sind doch Priester«, rief Klara erregt. »Sie haben sich doch dem Wort Gottes und seiner Gnade verpflichtet.«
»Kaum ein Mensch ist weiter von Gott entfernt als ein Inquisitor«, antwortete Markus mit seiner ruhigen Stimme und trank noch einen Schluck des Gebräus. Dann blickte er Klara in die Augen, wie immer, wenn sie ein ernstes Gespräch führten. »Sie kennen keine Gnade, keine Liebe und keine Vergebung. Sie predigen Gottes Wort, doch nichts ist ihnen ferner.«
»Ich habe viele Geschichten über die Inquisition gehört«, murmelte Klara, »und kann nicht glauben, dass Menschen so grausam sein können.«
Markus erhob sich von seinem Stuhl, ging zum Kamin und legte noch ein Scheit Holz nach. Das Scheit verschwand fast in seinen großen, kräftigen Händen. Sein langsamer Gang zeigte Klara, dass er wieder Schmerzen hatte. Eine Verletzung am Rücken, die noch von seiner Zeit als Soldat herrührte, quälte ihn ab und an. Mehr wusste Klara nicht, da Markus nicht gerne über diese Zeit sprach. Er blickte einen Moment ins Feuer, dann seufzte er.
»Als deine Eltern starben, habe ich dich bei mir aufgenommen und geschworen, dich vor allem Leid zu bewahren. Deine Mutter und ich, wir liebten uns, wie es nur Bruder und Schwester können. Ich habe getan, was ich konnte, damit du eine junge Frau wirst, auf die deine Mutter einmal stolz sein kann.« Markus drehte sich um und schaute Klara wieder ins Gesicht. »Die Welt ist unvorstellbar grausam, Klara. Ich habe Menschen Taten von solchem Gräuel begehen sehen, dass sie mir heute noch den Schlaf rauben. Vielleicht war meine Verletzung ein Geschenk Gottes, auch wenn sie mich fast zum Krüppel gemacht hat, denn sie hat mich weggebracht von den Schlachtfeldern dieser Welt, hierher, wo Krieg und Mord nur Geschichten sind.«
Markus biss sich auf die Lippen, als überlegte er genau seine nächsten Worte, und lächelte dann. »Du bist eine schöne junge Frau geworden, ebenso bezaubernd, wie deine Mutter es war. Vielleicht noch etwas klüger, als sie in deinem Alter war, daher ist es an der Zeit, dich nicht mehr wie ein kleines Mädchen zu behandeln.« Er schlurfte zu seinem Stuhl zurück und setzte sich. »Ich war der Diener vieler Herren. Ich zog als Soldat durchs Land und verkaufte mich dem Heerführer, der am meisten zahlte. Dann tötete ich in seinem Namen, bis die Schlacht geschlagen war, nahm mein Bündel und suchte mir den nächsten Ort, an dem mein Schwert gebraucht wurde. Ich weiß nicht, wie viele Leben ich genommen habe. Es machte mir nichts aus, denn das ganze Land war dem Krieg verfallen, und der Tod war stets nur eine Armlänge entfernt. So zog ich umher, bis unser Hauptmann mich und meine Kameraden zur Seite nahm und zur Bewachung eines Priesters abstellte.
Ich war ein guter Soldat und gehorchte allen Befehlen. Zu dieser Zeit hatte ich noch nicht viel über die Inquisition gehört. Ich hielt sie lediglich für eine eigene Bruderschaft unter den zahllosen Orden der Kirche, nicht stärker oder gefährlicher als die anderen auch.«
Markus griff nach seiner Tasse und trank einen Schluck Tee. Seine Hand zitterte, als er das Gefäß aufnahm und sich an der Wärme erfreute. »Es war ein Dorf wie dieses. Die Menschen waren Bauern, arbeitsam und ehrlich. Der Priester führte uns zu einem Haus, etwas abseits der Dorfstraße, vor dem eine kleine Menschenmenge wartete. Sie sahen elend aus. Ihre Kleider waren zerrissen. Die Frauen hatten zerzaustes Haar und schmutzige Gesichter. Sie versuchten, ihre weinenden Kinder zu beruhigen, die ihre Angst mit aller Kraft herausschrien.
›Treibt sie ins Haus und vernagelt die Türen‹, befahl uns der Priester,
Natürlich befolgte ich diesen Befehl. Es kam oft vor, dass Familien unter Hausarrest gestellt wurden, wenn sie sich eines Vergehens schuldig gemacht hatten. Damals war ich noch blind«, sprach Markus weiter und schüttelte den Kopf. »Ich sah nicht, dass die Frauen missbraucht worden waren, dass die Männer unter den Schmerzen überstandener Folter kaum laufen konnten und ihre Kinder in Todesangst zitterten. Und so trieben wir sie in das Haus hinein. Die Männer flehten uns um Gnade an, die Frauen weinten und baten uns, wenigstens die Kinder zu verschonen.
Noch immer verstand ich nicht, also führte ich weiter meine Befehle aus und verschloss die Türen. Kaum war die Arbeit erledigt, sah ich den Priester, mit einer großen Lampe in seinen Händen. Ich blickte in seine Augen, und die Freude darin ließ mich verstehen, was ich getan hatte.
Er warf die Lampe mit einem Lächeln auf das Dach. In diesem Moment schien alles um mich herum stillzustehen. Ich sah, wie das Feuer das Dach erfasste und sich die Flammen ausbreiteten. Ich hörte die flehenden Schreie der Eingeschlossenen wie aus weiter Ferne und spürte die Wärme auf meinem Gesicht, aber ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich stand vor dem Haus, hörte die Menschen in den brüllenden Flammen sterben und begriff, dass ich an ihrem Tod die Schuld trug.«
Klara sah Tränen in Markus’ Augen schimmern. Nach einem Moment straffte der Mann seine kräftigen Schultern und erzählte weiter. »Seit diesem Tag sollte ich nie mehr eine Nacht durchschlafen. In jener Nacht schlief ich gar nicht, bis zum Morgen wälzte ich mich auf meinem Lager und flehte Gott um Vergebung für meine Sünden an, doch die Last wurde nicht leichter. Am nächsten Tag stürzte ich mich in die Schlacht, mit dem festen Vorhaben, nicht lebend daraus zurückzukehren.
Selbst drei Treffer einer Axt hielten mich nicht. Blutüberströmt rannte ich weiter, hoffend, dass der Feind endlich Erbarmen zeigen und mir einen schnellen Tod gewähren würde. Ein Pfeil traf mich in den Rücken und ließ mich in gnädige Bewusstlosigkeit sinken.
Ich erwachte drei Tage später im Krankenlager und verstand, dass Gott mir noch immer nicht vergeben hatte.«
Markus leerte die Tasse und stellte sie auf den Tisch. »Es dauerte Wochen, bis ich wieder laufen konnte, also gab ich meine Arbeit als Soldat auf und kehrte hierher zurück. Während ich mit deinem Vater dieses Haus baute, gab mir deine Mutter die Kraft, mich dem Leben wieder zu stellen. Die Erinnerungen suchten mich noch immer heim, aber sie waren nicht mehr so stark.«
Markus blickte Klara in die Augen. »Sei vorsichtig und wachsam, Klara, wenn wir morgen zur Versammlung gehen. Vertraue auf dein Herz und deinen Verstand. Lass dich nicht von falschen Anschuldigungen blenden.« Dann lächelte Markus und vertrieb damit die Trauer aus seinem Gesicht. »Es wird Zeit, sich schlafen zu legen.«
Klara räumte die Tassen zur Seite, während ihr Onkel noch ein Scheit Holz in den Kamin legte. Tausend Fragen bewegten sie, doch sah sie die Müdigkeit in Markus’ Augen. Aufgewühlt ging sie zu Bett.
Doch sie fand keinen Schlaf. Ihr Onkel war ein verschlossener Mann, der nicht gerne von seiner Vergangenheit sprach. Klara hatte ihn auch nie dazu gedrängt. Sie wusste, dass er früher einmal Soldat gewesen war. Nach seiner Verletzung war er nach Reheim zurückgekehrt und hatte im Haus ihrer Mutter und ihres Vaters gelebt. Sie konnte sich kaum an eine Zeit ohne Markus erinnern. Klara hatte ihren Onkel als großzügigen und ruhigen Menschen kennengelernt. Umso erstaunter war sie, dass er getötet haben sollte. Diese Vorstellung passte nicht zu dem Bild, das sie von ihm hatte.
Klara wälzte sich in ihrem Bett. Am liebsten wäre sie zu Agnes gelaufen, um mit ihr über Markus’ Beichte zu reden. Die Weisheit der alten Frau fehlte ihr in dieser Nacht. Sobald die Versammlung vorbei war, würde sie zu ihr gehen. Sie zog die Decke über ihre Schultern, schloss die Augen und versuchte, zur Ruhe zu kommen.
Auf den ersten Blick war es eine Nacht wie jede andere. Die Läden der Häuser waren zugezogen, die Tiere von der Weide geholt und die Felder verlassen. Die Gerste war ausgesät, und der bevorstehende Herbst färbte bereits die ersten Bäume rot. Der Wind ließ die Blätter rascheln, und die Straßen des Dorfes waren leer. Doch hinter den verschlossenen Türen herrschte Angst.
Ruhelos wälzten sich die Bürger in ihren Betten. Sie fürchteten sich vor dem, was kommen würde und was sie nicht verhindern konnten. Es war wie das Warten auf einen nahenden Sturm. Man sah schon von Weitem, wie er den Himmel vereinnahmte, spürte, wie die Luft abkühlte und der Wind zunahm. Man konnte sich nur in Sicherheit bringen und warten, bis alles vorbei war.
Doch dieser Sturm war anders. Er konnte jeden erfassen, und es gab keinen Schutz vor ihm. Kein Dach bewahrte einen vor dem prasselnden Regen, und keine Mauer konnte den Wind abhalten. Die Menschen waren gefangen in ihrer Hilflosigkeit, dazu verdammt, abzuwarten, während andere über ihr Leben entschieden. Selbst der Klügste unter ihnen konnte sie aus dieser Lage nicht herausreden und selbst der Stärkste den Feind nicht niederknüppeln.
So warteten die Bürger von Reheim darauf, dass die Nacht verging. Ihre Gedanken kreisten um die Schrecken, die man ihnen antun würde, um die Fehler, derer sie sich schuldig gemacht hatten, und die Sünden, welche sie begangen hatten. Sie lagen in ihren Betten und flehten zum Herrn um Vergebung. Ihre Versprechungen wurden mit jeder Stunde größer. Sie beteten, dass das Auge der Inquisition sie nicht beachten und dieser Albtraum ein Ende nehmen würde.
Es war eine Nacht, in der jeder Bürger von Reheim insgeheim Verrat beging. An den Freunden, die er für seine Unversehrtheit opfern würde, und an den Nachbarn, deren Blut er vergießen würde, nur um nicht selbst in die Fänge der Inquisition zu geraten. Es dauerte nur wenige dunkle Stunden, bis die Bewohner von Reheim ihre Gemeinschaft aufgaben.
Pater Baselius hatte sich zum kleinen Gefängnis des Dorfes bringen lassen. Die Zellen rochen vermodert. Er hörte Ratten umherhuschen. Seine Schritte hallten laut. Als ihm die Tür geöffnet wurde, quietschten die Angeln. Dann drehte er sich zu Thomas um, der ihn hierher geführt hatte.
»Ich gehe davon aus, dass diese Räume hergerichtet werden. Die Zellen müssen sicher sein. Alle Schlüssel müssen uns übergeben werden. Einzig unsere Soldaten dürfen das Gebäude bewachen. Niemand darf sich ohne unsere ausdrückliche Erlaubnis dem Gefängnis nähern. Es ist jedem verboten, mit den Gefangenen zu reden.«
»Sehr wohl«, sagte Thomas und führte Baselius weiter.
Der ältere Mann ging langsam. Der Boden war uneben und glitschig von der Feuchtigkeit, die sich in langen Jahren hier gesammelt hatte. Eine Tür knarrte, und Thomas sagte: »Wir sind da.«
Pater Baselius hätte auch ohne seinen Helfer gewusst, wo sie waren. Er roch die Angst, die Menschen unter der Folter ausdünsteten. Es stank nach Schweiß und Exkrementen. Das Klirren von Ketten zeigte ihm, dass die Frau schon aufgehängt war. Normalerweise begannen die Ketzer schon bei seinem Anblick, um Gnade zu flehen, aber die Gefangene schwieg. Baselius nickte ein wenig mit dem Kopf. Dieser Fall schien etwas hartnäckiger zu sein.
»Schließt die Tür«, sagte er und trat in den Raum hinein. »Wir haben eine lange Nacht vor uns.«