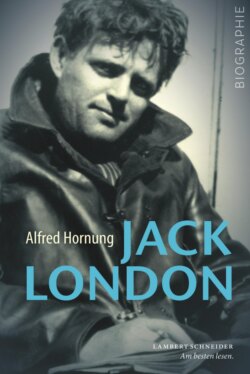Читать книгу Jack London - Alfred Hornung - Страница 9
Schulabbruch und Kinderarbeit
ОглавлениеIn der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden in dem sich expansiv ausdehnenden Land zahlreiche neue wirtschaftliche Möglichkeiten für Menschen mit Unternehmergeist. Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain hat für diese Zeit nach dem Bürgerkrieg den abwertenden Begriff „Gilded Age“ („Vergoldetes Zeitalter“) geprägt. Im Unterschied zum antiken „Goldenen Zeitalter“ wollte Mark Twain in dem zusammen mit Charles Dudley Warner 1873 verfassten gleichnamigen Werk angesichts des enormen wirtschaftlichen Aufschwungs auf den Verfall der geistig-moralischen Werte in der Gesellschaft hinweisen. Präsident Ulysses S. Grant hatte in seiner Amtszeit von 1869 bis 1877, in die die wirtschaftliche Rekonstruktion des Südens durch den Norden nach dem Bürgerkrieg und die weitere Öffnung des Landes im Westen fiel, die enge Verflechtung von politischen und wirtschaftlichen Interessen begünstigt und den Machtmissbrauch auf verschiedenen Ebenen indirekt befördert. An die Stelle des Wohls für das Gemeinwesen rückte der rigorose individuelle Wettbewerb. Der mit der fortschreitenden Besiedlung des Westens verbundene transkontinentale Eisenbahnbau, die Stahl- und Ölförderung im Osten sowie die Kohleförderung in den neuen Bergminen im Westen begünstigten die Entstehung eines ungehemmten Monopolkapitalismus und die exzessive Selbstverwirklichung starker Individuen. Entsprechend der jeweiligen politischen Perspektive wurden Cornelius Vanderbilt, Leland Stanford, Andrew Carnegie, John Pierpont Morgan und John D. Rockefeller als „Kapitäne der Industrie“ oder „Räuberbarone“ bezeichnet. Ihr Aufbau bedeutender Wirtschaftsimperien steht exemplarisch für den Geist des „vergoldeten Zeitalters“. An der Ostküste beherrschte Vanderbilt die Eisenbahnverbindungen zwischen New York, den Großen Seen und dem Mittleren Westen. Leland Stanford war verantwortlich für den Eisenbahnbau im Westen, dessen Einnahmen er unter anderem als Startkapital für die Gründung der Universität Stanford nutzte. Der aus Schottland eingewanderte Andrew Carnegie besaß das Monopol der Eisen- und Stahlindustrie. John Pierpont Morgan etablierte und beherrschte das New Yorker Bankenwesen und John D. Rockefellers Standard Oil Company monopolisierte schließlich von Pennsylvania aus die Ölindustrie. Gustavus Swift baute mit den Schlachthöfen in Chicago ein Monopol für die Fleisch- und Nahrungsmittelindustrie aus. Kehrseite der auf rücksichtslosem Wettbewerb basierenden Industrien waren die schamlose Ausbeutung der oft ohne Ausbildung und Sprachkenntnisse eingewanderten Arbeiter aus Europa und Asien und die zunehmende Praxis der Kinderarbeit.
Johnny London, 8 Jahre alt
Jack Londons Schulzeit war vom Kampf gegen diese kapitalistische Ausbeutung im Arbeitermilieu geprägt. Um die Familienkasse aufzubessern, trug der 10-jährige Schüler vor und nach dem Schulbesuch Zeitungen aus. Um 3 Uhr früh musste er Zeitungen an Abonnenten ausliefern, und nach dem oft als langweilig empfundenen Schulunterricht versuchte er, selbstständig in den Nachmittagsstunden vor Hafenkneipen und Spelunken an der San Francisco Bay Zeitungen zu verkaufen. An Sonntagen arbeitete er in einer Kegelbahn holländischer Einwanderer. Der 1935 von Londons langjährigem und bestem Schulfreund Frank Atherton verfasste Memoirenband, der erst 2014 von dessen Enkeltochter Diane Neil veröffentlicht wurde, zeichnet ein teilweise anderes Bild dieser frühen Schulzeit. Neben der Tristesse der ärmlichen Verhältnisse gab es durchaus auch erfreuliche Abwechslungen. Der Sommeraufenthalt in den Bergen bei Franks Eltern während der Ferien gehörte ebenso dazu wie die Abenteuergeschichten, die der Stiefvater John London den beiden Jungen von seinen Begegnungen mit Indianern erzählte und die ihren Abenteuergeist anregten. Bewusst nannte Frank Atherton seine Erinnerungen an die gemeinsamen Schuljahre Jack London in Boyhood Adventures (2014), in denen er die Doppelnatur seines Freundes als einsame Leseratte und brutale Kämpfernatur schilderte. So endete der verbale Angriff des Anführers einer Schulbande auf den während der Schulpause ein Buch lesenden Jack in einem für ihn erfolgreich beendeten Boxkampf. Diese Szene präfiguriert seine spätere Bewährung als sensibler Buchmensch und starker Kämpfer in der rauen Wirklichkeit des Hafenmilieus der San Francisco Bay. Sie zeigt auch seine lebenslange Faszination für das Boxen und den Boxsport, dessen wichtigste Kämpfe er als Reporter begleitete. Der Besuch der weiterführenden Highschool stand aufgrund der finanziellen Situation in der Familie nicht zur Debatte. Da der Stiefvater allmählich arbeitsunfähig wurde und die von der Mutter eröffnete Pension für schottische Fabrikarbeiterinnen bald scheiterte, reichte der durch Zeitungsaustragen und Kegelaufstellen erzielte geringe Zuverdienst nicht mehr aus. Nach dem Abgang von der Cole Grammar School lernte der sich nun Jack nennende 14-Jährige die grausame Welt der Kinderarbeit in der Konservenfabrik Hickmott’s Cannery in West Oakland kennen. Bei dieser Arbeit verbrachte er zwischen 12 und 18 Stunden damit, Gurken in Gläser zu stecken. Dafür erhielt er 10 Cents als Stundenlohn. In der autobiografischen Geschichte Der Abtrünnige (1965) [The Apostate (1906)] hat Jack London das Elend der Kinderarbeit ausführlich beschrieben und die zerstörerischen Auswirkungen von sich endlos wiederholenden maschinellen Arbeitsvorgängen dargestellt.
In der Erzählung schildert er die Leidensgeschichte des jugendlichen Protagonisten Johnny, seiner durch Arbeit entkräfteten Mutter und zweier jüngerer Geschwister, Will und Jennie. Londons Kindername Johnny sowie die Namen seiner afroamerikanischen Pflegemutter Jennie und deren Sohn William stehen für die selbst erlebte Ausbeutung von Kindern in den Fabriken. In der Geschichte muss der autobiografische Held schon mit 6 Jahren auf seine Geschwister zu Hause aufpassen, und mit 7 beginnt die Arbeit in der Fabrik.
Mit sechs Jahren war er Väterchen und Mütterchen für Will und die andern, noch kleineren Kinder gewesen. Mit sieben Jahren hatte er angefangen, in den Fabriken zu arbeiten – Garn aufspulen. Mit acht Jahren hatte er in einer anderen Fabrik Arbeit bekommen. Seine neue Arbeit war wunderbar leicht. Alles, was er zu tun hatte, war, daß er mit einem kleinen Stock in der Hand einen Strom von Tuch lenken mußte, der an ihm vorbeifloß. Dieser Tuchstrom kam aus einer mächtigen Maschine, ging über eine warme Trommel und dann weiter in andere Gegenden. Johnny saß immer an derselben Stelle, wo das Tageslicht nie hingelangte, und wie er unter einer Gasflamme dasaß, war es, als bildete er selbst einen Teil der Maschinerie.
(Der Abtrünnige, S. 430f.)
Die strapaziöse und Kräfte zehrende Arbeit wird zusätzlich dadurch verschlimmert, dass Johnny durch den Arbeitsbeginn vor Tagesanbruch und das späte Arbeitsende nie das Tageslicht zu sehen bekommt und dass er so durch die Einbindung in die maschinellen Abläufe selbst zu einer Art Maschine wird. Anfänglich erfüllt ihn das Lob des Superintendenten für die „maschinenähnliche Perfektion“ seiner Arbeit mit Stolz. Erst nachdem er aufgrund von arbeitstypischen Erkrankungen von der Textilfabrik in eine Glasfabrik wechseln muss, wird ihm die Ausbeutung seiner Arbeitskraft und seiner Gesundheit durch die geistige Fähigkeiten abtötenden mechanischen Prozesse bewusst. In der Geschichte wird er sogar in einer Arbeitshalle der Textilfabrik in den sein frühes Leben bestimmenden Maschinenrhythmus hineingeboren.
Nie hatte es eine Zeit gegeben, da er nicht in enger Verbindung mit Maschinen gestanden hätte. Er war unter Maschinen geboren und unter ihnen aufgewachsen. Vor zwölf Jahren war in der Webstube in eben dieser Fabrik eine Störung eingetreten. Johnnys Mutter war ohnmächtig geworden. Sie legten sie flach auf den Fußboden zwischen den lärmenden Maschinen. Ein paar ältere Frauen wurden von ihren Webstühlen hinzugerufen, der Vorarbeiter half, und im Laufe weniger Minuten gab es in der Webstube eine Seele mehr, als die zur Tür hereingekommen waren. Das war Johnny, der mit dem Poltern und Krachen der Maschinen in den Ohren geboren war und zum erstenmal in der warmen feuchten Luft atmete, die dick von Leinenflocken war. Er hatte an jenem ersten Tage gehustet, um sich die Lunge von den Leinenflocken zu befreien, und aus demselben Grunde hustete er seitdem immer.
(Der Abtrünnige, S. 421)
Krankheiten wie Epilepsie, Lungenentzündung oder Grippe treffen die Familien existentiell, weil es keine Lohnfortzahlung oder staatlichen Kompensationen gibt. Um den Fortbestand der Familie zu gewährleisten, gibt es eigentlich keinen Ausweg aus dieser Tretmühle. Dabei verkümmern auch alle emotionalen und menschlichen Werte. Nicht nur verändert sich das Verhältnis Johnnys zur Mutter, sondern auch zu seinen Geschwistern, und er ist der Auffassung, dass der von der Mutter bevorzugte Bruder Will auch zur Arbeit gehen könne statt zur Schule. Sporadische Anflüge vom Ausbruch aus dieser Situation erweisen sich als trügerisch. Letztlich sind es eine anhaltende Grippeerkrankung und die Erkenntnis seiner physischen und psychischen Degeneration, die ihn – dem Titel der Geschichte entsprechend – zum Abtrünnigen werden lassen:
Er ging nicht wie ein Mann. Er sah nicht wie ein Mann aus. Er war die Parodie eines menschlichen Wesens. Er war ein verzerrtes, verkümmertes und namenloses Stück Leben, das wie ein kranker Affe dahintrottete, mit hängenden Armen und gebeugten Schultern, engbrüstig, komisch und entsetzlich.
(Der Abtrünnige, S. 447)
Gegen die flehentlichen Bitten seiner Mutter um die Fürsorge für die Familie verweigert er sich standhaft der Arbeit und ist nur noch tranceartig getrieben von „einem unwiderstehlichen Drang, zu ruhen“ (Der Abtrünnige, S. 447). Zum ersten Mal in seinem Leben scheint er die Natur in Form eines Baumes bewusst zu registrieren und verlässt seinem inneren Antrieb folgend die Stadt. Es zieht ihn hinaus in die offene Landschaft. An einer Eisenbahnstation wartet er auf einen Frachtzug, auf den er in der Dunkelheit der Nacht aufspringt zur abenteuerlichen Fahrt in ein neues Leben.
Die in Der Abtrünnige dargestellte Entwicklung des Protagonisten entsprach Jack Londons eigener Erfahrung zermürbender Arbeitsprozesse und unmenschlicher Ausbeutung durch Fabrikbesitzer, die ihn den Job zweier entlassener Arbeiter verrichten ließen. Auch den Verlust menschlicher Beziehungen hatte er selbst erlebt, als er die Familienmitglieder wegen der langen Arbeitsstunden kaum mehr zu Gesicht bekam. Seine Mutter hatte die Hoffnung nicht aufgegeben, über die Einnahmen ihres Mannes und Sohnes sowie ihre eigenen Geschäfte ihr früheres Luxusleben in Ohio wiederherzustellen. Deshalb schien sie ihn nur noch als eine Einnahmequelle zu begreifen und kassierte das verdiente Geld am Monatsende skrupellos ab. Aber die hehre Hoffnung blieb angesichts der desperaten Situation eine Illusion. Der Vater erlitt weitere finanzielle Einbußen, war wiederholt krank und konnte nur noch als Nachtwächter arbeiten. Jacks Lieblingsstiefschwester Eliza war 1884 als 16-Jährige ausgezogen, um einen 41-jährigen Witwer mit drei Kindern zu heiraten. Als letzte emotionale Bindung blieben sporadische Besuche bei der in der Nähe wohnenden Mammy Jennie. In dieser verzweifelten Situation suchte Jack London einen Ausweg aus seiner Misere und beschloss, nie wieder die erniedrigende Lohnarbeit als „Arbeitstier“ aufzunehmen. Stattdessen wollte er nun selbstständig und sein eigener Boss werden.