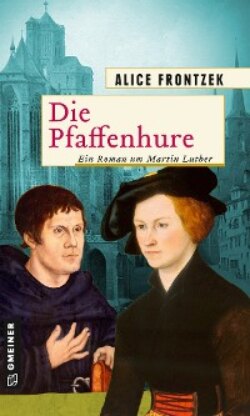Читать книгу Die Pfaffenhure - Alice Frontzek - Страница 6
Kapitel 2
Оглавление1501
Nach der Morgenandacht am Donnerstag servierte Grete eine letzte kleine Mahlzeit für die Familie und insbesondere für Martin, damit er und Hans den langen Weg bis zum nächsten Gasthaus durchhielten, ohne hungrig zu werden. Sie hatte einen Gemüseeintopf mit Möhren, Rüben, Kohl und etwas Rindfleisch zubereitet, würzig mit einem großen Stück Markknochen, Salz und etwas Bier. Dazu Brot. Ein großes Bündel Proviant hatte sie ebenfalls geschnürt: einen Laib Brot, ein Stück Schinken, einen Käse, getrocknete Pflaumen, Wein und Bier. Und natürlich die Geschenke für Frau Cotta und ihre Schwester – Honig, Wein und Kupferbecher aus dem Verkauf von Hans’ Hütte. Außerdem Messingbesteck für Martins Studentenleben, weiße Leinenbettwäsche, zwei Leinenhandtücher, Kleidung für kalte Tage und eine Decke. Martin packte sich Schreibzeug in eine flache Holzkiste: eine Schiefertafel, Kreide, zwei Bögen Pergament, Tinte, Feder und das Lateinbuch, das er zum Abschluss in Eisenach bekommen hatte. Wenn etwas fehlte, war es auch nicht so schlimm.
»Du bist ja nicht aus der Welt. Und in den Semesterferien kommst du nach Hause!«, sagte seine Mutter, als sie ihn zum Abschied auf die Stirn küsste.
Er umarmte seine Geschwister, streichelte den Schwestern über den Kopf und setzte sich zu seinem Vater auf den Kutschbock. Hans hatte sich von seinem Onkel einen kleinen Wagen geliehen. Davor hatte er seine zwei Pferde gespannt, die er mit Martin in Eisenach und Erfurt reiten wollte, sobald sie die Kutsche untergestellt hätten.
Der Vater hatte seinen besten Umhang gewählt, seine gute Sonntagshose sowie das weiße, geplättete Leinenhemd, das er nur zu besonderen Anlässen trug. Er wollte den Anschein erwecken, als sei dies seine tägliche Kleidung. Er strengte sich an, sich in seiner ungewöhnlichen Aufmachung wie selbstverständlich zu bewegen, doch der kleinste Grashalm, der winzigste Brotkrümel machten ihn nervös. Grete strich ihm säubernd über sein Hemd und klopfte ihm den Umhang ab. Dazu musste sie sich auf ihre Zehenspitzen stellen. »Gut siehst du aus! Viel Erfolg und gute Reise. Bleibt auf den Geleitstraßen. Gott schütze euch!«, verabschiedete sie sich von Mann und Sohn. Sie reichten sich die Hand. Dann trieb Hans die Pferde an.
Die Luft war noch frisch, der Himmel blau mit ein paar Schönwetterwölkchen, die Vögel zwitscherten, die Bäume trugen ihre ersten Knospen und der Boden war trocken. Es war ein perfekter Tag zum Reisen. Martin und Hans verließen Mansfeld und fuhren hinaus in die offene Landschaft. Auf den Wegen war es noch ruhig. Die meisten Menschen blieben um Karfreitag herum zu Hause. Es wurde kürzer gearbeitet und die Familie konnte sich in Haus und Hof den Ostervorbereitungen widmen, wie Grete, die buk und schmückte, um diesmal ohne Hans mit den Kindern ein schönes Osterfest zu verbringen.
Das Hufgeklapper der Pferde und das gleichmäßige Drehen der Kutschräder auf dem teils steinigen, teils erdigen Untergrund wurden lauter, je stiller es in der Natur wurde. Es entspannte Vater und Sohn nach dem lebhaften Abschied und den aufregenden Vorbesprechungen, sodass sie in angenehmes Schweigen verfielen und jeder seinen eigenen Gedanken nachhing. Die Pferde liefen ruhig, und hin und wieder begegnete ihnen jemand mit einem Fuhrwerk oder einem Handwagen, dem sie zum Gruße die Hand hoben. Das leichte Schaukeln auf dem Kutschbock ließ Martins Augen immer wieder zufallen, bis er beim nächsten Holpern erneut aufschreckte und sich zwang, wach zu bleiben. Schließlich wollte er nicht von der Kutsche fallen.
Mit zwei Zwischenübernachtungen in Sondershausen und Langensalza erreichten sie Eisenach am Samstagmittag. Zunächst bezogen sie einen Gasthof am Georgentor, wo sie die Pferde ausspannen und die Kutsche unter einem Dach abstellen konnten. Gegen einen Obolus wurden Hans’ Brauner und Martins Rappe versorgt. Dann machten sich die Männer auf den Weg zum Haus der Cottas.
Martin kannte sich aus und lief seinem Vater einen Schritt voraus. »Immer in Richtung Georgskirche. Da ist der Turm!«, sagte er.
»Ich weiß, schließlich bin ich auch nicht das erste Mal hier«, versuchte Hans mitzuhalten.
Sie kamen auf den weiten Marktplatz mit dem Trinkbrunnen, der großen Kirche, die Martin regelmäßig zu den Gottesdiensten besucht hatte, und dem Rathaus. Ringsherum standen stattliche Häuser, und eins davon war das der Familie Cotta. Es hatte drei Stockwerke und einen großen Dachboden. Der untere Bereich war massiv aus Stein und weiß getüncht, darüber befand sich verziertes Fachwerk, grau gestrichen. Es gab viele Fenster, dekorativ geschnitzte Türen und ein großes Tor. Martin fasste seinen Vater am Ärmel und zog ihn schneller vorwärts. Sie standen vor der schweren braunen Holztür mit dem Löwenklopfer und der Schelle an der Seite. Martin zog an der Schnur. Dann hörten sie Schritte, das Zurückschieben eines Riegels – die Magd öffnete. Es war Marie, die Martin bei seiner Abreise noch eine Extraportion Wurst zugesteckt hatte. Sie war sichtlich erfreut. Man hatte die beiden schon erwartet, denn nun erschien Frau Cotta in der Tür, gefolgt von ihrem Mann Conrad und einer Kinderschar. »Kommen Sie herein, Herr Ludher, was für eine Freude, dich so schnell wiederzusehen, Martin. Herein, herein!« Frau Cotta machte eine einladende Geste.
»Guten Tag, Hans. Grüß dich, Martin!«, meldete sich nun auch Conrad Cotta zu Wort, der Hans bei dessen Besuch vor einem Jahr das Du angeboten hatte.
Martin begrüßte die Mädchen, die ihm fast wie Schwestern ans Herz gewachsen waren. Die Älteste, fast vierzehn, zog ihn etwas schüchtern in Richtung guter Stube. Sie hieß Clara und trug ihre langen Haare zu zwei Zöpfen geflochten, die ihr hübsches Gesicht umspielten. Martin und sie hatten sich fast ein wenig ineinander verliebt. Das glaubte er jedenfalls, und ihre Zaghaftigkeit heute bestätigte ihm seinen Verdacht. Gesprochen hatten sie darüber nie, und natürlich konnte daraus nichts werden, denn damit hätte er Frau Cottas Vertrauen missbraucht, der er nichts als Dankbarkeit schuldete.
Sie gingen in die große Stube. Der Boden dort hatte breite, gewachste Holzdielen, und die Wände wiesen bis zur Hälfte eine Holzvertäfelung auf, die mit einer umlaufenden, durch Schnitzereien verzierten Leiste abschloss. Es gab einen Kachelofen, sowie einen hohen schmalen Holzschrank neben der Tür, der optisch jenen Teil des Raumes abtrennte, in dem ein großes Himmelbett stand. Sein grüner, schwerer Samtvorhang war bis auf einen Spalt zugezogen, durch den man kostbaren Bettstoff, ebenfalls in Grün mit Mustern, erkennen konnte.
Der Esstisch stand in der Mitte des Zimmers. Die Magd Marie stellte gerade eine große Zinnschüssel mit einer silbernen Kelle darauf. Es roch nach warmer, würziger Suppe. Neun Zinnteller waren eingedeckt.
Die drei Kleinsten setzten sich auf eine mit einer bunten Decke belegte Bank an das eine Ende des Tisches, Frau Cotta, ihre Tochter Clara und die Großmutter, die gerade hinzugekommen war, an eine der Längsseiten, ihnen gegenüber Martin und Hans, an den Kopf des Tisches Conrad, der Hausherr.
»Bitte nehmt Euch von dem Wein!«, forderte Frau Cotta die Gäste auf.
Sie reichten die Weinkanne herum, den Kindern schenkte die Magd ein leichtes Bier ein.
»Ich möchte mich noch mal sehr herzlich bei Euch bedanken. Martin hat sich bei Euch so wunderbar entwickelt. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden wäre, hätte er nicht Eure freundliche Aufnahme erfahren. Er weiß sich zu benehmen wie ein feiner Herr«, wandte Hans sich an die Gastgeberin.
»Ja, er hat sich sehr gemacht. Ich sehe ihn noch vor mir stehen, ganz schüchtern, meist die Augen gesenkt, nervös mit den Fingern spielend. Aber sein ehrlicher Blick, die klare Stimme, seine ernsten Gebete und seine schnelle Auffassungsgabe sind mir gleich positiv aufgefallen. Auch sein Flötenspiel zeigte Hingabe und Musikalität. Es hätte mir leidgetan, so ein Potenzial ungefördert verloren gehen zu lassen. Seid ganz unbesorgt und fühlt Euch nicht verpflichtet. Er war eine Bereicherung, ein Quell der Freude und auch hier und da eine große Hilfe im Haus.« Frau Cotta nickte Martin lächelnd zu.
Hans öffnete seinen Säckel, den er neben seinen Stuhl gestellt hatte. »Meine Frau schickt ein paar gute Dinge zum Dank: selbst gemachten Honig, eine Flasche unseres Weins – wir haben seit einem Jahr einen kleinen Weinberg – und geräucherte Wurst der letzten Schlachtung, eine Spezialität.«
»Vielen Dank! Wir werden uns alles schmecken lassen. Marie, bring diese Köstlichkeiten bitte in die Vorratskammer. Aber nun lasst uns ein Tischgebet sprechen. Martin, gib uns die Ehre!«
Martin faltete die Hände, schloss die Augen und sprach: »Speis uns, Vater, Deine Kinder, tröste die betrübten Sünder, sprich den Segen zu den Gaben, die wir jetzt hier vor uns haben, dass sie uns zu diesem Leben, Stärke, Kraft und Nahrung geben, bis wir endlich mit den Frommen zu der Himmelsmahlzeit kommen. Amen.«
»Danke, das war sehr schön. Greift zu!«, bat Frau Cotta.
Sie ließen sich die Suppe schmecken, die gefolgt wurde von einem Zanderbraten mit Gemüse und Brot. Zum Nachtisch gab es Grießbrei mit geschmolzenem Zucker und etwas Zimt. Das Schweigegebot während des Essens wurde heute nicht so streng genommen. Nur mit vollem Mund durfte nicht gesprochen werden. Bei den Jüngeren gab es viel zu kichern, was mit einem bösen Blick des Vaters quittiert wurde. Die Erwachsenen, zu denen Martin nun gezählt wurde, unterhielten sich noch lange am Tisch über das anstehende Studium, über Erfurt, über den Transport ihrer Briefe mit Boten und dem Postdienst einiger Zünfte, über das kleine Eisenach mit seinen dreitausend Einwohnern, über Magdeburg mit den fast fünfzehntausend Einwohnern und darüber, was Martin besser gefiele.
»Nun, eine große Stadt ist natürlich sehr aufregend, es gibt viel zu entdecken, viel Neues und Merkwürdiges. In einer Stadt wie Eisenach fühlt man sich sicher, alles ist schnell vertraut. In Magdeburg hatte ich einst ein Erlebnis, das ich bis heute nicht vergesse: Ich habe mit diesen meinen Augen einen Fürsten von Anhalt gesehen, der in der Breiten Straße zu Magdeburg in einer Barfüßerkutte umherging und um Brot bettelte. Auf seinem fast bis zum Boden gekrümmten Rücken trug er einen Sack wie ein Esel. Er sah aus wie ein Totenbild, nur Haut und Knochen. Ich weiß, wie ich vor Andacht erstarrte und mich meines eigenen Standes, der ja weiß Gott nicht hoch ist, schämte. Ich hatte Angst, dass diese Frömmigkeit womöglich die einzig Richtige ist. Seitdem ist mir Magdeburg unheimlich.«
Alle lachten und schenkten sich erneut ein.
»Nein, die zehn Gebote muss man einhalten, die Kirche besuchen und aufrichtig beten. Meint das Schicksal es gut mit einem, dann soll man den Armen geben und mit Ablässen die Kirche unterstützen. Wem nützt es, wenn man sich selber zu Tode darbt? Hat jemand Hände zum Arbeiten oder einen Kopf zum Denken, so soll er sie auch nutzen. Nicht umsonst hat Gott einen jeden von uns mit speziellen Gaben gesegnet!«
Alle stimmten Conrad zu. Er war ein großer, kräftiger Mann mit kantigem Gesicht und einem Schnurrbart. Seine Kleidung war aus feinem Stoff in Tannengrün. Er war Obervierherr von Eisenach, niemand bezweifelte seine Autorität und die Unumstößlichkeit seiner Aussagen.
Ursula Cotta ergänzte: »Ja, diese Unsicherheit habe ich bei dir bemerkt, aber nun gehst du aufrecht, kannst einem in die Augen sehen, hältst deine Finger still«, hier zwinkerte sie Martin lächelnd zu, »und du weißt, dass rechte Frömmigkeit Aufrichtigkeit, Fleiß und regelmäßiges Beten bedeutet. Nichts, wovor man sich fürchten muss.«
Ursula war jünger als Martins Mutter, vielleicht Mitte dreißig. Sie war schlank, etwa einen Meter fünfundsechzig groß, hatte feine Gesichtszüge, eine kleine, sehr gerade Nase, blaue Augen, wohlgeformte Lippen und eine helle, glatte Haut. Ihr Gesicht war umrahmt von einem weißen Schleier mit einem breiten Spitzensaum. Sie trug ein langes, glatt herunterfallendes weinrotes Samtkleid mit weinrot-wollweiß gemusterten langen Ärmeln. Um die Hüfte hatte sie einen dünnen Gürtel gebunden, an dem ein Samtsäckchen hing, in welchem sie ihr Taschentuch und ihren Rosenkranz, Haarnadeln und immer ein paar Münzen aufbewahrte.
Hans war still geworden. Sein Bauch krampfte ein wenig, denn bruchstückhaft fiel ihm ein, wie er in Eisleben einmal seinen Knecht so übel zugerichtet hatte, dass dieser nicht mehr aufgestanden war. Der Schurke hatte geklaut und es nicht zugeben wollen. Trotzdem war Hans’ Ruf danach angeschlagen gewesen. Er hatte die abfälligen Blicke der Leute nicht länger ertragen und mehrere Ablässe gekauft. Irgendwann musste es auch mal gut sein, fand er, es war immerhin ein Unfall gewesen! Auf den Vorschlag seines Onkels waren sie schließlich nach Mansleben umgezogen. Ein Jahr, nachdem Martin geboren worden war. Am 10. November des Nachts war der Kleine zur Welt gekommen und gleich am nächsten Tag auf den Namen des Heiligen Martin getauft worden. Ja, er, Hans, war nicht ganz unschuldig daran, dass Martin Frömmigkeit mit Angst verband. Wie oft hatte er sich nicht anders zu helfen gewusst, als seinen Sohn damit einzuschüchtern, dass Gott ihn bestrafen würde, wäre er nicht gehorsam! Wie sollte er ihn sonst erziehen? Vielleicht hätte er ihm stattdessen öfter sagen sollen, welche Dinge Gott mit Wohlwollen sah … einfach von der anderen Seite betrachtet. Doch tatsächlich war der Teufel überall. Als seine Frau eine neugeborene Tochter verlor, waren sie sich sicher gewesen, die Nachbarin habe sie verflucht, und freuten sich, als diese erschlagen aufgefunden und wahrscheinlich vom Teufel geholt worden war. Ja, das hatte Martin sicher alles Angst gemacht. Aber seine eigenen Eltern hatten Hans die Regeln des Lebens auch nicht anders vermittelt.
Und? War er nun nicht auf dem besten Wege, doch zu etwas zu kommen? Immerhin war er ordentlich gekleidet, sein Gesicht war gewaschen und geölt, damit die Falten und die trockene Haut nicht verrieten, welch harte Arbeit lange Zeit sein Leben bestimmt hatte. Er war zweiundvierzig Jahre alt. Ein Mann in den besten Jahren! Was pflegte er immer zu sagen: »Wer im zwanzigsten Jahr nicht schön, im dreißigsten nicht stark, im vierzigsten nicht klug und im fünfzigsten nicht reich ist, der darf danach nicht hoffen.« Klüger war er geworden, und reich zu sein, war er auf dem besten Wege. Er unterbrach seine Gedanken. Seine zeitweiligen Gewissensbisse hatten hier jetzt nichts verloren.
Frau Cotta brachte gerade drei Flöten und bat Martin, mit ihr und Clara die Lieder zu spielen, die sie gemeinsam geübt hatten. Hans war sehr beeindruckt und musste sich zusammenreißen, dass ihm nicht vor Rührung die Tränen kamen. Martin spielte wirklich schön – das hatte er gar nicht gewusst!
Als die Kirchturmuhr von St. Georg viermal läutete, verabschiedeten sie sich und besuchten Gretes Schwester Elisabeth. Nein, sie würden nicht zum Abendbrot bleiben, beschieden sie die Tante. Sie wären müde, müssten noch nach den Pferden sehen und morgen in aller Herrgottsfrühe nach Erfurt aufbrechen. Aber ob Elisabeth sie nicht noch zum Sechs-Uhr-Gottesdienst begleiten wolle, um für gutes Geleit für ihren Neffen und ihren Schwager auf ihrer Reise und einen guten Studienbeginn für Martin zu bitten?
Elisabeth willigte ein, und so gingen sie gemeinsam zurück zum Marktplatz zur Kirche, wo sie der Familie Cotta in den vorderen Bänken zuwinkten. Die Cottas gehörten zu den Bürgern, die dort ihren reservierten Platz hatten. Elisabeth, Hans und Martin standen mit vielen anderen Eisenachern etwas weiter hinten, knieten sich zum Gebet auf Bahnen von Decken, die vor ihnen lagen, und lauschten der lateinischen Predigt des Priesters. Während Hans die Bilder in den Kirchenfenstern betrachtete und das eintönige Singsang des Geistlichen ihn müde werden ließ, freute sich Martin, dass er alles verstand und hier und da Grammatikfehler des Priesters erkannte. Zweimal musste er gar innerlich lachen, denn der Prediger verwechselte ähnlich klingende lateinische Ausdrücke, die aber gänzlich unterschiedliche Bedeutungen hatten. So wollte er einen Heiligen »celleberimus«, der Gefeiertste, nennen, sagte stattdessen aber »cellerimus«, was den Heiligen zum Schnellsten machte. Martin verkniff es sich, laut loszuprusten, und schaute sich um. Niemand sonst schien den Fehler bemerkt zu haben, sein Lateinlehrer war nicht zu sehen, zwei alte Klassenkameraden auf der anderen Seite waren damit beschäftigt, die anwesenden Mädchen mit Mimik und Gestik zu kommentieren, und hatten offenbar nicht zugehört. Na ja.
Nach der Kirche wurde sich abermals, aber diesmal etwas kürzer, von den Cottas und von Elisabeth und anderen Bekannten verabschiedet. Dann gingen Vater und Sohn zügig in ihr Gasthaus, aßen noch einen kleinen Happen, tranken jeder einen Krug Bier und schliefen bis zum ersten Hahnenschrei.