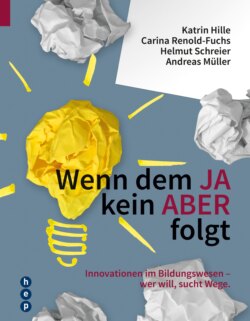Читать книгу Wenn dem JA kein ABER folgt - Felicia, Andreas Müller - Страница 4
Vorwort – Von Helmut Schreier
ОглавлениеVorwort
Von Helmut Schreier
U
nsere Auswahl positiver Beispiele ist eine zufällige Zusammenstellung, die derzeit bestehende Möglichkeiten pädagogischer Arbeit im Bildungswesen spiegelt. Wir vier Interviewer befassen uns seit Jahren mit der Entwicklung des Schulwesens. Deshalb pflegen wir ein gewissermassen professionelles Interesse an Begegnungen mit Persönlichkeiten, die als Kronzeugen für die Reformfähigkeit des Systems erscheinen. Auf diese Weise entsteht eine kurze Liste. Sie gestattet keinen Hinweis auf den Anteil erfolgreich-positiver Persönlichkeiten an der Gesamtzahl pädagogischer Söldner. Immerhin bleibt die Vermutung zulässig, dass an den Schulen Dutzende, aufs Ganze gesehen vielleicht Hunderte von Menschen derart hingebungsvoll pädagogisch tätig sind, dass das im Titel genannte Merkmal erfüllt ist. Wir verstehen dies «Wenn dem Ja kein Aber folgt» als Indiz für Tätigkeiten, die eine Antwort auf den Anspruch unternehmen, der in den Wörtern «Bildung» und «Erziehung» aufscheint. Die abstrakten und irgendwie abgegriffenen Begriffe wollen in jeder neuen gesellschaftlichen Lage neu mit Sinn gefüllt werden. In einem Erfindungsprozess, der immer auch als ein Selbstfindungsprozess beschrieben werden kann. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass unsere Gesprächspartner als Personen von ihrer Arbeit erfüllt sind und insofern als glückliche Menschen erscheinen.
Erfolgreiche Praxis ist in mancher Hinsicht komplexer als jedes Theoretisieren, sie umfasst etwa die Kompetenz dafür, sämtliche Einflüsse und Kräfte zu überblicken, die im Arbeitsfeld wirksam sind, und die Bereitschaft dazu, sich mit allen auf mehr oder weniger diplomatische Weise einzulassen. Es ist notwendig, die Anwendung und Ausbreitung pädagogischer Leitvorstellungen gegen blockierende und bremsende Kräfte durchzusetzen, Alliierte zu suchen, sich langfristig zu engagieren, nicht ohne die Bereitschaft, immer wieder von vorne anzufangen.
So sind es folgerichtig auch die in der Praxis Tätigen, die den Zusammenhang der pädagogischen Entwicklung entgegen den das Umfeld beherrschenden Erstarrungstendenzen am Leben halten und ihn vorantreiben. Sie sind sozusagen die Flügel des pädagogischen Diskurses, auch wenn sie manchmal dazu neigen, sich selber eher als Einzelkämpfer wahrzunehmen. Vergleichsweise gering an Zahl, fällt ihr Einfluss doch stark ins Gewicht: Es handelt sich ja um die intelligente Vorhut der Praxis, deren Verhalten nicht von starrer Routine bestimmt wird, sondern durch Intelligenz, die aus der sensiblen Auseinandersetzung mit der gegeben Situation hervorgeht und die daraus folgenden Tätigkeiten informiert. So halten diese Menschen die alte Aufgabe der Pädagogik am Leben und finden neue Muster, von denen wir teilnehmenden Beobachter hoffen, dass sie als Impulse ermutigend und anregend wirken werden.
Einige Punkte der neuen Muster treten hervor. Sie deuten die Umrisse einer neuen pädagogischen Kultur an. Einer Kultur, die jene Herausforderungen erkannt und angenommen hat, die teils mit der neuen Generation selbst und teils mit den veränderten Bedingungen der Arbeitswelt aufgetaucht sind:
Die Heterogenität der Herkunft der Kinder und Jugendlichen nimmt zu, ihre unterschiedlichen Profile und ihre verschiedenartigen Anlagen und Fähigkeiten, ihre aus dem Rahmen dessen, was als Norm galt, herausfallenden besonderen Handicaps und Behinderungen – all das steigt an und führt dazu, dass das alte Modell der Schule gewissermassen vor die Wand fährt. Kein Wunder, denn die ihr traditionell verfügbaren Instrumente – Belehrung und Zensur – gleichen Hammer und Meissel, während die neue Generation von Schülern mit elektronischer Informationstechnik umgeht und im Bann des Internets steht. Das Ungleichzeitige der beiden Welten kommt schmerzhaft zu Bewusstsein, wenn man bedenkt, dass die wesentlichen Zwecke und Mittel der alten Schule – Zensurenerteilung und Selektion – zutiefst unpädagogisch sind, ja an der Grenze zum Menschenfeindlichen liegen.
Es ist interessant zu beobachten, wie Impulse zur Abschaffung des in der Schule gezüchteten Konkurrenzverhaltens ausgerechnet aus der Arbeitswelt kommen, wo man längst begriffen hat, dass Leistung vor allem als Kooperations-Kompetenz Sinn macht. Und es ist die Arbeitswelt, die anstelle der Zensuren das Können ermittelt und als gemeinsame Währung eingesetzt sehen möchte. Persönlichkeiten in pädagogischen Berufen, die ihren pädagogischen Auftrag ernst nehmen, finden möglicherweise eher Verbündete in der Arbeitswelt und unter den in dieser Welt tätigen Eltern als in der verwalteten Welt des Schulwesens.
Entscheidendes Kriterium für den Erfolg bleibt der Bildungsprozess der Kinder und Heranwachsenden. Sein Gelingen vermittelt die Kraft zum Weiterarbeiten. Unsere Gesprächspartner haben die Erneuerung an der ihnen zugänglichen Stelle zu ihrer Sache gemacht. Sie durchschauen die Funktion der Bedenken, die ihnen anfangs von vielen Seiten als Grund dafür vorgetragen werden, lieber alles beim Alten zu lassen; anstelle dieses «Aber» neigen sie zum «wie»: «Wie schaffen wir das?»
In der Begegnung mit ihnen nehmen wir die Intensität ihres Engagements wahr und finden uns von ihrer positiven Haltung angesteckt.