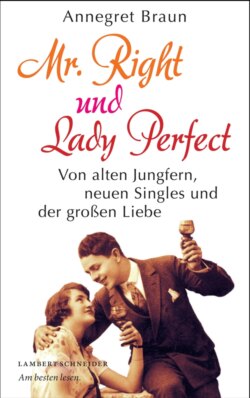Читать книгу Mr. Right und Lady Perfect - Annegret Braun - Страница 11
Brautschau als Geschäft – arrangierte Ehen
Оглавление„Ich wünschte nur einen wirklichen Freund, dem ich mein Herz und mein ganzes Vertrauen zu schenken vermöchte; dem ich Neigung und Zuversicht entgegenbrächte und der mein Glück, wie ich das seine machen könnte.“
Wilhelmine von Bayreuth
Von einer Liebesheirat konnten adelige Mädchen wie Wilhelmine von Bayreuth (1709–1758) nur träumen. Liebe zwischen Mann und Frau gibt es schon seit Adam und Eva, aber nicht eine Heirat aus Liebe. Das gab es jahrhundertelang nur in Romanen oder bei Künstlern. Liebe war das eine, Heirat das andere. So hielt es der Adel, zumindest die Männer. Manche hatten kaum mehr einen Überblick über ihre Mätressen. Wurden die Geliebten zu fordernd, dann machten die Herrscher kurzen Prozess und entledigten sich ihrer durch das Schwert. Oder sie ließen ihre einst innig Geliebten gnadenlos in den Kerker werfen oder in die Verbannung schicken. Liebe und Leidenschaft sind flüchtige Gefühle, auch beim Adel.
Bei der Heirat hingegen wollte sich der Adel lieber nicht auf so schwankende Gefühlszustände verlassen. Da zählten andere Werte: Macht und Reichtum – und der Stammbaum. Der durfte keinen Fehler aufweisen. Durch eine strategisch kluge Verheiratung festigten die Herrscher politische Verbindungen – eine frühe Form des Networking – oder sie erweiterten ihr Reich. Eine Heirat war preisgünstiger als ein Krieg.
„Die Kurprinzessin hatte dort [in Hannover] im Jahre 1707 einen Prinzen geboren. Da unsere Jahre sich entsprachen, wollten unsere Eltern die Bande ihrer eigenen Freundschaft befestigen, indem sie uns füreinander bestimmten. Mein kleiner Liebhaber fing sogar damals schon an, mir Geschenke zu schicken, und mit jeder Post unterhielten sich die beiden Fürstinnen über die zukünftige Vereinigung ihrer Kinder.“
Wilhelmine, damals im Kleinkindalter, über einen ihrer Heiratskandidaten
Die Wahl der ehelichen Verbindung musste wohlüberlegt sein und konnte nicht früh genug eingefädelt werden. In dem Alter, in dem Kindergartenkinder heute Vater-Mutter-Kind spielen, hatte eine kleine Adelstochter vor 300 Jahren schon einige Heiratskandidaten. So auch Wilhelmine von Bayreuth. Sie war die Tochter des preußischen Königs Friedrich Wilhelm I. (1688–1740), dem „Soldatenkönig“, und die ältere Schwester von Friedrich dem Großen (1712–1786). König Friedrich und seine Frau Sophie ließen keine Zeit verstreichen, sondern verhandelten mit dem europäischen Hochadel, kaum dass die Prinzessin aus den Windeln war. Mehrere Heiratskandidaten waren im Gespräch, erzählt Wilhelmine in ihren Erinnerungen. Ihre Memoiren sind eine kulturgeschichtliche Kostbarkeit, denn sie geben einen seltenen Einblick in die Gefühlswelt einer Königstochter im frühen 18. Jahrhundert. Der Favorit ihrer Mutter war der Prinz von Wales. Er würde in die Fußstapfen seines Vaters Georg II. treten und König von England werden. Königin Sophie versuchte, ihrer Tochter die Heirat mit dem englischen Kronprinzen schmackhaft zu machen: „Er ist gutherzig, aber von sehr geringem Verstand, eher hässlich wie schön und sogar etwas verwachsen. Sofern Sie sich ihm nur gefällig zeigen und seine Ausschweifungen dulden, werden Sie ihn gänzlich beherrschen und nach dem Tode seines Vaters mehr König sein als er. Bedenken Sie nur, wie groß Ihre Macht sein wird, von Ihnen wird das Wohl und Wehe Europas abhängig sein und Sie werden die Nation beherrschen.“
Einen Traumprinzen stellt man sich anders vor. Auch Wilhelmine stand nicht auf Weicheier, dazu noch einer, der nur Frauen und Partys im Kopf hatte. Sie schrieb in ihren Erinnerungen: „Welche Achtung und Rücksicht könnte man einem Manne erzeigen, der sich gänzlich beherrschen lässt und das Wohl seines Landes vernachlässigt, um sich wilden Vergnügungen hinzugeben.“ Wilhelmine ließ sich ihren Widerwillen nicht anmerken, aber sie war von der Beschreibung ihrer Mutter alles andere als begeistert. Ein eigenes Bild über sein Äußeres konnte sie sich nicht machen, denn Fotos gab es damals noch nicht und die gemalten Porträts waren ungefähr so realitätsnah wie das Bild eines Fotomodells nach der Computerbearbeitung.
Ihr Vater hingegen hatte ganz andere Pläne für seine Tochter. Er wollte Wilhelmine mit dem 24 Jahre älteren Herzog von Weißenfels verheiraten. Eine wirklich Alternative war das nicht: „Sein Gesicht war eher unangenehm als sympathisch; er war klein und schrecklich dick, er war weltgewandt, insgeheim aber brutal und bei alledem von sehr lockeren Sitten“, so beschrieb Wilhelmine diesen Heiratskandidaten, dem sie immerhin bei einem Fest persönlich begegnet war.
Dass die Eltern so gegensätzliche Vorstellungen von ihrem zukünftigen Schwiegersohn hatten, führte zu einem erbitterten Kleinkrieg zwischen König Friedrich und seiner Frau. Jeder versuchte, seinen Favoriten durchzusetzen und Wilhelmine auf die eigene Seite zu ziehen. Die Königin zeterte, dass sie ihre Tochter lieber tot sähe als in einer Ehe mit Weißenfels. Und der König drohte seiner Gattin, sie mitsamt ihrer missratenen Tochter in die Verbannung zu schicken. Der Kampf zog sich über viele Jahre hinweg: Der König befahl und die Königin intrigierte. Jeder setzte das Machtmittel ein, das ihm zur Verfügung stand. Zusätzlich setzten die beiden ihre Tochter mit Liebesentzug, Beschimpfungen, Schlägen, Zimmerarrest bei Wasser ohne Brot und anderen Strafen unter Druck. Man kann sich kaum vorstellen, wie sehr Wilhelmines Kinderseele darunter gelitten haben muss.
Doch dann bahnte sich eine Wende an. Ihr Vater zog einen neuen Heiratskandidaten aus der Tasche. Die beiden bisherigen Heiratskandidaten waren weit von dem entfernt, was sich ein junges Mädchen erträumte, aber es kam noch schlimmer: Der neue Kandidat war 50 Jahre alt und hatte Syphilis. Es war August der Starke, Kurfürst von Sachsen und König von Polen. Ausgerechnet dieser unersättliche Frauenheld, der so viele Mätressen hatte, dass ein Harem dagegen einem Kaffeekränzchen glich. Der sächsische Kurfürst sei Vater von 350 Kindern, schrieb Wilhelmine. Eine eindrucksvolle Zahl, aber wahrscheinlich reichlich übertrieben. Niemand wird über Augusts Nachkommenschaft Buch geführt haben und bei seinen vielen Amouren hatte der Kurfürst wahrscheinlich den Überblick schon längst verloren. Sein ausschweifendes Leben hatte deutliche Spuren hinterlassen. Syphilis und Diabetes schmerzten ihn sehr. Bei seinem Antrittsbesuch im preußischen Königshaus musste er auf einem gepolsterten Schemel Platz nehmen, weil er vor Schmerzen nicht auf einem normalen Stuhl sitzen konnte. Weder sein Frauenverschleiß noch seine Gebrechlichkeit schreckten das preußische Königspaar ab, diesen Mann ihrer Tochter zu geben. Sogar Sophie war bereit, ihren Wunschkandidaten, den Prinzen von Wales, zugunsten von August fallen zu lassen. Immerhin war er ein König und ein standesgemäßer Ehemann.
So kamen Friedrich Wilhelm I. und August der Starke miteinander ins Geschäft. Dabei profitierte vor allem August davon. Er bekam nicht nur eine blutjunge Ehefrau, sondern auch noch einige Extras: Soldaten für sein Heer und eine gute Mitgift. Alles schien perfekt, zumindest für das preußische Königspaar und den Heiratskandidaten, für Wilhelmine wahrscheinlich nicht. Dennoch war sie einfach nur froh, dass die Eltern in dem jahrelangen Kleinkrieg endlich mal einer Meinung waren. Der Waffenstillstand währte jedoch nur kurz. Keiner hatte mit Augusts Sohn gerechnet. Er verweigerte seine Unterschrift unter diesem Heiratsabkommen und machte damit einen Strich durch die Rechnung.
Nachdem August aus dem Rennen geflogen war, holten Wilhelmines Eltern ihre vorherigen Heiratskandidaten wieder hervor und der Kampf ging mit der gleichen Härte weiter. Nachdem sich auf dem Schlachtfeld der Eltern immer noch kein Sieger abzeichnete, schleppte der Vater wieder einen neuen Heiratskandidaten an: Friedrich III. von Brandenburg-Bayreuth. Er würde als Markgraf zwar nur über ein kleines Reich herrschen, aber man sagte ihm einen guten Charakter nach. Wilhelmine gefiel dieser Bewerber deutlich besser: „Dieser Fürst ist groß und von schönem Wuchs, er sieht vornehm aus, seine Züge sind weder regelmäßig noch schön, jedoch seine offene, einnehmende und sympathische Physiognomie entschädigt ihn für mangelnde Schönheit. Er schien sehr lebhaft, schlagfertig und keineswegs schüchtern.“ Es war zwar nicht Mr. Right, aber doch weitaus besser als alles, was ihr bisher geboten wurde. Im Vergleich zu den bisherigen Kandidaten war er fast schon ein Traummann.
„Sie durchbohren mir das Herz, indem Sie mir den größten Kummer zufügen, den ich jemals erfahren habe. Ich habe all meine Hoffnung auf Sie gesetzt, aber ich kannte Sie schlecht. Sie haben mir auf geschickte Weise die Bosheit Ihres Herzens und Ihre niedrige Gesinnung verheimlicht. Ich bereue all meine Güte für Sie und meine Sorge um Ihre Erziehung und alle Mühen, die ich Ihretwegen erduldete. Ich erkenne Sie nicht länger als meine Tochter an und sehe in Ihnen von nun an meine ärgste Feindin, da Sie es sind, die mich meinen Gegnern, die jetzt triumphieren, geopfert hat. Rechnen Sie nicht mehr auf mich; ich schwöre Ihnen einen ewigen Haß und werde Ihnen niemals verzeihen.“
Brief von Königin Sophie an ihre Tochter Wilhelmine, als diese sich mit den Heiratsplänen ihres Vaters einverstanden erklärte
In den Augen von Königin Sophie war er jedoch ein unwürdiger Kandidat. Sie hatte ihre Tochter zur Königin erzogen. Wilhelmine an einen Markgrafen zu geben, war für sie reine Verschwendung. Sophie war sehr erbost, dass ihre Tochter gegenüber den Heiratsplänen des Königs keinen Widerstand zeigte und intrigierte unermüdlich weiter. Sogar als Wilhelmine und der Markgraf sich verlobt hatten, versuchte Sophie noch, den englischen Kronprinzen von seiner Insel zu bewegen, um in letzter Minute einzuschreiten und die verhasste Verlobung zu lösen. Doch der ersehnte Retter kam nicht. So heiratete Wilhelmine ihren Prinzen von Bayreuth. Nach dem ganzen Drama war es fast so etwas wie ein Happy End. Bei der Hochzeit, so schrieb sie in ihren Memoiren, empfand sie gegenüber dem Prinzen keinerlei Abneigung, was bei den damaligen Heiratspraktiken einer Liebeserklärung gleichkam. Und als sie ihren Ehemann näher kennenlernte, entstand in ihr eine tiefe Zuneigung: „Ich liebte ihn leidenschaftlich; die Gleichheit der Gemütsart und der Charaktere ist ein starkes Band; in uns war sie vorhanden.“
Wilhelmine sehnte sich nach einer gegenseitigen Liebe, in der man sich treu ist: „Die wahre Liebe duldet keine Teilung. Ein Mann, der Mätressen hat, schließt sich an diese an; und in dem Maße verringert sich in ihm die Liebe für die rechtmäßige Gemahlin.“ Ewige Treue von einem Mann? Das waren damals schon utopische Vorstellungen. Nachdem die erste Leidenschaft verflogen war, legte sich ihr Mann, wie die anderen Männer, eine Mätresse zu. Das war damals für das Image genauso wichtig wie heute der Luxusdienstwagen auf dem reservierten Parkplatz direkt neben dem Firmeneingang. Dass ihr Ehemann eine Mätresse hatte und sie auch noch so öffentlich präsentierte, verletzte Wilhelmine sehr. Um die Schöne aus dem Bannkreis ihres Mannes zu entfernen, verheiratete sie die Geliebte nach Österreich.
Aus der Königstochter, die ein Spielball der höfischen Zwänge war, erblühte eine Frau, die ihr Leben selbst in die Hand nahm. Sie komponierte, schrieb und widmete sich mit großer Leidenschaft der Architektur. Wilhelmine baute das Opernhaus und das neue Schloss und schuf aus dem Provinznest Bayreuth eine der prunkvollsten Städte des 18. Jahrhunderts.
Nicht alle Adeligen setzten eine Heirat so gewaltsam durch wie Wilhelmines ehrgeizige Eltern, aber Politik und diplomatische Beziehungen waren auch in anderen europäischen Herrscherhäusern zu wichtig, um Rücksicht auf die persönlichen Vorlieben der Kinder nehmen zu können.
Auch im Bürgertum war die Heirat von strategischen Überlegungen bestimmt. Das Kind musste schließlich gut versorgt sein. Oder der Vater benötigte bessere Bankverbindungen und hielt Ausschau nach einem geeigneten Bankier für sein Töchterchen. Es waren die Eltern, die nach einem geeigneten Schwiegersohn oder einer passenden Schwiegertochter suchten.
Eine gute Partie zu finden, beschäftigte die Eltern über Jahre. Sie mussten den Heiratsmarkt beobachten, wer gerade auf Brautschau war oder wen man im Blick haben sollte, weil er oder sie bald das Heiratsalter erreicht haben würde. Zusätzlich musste man unauffällig Erkundigungen über die finanziellen Verhältnisse und den Lebenswandel der Wunschkandidaten einholen. Dieser Aufgabe gingen die Eltern damals mit dem gleichen Eifer nach wie die Eltern heute bei der Suche nach der richtigen Schule für ihren Nachwuchs. Je wohlhabender die Eltern, umso höher der Anspruch. Das Geld muss schließlich gewinnbringend investiert werden.
„Und als ich wieder heim kommen war, handelte Hanns Frej mit meinem Vater und gab mir seine Tochter mit Namen Jungfrau Agnes, und gab mir zu ihr 200 fl. [Gulden] und hielt die Hochzeit“.
Albrecht Dürer über seine Hochzeit 1494, nachdem er von seinen Lehrjahren in der Fremde zurückgekehrt war
Die Ehen waren früher genauso gut oder schlecht wie die heutigen Liebesehen. Glück bedeutete damals, einen Gefährten gefunden zu haben, der einen durch das Leben begleitete und mit dem man eine Familie gründete. Bis ins 19. Jahrhundert stand nicht die Person im Mittelpunkt, sondern die Funktion. Die Rolle als Ehefrau oder als Ehemann musste von jemandem besetzt werden, der sich dafür eignete. Wurden die Eltern mit dem einen Heiratskandidaten nicht einig, trat man eben mit einem anderen in Verhandlung. Der Mensch als Individuum steckte noch in den Kinderschuhen. Dennoch zeigt die Geschichte immer wieder Liebende, die sich niemals mit einem anderen zufrieden gegeben hätten. Das Alte Testament erzählt von Jakob, der sich in Rahel verliebte und sie unbedingt heiraten wollte. Ihr Vater verlangte jedoch, dass Jakob sieben Jahre lang für ihn arbeitete. Jakob, immer seine Traumfrau vor Augen, schuftete für seinen zukünftigen Schwiegervater unentgeltlich und wie sich später herausstellte, auch umsonst. Nach den sieben Jahren gab ihm sein Schwiegervater Lea zur Frau, die ältere Schwester. Sie musste zuerst verheiratet werden. Das bemerkte Jakob aber erst nach der Hochzeitsnacht, als er seiner Angetrauten den Schleier lüftete. Doch Jakob wollte unbedingt seine große Liebe Rahel heiraten. Und da die Männer früher mehrere Frauen haben konnten, gab ihm sein Schwiegervater nach der Brautwoche auch Rahel zur Braut, aber nur unter der Bedingung, dass er ihm nochmal sieben Jahre als Knecht diente.
Genauso wie Jakob, möchten Männer heute nur Frauen heiraten, die sie lieben, obwohl die wenigsten bereit wären, 14 Jahre lang unentgeltlich als Pförtner oder Hausmeister für die Firma des Schwiegervaters zu arbeiten.
In mancher Hinsicht sind wir heute nicht weit weg von der Heiratspraxis vor 200 Jahren, als Männer und Frauen leicht ersetzbar waren. Man wundert sich heute manchmal, wie leicht eine Ehefrau durch eine junge Geliebte ersetzt wird.
Auch wenn früher die Individualität bei der Heirat keine große Rolle spielte, entwickelten sich zwischen der Braut und dem Bräutigam zarte Gefühle der Zuneigung. Das zeigen frühe Liebesbriefe. Zwar enthielten sie oft standardisierte Formulierungen, was aber keinesfalls als ein Mangel an Gefühlen gedeutet werden darf. Junge Mädchen würden es entschieden von sich weisen, wenn man ihnen unterstellen würde, dass die inflationäre Formel „Hab Dich lieb“ oder „Love you“ nur reine Buchstabenhülsen seien. In den Herzen der jungen Menschen ist viel Speicherplatz für innige Gefühle, sodass die Formulierungen durchaus ernst gemeint sind.
„Ehrbarer, freundlicher, herzlieber und vertrauter Bräutigam! Dein Schreiben habe ich am 22. Dezember nach unserem Kalender mit Verlangen und herzlichen Freuden wohl empfangen und darin von Deinem Wohlaufsein und dem der Deinen vernommen, welches mir die größte Freude von Dir zu vernehmen ist. […] Und ich danke Dir, mein herzallerliebster Schatz, für Deine treue Fürsorge, daß Du mich der Kälte halber mit einer Ärmelweste versehen hast. Ich will diese um Deinetwegen tragen und dabei Deiner gedenken […] bis zu Deiner Wiederkunft, die Gott mit herzlicher Freud bald gebe.“
Magdalena an ihren Verlobten Balthasar, 25. Dezember 1582, Nürnberg
Wie frühe Liebesbriefe aussahen, zeigen die noch erhaltenen Briefe von Magdalena Behaim und Balthasar Paumgartner aus Nürnberg. Auch ihre Ehe war arrangiert. Sie wurden im Oktober 1582 verlobt und heirateten im April 1583. Balthasar war Kaufmann und deshalb viel unterwegs, oft in Italien. Deshalb überbrückte das Verlobungspaar die Trennung mit Briefen. Sehnsuchtsvoll warteten sie auf die Briefe des anderen. Balthasar schrieb am 15. Dezember 1582 aus Lucca an seine Verlobte: „Ehrbare, tugendreiche, getreue, freundliche, herzliebe, vertraute Braut! Dein Schreiben vom 11. November habe ich diese Nacht um zwölfe mit großem Verlangen wohl empfangen. Da ich aber wohl gewußt und ausgerechnet gehabt, daß wieder Antwort von Dir auf mein Schreiben wird kommen müssen, hab ich einen solchen Brief am vergangenen Sonntag mit Begierden erwartet und bin derowegen den ganzen Tag nicht aus dem Haus gekommen.“
Magdalena legte ihren Briefen kleine Geschenke bei, einmal Blumen aus ihrem Garten und ein andermal ein Band, das Balthasar an seinem Handgelenk tragen sollte: „Freundlicher und herzallerliebster Schatz, mit diesem Brief schicke ich Dir das kleine Schnürlein; das sollst Du um meinetwegen tragen und dabei meiner gedenken und mir damit freundlich angebunden sein“.
„Mein Herzensschatz, wie wird mir nur sein, wenn ich Dich wieder sehe und habe. Die Zeit dünkt mir ja nunmehr so lang. Gott helfe uns, die zwei Monate von jetzt an auch noch zu überwinden.“
Magdalena an ihren Ehemann Balthasar, August 1594
Die Liebesbriefe zeigen, dass arrangierte Ehen und Glück kein Widerspruch bedeutete. Die Ansprüche waren bescheidener. Man erwartete vom anderen kein vollkommenes Lebensglück, sondern war schon mit einigen Annehmlichkeiten zufrieden. Die Erinnerungen von Henriette Herz (1764–1847), die als Gastgeberin eines literarischen Salons Berühmtheit erlangte, zeigen, wovon ein junges Mädchen träumte:
Henriette war eine dunkelhaarige Schönheit. Sie stammte aus einer jüdischen Familie und lernte als 15-Jährige bei ihrer Tante nähen. Eines Tages vertraute ihr die Tante ein Geheimnis an: „Du wirst bald heiraten.“ Mit ihren ausdrucksvollen, dunklen Augen sah Henriette ihre Tante überrascht an und fragte, wer ihr zukünftiger Ehemann sei. „Marcus Herz“, antwortete die Tante. Henriette kannte Marcus Herz nur vom Sehen: „Ich wusste wenig von meinem Bräutigam, er war fünfzehn Jahre älter als ich, klein und häßlich, hatte aber ein geistreiches Gesicht und den Ruf eines Gelehrten.“
Schön war er zwar nicht, aber immerhin klug. Hier zeigt sich, dass der Anspruch damals ein anderer war. Es kam nicht so sehr darauf an, wen man heiratete, sondern dass man heiratete: „Ich freute mich kindisch dazu, Braut zu werden und malte es mir recht lebhaft aus, wie ich, von meinem Bräutigam geführt, nun spazieren gehen würde, wie ich bessere Kleider und einen Friseur bekommen würde, denn bis jetzt machte mir die Tante das Haar, mit Talg geschmiert, nach ihrem eigenen Geschmack zurecht; ferner hoffte ich auf ein größeres Taschengeld, das jetzt in 2 Groschen monatlich bestand, und von den kleinen etwas feineren Gerichten, die zuweilen für meinen Vater bereitet wurden, etwas zu bekommen.“
Ungeduldig ersehnte sie ihren Verlobungstag, den ihr die Tante verraten hatte. Beim Mittagessen fragte ihr Vater, um die Sache spannender zu machen oder um ihr eine Wahlmöglichkeit zu suggerieren, ob sie lieber einen Doktor oder einen Rabbiner heiraten möchte. Henriette antwortete, dass sie mit allem einverstanden sei, was ihr Vater beschließen würde. Das war eine kluge Antwort, denn der Notar und der Bräutigam standen schon bereit, um den Ehevertrag zu unterzeichnen. Währenddessen wartete sie im Nebenraum, denn ihre Unterschrift war nicht notwendig. Anschließend feierte die Familie die Verlobung mit gutem Essen und belehrenden Reden.
Auch bei arrangierten Ehen hatten junge Mädchen nicht das Gefühl, dass gegen ihren Willen entschieden wurde, denn die Eltern fragten ihre Töchter, ob sie einverstanden seien. Das waren die jungen Mädchen auch meistens, denn sie waren dazu erzogen worden, ihren Eltern zu gehorchen. Außerdem vertrauten sie der Wahl ihrer Eltern, denn es war ein Ausdruck ihrer Fürsorge.
Henriette war nun verlobt, aber ihre Erwartungen wurden enttäuscht: Der Speiseplan verbesserte sich nicht. Die feinen Gerichte waren weiterhin ihrem Vater vorbehalten. So hoffte sie, dass die Ehe die entscheidende Wende bringen würde: „Ich freute mich mit der Aussicht, bald Frau zu werden, um ausgehen und essen zu können, soviel und was ich wollte.“ Die Unterschiede zu den heutigen Glückserwartungen sind nicht zu übersehen. Mit einem guten Essen lässt sich heute keine Frau mehr abspeisen. Ein Mann kann zwar eine Frau mit köstlichen Speisen beeindrucken, vor allem wenn er selbst am Herd steht, aber ein Heiratsgrund sind zartes Gemüse und cremige Desserts beileibe nicht. Da muss ein Mann schon noch mehr auffahren.
Mit dem feinen Essen in der Verlobungszeit wurde es zwar noch nichts, aber Henriette kam in den Genuss einiger erhoffter Privilegien: Ihr Taschengeld erhöhte sich von zwei auf sechs Gulden, sie bekam neue Kleider und durfte zweimal in der Woche zum Friseur. Ansonsten fand sie die Zeit als Braut nicht besonders aufregend. Marcus Herz kam jeden zweiten Tag zu Besuch, aber er spielte mit den Eltern und anderen Gästen Karten, während Henriette neben ihm saß und sich langweilte. Wenn sie ihren Verlobten beim Abschied zur Tür brachte, tauschten sie im Hausflur Zärtlichkeiten aus. In ihren Erinnerungen schreibt sie: „Seine Liebkosungen taten mir wohl, doch verstand ich manche in meiner Unschuld nicht.“ Darauf geht sie in ihren Erinnerungen nicht näher ein, doch sie schildert ihre Ahnungslosigkeit: „So fragte ich einmal eine junge Frau in unserem Hause, auf welche Weise man ein Kinde bekäme – und sie antwortete mir, wenn man sehr oft an denselben Mann denke – das tat ich oft und viel an Marcus, und ich ängstigte mich, daß ich so Schande über meine Eltern bringen würde.“
Man kann sich leicht ausmalen, welche Sorgen sich Henriette Herz machte. Jetzt bloß nicht an den Verlobten denken, war wahrscheinlich ihre Verhütungsmaßnahme.
Mit ihrer Hochzeit gingen auch endlich ihre tiefsten Sehnsüchte in Erfüllung. Am Morgen nach der Hochzeit kam der Friseur zu Henriette und die Köchin nahm ihre Anweisungen für das Mittagessen entgegen. Henriette war am Ziel ihrer Träume. Sie war Ehefrau und Herrscherin über den Speiseplan.
Henriettes Ehe war keine Liebesheirat, aber das hinderte sie nicht daran, ihren Ehemann mit einem romantischen Blick zu betrachten: „Ich war glücklich, liebte mit der fünfzehnjährigen Liebe einen dreißigjährigen Mann, ich hatte viele Romane gelesen und sie in mich aufgenommen.“ Henriette träumte sich ihren hässlichen, aber intellektuellen Ehemann zum Romanhelden zurecht. Eine gute Strategie für eine glückliche Ehe. Damit könnte man auch heute viele kriselnde Ehen kurieren. Anstatt die Mängel zu kritisieren, wäre es wirkungsvoller, den Ehemann als Superman der reparierten Waschmaschine zu betrachten.
In arrangierten Ehen waren Frauen nicht einfach nur Opfer der männlichen Willkür. Die Ehe gab zwar Rahmenbedingungen vor, aber innerhalb dieser Vorgaben konnten Frauen ihr Glück selbst gestalten. Henriette war wissbegierig und interessierte sich für Menschen und Literatur. Während ihr Ehemann die berühmtesten Persönlichkeiten seiner Zeit aus Politik und Wissenschaft empfing, unterhielt Henriette die Ehefrauen bei einem Kaffeekränzchen im Nebenraum. Aus diesen Damentreffen entstand Henriettes berühmter Salon, in dem so bedeutende Frauen und Männer wie Sophie Mereau, die Ehefrau von Clemens von Brentano, oder Alexander und Wilhelm von Humboldt zu Gast waren. Übrigens war der Salon bei gutem Tee, feinem Gebäck und interessanten Gesprächen auch ein Ort für Herzensbegegnungen. Der Schriftsteller und Kulturphilosoph Friedrich Schlegel begegnete dort seiner späteren Ehefrau Dorothea Veit.
Allen Heiratsplänen zum Trotz, machte auch beim Adel manchmal die Liebe einen Strich durch die arrangierte Ehe. Kaiser Franz Josef I. von Österreich sollte Helene heiraten, die Tochter von Herzog Max von Bayern und seiner Frau Ludovika. Auf seinem Geburtstagsempfang in Bad Ischl erblickte Franz Josef Helenes bezaubernde Schwester, die 15-jährige Elisabeth. Da war es um ihn geschehen: Sie sollte seine Frau werden und keine andere! Obwohl sein Sinneswandel eine große Kränkung für Helene bedeutete, willigten die Eltern in die Ehe ein. Franz Josef liebte Elisabeth abgöttisch. Ihr Glück war ihm wichtiger als sein eigenes. Deshalb verzichtete er auf ihre Nähe und unterstützte Elisabeths monatelange Reisen und Kuraufenthalte. Ihre Gemächer ließ er mit exotischen Blumen und Vögeln bemalen, die sie so sehr liebte. Als Elisabeth ermordet wurde, sagte er zu seinem Adjutanten: „Sie wissen nicht, wie sehr ich diese Frau geliebt habe.“
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts gedieh im Bürgertum ein zartes Pflänzchen namens Liebesehe. Nicht mehr die Eltern bestimmten den Mann fürs Leben, sondern das eigene Gefühl. Doch nach wie vor hielten die Eltern die Fäden in der Hand. Sie achteten darauf, dass sich ihre Töchter in den richtigen Kreisen bewegten und schickten sie zu festlichen Bällen oder Hauskonzerten der feinen Gesellschaft. Damit trafen sie schon eine Vorauswahl.
Um die Töchter gut zu verheiraten, musste der Ruf tadellos sein. Kein Fleckchen durfte das weiße Gewand beschmutzen. Die Töchter zu verheiraten, war ein anstrengendes Geschäft. Davon erzählt ein literarisches Sittengemälde des Münchner Bürgertums um 1900 mit dem vielsagenden Titel „Der Kampf um den Mann“, geschrieben von Carry Brachvogel. Die Schriftstellerin, die sich für Frauenrechte einsetzte, war lange Zeit bis vor wenigen Jahren vergessen. Weil sie Jüdin war, wurde sie 1942 in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert, wo sie wenige Monate später entkräftet starb.
In dem Roman geht es um die Bemühungen der Witwe Frau von Merk, ihre drei Töchter standesgemäß zu verheiraten. Alles sah ganz hoffnungsvoll aus. Ihre jüngste Tochter Tilde war bildhübsch. Sie hatte viele Verehrer und ließ – ihres Wertes bewusst – alle abblitzen. Dann erschien Saranoff, ein vermögender, russischer Student mit Hauptberuf Sohn. Er ließ sich nicht so leicht abwimmeln. Sein Jagdtrieb war angesichts der vornehmen Zurückhaltung von Tilde erwacht. Galant umwarb er die stolze Schöne und zeigte sich sehr freigiebig. Vor staunenden und neidischen Blicken warf er große Geldscheine bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Tildes Korb. Tilde wurde um diese aussichtsreiche gute Partie beneidet. Sie genoss die bewundernden Blicke, wenn sie an seinem Arm spazieren ging. Die Mutter war stolz, denn ein wenig von dem Glanz fiel auch auf sie. Doch dann geschah etwas völlig Unerwartetes. Kurz vor der Verlobung setzte sich der reiche Russe über Nacht ab. Am nächsten Tag stand es in der Zeitung: Saranoff war spielsüchtig und hatte eine Menge Schulden. Der Skandal war perfekt. Ihre Mutter befürchtete, dass es nach dieser Blamage nun schwierig werden könnte, Tilde zu verheiraten. So ein Desaster war nur mit einer guten Mitgift auszugleichen. Also hieß es, zu sparen, wo es nur ging: Kartoffeln statt Fleisch und Kerzen statt Petroleum. Nach außen hin durfte man sich jedoch nichts anmerken lassen und musste den gewohnten Lebensstil weiterführen, um die letzten Heiratschancen nicht auch noch zu verderben. Die Mutter versuchte zu retten, was zu retten war und verlangte von Tilde, dass sie sich jetzt nur ja nicht versteckte, sondern spazieren ging, dabei souverän lächelte und sich keinesfalls etwas von der Enttäuschung anmerken ließ. Tilde spielte tapfer mit und versuchte, die mitleidigen und schadenfreudigen Blicke zu ignorieren. Wenn immer es ging, verkroch sie sich. In der Gemäldegalerie lenkte sie sich mit Malen von ihrem Schmerz ab. Als ein Künstler sich für sie interessierte, war es wie Balsam für ihre Seele. Sie verliebte sich in ihn, doch er wollte sich nicht binden. Am Schluss bekam sie ihn doch. Es war nicht die lukrative Partie, die sich Frau von Merk für ihre Tochter erhofft hatte. Aber Tilde hatte sich aus diesem Korsett befreit und aus Liebe geheiratet.
Im Bürgertum war es wichtig, die Fassade von Wohlstand und Moral aufrechtzuerhalten. Das funktionierte auch einigermaßen, denn in der Biedermeierzeit lebten die Familien hinter ihren schweren Samtvorhängen, verborgen von der geschäftigen Welt.
Auf dem Land war das anders. Dort gab es keine Fassade, hinter der man sich verstecken konnte, denn man kannte sich. Oder man kannte jemand, der den anderen kannte. Die Dorfbewohner waren sehr auskunftsfreudig und hielten mit Informationen nicht hinterm Berg, ob es nun erwiesene Tatsachen oder so gut wie gesicherte Vermutungen waren. Für einen Vater war es ein leichtes, Erkundigungen über mögliche Heiratskandidaten einzuziehen. Die soziale Kontrolle funktionierte auf dem Dorf lange Zeit ziemlich zuverlässig. Heiratsschwindler hatten keine Chance auf dem Land.
Wie im Bürgertum, so heiratete man auch auf dem Land unter seinesgleichen. Für einen Bauernsohn kam nur eine wohlhabende Bauerntochter infrage, die genügend Mitgift mitbrachte. Eine Heirat auf dem Land war ein Geschäft, denn der Bauernhof war die Existenzgrundlage für alle, die auf dem Hof lebten. Und das waren nicht nur das Hochzeitspaar und die zukünftigen Kinder, sondern auch die Eltern, die ledigen Geschwister und die alten Tanten, dazu noch Mägde und Knechte. Ein Großbauer war früher auf dem Land das, was heute ein großer Unternehmer in der Stadt ist – einer, der etwas zu sagen hat, auf den die Menschen hören. Dass eine Heirat nicht nur eine Sache zwischen Braut und Bräutigam war, zeigt sich auch daran, dass man sagte: „Der Hof heiratet“.
Das Heiratsgeschäft wurde sehr bedacht eingefädelt. Bevor ein Großbauer eine andere Familie anfragte, ob sie an der Gründung eines Verwandtschaftsverhältnisses interessiert sei, wusste er schon genau, wie viel Pferde die Familie im Stall stehen hatte und wie viel Tagwerk Land sie beackerten.
Beruhte das Interesse auf Gegenseitigkeit, dann folgte eine genauere Begutachtung, jedoch nicht des möglichen Heiratskandidaten, sondern der Kühe. Man inspizierte den ganzen Besitz vom Keller bis unters Dach, so wie ein Unternehmer heute die Bilanzen begutachtet, bevor er mit einer anderen Firma fusioniert.
Von einer solchen Begutachtung erzählt Oskar Maria Graf in seinem Buch „Das Leben meiner Mutter“. Seine Mutter Resl stammte von einem Bauernhof in der Nähe des Starnberger Sees und hätte am liebsten einen Bauernsohn geheiratet. Aber so viele gab es nicht. Ihre Schwestern hatten den Heiratsmarkt schon abgeräumt. Resls verwitwete Mutter tröstete ihre Tochter, dass halt nicht jede einen Bauernsohn heiraten könne, aber Maxl sei auch keine schlechte Partie. Immerhin war er ein aufstrebender Bäcker mit ehrgeizigen Plänen. „Mein Brot frisst sogar der König“, erklärte er stolz. Dass Bayerns Märchenkönig Ludwig II. zu Maxls Kundschaft gehörte, beeindruckte sie nicht. Resls Bedenken wurden erst ausgeräumt, als sie hörte, dass auch der Pfarrer die Wahl für gut befand.
Für Maxl hingegen war Resl ein Glücksfall. Ihre Mitgift war mehr als er erwartet hatte: 3000 Gulden, ein einjähriges Kalb und einen Kuchlwagen, auf dem die ganze Aussteuer vom Handtuch bis Kleiderschrank aufgetürmt war.
Um die Katze nicht im Sack zu kaufen, schauten sich Resl und ihre Mutter den Besitz von Maxl an. Die Mutter fand nur wenig auszusetzen, wie Oskar Maria Graf erzählt: „Wohl bemerkte sie hin und wieder flüchtig, daß das Haus eng genug sei, indessen jeder konnte daraus hören, wie wenig herabmindernd, wie einsichtsvoll und nachsichtig das gemeint war. Auf dem etwas verwirrten, ernsten Gesicht der Resl hingegen lag eine deutliche, beinahe angstvolle Enttäuschung, als man durch die Räume des Bäckerhauses ging. Wohn- und Backstube, ja die waren wenigstens noch einigermaßen geräumig, jede andere Kammer, aber – du lieber Gott, wenn sie da an das weitläufige, luftige Bauernhaus in Aufhausen dachte!“ Resl war jedoch einigermaßen versöhnt, als sie den sauberen Stall mit zwei Kühen sah. Bisher hatte sie nur von einer Kuh gewusst. Maxl sagte stolz, dass er es auf vier Kühe bringen wolle. Resls Gesicht leuchtete auf. Wenn sie schon keine Bauern heiraten konnte, dann wenigstens einen Bäcker mit Kühen. So konnte sie zumindest ein bisschen Bäuerin sein.
Resls Auszug von ihrem Elternhaus zu ihrem Ehemann am Tag ihrer Hochzeit:
„Ja, nun erst, da sie wirklich von dem Stück, das alle ihre Erlebnisse und Erinnerungen, die Freuden und Leiden ihrer Jugend umschloß, wegging, schluchzte sie wahrhaft verloren wie ein hilfloses Kind, dem man das Liebste auf Erden genommen hatte. Da sagte die Heimräthin [ihre Mutter] ein wenig verärgert und rauh: ‚Resl, das hätt’st du dir schon früher überlegen müssen! … Geh weiter jetzt!‘ Und sie sah ihre zerbrochene Tochter fest an und sagte wiederum, aber um einen Grad milder: ‚Resl! Jetzt zier dich doch nicht gar so! Man ist ganz einfach füreinander bestimmt!“
Aus: Oskar Maria Graf, Das Leben meiner Mutter
War die Heirat eine beschlossene Sache, dann wurde das Geschäft besiegelt. In Bayern gab der Bräutigam seiner Zukünftigen das Drangeld oder einen Ehetaler. Löste die Braut die Verlobung, musste sie das Drangeld zurückgeben. Das kam aber selten vor, denn das hätte dem Ruf des Mädchens sehr geschadet. Wenn der Bräutigam die Verlobung löste, durfte die Braut das Drangeld behalten und bekam von ihm zusätzlich noch ein Bußgeld für die Schande, die er über das Mädchen und ihre Familie gebracht hatte.
In manchen Gegenden gab der Bräutigam statt des Drangelds ein Brautgeschenk. Das konnte ein Gebetsbuch, ein Rosenkranz, ein seidenes Halstuch oder eine Pelzmütze sein. Manche Männer schenkten ihrer Braut auch einen schönen, verzierten Kamm, mit dem Mädchen ihre hochgesteckten Haare schmückten, oder aber einen Ring. Der materielle Wert war gegenüber den heutigen Brillantringen gering. Meistens waren die Steine aus farbigem Glas, aber dennoch hatte es dieser Ring in sich, wie auch die anderen Brautgeschenke. Das Eheversprechen war damit rechtsverbindlich, so wie eine Unterschrift. Und das konnte fatale Auswirkungen haben, wie die nächste Geschichte zeigt:
Anna Magdalena Niedermeier lebte im 17. Jahrhundert in der Grafschaft Lippe. Als ihr Mann starb, hinterließ er ihr einen großen, stattlichen Hof. Eine junge, vermögende Witwe, dazu noch kinderlos, das lockte ehrgeizige Männer aus der ganzen Gegend an. Die Heiratswilligen umschwärmten Anna Niedermeier wie Schmeißfliegen einen Kuhfladen. Ihr Nachbar Johann Bernd Lansberger war im Vorteil, denn er hatte einen Trumpf in der Hand: ein Eheversprechen. So behauptete er jedenfalls. Anna Niedermeier sagte, das sei alles erlogen. Um das Eheversprechen einzuklagen, ging Johann Lansberger vor Gericht. 1679 reichte er eine Klage gegen Anna Niedermeier ein. Sie habe ihm die Ehe versprochen, und das vor Zeugen! Und jetzt wolle sie nichts mehr davon wissen. Was war geschehen? Johann Lansberger erzählte die Geschichte vor Gericht so: Sein Vater habe Anna Niedermeier aufgesucht und ihr die Ehe mit seinem Sohn angetragen. Sie habe ja gesagt, also um genau zu sein: Eigentlich habe sie nicht deutlich nein gesagt, was ja auf dasselbe rauskommt. Es ist erstaunlich, wie hartnäckig sich manche männlichen Deutungen von weiblicher Einwilligung bis heute halten.
Vater und Sohn gingen deshalb zur nächsten Stufe der Brautwerbung über. Mit einigen anderen männlichen Verwandten im Schlepptau, besuchten die beiden Anna Niedermeier auf ihrem Hof. Fragt man sich, warum Vater und Sohn für die Brautwerbung noch die halbe Verwandtschaft mitschleppten, so wird vieles durch die Tatsache klar, dass genau diese Männer später als Zeugen in dem Verfahren aussagten.
Johann Lansberger erklärte dem Gericht, was dann geschah: Anna bewirtete die Männer mit Bier. Vater und Sohn indessen bemühten sich, mit Anna ins Geschäft zu kommen. Nach Johanns Aussage waren sie äußerst erfolgreich. Anna Niedermeier gab zur Bestätigung, dass sie Johann Lansberger heiraten würde, mindestens dreimal die Hand darauf. Außerdem ließ sie sich von dem Bräutigam in den Arm nehmen und sogar, als sein Vater sie Schwiegertochter nannte, protestierte Anna nicht. Hier wieder die männliche Interpretation: keine Gegenwehr, also ein klares Einverständnis.
Aber das war noch nicht alles. Der Abend hatte ja erst begonnen. Als die anderen Männer gingen, blieb Johann noch da und trank mit seiner zukünftigen Braut zwei Kannen Bier. Das erklärt manches von dem, was noch folgte. Johann ging mit Anna in die Schlafkammer und verbrachte die Nacht in ihrem Bett, so erklärte er. Anfänglich hatte er auch behauptet, mit ihr geschlafen zu haben, aber diese Geschichte ließ er im Laufe des Prozesses fallen. Der entscheidende Beweis für das Eheversprechen war, dass Anna den Ring als Geschenk von ihm angenommen hatte. Dass sie den Brautring besaß, musste jedes Gericht als klares Ehe-Einverständnis bewerten.
Für Johann war die angestrebte Ehe in trockenen Tüchern. Er sei deshalb wie vor den Kopf gestoßen gewesen, als Anna nach drei Tagen die geplante Heirat absagte, erzählte er weiter. Sie habe sich anders entschieden. Johann sei zu jung, um ihren Hof zu führen. Außerdem habe sie schon einem anderen Mann die Ehe versprochen.
Nun wurde Anna Niedermeier befragt. Sie erzählte die Geschichte ganz anders: Es sei richtig, dass Johanns Vater ihr die Heirat mit seinem Sohn angetragen habe. Auf diesen Heiratsantrag habe sie nur ausweichend geantwortet. Ob sie fatalerweise davon ausging, dass ein Mann auch Zwischentöne verstehen kann oder ob sie sich einfach nur überrumpelt fühlte und ihr so schnell keine passende Antwort einfiel, wissen wir nicht. Kurze Zeit später, so erzählte Anna weiter, sei schließlich Johann mit seinem Gefolge auf ihrem Hof erschienen. Auf diese Männergesellschaft hatte sie gar keine Lust. Deshalb wollte Anna sie nicht reinlassen. Aber ihr Vetter, der auch dabei war, drängte so lange, bis sie nachgab. Sie habe die Männer dann zwar mit Bier bewirtet, aber selbst nur ein Glas erst nach Aufforderung getrunken. Bei der erstbesten Gelegenheit sei sie aus dem Raum gegangen. All das, was Johann Lansberger behauptete, dass sie sich umarmen ließ, ihm die Ehe versprach oder sich als Schwiegertochter anreden ließ, sei nicht wahr.
Und wie war es mit dem Ring und der gemeinsamen Nacht? Dass er die Nacht in ihrem Bett verbracht habe, sei zwar richtig, aber es sei gegen ihren Willen geschehen. Sie lag bereits im Bett, als er in ihre Kammer kam und sich neben ihr fallen ließ, trotz ihrer Proteste. Er schlief sofort ein und war nicht mehr wegzubewegen. Auch ihr betrunkener Vetter war in ihrer Kammer eingeschlafen. Dass die beiden Männer zu nichts mehr fähig waren, dass also von ihnen keine Gefahr ausging, war nicht zu übersehen. Anna wickelte sich zum Schutz in ihr Bettzeug ein, verbrachte eine unruhige Nacht und stand schon lange vor Tagesanbruch wieder auf. Als sie ihren Kellerschlüssel aus der Schürzentasche herausholte, fand sie darin einen Ring, den sie nicht kannte. Ihr war klar, dass Johann Lansberger ihn dort heimlich versteckt haben musste. Wütend warf sie das Schmuckstück auf das Bett.
Der Fall war äußerst verzwickt. Das Gericht machte sich die Sache nicht leicht und bat sogar die juristische Fakultät in Gießen um ein Gutachten. Zunächst sah es ganz hoffnungsvoll für Anna aus. Das Gericht in Detmold kam zu dem Schluss, dass Johann das Eheversprechen nicht beweisen könne. Anna Niedermeier sei also nicht daran gebunden. Doch Johann Lansberger ließ nicht locker und legte Beschwerde ein. Ein zweites Gutachten, diesmal von der Juristischen Fakultät in Erfurt, kam zu einem ganz anderen Schluss: Wenn Lansberger das Eheversprechen beeiden könne, dann müsse Anna ihn heiraten. Das konnte Johann selbstverständlich. Daraufhin verlangte Anna ein weiteres Gutachten, aber es half alles nichts. Anna wurde gegen ihren Willen mit Johann Lansberger zwangsverheiratet!
Doch Anna fügte sich nicht dem Urteil. Sie kämpfte weiter, um aus dieser fatalen Ehe wieder rauszukommen. Anna ging vor das Reichskammergericht und erreichte schließlich, dass alle bisherigen Maßnahmen fallen gelassen wurden, also auch ihre Zwangsheirat mit Johann, und dass der Fall neu aufgerollt wurde. Ein neues Gutachten wurde erstellt, diesmal von der Duisburger Universität. Diese Beurteilung brachte für Anna endlich die ersehnte Wende. Die Duisburger Juristen kamen zum gleichen Schluss wie ihre Kollegen in Gießen: Johann könne das Eheversprechen nicht beweisen. Anna bekam deshalb die Möglichkeit, das Eheversprechen durch Eid zurückzuweisen. Sechs Jahre nach Prozessbeginn war sie von jeder Heiratsverpflichtung freigesprochen.
Ein Eheversprechen hatte damals eine viel größere Tragweite. Eine Verlobung ist heute eine Besiegelung der Liebe. Wird die Verlobung gelöst, hat das keine Folgen, außer einem gebrochenen Herzen für den einen, während der andere sich herausredet: „Eine Verlobung ist ein Versprechen und versprechen kann man sich ja mal.“
Früher gab es viele Eheklagen. Selten war es ein Mann, so wie Johann, der die Ehe eingeklagte. Meistens waren es junge Mädchen, die schwanger waren und versuchten, den flüchtigen Kindsvater als Ehemann zu erstreiten. Für den Ruf der Frau war es wichtig, nachzuweisen, dass der Mann ihr die Ehe versprochen hatte, bevor sie mit ihm schlief. Damit war ihr Ruf gerettet, auch wenn ihr Mitleid und Gespött nicht erspart blieben.
„Wir haben uns in Sri Lanka kennengelernt. Da gingen wir zusammen in die Schule und in dieselbe Klasse in der Oberstufe. Ranji beobachtete mich öfters im Klassenzimmer. Mein Sitznachbar machte Bemerkungen. Ich schaute zu ihr und sie lächelte mich an. Wir haben uns öfters in den Pausen getroffen und merkten, dass wir uns gut verstanden. Zu unserer Zeit war es ein Tabu, sich selbst einen Partner auszusuchen. Die Eltern arrangierten die Ehe für einen. Eines Tages sah mein Vater mich mit Ranji in einem kleinen Café. Damit hatten wir beide nicht gerechnet. Wir hatten Angst, dass er unsere Liebe verbietet. Unsere Eltern waren sehr verärgert. Plötzlich wusste jeder aus unserem Dorf, dass wir uns beide lieben. Das war uns allen ziemlich unangenehm. So beschlossen unsere Eltern, miteinander zu reden und die Hochzeit zu planen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Bis heute bereuen wir unsere Entscheidung nicht.“
Ranji (42) und Siva (43), seit 17 Jahren verheiratet
Wenn man heute von arrangierten Ehen spricht, denkt man an Zwangsehen, die es in vielen Ländern gibt. Die Unterscheidung von „arrangiert“ und „Zwang“ ist nicht einfach. Es gibt arrangierte Ehen, bei denen die Wünsche der Söhne und Töchter berücksichtigt werden. Die Eltern fragen ihre Kinder, ob sie mit der Wahl einverstanden sind. Wenn sie aber aus Gehorsam der Eltern gegenüber niemals nein sagen würden, ist es dann Zwang? Viele vertrauen der Lebenserfahrung ihrer Eltern mehr als ihrem eigenen Urteil, weil sie wissen, dass Gefühle alleine nicht ausreichen für eine lebenslange Ehe.
Und dann gibt es arrangierte Ehen, die brutal erzwungen werden und jede Menschenwürde mit den Füßen zertrampeln. Wer sich nicht fügt, wird gnadenlos bestraft. 2016 ging die Nachricht über eine indische Mutter durch die Presse, die ihre 18-jährige Tochter fesselte, mit Benzin übergoss und verbrannte. Die Tochter hatte nicht den Mann geheiratet, der für sie vorgesehen war, sondern den Mann, den sie liebte.
Eine arrangierte Ehe, so wie es in unserem Kulturraum früher normal war, ist für uns moderne Menschen heute unvorstellbar. Jemanden zu heiraten, den man kaum kennt? Das ist doch so riskant wie Lose ziehen. Obwohl es ein Glücksspiel sein soll, bringt es kein Glück. Es gibt fast nur Nieten und meistens erwischt man genau diese. Doch die Lebenseinstellung war damals eine andere. Arrangierte Ehen waren früher so normal wie heute Onlinedating. Man wusste über den anderen nicht viel, außer einige wesentliche Informationen, wie Stammbaum, Vermögen und berufliche Stellung. Beim Onlinedating reichen als Basisinformationen Haarfarbe, Filmfavoriten und die Lebenseinstellung wie Veganer, Tierschützer oder Porschefahrer. Wie auch heute, so hoffte man damals, dass die Liebe wachsen würde, wenn man sich erst mal näher kennenlernte. Früher trat dies auch oft ein, denn Liebe im Bürgertum bedeutete etwas anderes als heute, nämlich gegenseitige Wertschätzung. Und das ist etwas anderes als Schmetterlinge im Bauch. Das berauschende Gefühl der Verliebtheit empfanden Frauen selten im wirklichen Leben, sondern in der Fantasie, wenn sie Romane über Sehnsucht, Leidenschaft und Verzweiflung lasen. Madame Bovary war ein Bestseller, obwohl man solche Romane vor jungen Mädchen fernhielt. Man wollte bei ihnen keine falschen Erwartungen wecken. Doch in den Bücherregalen ihrer Mütter fanden die jungen Mädchen diese Romane – irgendwo zwischen Goethe und Schiller versteckt – und lasen sie heimlich. Sie tauchten in diese unwirkliche, fantastische Welt ein, aber ihnen war klar, dass in einer Ehe andere Dinge zählten. Genauso wie die Leser von Harry Potter wissen, dass es im wirklichen Leben mit dem Zaubern ziemlich schwierig ist, so rechneten die jungen Mädchen nicht mit einem gutaussehenden Helden und leidenschaftlicher Liebe – auch wenn sie vielleicht davon träumten.
Arrangierte Ehen hatten durchaus Vorteile. Man musste seinen Partner nicht selbst suchen, sondern überließ den Eltern diese Aufgabe. Heute ist trotz allen Freiheiten – oder gerade deshalb – Partnersuche ein mühevolles Unterfangen. Singles erzählen von langweiligen Partys, teuren Singlereisen und stundenlangem Durchforsten von Datingbörsen und Chats, die zu nichts führen. Es ist nicht immer einfach, einen Partner zu finden. Manchmal läuft einem das Glück über den Weg und man verliebt sich. Alles scheint so wunderbar und perfekt, die Liebe des Lebens. Und dann stellt sich nach einiger Zeit heraus: Es war der Falsche. Die hohen Trennungszahlen sprechen für sich. Gefühle können den Blick auf den anderen ganz schön vernebeln. Deshalb verlassen sich heute viele auf die Algorithmen von Datingbörsen. Und deshalb suchen auch erstaunlich viele Singles ihr Liebesglück in der neuen Realityshow „Hochzeit auf den ersten Blick“. In dieser Sendung geht es um genau das, was der Titel verheißt: Das Paar sieht sich auf dem Standesamt zum ersten Mal und ist einige Minuten später verheiratet. Eine arrangierte Ehe in der konsequentesten Form. So radikal war man früher nicht. Aber die damaligen Ehen waren ja fürs Leben geschlossen und nicht für die Zuschauerquote.
In der Sendung „Hochzeit auf den ersten Blick“ stellt ein Expertenteam Frauen und Männer als Paar zusammen. Die Experten der ersten Staffel waren eine Psychoanalytikerin, die das Seelenleben der Heiratswilligen ergründete und eine Matching-Expertin, die mittels verschiedener Tests ausrechnete, wie groß die Übereinstimmung der Kandidaten ist. Mit dabei war auch ein Heilpraktiker mit dem Spezialgebiet Wohnpsychologie, der anhand der Farbe des Sofas die verborgenen Bedürfnisse der Kandidaten erkannte. Bei der ersten Staffel gehörte sogar ein evangelisch-freikirchlicher Theologe zum Team. Seine Aufgabe hat sich für den Zuschauer nicht so einfach erschlossen. Für die Trauungszeremonie war er jedenfalls nicht zuständig, denn die Kandidaten heirateten nur standesamtlich. Mit der Zeit wurde klar, dass er als seelischer Beistand dazu da war, die Scherben zusammenzufegen. Nach sechs Wochen Ehepraxis stellte er den Kandidaten die alles entscheidende Frage: „Wollt Ihr zusammenbleiben oder wollt Ihr die Scheidung?“ Dass inzwischen selbst Pfarrer einen Service mit Scheidung statt Hochzeit anbieten, verheißt keine gute Zukunftsprognose für die dahinkränkelnde Ehe. Wenn die Pfarrer die Ehe schon nicht mehr ernst nehmen, wer dann?
Macht eine arrangierte Ehe heute noch Sinn? Jemanden zu heiraten, den man noch nie zuvor gesehen hat? Volles Risiko? Nicht riskanter, als auf der Basis von Gefühlen zu heiraten, so argumentieren die Experten und schwärmen von der Datingshow als ein „noch nie dagewesenes Sozialexperiment“. Eine Ehe auf der Basis von wissenschaftlichen Methoden habe durchaus Chancen auf Bestand. Da wo Liebe blind macht, schafft die Wissenschaft einen klaren Durchblick.
Das klingt überzeugend. Doch die Aussichten auf Erfolg sind gering. Es könnte funktionieren, wenn die Erwartungen und das Wertesystem ähnlich wären wie vor 100 Jahren. Das sind sie aber nicht. Damals bedeutete gegenseitige Fürsorge viel, das Paradies erwartete keiner. Doch heute suchen Paare in einer Beziehung den Himmel auf Erden. Auch in der Heiratsshow dreht sich alles um große Emotionen: „Die Suche nach dem Gefühl der einzig wahren Liebe“ erklärt die sonore Stimme aus dem Off. Oder: „Ich will einfach nur glücklich sein“, seufzen die Kandidaten und Kandidatinnen. Doch damit ist das beste Expertenteam überfordert. Es kann zwar eine Heirat vermitteln, aber nicht das Glück herbeizaubern.
Vor allem keines, das den heutigen Ansprüchen genügen kann, die Sehnsucht nach Romantik. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Kandidatinnen eigentlich nur wegen des Hochzeitskleids heiraten wollen. Einmal im Leben Prinzessin sein!
Die heutigen Träume von Liebesglück, genährt durch Filme, sind weit von dem entfernt, was die Wirklichkeit zu bieten hat. In „Hochzeit auf den ersten Blick“ prallen zwei gegensätzliche Liebesauffassungen aufeinander: Die arrangierte Vernunftehe und die romantische Liebesehe. Die Spielregeln sind unterschiedlich. Man kann nicht mit Quartettkarten Skat spielen. In Dänemark, wo diese Sendung zuvor lief, haben sich alle Paare getrennt. In Deutschland ist bis jetzt noch ein Paar aus der ersten Staffel zusammen. Bea und Tim hatten sich auf dem Standesamt auf Anhieb ineinander verliebt. Irgendwann hatten sie die ersten Beziehungskrisen. Doch das brachte sie nicht auseinander.
Es ist heute einfacher, einen Partner zu finden, als mit ihm zusammenzubleiben.
Auch wenn man sich bewusst macht, dass „Hochzeit auf den ersten Blick“ nicht für die Kandidaten gemacht wird, sondern für die Zuschauer – und für eine hohe Zuschauerquote –, so ist es doch erstaunlich, wie viele junge Leute sich für die Sendung bewerben und bereit sind, sich auf eine arrangierte Ehe einzulassen. Und sie sind nicht die einzigen, wie die nächste Geschichte zeigt:
Sarah ist eine attraktive 27-jährige Wienerin und überzeugte Yogi. Sie reiste nach Italien zu einem Yogafestival, um den Mann fürs Leben zu finden. Die Filmemacherin Lia Jaspers hat sie für ihren Dokumentarfilm „Match Me!“ begleitet. Bevor die Reise losging, musste Sarah einen Fragebogen ausfüllen, zum Beispiel, welche Hobbys sie hat und ob sie bereit wäre, in ein anderes Land zu ziehen. Dazu war Sarah bereit. Es ist erstaunlich, wie viele attraktive junge Menschen aus aller Welt sich zu dem Festival eingefunden hatten, um jemanden zu heiraten, den sie gar nicht kennen. Es sah beileibe nicht so aus, als wäre diese Art der Partnersuche die letzte Chance, sondern eine sehr bewusste Entscheidung. Vielleicht ist es die Sehnsucht nach Verbindlichkeit, dass junge Menschen eine arrangierte Ehe eingehen.
Die jungen Heiratswilligen waren in Zelten untergebracht, kochten zusammen, meditierten, redeten und lachten, wie in einem großen internationalen Ferienlager. Urlaub, Sonne und viele junge Leute, da müssten doch die Funken sprühen. Aber die Yogis hatten andere Ziele. Sie wollten sich nicht auf ihre eigenen Gefühle verlassen. Sarah glaubt, dass eine auf göttliche Inspiration getroffene Wahl zuverlässiger sei. Liebe müsse wachsen.
Dann kam die „Night of Announcements“. An diesem Abend werden die Paare bekannt gegeben, die das Komitee, bestehend aus fünf Yogis, durch „spirituelle Vibrationen“ erfühlt haben. Für Sarah hatten sie Jonas aus Litauen ausgewählt. Am Anfang bestand eine große Scheu zwischen ihnen, doch sie mochten sich. Sarah und Jonas wollten sich Zeit lassen, einander kennenzulernen. Zurück in ihrem Zuhause, bestand ihr Kontakt nur über Skype. Es war ihnen wichtig, erst mal eine Freundschaft aufzubauen und mehr über den anderen zu erfahren: Was interessiert den anderen, was fühlt er, was denkt er?
Nach vier Monaten besuchte Sarah Jonas in Litauen, wo er in einer Wohngemeinschaft mit zwei Frauen lebte. Sie fühlte sich wohl bei ihm. Er habe ihr Herz geöffnet, erzählte sie. Dann kam Jonas nach Wien. Vor der Kamera wirken beide entspannt und humorvoll. Vielleicht ist das die Gelassenheit der jahrelangen Yogameditation.
Als sie sich für einen gemeinsamen Wohnort entscheiden mussten, war es für Sarah klar, dass sie zu Jonas nach Litauen zieht. Für sie war es nicht wichtig, ob sie in einem armen oder reichen Land lebte. Wichtig war ihr, dass Jonas sich als Mann fühlte und nicht von ihr abhängig sein musste. Er konnte kein Deutsch – sie unterhielten sich in Englisch – und hätte in Wien wohl keinen Job gefunden. In bikulturellen Ehen liegt tatsächlich der größte Konfliktstoff darin, dass Männer, die in ihrem Herkunftsland etwas galten, nun in ihrer neuen Heimat von ihrer Frau völlig abhängig sind.
Sarah zog zu ihm in die Wohngemeinschaft und teilte mit Jonas das Zimmer. Mit der Zeit tauchten auch erste kleine Meinungsverschiedenheiten auf. So kritisierte Jonas, dass Sarah zu essen begann, ohne dass sie die Mahlzeit gemeinsam gesegnet hätten – aber im gelassenen Ton eines entspannten Yogis. Sarah erzählt im Interview, dass sie sich auch stritten, aber lernten, immer besser miteinander umzugehen. Es helfe, dass sie „gematcht“ wurden. Oft seien es gerade die Gegensätze, die einander zur Reife helfen.
Nach einigen Monaten feierten sie ihre Hochzeit, zusammen mit ihren Familien, ganz romantisch am Strand mit Musik, Tanzen und Meeresrauschen. Ein fröhliches Fest.
Und wie ging es weiter? So viel erfährt man im Film nicht darüber. Es scheint ein normaler Ehealltag zu sein. Die Schlussszene zeigte, dass sie vertraut miteinander umgehen, trotz Meinungsverschiedenheiten: Sarah möchte mit ihrem Mann über die Zukunft reden und wirft ihm vor, dass er keinen Plan habe. Jonas hat aber keine Lust, darüber zu diskutieren und meint: „Was ist los mit dir? Was ist dein Problem? Vielleicht gehen wir nach England und arbeiten dort.“ Und beendet das Gespräch: „Schluss aus – mehr gibt’s nicht zu besprechen!“ Während sie gemeinsam zum Haus gehen, fragt er Sarah in einem versöhnlichen Ton: „Soll ich Dir einen Tee machen? Magst Du einen Ingwertee?“ Sie: „Jetzt nicht, lieber nach dem Essen – oder geht Dir das zu weit in die Zukunft?“ Daraufhin er: „Ich zieh mein Teeangebot zurück. – wegen Deines Sarkasmus.“ Sie: „Okay.“ Vielleicht ist Humor und Gelassenheit ein gutes Rezept, damit eine Beziehung gelingt.
Dass die arrangierte Ehe von Sarah und Jonas funktioniert, liegt daran, dass sie eine göttliche Fügung darin sehen. Sie sind überzeugt, dass Liebe wächst, wenn man bereit ist, den anderen anzunehmen. Sein Kind könne man ja auch nicht aussuchen, argumentiert Sarah.
Gefühle sind schwankend. Zu einer gelingenden Beziehung gehört mehr. Der provokante Buchtitel „Liebe dich selbst und es ist egal, wen Du heiratest“ von Eva-Maria Zurhorst zeigt, dass es nicht darum geht, den richtigen Partner zu finden, sondern darum, sich selbst zu akzeptieren und dadurch auch den Partner anzunehmen. Man nimmt sich nach gescheiterten Beziehungen immer in die nächste Partnerschaft mit. Dass dieses Buch monatelang auf den Bestsellerlisten stand, macht deutlich, dass in unserer Gesellschaft ein Bedürfnis nach einer verbindlichen und dauerhaften Beziehung besteht – auch wenn die wenigsten von uns bereit wären, eine arrangierte Ehe einzugehen. Aber man kann als Liebespaar eine Verbindlichkeit leben, die auch dann noch gilt, wenn die Verliebtheit vorbei ist.