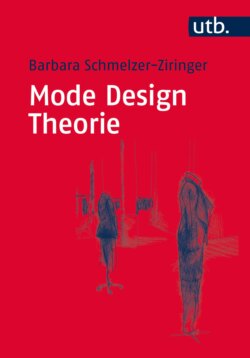Читать книгу Mode Design Theorie - Barbara Schmelzer-Ziringer - Страница 11
1.3 Designwissen – Wissen zum, durch und über Modedesign
ОглавлениеDie Verwissenschaftlichung des Designs schreitet mit dem Anspruch voran, die Entwurfs- und Herstellungsprozesse von Artefakten aus industrieller Produktion in einen Wissenschaftskanon zu fassen, um eine Methodologie des Designs zu entwickeln und deren Produktivität für andere Disziplinen zu erforschen.88 Gui Bonsiepe stellte als [<<36] Designtheoretiker dazu trocken fest: „Das kalte Bad der Verwissenschaftlichung und Rationalisierung dürfte einem auf Technik und Industrie ausgerichteten Beruf nicht erspart bleiben.“89 Die Entwicklung einer Designmethodologie steht und fällt laut Bonsiepe mit der „Hypothese, dass es beim Gestalten Invarianten gibt, aus denen sich ein Gerüst für das Gestalten bauen lasse“.90 Doch unterschiedliche Entwurfsprozesse implizieren, dass sie aus sich heraus spezifische Entwurfsmethoden entfalten, die sich nicht verallgemeinern lassen, was dem Ziel einer Methodologie entgegenstünde. Doch gerade dieser „Widerspruch wäre auszutragen“.91
Die wissenschaftliche Einsicht, dass Entwurfsprozesse die Welt gestalten, dass sie jede alltägliche Form, jedes alltägliche Ding genau bestimmen92 und nicht nur Wissenschaft und Forschung als ‚Entwicklungsmotoren‘ einsetzbar sind, ist in den Human- und Technowissenschaften selbstverständlich. In deren Verzahnung verschiedener Disziplinen wird nicht mehr allein deskriptiv-analytisch, sondern vermehrt kreativ geforscht, um Biofakte zu erzeugen.93 In der Pharmaindustrie spricht man mittlerweile vom Wirkstoffdesign und Arbeitsprozesse unterliegen einem Prozessdesign. Medikamente und Bekleidung wirken gleichermaßen auf menschliche Körper ein und verlinken sich bei der Entwicklung biofunktionaler, medizinischer Textilien, die Wirkstoffe über die Kleidung in die Haut transferieren bzw. den Körper gegen Keime und Bakterien schützen.94
Die Verwissenschaftlichung des Designs95 verspricht auch den Modeakteur/inn/en enormen Prestigegewinn, da deren Einfluss auf gesellschaftliche Strukturen physischer und psychischer Natur verstärkt wahrgenommen wird. In diesem Prozess wird das Styling, jene Tätigkeit der Oberflächengestaltung, die gerade das Modedesign von ‚harten‘ ingenieurmäßigen Industriedesign-Disziplinen96 und von der Architektur trennt, aufgewertet. Denn für eine erfolgreiche Markteinführung benötigen insbesondere neue und ungewohnte technologische Entwicklungen eine kundengerechte [<<37] Verpackung – ein optimiertes Styling –, damit sie an bestehende ästhetische Gewohnheiten anschlussfähig werden. Aktuell wird als gangbare Zukunftsvision der textilen Körperhülle die Funktion einer Schnittstelle zwischen Körper und technologisierter Umwelt eingeschrieben, und als unmittelbares ‚intelligentes‘ Medium im Sinne von techno fashion konzipiert.97 Jenseits des militärischen Gebrauchs sind die Zielsetzungen und der tatsächliche Nutzen ‚hochtechnologisierter‘ Bekleidung noch nicht abzuschätzen, da derzeit vorwiegend Studien und Prototypen vorliegen, die für eine zivile Nutzung und um weltweit wettbewerbsfähig zu sein erst Produktions- und Marktreife erlangen müssen. Diese verstärkte Entwicklung zur Kooperation von Modeindustrie und Technologiekonzernen zeichnete sich 2013 mit dem Wechsel des Yves-Saint-Laurent-CEO Paul Deneve zum Computerhersteller Apple öffentlich ab, nachdem er eine langjährige Karriere in der Modebranche hinter sich hatte.
Hatte Mart Stam den Begriff des Industriedesigners noch nicht unter besonderer Berücksichtigung der Bekleidungsgestaltung in die (deutschsprachige) Welt gesetzt,98 so sehr haben die Publikationen zu Mode im Kontext von Design und Technologie in den letzten Jahren zugenommen. Doch steht bisher kein ausreichendes Theoriekorpus zur Verfügung, der Designtheorie als eigenständige akademische Disziplin bestätigen würde, und es steht nach wie vor infrage, ob dies anzustreben wäre.99 Die Unschärfe des Gegenstandes basiert paradoxerweise gerade auf den theoretischen Schriften zum Design. Victor Papanek behauptete, dass jeder Mensch grundsätzlich ein Designer sei, oder zumindest alles, was wir tun, auf Design beruhe, wenn dies im Sinne einer telesis „bewußtes Handeln zur Herstellung sinnvoller Ordnung“ darstelle.100 Laut der Designtheoretikerin Claudia Mareis favorisieren „diejenigen Positionen, die an das intellektuelle Erbe des Design Methods Movement der 1960er und -70er Jahre anschließen […] insbesondere technische bzw. technikaffine Designtätigkeiten als Untersuchungsgegenstand“, wie zum Beispiel aus „der Architektur, den Ingenieur- und Planungswissenschaften oder der Informatik“.101 Derartige Designforschungsansätze wiesen gleichzeitig „gewisse technokratische und androzentrische (auf ‚Männlichkeit‘ ausgerichtete) Prägungen“ auf.102 [<<39]
„Auch wurde im Design Methods Movement dezidiert zwischen den Vorgehensweisen von Designern und (Natur-)Wissenschaftlern unterschieden. Nur vor diesem Hintergrund ist es heute zu verstehen, dass Design als Disziplin der ‚Synthese‘ oder des ‚Dazwischen‘ postuliert wird: zwischen den Disziplinen, zwischen den Dingen, zwischen Kunst und Wissenschaft, zwischen Erkennen und Handeln… Analogien zu zeithistorisch relevanten Wissensmodellen sind da kaum von der Hand zu weisen. Zum einen gilt dies mit Blick auf die in den 1960er Jahren virulente Debatte zu den ‚zwei Kulturen‘ der Geistes- und Naturwissenschaften […], zum anderen hinsichtlich kybernetischer Leitideen.“103
Die Konzeption von Design als Hybriden „wird vom Topos eines fehlenden ‚Dritten‘ angeleitet“ und diesem Dritten gegenüber bleiben die Dichotomien zwischen Theorie und Praxis, Ideellem und Materiellem aufrecht.104 Dagegen schlug Mareis vor, „Design als eine historisch kontingent gewachsene Wissenskultur zu verstehen und ihre multiplen Praktiken, Mechanismen und Prinzipien zu befragen“.105
Für die theoretische Auseinandersetzung mit Kunst und Design stellt die dreifache Typologie Christopher Fraylings, die von Alain Findeli näher bestimmt wurde, ein Raster dar,106 das im Hinblick auf Modedesign sinnvoll anzuwenden ist.107
1. Unter Forschung für Kunst und Design108 wären im Hinblick auf das Berufsbild des Modedesigners/der Modedesignerin das elementare Erlernen von Praktiken und der Researchprozess zu verstehen, welche die Entwürfe und Modelle von Modekollektionen antizipieren. Das Wissen darüber ist später implizit in den Kollektionsteilen respektive Kleidungsstücken enthalten.
2. Forschung durch Kunst und Design ist eine Art projektgeleitete, wissenschaftliche Forschung, die für die Praxis produktiv gemacht wird.109 Diese kann alle Versuche im Modebereich einschließen, die auf eine verbesserte (Entwurfs-)Technik zur Herstellung von Bekleidung abzielen, genauso wie jedwede Gestaltungsprozesse, textiltechnologische Verfahren, experimentelle Produktionstechniken und [<<40] Materialforschung etc. Damit wären die partizipative Erfassung der jeweiligen Effekte und der eventuelle Nutzen für andere Disziplinen verbunden.
3. Zur Forschung über Kunst und Design zählt im Besonderen die Konzeption von theoretischem Wissen, von Mode- bzw. Designgeschichte und die Erstellung kanonischer Texte, welche praxisorientierte, vestimentäre Wissensbestände in Theorie überführen. Findeli kritisierte, dass diese meist eine mangelnde Relevanz für die Designpraxis aufweisen würden, wenn die Fragestellungen dafür mehrheitlich auf die jeweiligen soziologischen, historischen oder anthropologischen Forschungsdisziplinen ausgerichtet blieben.110
Obwohl derzeit eine Verschiebung zur Interpretation methodisch-systematischer Prozesse des Designs zu beobachten ist,111 verbleibt erfahrungsgeneriertes Modedesign-Wissen strukturell in der Kategorie des impliziten, stillen, intuitiven Wissens. Dieses ‚geheime‘ Wissen durch Erfahrungen, das Designer/innen im Laufe ihres Arbeitslebens sammeln, wird grundsätzlich erwartet, um konkurrenzfähig zu sein. Es kann nicht als explizites, als speicherbares und als solches übertragbares Wissen zur Verfügung stehen, denn gerade dieses spezielle Wissen zeichnet einzelne Designer/innenpersönlichkeiten aus.112 Jene kognitiven Prozesse werden von Nigel Cross als Design Thinking oder Designerly Ways of Knowing untersucht.113
Designwissenschaft verfolgt mit der Anrufung des Designs als Wissen das Ziel dieses stille, implizite Wissen, das im Körper verortet ist, jenes inkorporierte ‚Vermögen‘ zu externalisieren und dieses ,habituelle Können‘ zum Sprechen zu bringen, damit es für weitere Produktionsprozesse reproduzierbar und verwertbar wird. Claudia Mareis verwies mit Nachdruck darauf, dass Designforschende
„künftig nicht umhinkommen, sich über praxisbasierte und angewandte Fragestellungen hinaus, in einer differenzierten und kritischen Weise mit den Kriterien und Werten, aber auch mit den Mythen und Kulturen sowohl des wissenschaftlichen als auch künstlerischen Arbeitens auseinanderzusetzen, wenn in einer ernstzunehmenden Weise zu einer kritischen Geschichtsschreibung des Wissens beigetragen werden soll.“114 [<<41]
Dahin gehend und im Sinne des Philosophen Michel Foucault ist es möglich und wünschenswert, dass Modedesigner/innen auch als Forschende ihr eigenes Tun verwissenschaftlichen und damit aktiv in die „Wahrheitsspiele“115 der Produktion und Konstitution von „Designwissen“116, in die Konjunktion von Macht und Wissen eingreifen.