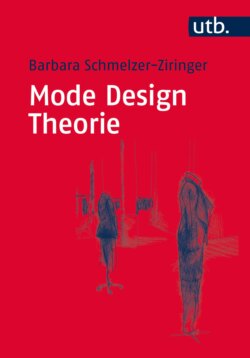Читать книгу Mode Design Theorie - Barbara Schmelzer-Ziringer - Страница 13
1.5 Mode und Theorie designen
ОглавлениеEntwurfstätigkeit und wissenschaftliche Tätigkeit haben unterschiedliche Prämissen. „Der Entwerfer beobachtet die Welt aus der Perspektive der Entwerfbarkeit. Der Wissenschaftler hingegen betrachtet die Welt aus der Perspektive der Erkennbarkeit.“145 Die Entwurfsforschung zum Modedesign erfasst, wie Figurinen und Schnitte gezeichnet, Drapierungen vorgenommen werden etc., und versucht, alle Tätigkeitsfelder von Designer/inne/n anhand von Interviews, qualitativen und quantitativen Studien etc. zu beschreiben. Dennoch ist es nicht möglich, Entwurfsprozesse wissenschaftlich zu standardisieren. Für Bonsiepe wird hier das
„Spannungsverhältnis zwischen kognitiv orientierter Tätigkeit (Forschung) und nicht kognitiv orientierter Tätigkeit (Entwerfen) sichtbar, wobei aber, um eventuelle Missverständnisse zu vermeiden, sogleich betont werden soll, dass die Entwurfstätigkeit in zunehmendem Maße kognitiv durchwoben ist.“146 [<<47]
Er spricht das Problem der Weitergabe von Entwurfswissen an, das in der Ausbildung sprachlich, visuell und haptisch zu vermitteln ist. Mit Blick auf die Modebranche ist dem zuzustimmen, dass, wer sich nur auf vermeintliche Kreativität beruft, wenige Möglichkeiten zur Entfaltung haben wird147 – egal in welchem Segment. Denn Entwurfswissen ist auch Erfahrungswissen, was sich meiner Einschätzung nach in der langjährigen Zusammenarbeit mit Modedesigner/inne/n bestätigt hat. Ein wichtiger Bestandteil der Entwurfsarbeit besteht darin, Entscheidungen innerhalb eines zeitlichen und an die jeweiligen Möglichkeiten angepassten Rahmens zu treffen. Der Rhythmus der global stattfindenden Modewochen und Modemessen fordert eine zielgerichtete Planung der Kollektionen ein.148 Dafür ist es notwendig, über die Konsequenzen der Entscheidungen zu reflektieren, was ökonomisches und soziokulturelles Wissen voraussetzt. Modedesign ist an viele außenstehende Faktoren gebunden. Eine Einzelperson als Urheber/in einer Kleiderkollektion ist zwar in der Lage, Entwürfe zu erstellen und Prototypen zu nähen, jedoch bleibt eine solche alternative Produktionsweise auf geringe Stückzahlen beschränkt. Diese Arbeit wird gemeinhin als Schneiderei oder Kunsthandwerk – ohne diese Tätigkeiten abzuwerten zu wollen – und nicht als Modedesign bezeichnet.
Der Filmtheoretiker Richard Dyer hat vier Typen für das Phänomen der Urheberschaft herausgearbeitet: die individuelle, die vielfache, die kollektive, bei der die Einzelleistung nicht mehr zu erkennen ist, und die korporative, bei der Organisationen, rechtliche Körperschaften und/oder Privatinvestor/inn/en als Urheber/innen auftreten.149 Diese Unterscheidungen sind für die Filmindustrie aufschlussreich und können auf die Modeindustrie übertragen werden, in der stets vielfach, kollektiv oder korporativ agiert wird. Kalkulierte Public Relations und ein präzises Markenmanagement suggerieren jedoch, dass es eine individuelle Autor/innenschaft von Modekollektionen gäbe, die durch das Branding beziehungsweise image building des/der Designer/s/in entsteht und dabei einen Mehrwert erzeugt, der Designer/innenware erst begehrenswert macht. Die Benennung „Designer“ kann als Schlüsselwort der Werbewirksamkeit gedeutet werden, daraus folgt eine Hervorhebung des Namens des/der Designer/s/in.150 Diese „Übernahme aus dem Bereich der Kunst, wo die Signatur des Künstlers die Einzigartigkeit, Authentizität, Individualität und die schöpferische [<<48] Leistung garantiert“, macht das Designer/innenetikett als Label für den Marktwert wichtiger als die eigentlichen Produkte.151 Der Designprozess gestaltet sich dagegen anders, denn erstens ist es äußerst selten, dass einzelne Designer/innen völlig originär arbeiten und tatsächlich komplett neue eigene Stile entwickeln – meistens handeln sie innerhalb eines historisch vorhandenen, stilistischen Spektrums und variieren dieses.152 Des Weiteren benötigen die Prozesse der Bekleidungsgestaltung für ein Modelabel die Zusammenarbeit mit Stoffdesigner/inne/n und -produzent/inn/en, Schnittgestalter/inne/n, Musternäher/inne/n und Konfektionsunternehmen, Stylist/inn/en, Presseagent/inn/en, Einkäufer/inne/n, Repräsentant/inn/en des Marktumfeldes und vielen anderen, deren Potenziale und Erwartungshaltungen auf den/die Designer/in einwirken.
Sowohl in einem Designatelier als auch in einem Unternehmen mit mehreren Hunderten Mitarbeiter/inne/n müssen vielfältige Überlegungen angestellt und mannigfaltige Entscheidungen getroffen werden. Schon in der Entwurfsphase sind diese Komponenten zu berücksichtigen. Es ist beispielsweise von Bedeutung, die Arbeit von Kolleg/inn/en und kommerzielle Trends zu kennen, um nicht unfreiwillig zum/r Trittbrettfahrer/in beziehungsweise copycat zu werden. Im Rahmen der künstlerischen Konzeptionen von Kollektionen müssen, den kommerziellen Möglichkeiten und technischen Bedingungen entsprechend, viele kleine Einzelentscheidungen getroffen und richtungweisende Schritte gesetzt werden, die einen erheblichen Einfluss auf das künstlerische Niveau haben. Freie Künstler/innen können im Gegensatz dazu relativ terminunabhängig arbeiten und es ist für sie möglich, ein Kunstwerk gänzlich autark zu fertigen. Ebenso steht es ihnen frei, das Material und die Medien zu wechseln, mit denen ein Kunstwerk auch intuitiv produziert werden kann. Doch die auf die Materialauswahl von Stoffen, Leder, Accessoires etc. beschränkte Arbeit von Modedesigner/inne/n, die Musterung der Kollektionsteile und die Wahl von Ort und Zeit der Präsentation, der Models und der Teams für Make-up, Licht- und Tondesign einer Modenschau erfordern aufmerksame, reflektierte Entscheidungen. Diese Tätigkeiten in einem angemessenen Zeitrahmen zu bewältigen, ist aus meiner praktischen Perspektive eine der Grundbedingungen für die Arbeit als Modedesigner/in.
Gleichermaßen ist die Frage nach der Art von Bekleidung, mit der wir leben wollen und wie diese hergestellt wird, von fundamentaler Bedeutung. Also kann in diesem Sinne design means to question and to decide als Gestaltungsprinzip für Modedesign, das jenseits ideologisch aufgeladener Designdiskurse wirksam ist, [<<49] gelten. Gestaltungsentscheidungen sind auf einer haptisch-visuellen Ebene positioniert und benötigen gleichzeitig eine verbale Artikulation. Daher ist die ‚visuelle Wende‘ in den Wissenschaften, die von Bild gebenden Verfahren digitaler Informationsverarbeitung mitgetragen wurde, dafür verantwortlich, Designtheorie als „Erforschung der Verkettung von Visualität und Diskursivität“153 zu denken. Darüber hinaus stehen im Hinblick auf einen materialist turn154 neben der Form und der Materialität die Haptik und olfaktorischen Eigenschaften von Artefakten zur Debatte. Der vonseiten der Geistes- und Kulturwissenschaften ausgerufene design turn strebt in der Gestaltung und Realisierung eine operative Wende in Richtung einer Überwindung des Gegensatzes von Theorie und Design an.155 Die Ergebnisse dieser innovativen Disziplinentransfers und deren kritische Bewertung stehen zukünftig zur Diskussion.