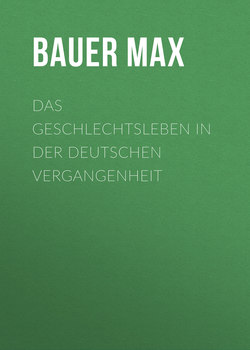Читать книгу Das Geschlechtsleben in der Deutschen Vergangenheit - Bauer Max - Страница 3
Das Leben auf dem Dorfe
ОглавлениеDas Leben der Bauern war während des ganzen Mittelalters hindurch eine ununterbrochene Kette von Misshandlungen und Verfolgungen seitens ihrer Herren: des Adels und des Klerus. Der Bauernstand, und nicht nur der leibeigene, lebte in fortwährender Knechtung, vollkommen abhängig von der Willkür seiner Besitzer. Nie war er davor sicher, von den Seinen getrennt zu werden, wenn es dem Herrn gefiel, die Frau oder die Kinder des Hörigen zu verschenken, zu verkaufen oder zu verpfänden. Im Jahre 1333 versilberte Konrad Truchsess von Urach zwei Bauernweiber mit ihrer Nachkommenschaft an das Kloster Lorch um drei Pfund Heller. Das Jus primae noctis beraubte ihn der Jungfräulichkeit der Gattin, deren Tugend überdies alle möglichen Fährlichkeiten drohten. Ward ein Bauer um Geld gestraft, und dieses nicht eintreibbar, und konnte auch an seinem Besitztum die Strafe nicht vollstreckt werden, dann sollte, wie das Weistum von Wilzhut, zwischen Braunau und Salzburg, bestimmt, die Frau des Straffälligen geschändet werden.
Dieses Weistum ist so vorsorglich, zu dekretieren, dass es dem Gerichtspfleger gestattet sei, falls die Frau »gefiel aber dem pfleger an der gestalt nicht«, er die Entehrung dem Gerichtsschreiber abtreten und dieser, wenn auch ihm die Ausführung nicht zusagte, sie dem Amtmanne »auferladen« könne. Nach wie vor waren die frischen Dirnen ein begehrter Artikel, um die Harems der Herren zu bevölkern. Der Ritter Ulrich von Berneck hielt sich nach dem Tode seiner Frau zwölf hübsche junge Mädchen »zur Erleichterung seiner Witwerschaft«. Kaiser Friedrich II. hatte seinen Harem, dem auch die Eunuchen nicht fehlten, in Luceria.
Das einzige Vergnügen jener bemitleidenswerten, erniedrigten Menschen war neben Völlerei die rohe sinnliche Liebe, der sie fröhnten, wo und wann sich Gelegenheit dazu bot.
Weit besser als die Hörigen und selbst freien Bauern Norddeutschlands waren die Ackerbürger im Süden Deutschlands daran, die sich ihre Selbständigkeit zu wahren gewusst, auf ihrem Grund und Boden nicht selten mit Glücksgütern reich gesegnet als eigene Herren schaltend, sich den Rittern gleichhielten, deren Tracht und Lebensgewohnheiten sie ins Dorf zu verpflanzen trachteten. Diese Nachahmung ritterlicher Sitten und Gebräuche verzerrte sich unter den ungehobelten Bauernfäusten natürlich ins Groteske, ab und zu ins Widerlich-Gemeine. Ein köstliches Beispiel bäuerlicher Grossmannssucht ist uns im »Meier Helmbrecht« von Wernher dem Gärtner, der ältesten deutschen Dorfgeschichte, entstanden im 13. Jahrhundert, überliefert. Der Titelheld, ein reicher Bauerssohn, den die Eltern verzärtelt, strebt darnach, Ritter zu werden, bringt es aber nur zum Strauchdieb, der vom Schicksal ereilt, geblendet, eines Fusses und einer Hand beraubt wird, als eben seine Schwester Gotelinde mit einem seiner Spiessgesellen Hochzeit hält.41
Wie die Dorfburschen, so liebäugelten auch die Alten mit den edlen Herren und sahen wohlgefällig zu, wenn ein Ritter eine arme Verwandte einem reichen Bauerssohn als Gattin aufhalste, oder ein verarmter Rittersmann ein hübsches Dirnlein heimführte, um mit der Mitgift sein verrostetes Schild neu zu vergolden42 – also nichts Neues unter der Sonnen! Besonders den Dorfschönen stachen die noblen Herren in die Augen, die so ganz anders geartet waren, als die grobkörnigen Burschen, die so zierliche Redensarten zu drechseln wussten und mit Geschenken nicht geizten. Aus den Liedern der Minnesänger ist ersichtlich, dass die Adeligen diese gute Meinung zu nutzen verstanden und Abenteuern mit den drallen Dirnen keineswegs aus dem Wege gingen. Nidhardt von Reuenthal ergeht sich in breiten Schilderungen seiner Erfolge und über das Liebesleben auf dem Dorfe. In einem seiner Gedichte unterhalten sich Mutter und Tochter, und die Mutter meint, das 16jährige Töchterchen sei noch viel zu jung zur Liebe. »Ei was,« entgegnet diese schnippisch, »Ihr wart ja erst zwölf Jahre, als Ihr Euerer Jungfernschaft ledig wurdet.« »Nun so nimm meinetwegen Liebhaber so viel du willst.« »Das thät' ich auch gerne, wenn Ihr mir nicht immer die Männer vor der Nase wegfischtet. Pfui doch, hol Euch der Teufel! Habt doch schon einen Mann, was braucht Ihr noch andere?« »Pst, schweig still, Töchterlein. Minne wenig oder viel, ich will nichts dagegen haben, und solltest du auch ein Kindlein wiegen müssen. Sei aber auch verschwiegen, wenn du mich der Liebe nachgehen siehst.«
Hermann von Sachsenheim hat im Liederbuche der Klara Hätzlerin einen für ihn sehr unrühmlichen Sturm auf eine Grasmagd besungen. Oswald von Wolkenstein weiss gleichfalls von Abenteuern mit Dörflerinnen zu erzählen, ebenso Tannhäuser und andere Minnesänger mehr.
Die Dorfschönen fühlten sich eben durch die Bevorzugung seitens des Adels geehrt, und ihre Liebhaber und Gatten drückten gerne ein Auge zu, geradeso wie es sich etwas später die Bürger zur Ehre rechneten, wenn irgend ein Höhergestellter, oder gar – horribile dictu – ein Adeliger, sich gnädigst herabliess, ihre Frauen zu verführen. Darauf deutet wenigstens die Stelle in Balthasar Voigts, Pastors zu Drubeck, »Ägyptischem Joseph« hin, eine »geistliche Komödie, sowohl in kleinen als grossen Schulen zu agieren«, ein Machwerk voll widerlicher Plattheiten und Schweinereien, die aber trotzdem von halbwüchsigen Knaben gesprochen und dargestellt wurden! In dieser »Schulkomödie« erzählt Medea, Potiphars Frau, von Josephs angeblichem Verführungsversuch:
»Kein Edelmann, kein Graf im Reich,
Die doch gewest wärn Meinesgleich,
Haben mir Unehr zugemut't,
Wie dieser euer Hebräer thut.
Wär mirs geschehn von einem Edelmann,
Möcht ihr's euch ziehn zu Ehren an,
Dass ihr zum Weib hätt solch Matron,
Welch gefiel jeder Adelsperson.«
Und so etwas schrieb ein Geistlicher für die Jugend!
Neben den Rittern und Knappen waren hauptsächlich die Dorfpfaffen bei den Frauen als Liebhaber beliebt, worauf ich noch zurückkommen muss, ebenso wie bei den Männern die Mägde des eigenen Hauses und die Frauen und Töchter der Nachbarn. Übrigens ist aus dem Schwankbuche »Peter Leu« ersichtlich, dass die schlauen Mägdlein schon damals die Kunst verstanden, irgend einem unschuldigen armen Teufel die Paternität aufzubrummen, die ein ganz anderer auf dem Gewissen hatte.43
Wo Verführung gang und gäbe war, fehlten auch deren Folgeerscheinungen, namentlich der Kindesmord, nicht. Strenge, zum Teil unmenschliche Strafen sollten das Übel steuern. »Kindsvertilgerin lebendig ins Grab, ein rohr ins maul, ein stecken durchs hertz« bestimmt beispielsweise das Brenngenborner Weistum von 1418. Noch grausamer waren die urwüchsigen Dithmarschen Bauern, welche sogar gefallene Mädchen im Sumpfe lebendig begruben, welches Urteil der älteste Mann der Familie der Verbrecherin zu vollziehen hatte.44 Den Verführer seiner Frau und diese selbst konnte der Dithmarsche nach eigenem Ermessen bestrafen, verstümmeln, töten oder freigeben.45 Ein Gleiches gestattete auch das mit grausamen Strafen sehr freigebige Berliner Stadtbuch.46
So frei übrigens das Bürgertum und die Bauern im grossen und ganzen über den Geschlechtsverkehr dachten, in einem waren sie einig: in der Achtung vor der Jungfräulichkeit. Darum galt ihnen die Notzucht als eines der todeswürdigsten Verbrechen, auf das zum Teil fürchterliche Strafen gesetzt wurden. Sogar die Nötigung der fahrenden Frauen – »an varndeme wive« – und an der Geliebten ahndet der Sachsenspiegel III art. XLVI 1 mit dem Tode. Der Schwabenspiegel verbietet nur die »notnunft« an »siener amîen«, der Geliebten.
Die Ahndung des Verbrechens war entweder die Enthauptung, manchmal das Lebendbegraben, wie dies 1418 einem Krämer in Augsburg erging. Im 13. Jahrhundert wurde in Basel ein Geistlicher dieses Deliktes wegen entmannt und dann getötet. Im Frankenbergischen wurde dem Vergewaltiger ein spitzer Eichenpfahl aufs Herz gesetzt, den die Geschändete mit drei wuchtigen Hammerschlägen in den Körper treiben musste; so wird wohl die Todesart variiert, aber der schimpfliche Tod blieb überall das Los des Verbrechers.
Nach diesen düsteren Bildern der »guten alten Zeit«, die gewisse dichterisch veranlagte Romantiker gerne als Vorbild für unsere verderbte Epoche aufzustellen belieben, wieder zu etwas Heiterem.
Am lustigsten ging es im Dorfe natürlich bei den seltenen Festlichkeiten, an hohen Feiertagen und bei den Kirchweihen zu, wo man sich im Essen, Trinken, Lieben und Raufen nicht genug zu thun wusste.
Die Hochzeiten begüterter Dörfler zählten gleichfalls als Festlichkeiten, zu denen die Verwandten und Freunde oft von weither kamen, um sich vergnügte Tage zu machen. Drei detaillierte Schilderungen solcher bäuerlicher Hochzeitfeiern sind auf uns gekommen, die hier auszüglich mitgeteilt sein mögen. Das erste dieser Gedichte, »Von Metzen hochzit«, entstammt dem Anfang des 14. Jahrhunderts. Der junge Meier Börschi (Bartholomeus) will seine Geliebte Metzi heiraten. Am Montag früh versprechen sie sich, und da die beiderseitige Mitgift das Paar zufrieden stellt, wird am Abend desselben Tages die Hochzeit mit einem solennen Hochzeitsmahle gefeiert, bei dem es hoch hergeht und alle vollgetrunken sind, als man das Brautpaar zu Bett bringt. Die Braut schreit, weint und sträubt sich erst gegen das Auskleiden, wie es die Gepflogenheit verlangt. Am Morgen wird dem jungen Ehepaare das Essen ans Bett gebracht, worauf sich Metzi unter dem Jubel der Bauern bei Zwerchpfeifen- und Trommelklang anzieht, um in die Kirche zur Trauung zu ziehen.
Das Gedicht der oft erwähnten Klara Hätzlerin »von meyer Betzen« lehnt sich ziemlich eng an »Metzis Hochzeit« an, nur dass Metzi mit einer fürchterlichen Schlägerei, hingegen das Poem der Hätzlerin mit der saftigen, aber witzigen Beschreibung der Brautnacht also endet:
»Da führt man Pezen (den Bräutigam) auf die Fahrt
Und stellt ihn zu dem Brautbett.
Zwei grosse Pantoffel er an hätt'.
Als man ihm nun die Mezen (seine Braut) gebracht,
Sprang er fröhlich ins Bett und lacht.
Alsbald er sie mit dem Arm umfing,
Darauf Alles aus der Kammer ging.
Pez sprach: ›Hätt' ich ein Licht
Glaub mir, ich unterliess es nicht
Ich macht aus dir ein Eheweib‹
Beteuerte er bei seinem Leib.
›Dass doch nur der Mond jetzt schien,
Dann liess ich dich nicht also hin.‹
Mez sprach: ›Du volle Kuh,
Was soll dir denn ein Licht dazu?
Min's Vaters Knecht der Upelpracht,
Konnt' es sogar um Mitternacht!‹«
Heinrich von Wittenweiler führte im 15. Jahrhundert die Erzählung von Metzens Hochzeit in breiter Weise weiter aus, sie durch viele Zusätze modernisierend und vergemeinernd.47
Der Held ist Bertschi Triefnas, der in dem Dorfe Lappenhausen wie ein Pfau herumstolzierte und sich als Junker anreden liess. Er liebt Mäczli Rürenzumph, der zu Ehren er mit seinen Genossen turniert, der er Ständchen bringt, die er im Kuhstalle erfolglos zu bezwingen sucht, und bei der er durchs Dach bricht, als er sie in ihrer Kammer belauschen will. Da alles dies ihm Mäczli nicht geneigter macht, lässt er sich von dem Dorfschreiber einen Liebesbrief schreiben, den dieser an einen Stein bindet und Mäczli zuwirft, wodurch er sie am Kopfe verwundet. Der Brief wird gefunden und Mäczli ruft ihrem Vater zu, um dessen Grimm zu entwaffnen, sie blute am Kopfe und müsse zum Arzte gebracht werden. Das Gefolge teilnehmender Freunde und Nachbarn weist der Arzt hinaus, worauf ihn Mäczli bittet, ihr den erhaltenen Brief vorzulesen. Er thut es, erpresst aber von ihr durch die Drohung, den Inhalt dem Vater mitzuteilen, eine Liebkosung, gibt ihr aber zugleich Rat, wie sie dessen Folgen vertuschen soll. Darauf setzt er ihr einen floskelreichen Liebesbrief auf, der einer Kupplerin zur Übergabe an Bärtschi ausgehändigt wird. Nachdem sich dieser den Brief vorlesen liess, beruft er seine Freunde und Verwandten, um mit ihnen seine Heirat zu beraten. Man spricht für und wider, bis endlich alle einig sind. Sofort machen sich zwei der Freunde auf, Bärtschis Werbung bei dem Brautvater vorzubringen, der sie günstig aufnimmt und nach einigen Formalitäten seine Einwilligung gibt, wovon man den Freier benachrichtigt. Mäczli fällt bei der Nachricht von Bärtschis Werbung in Ohnmacht, kommt aber gleich wieder zu sich und lässt sich von den Freundinnen schön machen und in die Versammlung führen, wo sie sich erst »mit füssen und elnpogen« wehrt, ehe sie ihr Jawort gibt. Mäczli empfängt von ihrem Galan einen kleinen verzinnten Ring mit einem Saphir aus Glas und ein weiteres Kleinod mit zwei Perlen aus Fischaugen. Die Angehörigen verlassen nun das Haus, nicht ohne vorher dem jungen Ehemanne Haar und Bart zerzaust zu haben, um bei den Anstalten zur Hochzeit nicht im Wege zu sein. Gäste werden eingeladen und kommen »geritten auf eseln und auf schlitten«. Am Festtage verkündet der Pfarrer in der Kirche den Vollzug der Ehe, worauf man sich in des jungen Ehemanns Haus begibt, um erst die Brautgaben zu empfangen, ehe man mit dem überreichen Mahle beginnt, nach dem man sich im Tanze belustigte.
»Die Mägdlein waren also rüg
Und sprangen her so ungefüg,
Dass man ihnen oft, ich weiss nit wie,
Hinauf konnt seh'n bis an die Knie.
Hildens Brustlatz war zu weit,
Darum ihr zur selben Zeit
Das Brüstlein aus dem Busen sprang.«
Das Ende mit Schrecken ist Prügelei mit Mord und Totschlag.
In der Brautnacht wird dem Pärchen eine Stärkung gereicht, nicht so der anderen Weiblichkeit, die, die günstige Gelegenheit benützend, gleichfalls die Nacht mit ihren Liebhabern verbringt. Am nächsten Tag setzt die Hochzeit wieder ein und endet mit einer wahren Schlacht, bei der die Obrigkeit einschreiten muss.
Die freie Denkungsart des Mittelalters in geschlechtlichen Dingen hielt sich nicht an den heute gang und gäben Standpunkt, dass nur der Mann allein seinen sinnlichen Bedürfnissen Rechnung tragen dürfe, die Frau aber den einmal geweckten Naturtrieb zu unterdrücken habe. War die Vorzeit auch intolerant gegen Fehltritte von Mädchen, so erkannte sie der Frau das Recht zu, von ihrem Manne die Leistung der ehelichen Pflicht voll und ganz beanspruchen zu dürfen. Luthers Ansicht: »Ein Weib, wo nicht die hohe seltsame Gnade da ist, kann eines Mannes ebensowenig entraten als essen, schlafen, trinken und andere natürliche Notdurft«, die er oft und in verschiedenen Varianten verficht, war ganz die seines Zeitalters, was schon daraus hervorgeht, dass sogar gesetzliche Bestimmungen der Frau ihr durch die Heirat erworbenes Recht in für den betreffenden Gatten tragikomischen Bestimmungen zu wahren suchen.
Diese Gesetze vertreten ganz Luthers Standpunkt, der in seinem Traktat »Vom ehelichen Leben« erklärt: »Wenn ein tüchtig Weib zur Ehe einen untüchtigen Mann überkäme und könnte doch keinen anderen öffentlich nehmen und wollte auch nicht gern wider Ehre thun, soll sie zu ihrem Mann also sagen: Siehe, lieber Mann, du kannst mein nicht schuldig werden, und hast mich und meinen jungen Leib betrogen, dazu in Gefahr der Ehre und Seligkeit bracht, und ist für Gott keine Ehe zwischen uns beiden, vergönne mir, dass ich mit deinem Bruder oder nächsten Freund eine heimliche Ehe habe und du den Namen habst, auf dass dein Gut nicht an fremde Erben komme, und lass dich wiederum williglich betrügen durch mich, wie du mich ohne deinen Willen betrogen hast.« Der Mann, führt Luther48 weiter aus, hat die Pflicht, die Bitte zu erhören; will er nicht, so darf er nicht böse sein, wenn die Frau von ihm läuft.49
Am weitschweifigsten ergehen sich die westfälischen Weistümer über diese auch heute noch brennende Frage. Sie erkennen in erster Linie dem Nachbarn des untauglichen Ehemannes das erste Recht auf Stellvertretung zu, dann jedem X-beliebigen. Das Beuker Heidenrecht (III 42) besagt wie folgt: »Item so erkenne ich auch für Recht, so ein guter Mann ihr Frauenrecht nicht vollziehen könne, dass sie darüber klagt, so soll er sie aufnehmen und tragen über sieben Zäune und bitten seinen nächsten Nachbarn, dass er seiner Frau helfe; wenn ihr geholfen ist, soll er sie wieder nehmen, sie wieder tragen nach Haus und setzen sie sacht nieder und ihr ein gebratenes Huhn und eine Kanne Wein vorstellen.« In der Landfeste von Hattingen hat dieser Gebrauch gleichfalls Platz gefunden: »Da ein Mann wäre, der seinem rechten Weibe ihr frauliches Recht nicht thun könne, so soll er sie sachte auf den Rücken nehmen und tragen über neun Zäune und setze sie dort vorsichtig nieder, ohne Stossen, Schlagen, Werfen und ohne bösen Worte, rufe alsdann seine Nachbarn an, dass sie ihm seines Weibes Not wehren helfen. Und wenn dann seine Nachbarn das nicht thun wollen oder können, so soll er sie senden auf die nächste Kirchweih in der Nähe, und dass sie dort »sich seuverlich zumache und zehrung habe, hänge er ihr einen mit Geld bespickten Beutel auf die Seite. Kommt sie von dorther wieder ungeholfen, dann helfe ihr der Teufel!«
Nach dem Bochumer Landrechte (III. 70) genügt ein Teufel nicht mehr. Hat der Mann die Frau über die Zäune getragen, dort fünf Stunden lang um Hilfe gerufen, sie im neuen Kleid mit Geld versehen auf einen Jahrmarkt geschickt, ohne dass sich ihr Wunsch erfüllte, dann mögen ihr »thausend düffel« helfen.50
War die Frau ansehnlich, dann bedurfte es solcher Gewaltmassregeln kaum, sie fand unter der Dorfjugend leicht einen Liebhaber, und verhielt sich diese spröde, dann war noch immer der Herr Geistliche da.
Denn wenn auch die Geistlichkeit gegen die Unzucht von der Kanzel herab Zeter und Mordio predigte, so war sie während ihrer unendlich vielen Freizeit eine ewig dräuende Gefahr für den schöneren Teil ihrer Pfarrkinder.
»Die Sünden, die begehn allein
Die Pfaffen, sind die Weibelein«
sagt der Freidank in seiner Bibel des Mittelalters, in der »Bescheidenheit«, indem er den Klerikern ins Gewissen zu reden sucht und ihnen zürnend zuruft:
»Ein jeder Priester meiden soll
Mess oder Weib; das stehet wohl:
Das Haus bedarf der Reinheit wohl,
Darein Gott selber kommen soll.«51
Auch Walter von der Vogelweide meint: »Die Pfaffen sollten keuscher leben als die Laien«, sie thaten es aber so selten, dass die Bauern froh waren, wenn ihre Seelenhirten Beischläferinnen besassen. Die kernigen Friesen duldeten keine Priester ohne Konkubinen in ihrer Mitte: »Se gedulden ock geene Preesteren, sunder eheliche Fruwen, op dat se ander lute bedde nicht beflecken, wente sy meinen, dat idt nich mogelygk sy, und baven die Natur, dat sick ein mensche ontholden konne«.52
Mit anerkennenswerter Offenheit äussert sich ein Manuskript-Fragment aus dem 13. Jahrhundert »de rebus Alsaticis«: »Um das Jahr 1200 hatten auch die Priester allgemeine Beischläferinnen, weil gewöhnlich die Bauern sie selbst dazu antrieben. Diese sagten nämlich: Enthaltsam wird der Priester nicht sein können, es ist darum besser, dass er ein Weib für sich hat, als dass er mit den Weibern aller sich zu schaffen macht.« Welche Gefahr dieses Beackern fremder Felder darstellte, beweist nach der eben citierten Quelle ein Herr Heinrich Bischof von Basel (1215-38), der bei seinem Tode 20 vaterlose Kinder ihren Müttern hinterliess. Ein Bischof von Lüttich, den das Konzil von Lyon absetzte, besass gar 61 Sprösslinge. Nach Caesarius von Heisterbach scheute mancher Pfaffe selbst nicht davor zurück, mit Jüdinnen Verhältnisse einzugehen, im Mittelalter eine Todsünde, doppelt sündhaft für einen Geistlichen.
Offen und ungescheut unterhielten die meisten Geistlichen ihre Pfarrersköchinnen bis zur Reformation, die sich diese Achillesferse der Gegenpartei nicht entgehen liess und eine ganze Litteratur wider die Pfaffenbuhlerinnen zeitigte. Die »Epistolae virorum obscurorum« und Ulrich von Huttens Gesprächbüchlein sind köstliche Blüten dieser Kampfschriften; namentlich das erstgenannte Buch übergiesst die Pfarrerdirnen und ihre Liebhaber mit ätzender Satire. Aber auch die katholische Litteratur bemächtigte sich von altersher des dankbaren Stoffes, um ihr Mütchen an den Pfaffendirnen zu kühlen, sei es in ernst mahnender, sei es in derb-komischer Manier. Der »Pfarrer von Kahlenberg« weiss durch die hübsche Beischläferin seines Bischofs sich manchen Vorteil zu erschleichen. So liegt er einmal unter dem Bette, während der Bischof seiner Liebsten »die Kapelle weiht«.53 Da dieser Eulenspiegel im Priesterkleide den Befehl erhielt, Bedienerinnen zu haben, die 40 Jahre zählen, so nimmt er sich zwei von je 20 Jahren. Im Till Eulenspiegel und den anderen Schwankbüchern des Mittelalters gehört der verbuhlte Pfaffe zu den stereotypen Figuren, die es meisterlich verstehen, die Gatten und Väter zu hintergehen. Manchmal misslang allerdings das Vorhaben, dann empfingen sie eine Tracht Prügel, wurden sogar manchmal erschlagen. Doch auch an ernsten Stimmen über das pfäffische Treiben fehlt es nicht. Thomas Murner, dessen Geissel auch seine eigenen Standesgenossen nicht verschont, wenn es gilt, der Menschheit ihre Laster vorzuhalten, ironisiert im »Narrenspiegel«:54
»Dann hör' ich eurer Köchin Beicht',
Und ihr thut's meiner auch vielleicht
Und thut, wie unser Vorfahr that,
Der von der Höll' uns alle hat
Befreit, uns thät vor Tod bewahren,
Dass wir nicht brauchen hineinzufahren.
Jedoch, sobald ihr wolltet schnurren
Und wider unsre Freiheit murren,
Aus meiner Pfarr', aus meinem Haus
Meine liebe Köchin treiben aus,
Mit der ich alle Kurzweil' treib',
Die mir auch wärmet meinen Leib,
Die wohl schon zwanzig ganze Jahre
Mir hat gekräuselt meine Haare –
Das würde dir nicht schlecht vergolten.
Denn bald die Bauern wissen sollten,
Bald sagt' ich ihnen frohe Märe,
Dass nirgends eine Hölle wäre.«
Dann weiter:
»Jeder hat eine Dienerin,
Die tag und nacht bischlaft im.«
Die Herren Geistlichen waren Epikureer, die dem Sprichworte huldigten: »Es ist kein feyner leben auf erden, denn gewisse Zinss haben von seinem Lehen, eyn Hürlein daneben und unserem Herre Gott gedienet.«
Die Pfarrer durften sich ungestört ihrer wilden Ehe hingeben, wenn sie ihre Oberen nur dafür bezahlten. Aus diesem Sündengeld zogen viele Bischöfe grosse Summen. »Es war ein mal ein priester, der gab alle iar dem fischgal (Fiskal) fier guldin, dass er im die Kellerin in ruwen (Ruhe) liess«55, eine stattliche Summe, die ein Erkleckliches ausmachte, wenn eine grössere Anzahl von Priestern aus einer Diözese den gleichen Betrag erlegen musste. Heinrich von Hewen, um die Mitte des 15. Jahrhunderts Bischof von Konstanz, selbst ein üppiger Herr, gewann aus den Konkubinen-Abgaben seiner Geistlichen eine jährliche Einnahme von 2000 Gulden. Das ärgerliche Leben der Geistlichkeit verlockte sogar die abergläubische Menge, ihnen die Schuld an Epidemien und schweren Erkrankungen ihrer Beichtkinder, besonders an der Epilepsie, zuzuschieben. »Da ward darnach von etlichen also gedeutet, als sollten diese Leute nicht recht getaufft, oder doch ihre Tauffe nicht krefftig sein, weil sie die von solchen pfaffen empfangen, die da unverschampt, mit unzüchtigen Huren in öffentlicher Unehe bey einander lebten, darüber das gemeine Volk bald ein aufstehen gemacht, und alle pfaffen zu todt geschlagen hette.«56
Neben der Liebe vergassen auch viele Geistliche nicht, weltliche Güter zu eigenem und zum Nutzen ihrer Klöster zu ergattern. Junge, hübsche und reiche Witwen und Waisen waren ein gesuchter Artikel für Laien und Priester. »Darnach sind etliche (Geistliche),« äussert sich Geiler von Kaisersberg, »die wittwen und weyssen heymsuchend. Warumb? Darumb: Sy begerend sye zuo verfueren, uff dass sye ires leibes und guotes gantz gewaltig werdend.«57
Ausser ihren Beichtkindern und ihren Wirtschafterinnen standen übrigens der höheren Geistlichkeit die ihnen subordinierten Klöster für galante Abenteuer zur Verfügung, worüber schon in früher Zeit viele Klagen laut wurden, deren Berechtigung auch Karl der Grosse durch einige seiner Kapitularien anerkannte.
41
Eine in jeder Beziehung ausgezeichnete Neubearbeitung Meier Helmbrechts lieferte Ludwig Fulda (Hendel, Halle a. S.), deren Lektüre nicht warm genug empfohlen werden kann.
42
Freytag, Bilder aus der deutschen Vergangenheit, II.I S. 64 ff.
43
Peter Leu, erneut v. Karl Pannier, 12. Kap. S. 98.
44
O. Beneke, Von unehrlichen Leuten, S. 168.
45
Bartels, Der Bauer in der deutschen Vergangenheit, S. 56.
46
Maximilian Rappsilber, Alt Berlin, S. 79.
47
Herausgegeben von Ludw. Bechstein.
48
Jena 1522 II. 146.
49
Dr. Karl Hagen, Deutschlands literarische und religiöse Verhältnisse im Reformationszeitalter, S. 234.
50
Alwin Schultz, Deutsches Leben im XIV. und XV. Jahrh., S. 159.
51
Freidank a. a. O., Aus dem Mittelhochdeutschen von K. Pannier, S. 24 ff.
52
Corvin, Pfaffenspiegel, V. Aufl. S. 303.
53
»Der Pfarrer von Kahlenberg.« Ein Schwankgedicht. Erneut von Karl Pannier, Leipzig, S. 36.
54
19. 86.
55
Schimpf und ernst v. Bruder Johannes Pauli, Strassburg 1522.
56
Cyr. Spangenberg, Adels Spiegel. Historischer ausf. Bericht: Was Adel sey und heisse etc. Schmalkalden 1591. fol. 403 b ff.
57
Seelenparadies, fol. 147 a.