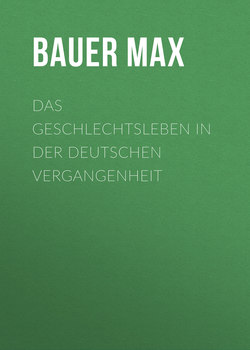Читать книгу Das Geschlechtsleben in der Deutschen Vergangenheit - Bauer Max - Страница 5
Beilager und Ehe
ОглавлениеDie Ehe, dieses älteste von Naturgesetzen diktierte Verhältnis, das zwei Menschen aneinander schliesst, hat kein anderes Volk so edel aufgefasst, wie die Germanen.
»Das Verlöbnis war ein Vertrag, durch welchen Mann und Weib sich zu einem Haushalt und Gründung einer Familie für das ganze Leben verbanden, um einander lieb zu sein über alles auf Erden, Wunsch, Willen und Besitztum gemeinschaftlich zu haben. Selbst mit dem Tode hörte die Pflicht der überlebenden Gattin nicht auf. Bei einigen Germanenvölkern war es der Frau nur einmal gestattet, in den Ring der Zeugen zu treten, vor denen sie das Gelöbnis ablegte; und es sind Spuren erhalten von noch älterer strenger Volkssitte, nach welcher die Frau den Gatten so wenig überleben durfte, wie der Gefolgmann seinen Wirt, wenn dieser in der Schlacht fiel. Das Weib des Germanen war nicht nur die Hausgebettete, die auf gemeinsamem Lager den Hals des Gatten umschlang, und nicht nur Herrin des Hauses und Erzieherin der Kinder, wie bei den Römern, sie war auch seine Vertraute und Genossin bei der männlichen Arbeit. Die Geschenke, welche der Mann ihr zu dem Gelöbnis gab, ein Joch Rinder, Speer und Ross68, waren symbolisches Zeichen, dass sie mit ihm über den Herden walten würde und als seine Begleiterin an der Feldarbeit teilnehmen, ja dass sie ihm auf dem Kriegspfade folgen sollte, in der Schlacht seinen Eifer zu stählen, seine Wunden zu rühmen, nach seinem Tod ihn zu bestatten und vielleicht zu rächen.«69
»Der Innigkeit germanischer Ehe schadete nicht, dass sie schon in der Urzeit oft ein Familienvertrag war, der im Interesse zweier Geschlechter geschlossen wurde«, und diese Art des Ehebundes blieb in allen Ständen von der Urzeit an die vorherrschende. Die Liebe kam in zweiter Linie; trotz Freytags poetischer Verherrlichung war meist rein prosaisches Interesse die Ursache der Verheiratung.
»Wie in heidnischer, so ist die Ehe auch in christlicher Zeit durchaus ein Geschäft zwischen dem Bräutigam und den Verwandten der Braut, wobei letztere vielfach gar nicht um ihre Zustimmung befragt wurde«70, nur trat mit der Zeit eine Wandlung dahin ein, dass der ursprünglich dem Vater oder dem Mundwalt der Braut, dem ältesten Bruder oder Vormund, übergebene Brautkauf nun der jungen Frau selbst, sei es als Morgengabe, oder als Wittum (videme) zufällt. War die Morgengabe ein freiwilliges Geschenk des Ehegatten an seine Neuvermählte, so wurde die Höhe des Wittums vorher genau festgesetzt. Siegfried schenkt seiner jungen Gattin den Nibelungenhort, Bärschi in »Metzens Hochzeit«, der Metzi, ein feistes Mutterschwein zur Morgengabe.
Die altdeutsche Eheschliessung zerfällt in die Erwerbung der Braut durch den Verspruch vor dem Vormund und durch die Übergabe der Braut an den Bräutigam durch die Heimführung. Durch die Verlobung erstanden dem Bräutigam bereits rechtliche und eheliche Ansprüche an die Braut, deren Verletzung durch Dritte gesetzliche Ahndung findet. Daher wird mit Recht der Satz aufgestellt, dass die Verlobung die Eheschliessung, die Trauung aber nur den Vollzug der Ehe darstellte. Die Verlobung schildert das Nibelungenlied bei Gelegenheit des Verspruches von König Giselher mit der Tochter Rüdegers von Bechelaren. Nachdem des Königs Brüder als Freiwerber das Jawort erhalten haben, der Jungfrau seitens des burgundischen Geschlechts das Wittum festgelegt wurde und der Brautvater eine Summe Gold und Silber als Mitgift ausgesetzt hat, heisst man das junge Paar nach alter Sitte in den »rinc« (einen Kreis) treten, fragt die Jungfrau, ob sie gewillt sei, den Recken zum Manne zu nehmen, und als sie das auf ihres Vaters Rat bejaht, reicht Giselher der Braut die Hand zum Gelöbnis.
Der Ring, als Zeichen der Verlobung, kam mit dem Eindringen des Christentums zu den europäischen Völkern. In der Gudrun »jedwederz dem andern daz gold stiez an die hant«.71
War die Verlobung auch identisch mit der Ehe selbst, so räumte sie dem Bräutigam doch keine ehelichen Rechte ein. Das geschlechtliche Zusammenleben Verlobter war untersagt und auf vorzeitigen Beischlaf standen strenge Bussen. Untreue der Braut galt vielfach als Ehebruch; der Verführer erlitt Todesstrafe, wenn er nicht durch zwölf Eideshelfer beschwören konnte, von der stattgehabten Verlobung nichts zu wissen. Über die Untreue des Bräutigams glitt man leichter hinweg. Das Hamburger Stadtrecht von 1270 bestimmt, wenn der Verlobte von einem Weibe wegen intimen Umgangs mit ihr verklagt werde, so habe die Braut drei Monate auf die Entscheidung zu warten; könne die Sache nur in Rom geführt werden, so warte sie ein Jahr. Ist der Prozess auch dann noch nicht zu Ende, so ist das Verlöbnis aufgelöst und der Braut gebührt eine Entschädigung von 40 Mark Pfennig. Dasselbe galt für eine Klage gegen die Braut.72 Wer eine Braut entführte, hatte ausser den Blutsverwandten auch den Verlobten zu sühnen, unter Umständen den zehnfachen Brautkauf zu erlegen, und musste die Entführte behalten, denn der Raub löste die Verlobung. Nur die bayrischen Rechte verlangten die Rückgabe der Braut an den Bräutigam. Die Entführung wurde von unseren Vorfahren zu den schwersten Verbrechen gerechnet; Notzucht und Frauenraub fielen in den Gesetzen mehrfach zusammen. Selbst das Asylrecht in den Klöstern und anderen Freistätten, die kein Scherge betreten durfte, blieb den Frauenräubern verschlossen. Karl der Grosse verhängte über den Entführer der Tochter seines Herrn die Todesstrafe, die Kirche belegte alle diese Verbrecher mit ihrem Bann. Schwere Geldbussen waren allen Gesetzen des Mittelalters gemeinsam, wenn sie nicht auf Leib- und Lebensstrafen erkannten. Das Hamburger Stadtrecht von 1270 bedroht den mit Todesstrafe, der eine Jungfrau unter 16 Jahren, wenn auch mit ihrem Willen, oder eine ältere gegen ihren Willen entführt; der Entführer geht nur dann frei aus, wenn er ein nacktes Mädchen über 16 Jahre mit seinem Einverständnis entführte.73
68
Tacitus, Germania, Cap. 18.
69
Gust. Freytag, Bilder a. d. d. Vergangenheit, 26. Aufl., S. 87.
70
Prof. Dr. J. Dieffenbacher, Deutsches Leben im 12. Jahrh., S. 120.
71
D. Paulus Cassel, Die Symbolik des Ringes, S. 21.
72
Weinhold a. a. O. I. 348 ff.
73
Weinhold a. a. O. I. 308 ff.