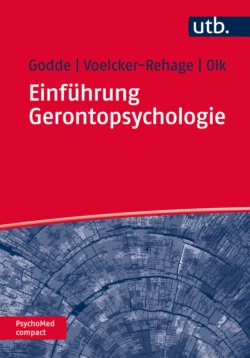Читать книгу Einführung Gerontopsychologie - Ben Godde - Страница 10
Оглавление2 Theorien des Alterns
Im folgenden Kapitel wird Altern aus Sicht der Biologie und der Psychologie dargestellt. Auf soziale und soziologische Theorien des Alterns sei hingewiesen (Bengtson, 2008). Diese werden aber aufgrund des biologisch-psychologisch orientierten Ansatzes dieses Buches nicht besprochen.
Im Sinne der Biogerontologie wird der Alternsprozess als die Summe an Veränderungen definiert, die zu einem Funktionsverlust von Zellen, Geweben und Organen und in letzter Konsequenz zum Tod führen (Hayflick, 2007). Biologisches Altern wird somit als ein Abbauprozess Altern als Abbauprozess verstanden, der mit dem Abschluss der ontogenetischen Entwicklung (oder Maturation) beginnt und zwangsläufig und irreversibel ist.
Altern als Entwicklungsprozess
Psychologische Theorien beschäftigen sich dagegen vor allem mit Veränderungen von Kompetenzen im physischen, psychischen und sozialen Bereich über die gesamte Lebensspanne. Dabei wird auch das Altern als Entwicklungsprozess aufgefasst, der je nach Betrachtungsebene multidirektional und multidimensional verläuft und durch positive und negative Veränderungen (Plastizität) gekennzeichnet ist (Kapitel 1).
Diese unterschiedlichen Betrachtungsweisen schließen sich keineswegs gegenseitig aus, sondern beschreiben jeweils unterschiedliche Schwerpunkte in der Betrachtung des Entwicklungs- bzw. Alternsprozesses.
2.1 Altern aus Sicht der Biologie
Wann beginnt das biologische Altern?
Maturation, Reproduktion und Altern
Im Rahmen biologischer Alternstheorien werden hauptsächlich drei Lebensphasen unterschieden: Während der Kindheits- und Jugendentwicklung (Ontogenie) werden Veränderungen im Sinne von Wachstums- und Reifungsprozessen (Maturation) interpretiert, die der Ausbildung und Perfektionierung von körperlichen Funktionen dienen. In dieser Phase werden Veränderungen also positiv gedeutet. Daran schließt sich eine Phase der Stabilität und Reproduktion an, die als adulte Form bezeichnet wird und im Vergleich zu den anderen beiden Phasen nur wenige Jahre andauert.
Bereits im Alter von 25 – 30 Jahren folgt die sogenannte Postentwicklungsphase (Postontogenie). In dieser Phase, so die Annahme, sind (biologische) Wachstums- und Entwicklungsprozesse abgeschlossen und das biologische Altern beginnt. Altern wird damit eindeutig von Entwicklung und Lernen abgegrenzt, wie es im Rahmen von psychologischen Alterstheorien (Kapitel 6: Psychologisches Altern) diskutiert wird.
In Ansätzen wird versucht, biologische und psychologische Alter(n)stheorien zu integrieren und auch mit sozialen bzw. soziologischen Theorien in Beziehung zu setzen. Somit wird auch das biologische Altern zunehmend als Entwicklungsprozess mit Verlusten, Stabilität und Gewinnen in verschiedenen Funktionsbereichen aufgefasst (Kapitel 5). Der Einfachheit halber und zum besseren Verständnis orientieren wir uns in diesem Kapitel jedoch am traditionellen Begriff des biologischen Alter(n)s.
Seneszenz
Altersveränderungen auf Ebene der Zelle, Gewebe oder Organe sind in der Regel schädlich für den Organismus und können mit späteren Funktionseinbußen verbunden sein, ohne allerdings notwendigerweise zu Krankheiten führen zu müssen. Mehren sich diese physiologischen Abbauprozesse und sind primäre und sekundäre Altersveränderungen (Kapitel 1) mit ausgeprägten Funktionseinbußen verbunden oder führen zu Krankheiten, spricht man auch von einem Status der Seneszenz. Dieser wird in der Regel im höheren Alter erreicht.
Menschen werden immer älter
Die Lebenserwartung steigt kontinuierlich an (Abb. 2.1). Durch bessere medizinische Versorgung und verbesserte Lebensumstände lässt sich nach Fries (2005) die Morbidität aber länger hinauszögern als die Mortalität. Die Phase der Seneszenz wird also kürzer („Compression of morbidity“).
Inter- und intraindividuelle Variabilität
Abbildung 2.2 fasst exemplarisch Altersveränderungen in verschiedenen Organen und Körperfunktionen zusammen. Dabei sollte (wie bereits in Kapitel 1 angesprochen) berücksichtigt werden, dass die dargestellten Veränderungen Mittelwerte beschreiben und die individuellen Veränderungen deutlich nach oben oder unten von diesen Mittelwerten abweichen können (interindividuelle Variabilität). Auch laufen einzelne biologische Alterungsprozesse nicht alle zur gleichen Zeit und auch nicht gleich intensiv ab (intraindividuelle Variabilität).
Abb. 2.1: Verbleibende Lebenserwartung von Neugeborenen und 70-Jährigen in Deutschland 1881 – 2010 (Statistisches Bundesamt, o. J.). Die Zunahme der Lebenserwartung von Neugeborenen bis in die 1960er Jahre beruht vor allem auf einer Abnahme der Säuglingssterblichkeit. Seitdem nimmt die verbleibende Lebenserwartung von Neugeborenen (durchgezogene Linie) wie auch von Menschen jenseits der 70 (gepunktete Linie) stetig zu.
Abb. 2.2: Die Leistungsfähigkeit der Organe des menschlichen Körpers eines 75-Jährigen im Vergleich zu einem 30-Jährigen (in Prozent) (nach Hahn, 1998).
Biologische Alternstheorien
Biologische Alter(n)stheorien versuchen entweder das „Warum“ (ultimate Theorien) des Alterns zu erklären oder das „Wie“ (proximate Theorien; Abbildung 2.3). Diesen zwei Perspektiven können wiederum zahlreiche Einzeltheorien zugeordnet werden (Ho et al., 2008). Mittlerweile wird allerdings davon ausgegangen, dass es nicht die eine biologische Alter(n)stheorie gibt, mit der alle Alter(n)sphänomene erklärt werden können und die eine befriedigende Antwort auf die Frage liefert, was darüber entscheidet, wie alt wir werden und wie alt wir werden könn(t)en. Die Theorien des Alterns bilden vielmehr ein Mosaik. Altern ist dabei eher das Resultat der Interaktion verschiedener Charakteristika und Prozesse als das eines einzelnen Prozesses (siehe auch „Nature-Nuture“-Debatte, Kapitel 1).
Biologische Alternstheorien bilden ein Mosaik an Erklärungsansätzen für das wie und warum des Alterns.
Warum altern wir?
Ultimate Theorien verstehen Altern aus Sicht der Evolutionstheorie als Ergebnis eines deterministischen Programms und fragen nach dem „Warum“. Gründe für ein solches evolutionär entstandenes genetisches Alterungsprogramm sind in Fortpflanzungs- und Rekombinationsstrategien und in Strategien zur Begrenzung der Population zu sehen. Mit der Fortpflanzung auftretende Rekombinationen des Erbguts erlauben eine selektive Anpassung an sich verändernde Umweltbedingungen. Um eine Überpopulation zu vermeiden, sind dabei schnellere Zyklen des Generationswechsels mit kürzeren Lebensspannen, also früherer Alterung korreliert (Ho et al., 2008). Die Mehrzahl der Theorien dieser Perspektive befasst sich mit der Wirkung von Genen auf das biologische Altern im Sinne eines programmierten Zelltods oder von Genen, deren Produkte das Altern beschleunigen oder hinauszögern. Sie werden deshalb auch als Theorien des programmierten Alterns bezeichnet.
Wie altern wir?
Proximate Theorien fragen nach dem „Wie“ und sehen das Altern in der Regel als Folge stochastischer Abbau- und Schädigungsprozesse über die Zeit. In diesem Sinne ist Altern und schließlich Tod eine Folge abnehmender Reparaturkapazität für akkumulierende Fehler und Schäden auf zellulärer Ebene. Sie werden deshalb auch unter den Schadens- oder Schädigungstheorien zusammengefasst. Es besteht dabei keine einheitliche Systematik. Die proximaten Theorien beleuchten Altern auf unterschiedlichen Ebenen, wobei molekulare Theorien überwiegen. Auch sind die gleichen Theorien z. T. mit unterschiedlichen Namen belegt. Derzeit existieren etwa 300 Alternstheorien (Beyer, 1997), die jeweils unterschiedliche Phänomene des Alternsprozesses auf unterschiedlichen Ebenen von der Einzelzelle bis zu Funktionssystemen aufgreifen oder beschreiben.
Abb. 2.3: Biologische Alternstheorien.
Theorien des programmierten Alterns
Maximale Lebensdauer
Programmtheorien (auch genetische Theorien genannt) des Alterns entstanden aus Befunden, die zeigen, dass die Lebensspanne innerhalb von Säugetier-Spezies sehr konstant ist, zwischen Spezies aber stark variiert. Auch scheint die maximale Lebensdauer der Menschen in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden unverändert etwa 120 Jahre zu betragen. Gezeigt wurde außerdem, dass Menschen mit langlebigen Eltern und Großeltern länger leben als Personen, deren Eltern vor dem 50. Lebensjahr starben.
Die meisten Theorien dieser Perspektive gehen von genetisch gesteuerten Alterungsprozessen aus, die letztendlich zum Tode führen. So stirbt der Organismus nach der Hypothese der genetisch aktiv gelenkten Alterung nach einer ‚programmierten‘ Zeit. Sehr prominent ist die Hypothese, dass die maximale Zahl an Zellteilungen genetisch bestimmt und damit eine Art biologische Lebensuhr genetisch programmiert ist.
Die meisten unserer Körperzellen werden regelmäßig ersetzt, wobei alternde, funktionell abbauende Zellen durch neue Zellen ersetzt werden, die deren Funktion übernehmen. Hayflick und Moorhead (1961) zeigten, dass, mit Ausnahme der Knochenmarksstammzellen und Krebszellen, Zellen in vitro eine begrenzte Teilungsfähigkeit haben. Nach Erreichen des Zellteilungslimits gehen diese Zellen in eine Art Ruhezustand über, der als zelluläre Seneszenz bezeichnet werden kann und mit dem Absterben der Zelle endet. So können sich Bindegewebszellen in einem Nährmedium bis zu 50-mal teilen, aber nicht öfter.
Telomerhypothese
Im Zusammenhang mit den Befunden von Hayflick und Moorhead wurde als ein Erklärungsansatz die sogenannte Telomerhypothese entwickelt, die heute zu den populärsten Alternstheorien zählt. Voraussetzung für eine vollständige Replikation der Chromosomen ist es, dass ihre Enden verlängert werden. Hierfür sorgt das Enzym Telomerase. In allen ausgereiften Zellen des Menschen und der Säugetiere wird keine Telomerase mehr gebildet, sodass es mit jeder Replikation zu einer Verkürzung der Chromosomen kommt. Unterschreiten diese eine kritische Länge, sterben die Zellen ab.
Todesgene
Viele Forscher sind auf der Suche nach sogenannten „Todesgenen“ oder „Langlebigkeitsgenen“. So sind zum Beispiel Gene identifiziert worden, die mit erhöhtem Stoffwechsel und zellulären Stressreaktionen assoziiert werden können. Beide Phänomene werden als Ursachen oder Verstärker des zellulären Alterns aufgefasst. Die Existenz solcher Gene wird aber auch angezweifelt, da sie biologisch keinen Selektionsvorteil bieten und daher während der Evolution verloren gegangen sein müssten.
Eine generelle Kritik an den genetischen Alternstheorien beruht auf Befunden, dass sich statistisch die Unterschiede in der Lebensdauer von Menschen nur zu maximal 30 % durch genetische Ursachen erklären lassen.
Es gibt genetisch bedingte Krankheiten, die zum Teil durch Symptome gekennzeichnet sind, die dem natürlichen Alterungsprozess ähnlich sind, aber schon im frühen Erwachsenenalter oder sogar der Kindheit einsetzen (z. B. Progeria; s. Kasten). Durch das Studium dieser Krankheiten hoffen Forscher, den genetischen Grundlagen des Alterns auf die Spur zu kommen.
Progeria
Progeria bezeichnet verschiedene Krankheitsbilder, wie zum Beispiel das Werner-Syndrom und das Hutchinson-Gilford-Syndrom (HGPS), bei denen ein vorzeitiges körperliches Altern zu beobachten ist. Von diesen Krankheiten betroffene Patienten sind bei Geburt noch unauffällig, zeigen aber ab der Pubertät (Werner-Syndrom) oder sogar ab dem ersten Lebensjahr (HGPS) einen bis zu zehnmal schnelleren Alterungsverlauf. Dieser äußert sich u. a. in mangelndem Wachstum, Arterienverkalkung, Verlust des Fettgewebes in der Unterhaut, Osteoporose, Haarausfall und schwacher Stimme. Während beim Werner-Symptom auch ein verstärktes Tumorwachstum zu beobachten ist, ist dies bei HGPS nicht der Fall. Auch mit dem Altern oftmals assoziierte neurodegenerative Erkrankungen treten bei HGPS nicht auf. Die Lebenserwartung liegt bei etwa 50 (Werner-Syndrom) bzw. 14 Jahren (HGPS).
Beim Werner-Syndrom handelt es sich um eine autosomalrezessiv vererbte Krankheit, bei der eine Mutation des Chromosoms 8 zu einer Verkürzung der Telomere in der DNA führt (s. Telomerhypothese), wodurch die Zellteilungsrate deutlich beschränkt wird. Eine kausale Therapie und Heilung ist nicht möglich, es können lediglich Symptome und Komplikationen – auch präventiv – behandelt werden.
HGPS beruht hingegen auf einer Spontanmutation auf einem DNA-Strang des Chromosoms 1 (autosomal-dominat), die zu Defekten in einem Protein führt, das verschiedene regulatorische Funktionen bei der DNA-Transkription hat und den Zellkern stabilisiert (Lamin A oder „Progerin“). Neuere Therapieansätze mit einem Enzym, das die Bildung von defektem Lamin A unterdrückt, scheinen in Tierversuchen vielversprechende Ergebnisse zu zeigen, sind beim Menschen aber noch in der Erprobungsphase.
Schadens- oder Schädigungstheorien
Die Schadens- oder Schädigungstheorien umfassen die genetischen und somatischen Zelltheorien und die physiologischen Systemtheorien. Dabei sehen die genetischen und somatischen Zelltheorien das biologische Altern als Folge von Schädigungen der zellulären Bausteine des Lebens. Physiologische Systemtheorien betrachten das Altern als Folge von kumulativen Störungen ganzer Körpersysteme, wie zum Beispiel des Immun-, des Hormon- oder des zentralen Nervensystems.
Alle diese Theorien gehen davon aus, dass durch Gebrauch sowie durch verschiedene innere und äußere Faktoren und Einflüsse Schäden auf molekularer, zellulärer oder systemischer Ebene hervorgerufen werden, die, wenn die vorhandenen Reparaturmechanismen nicht mehr ausreichen, zu Störungen im physiologischen Gleichgewicht und in verschiedenen Körperfunktionen führen. Die ultimative Folge dieses Prozesses ist dann der Ausfall des Gesamtsystems, also der Tod.
Zu den bedeutendsten Zelltheorien zählen die Fehler- oder Katastrophentheorie, die (Somatische) Mutationstheorie, die Theorie der freien Radikale, die Abnutzungstheorien und die Quervernetzungstheorien (Abb. 2.3).
Die Fehler- oder Katastrophentheorie besagt, dass das Altern auf einem Ungleichgewicht zwischen sich akkumulierenden DNA-Schädigungen und den vorhandenen Reparaturmechanismen beruht. Solche DNA-Schädigungen treten nach der (Somatischen) Mutationstheorie spontan auf oder können durch verschiedene Mechanismen, wie z. B. freie Radikale (s. Kasten), Strahlen oder DNA-Viren, bedingt werden. Die Anzahl der Schädigungen und Mutationen nimmt mit zunehmendem Alter zu. Wenn Schäden nicht mehr ausreichend repariert werden können, kommt es zu zellulären Dysfunktionen und in der Folge zu Altern und Seneszenz.
Nach den Abnutzungstheorien (englisch: „wear and tear theories“) wird der Körper als eine Art Maschine verstanden, die ebenso wie Letztere mit der Zeit, also mit dem Gebrauch, abgenutzt und schließlich funktionsunfähig wird. Diese Abnutzung kann auf allen Ebenen stattfinden, von der Zelle über Gewebe bis zu komplexen Organen. Als Beispiel kann das Muskel-Skelett-System dienen, das im Alter vermehrt von Arthrose betroffen ist.
Roger Bacon (1220 – 1292) war einer der ersten, die eine Art „wear-and-tear“ Theorie vorschlug. Ihm zufolge ist Altern das Ergebnis von übermäßigem Verbrauch und Abnutzung der körperlichen Reserven.
Bei den Quervernetzungstheorien (englisch: „cross-linking theories“) werden die molekularen Veränderungen an intra- und extrazellularen Makromolekülen, wie zum Beispiel Kollagen, DNA und RNA, in den Mittelpunkt der Betrachtung gestellt. Durch eine vermehrte Quervernetzung im Kollagen nimmt zum Beispiel die Elastizität von Geweben, wie zum Beispiel des Herzmuskels oder des Bindegewebes, ab (Kollagentheorie).
Auch die DNA kann durch Quervernetzungen beeinträchtigt werden, wenn hochreaktive Atome oder Moleküle, zum Beispiel freie Radikale, an die DNA-Doppelhelix binden. Normalerweise werden solche Bereiche durch die Reparaturmechanismen der Zelle herausgeschnitten und die defekte DNA bei der Zellteilung auf Grundlage des anderen Doppelhelixstranges korrigiert. Sind allerdings beide komplementären Stränge der DNA betroffen oder der Reparaturmechanismus zu langsam, können sich Quervernetzungen in Form von langen Molekülen zwischen den beiden Strängen bilden. Dadurch wird das Auslesen der genetischen Information entscheidend beeinträchtigt. Die Folge sind auch hier Schäden in Zellen und Geweben und verminderte Funktionen.
Die Theorie der freien Radikale, schließlich wurde Mitte der 1950er Jahre von Harman (1956) propagiert. Freie Radikale sind hochreaktive Substanzen, die in allen Zellen als Zwischenprodukte des Zellstoffwechsels entstehen. Sie können zum einen DNA, Fette, Proteine und andere Moleküle oxidieren und dadurch schädigen und zum anderen können sie auch weitere Radikale und verwandte Oxidantien erzeugen und so zerstörerische Kettenreaktionen in Gang setzen. Nach Behl und Moosmann (2008) gilt die Theorie der freien Radikale und des oxidativen Stresses trotz leichter Modifikationen bis heute als eine der plausibelsten Erklärungen für den biologischen Alternsprozess.
Im Körper besteht ein vielfältiges Schutzsystem gegen schädliche freie Radikale. Dazu gehören körpereigene Enzyme oder Antioxidantien wie Bilirubin. Auch mit der Nahrung aufgenommene Antioxidantien wie Betakarotin oder die Vitamine C und E können freie Radikale neutralisieren, d. h. sie zerstören die schädigenden freien Radikale. Allerdings bleiben die induzierten Schäden bestehen. Vor allem aber wird das Antioxidans selbst durch die Übertragung eines Elektrons auf das freie Radikal zu einem neuen Radikal. Gegebenenfalls kann die Wirkung dieses neuen freien Radikals schädlicher sein als die des dadurch neutralisierten. Dies ist der Grund dafür, dass hohe zugeführte Dosen von Vitamin E das Krebsrisiko erhöhen und nicht senken. Unter normalen Bedingungen sind die körpereigenen Verteidigungsmechanismen ausreichend. Wichtig: Nicht alle freien Radikale sind schädlich. Freie Radikale sind zum Beispiel Teil des Immunsystems. In Makrophagen oxidieren und töten sie Bakterien.
Physiologische Systemtheorien
Systemische Alternstheorien betrachten Altersveränderungen in größeren Funktionsbereichen wie dem neuroendokrinen System oder dem Immunsystem (zu Altersveränderungen im zentralen Nervensystem, Kapitel 5).
Die Endokrintheorie besagt, dass die biologische Uhr durch die Hormone die Geschwindigkeit des Alterns steuert. Als Beispiel wird hier häufig die Menopause bei Frauen angeführt. Weiterhin wirken Hormone auf das Wachstum, den Stoffwechsel, die Temperaturregulation und auf Entzündungs- und Stressreaktionen.
Die Immuntheorie basiert zum einen auf der Erkenntnis, dass mit zunehmendem Alter die Fähigkeit des Immunsystems abnimmt, Antikörper gegen Fremdkörper zu bilden (Abwehr von Infektionen nimmt ab) und dass zum anderen im höheren Alter Autoimmunvorgänge zunehmen (Zunahme chronischer Autoimmunkrankheiten). Diese stehen mit dem Auftreten von seniler Demenz und verschiedenen Gefäßerkrankungen in Beziehung (Platt, 1991).
Das Immunsystem wird durch eine Vielzahl von Genen reguliert, die auf einem einzigen Chromosom liegen und als Histokompatibilitätskomplex (MHC) bezeichnet werden. Diese Gene sind für die Ausprägung verschiedener Komponenten des Immunsystems verantwortlich. Etwa ab der Pubertät kommt es zu einer Abnahme der Lymphozyten in der Thymusrinde und einer Verringerung der T-Lymphozyten im Thymus und im peripheren Blut. Ab etwa dem 30. Lebensjahr nimmt der Serumspiegel der Thymushormone ab, sodass die Adaptationsfähigkeit gegenüber unterschiedlichen Umwelteinflüssen abnimmt, die Infektanfälligkeit zunimmt und es zum Auftreten von Autoimmunphänomenen und -krankheiten sowie zu einer erhöhten Inzidenz von bösartigen Geschwülsten kommt (Platt, 1991).
Da jedoch Altersveränderungen auch in vielen Organismen auftreten, die kein Immunsystem besitzen und darüber hinaus das Immunsystem durch übergeordnete hormonelle Regulation kontrolliert wird, ist die grundsätzliche ursächliche Bedeutung für den Alternsprozess umstritten.
Sonstige biologische Theorien
Im Zusammenhang mit den oben genannten Schadenstheorien werden noch zwei weitere Theorien diskutiert, die vor allem die Wirkung von Stoffwechselprozessen in den Blick nehmen.
Theorie der maximalen Lebensrate
Die Theorie der maximalen Lebensrate (Rubner, 1908) geht davon aus, dass die zum Verbrauch zur Verfügung stehende Energiemenge über die Lebensspanne für jedes aerobe Lebewesen identisch ist, sich die Lebenserwartung eines Organismus also umgekehrt proportional zu seiner massenspezifischen Stoffwechselrate verhält. Untersuchungen zu diesen Thesen werden hauptsächlich an Vögeln durchgeführt, die aufgezeigten Beziehungen sollen aber auch für Säugetiere und den Menschen gelten (Prinzinger, 1990).
Theorie der kalorienarmen Kost
Die Theorie der kalorienarmen Kost sieht ebenfalls einen Zusammenhang zwischen Energieaufnahme und Lebenserwartung. Untersuchungen an Nagetieren zeigen, dass diese bei einer Kost, deren Kalorienzahl 30 bis 50 % unter denen der Kontrolltiere liegt, länger gesund bleiben und länger überleben als die „wohlgenährten Artgenossen“. Dabei erhöht sich nicht nur das durchschnittliche, sondern auch das maximale Alter (Weindruch et al., 2001).
Die positiven Auswirkungen einer kalorienarmen Kost betreffen in erster Linie die sog. Biomarker, also die Parameter, die sich im Alter ungünstig verändern, wie Blutdruck, Insulin- und Blutzuckerspiegel. Die Hypothese besagt, dass aufgrund der sparsamen ausgewogenen Ernährung (keine Mangelernährung) die Zellteilung in einigen Geweben langsamer abläuft (Krebs tritt seltener auf), der niedrigere Blutzuckerspiegel die Sklerotisierung von Geweben verzögert und die Entstehung freier Radikale eingeschränkt wird, sodass sie weniger Schaden an den Mitochondrien anrichten. Die Übertragbarkeit dieser Befunde auf den Menschen ist allerdings bis heute noch nicht abschließend belegt.
Ende der 1980er Jahre wurden in den USA zwei unabhängige Studien gestartet, um die Effekte einer kalorienarmen Ernährung auf die Lebenserwartung von Affen zu untersuchen – eine am US National Institute on Aging (NIA) in Bethesda, Maryland, die andere am Wisconsin National Primate Research Center (WNPRC) in Madison. Obwohl erste Zwischenberichte auf einen positiven Zusammenhang hindeuteten, konnten die 2012 im Fachblatt Nature veröffentlichten endgültigen Ergebnisse der NIA-Studie diesen nicht bestätigen. Altersbedingte Krankheiten wie Diabetes, Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen schienen lediglich etwas verzögert aufzutreten. In der WNPRC-Studie war hingegen die Überlebensrate der kalorienreduzierten Experimentalgruppe gegenüber der Kontrollgruppe signifikant erhöht. Allerdings wird diese Studie wegen methodischer Besonderheiten in der Fachwelt kritisch diskutiert (Austad, 2012).
Übergreifende Theorien
Die meisten oben beschriebenen genetischen Schadens- und Systemtheorien werden nicht uneingeschränkt akzeptiert. So ist z. B. für die Theorie der kalorienarmen Kost und die Theorie der maximalen Lebensrate unklar, ob die in Tierversuchen und/oder in vitro nachgewiesenen Phänomene auch auf den Menschen übertragbar sind. Einige Theorien, wie z. B. die Fehler-Katastrophentheorie und die Abnutzungstheorie, sind z. T. in Studien widerlegt worden. Sie sind eher von historischem Interesse. Und für wieder andere Theorien, wie z. B. für die Kollagentheorie, die Mutationstheorie und die Theorie der freien Radikale, ist die direkte Verknüpfung mit dem Alterungsprozess (noch) unklar.
Da die verschiedenen Körpersysteme hochgradig integrativ miteinander vernetzt sind, bewirken Altersveränderungen an einer Stelle auch insgesamt ein Ungleichgewicht und verringerte Effektivität des gesamten Systems.
Einbußen im Immunsystem erfordern verstärkte zentralnervöse und hormonelle Kontrollprozesse und machen den Körper empfänglicher für Krankheiten. Das Immunsystem ist seinerseits auf ein funktionierendes Zentralnervensystem und Hormonsystem angewiesen.
Viele Forscher gehen deshalb nun dazu über, Alternsprozesse in ihrer Gesamtheit und auf bestimmte physiologische Organisationsstufen bezogen (z. B. Organ, Zelle) zu beschreiben. Dabei differenzieren sie nicht ausdrücklich zwischen einzelnen Alternstheorien.
Angeborene und somatische Mutationen im Laufe des Lebens (z. B. durch Umweltgifte) können den Elektronentransport in der Atmungskette (Energieproduktion) behindern. Die Folge ist eine verstärkte Bildung freier Radikale (die bei der Atmungskette als Nebenprodukte entstehenden freien Sauerstoffradikale werden aufgrund der größeren Menge nicht alle von Schutzenzymen abgefangen), die die DNA schädigen können. Dies führt dann zu weiteren Mutationen und damit zu einer nachlassenden Energieproduktion. An diesem Beispiel wird sehr schön das Zusammenspiel zweier Alternstheorien, der Mutationstheorie und der Theorie der freien Radikale, deutlich.
Homöostasistheorie
Diese Sichtweise wird in der Homöostasistheorie des Alterns aufgegriffen und mit den zellulären Alternstheorien zusammengeführt.
Homöostasis beschreibt ein dynamisches Gleichgewicht der physiologischen Vorgänge, bei denen geringe Abweichungen auf einer Ebene durch entsprechende Adaptionsprozesse auf anderen Ebenen ausgeglichen werden und dadurch die Funktion stabil erhalten werden kann.
Normale Schwankungen oder kurzzeitige kleinere Abweichungen von der Funktion (z. B. bei Krankheiten) können normalerweise toleriert werden, ohne dass es zu Schädigungen oder Funktionseinbußen kommt. Die Homöostasistheorie besagt nun, dass mit dem Alter, durch die Anhäufung von Veränderungen auf verschiedensten Ebenen und durch eine Verringerung des adaptiven Potenzials selbst, der allostatische Druck zu groß wird. Dies bedeutet, dass größere oder langandauernde Abweichungen von der Norm nicht mehr ausgeglichen werden können und es somit zu bleibenden Veränderungen und Schädigungen kommt.
Abb. 2.4: Zusammenhang zwischen genetischen Theorien, Schädigungs- und Systemtheorien (modifiziert nach Jazwinski, 1996).
Beispielhaft können Alterseffekte auf die Homöostase bei der Temperaturregulation beschrieben werden: Altersbedingt kommt es häufig zu strukturellen und funktionellen Veränderungen der Haut, der Durchblutung und der Muskelmasse. Zusammen mit ebenfalls altersbedingten Veränderungen in den peripher- und zentralnervösen Strukturen zur Messung der Körpertemperatur wird die Temperaturregulation nachhaltig beeinträchtigt. Dadurch erhöht sich die Anfälligkeit für Krankheiten.
Der Zusammenhang zwischen genetischen Theorien, Schädigungs- und Systemtheorien ist in Abbildung 2.4 zusammengefasst.
Bedeutung biologischer Alternstheorien für Gehirn und Geist
Nervenzellen teilen sich nicht
Das Gehirn ist, wie andere Organe des menschlichen Körpers, vom Altern betroffen. Deshalb lassen sich Theorien des biologischen Alterns auch auf das Gehirn anwenden. Nervenzellen werden im Gegensatz zu anderen Körperzellen nicht ständig erneuert, sondern können ein Leben lang erhalten bleiben. Das Hayflick-Limit spielt für diese Zellen also keine Rolle. Nervenzellen sind damit allerdings zeitlebens und kumulativ allen negativen Einflüssen ausgesetzt, die die Funktion zunehmend stärker einschränken und schließlich zum Tod der Nervenzelle führen können.
Eine Ausnahme bildet der Hippocampus. In dieser Gehirnregion, die besonders für Lernen und Gedächtnis von Bedeutung ist, werden ständig neue Nervenzellen gebildet (Neurogenese) und unter Bildung neuer Synapsen (Synaptogenese) in die bestehenden Netzwerke eingebaut. Allerdings hat im Hippocampus auch der Abbau von Nervenzellen eine funktionelle Bedeutung, da dadurch die Knüpfung neuer Netzwerke ermöglicht wird. Auch Neurogenese und Synaptogenese (die Ausbildung von Synapsen) im Hippocampus sind dem generellen Alterungsprozess unterworfen und nehmen im Alter ab.
Insbesondere die Quervernetzungstheorie spielt für das Altern des Gehirns eine wichtige Rolle. Sogenannte Plaques, akkumulierende große Eiweißmoleküle, werden mit pathologischen Altersveränderungen bei der Alzheimerkrankheit in Verbindung gebracht. Die Plaques alleine können die Alzheimer-Demenz aber nicht erklären (Kapitel 8).
Neben den Nervenzellen bestehen das Gehirn sowie das gesamte Zentralnervensystem aber auch aus weiteren Zellen und Geweben, wie zum Beispiel den Gliazellen und den Blutgefäßen, die vor allem für die Versorgung und den Erhalt der Nervenzellen zuständig sind. Das Altern dieser Strukturen im Sinne der genannten Alternstheorien hat natürlich auch Auswirkungen auf die Funktionstüchtigkeit des Gehirns.
Seit den 1990er Jahren gewinnt der neue Ansatz einer Neurowissenschaft der lebenslangen Entwicklung (Lifespan developmental neuroscience) eine zunehmende Bedeutung in Forschung und Lehre, ohne allerdings schon in bedeutendem Ausmaß Einzug in die Lehrbücher gehalten zu haben.
Im Sinne dieses neuen Ansatzes wird – wie in der Psychologie – auch die neurobiologische Entwicklung nicht mehr als bereits mit der Maturation abgeschlossen bezeichnet und das Altern als reiner Abbau- oder Degenerationsprozess gesehen. Vielmehr werden Prinzipien der Kindheits- und Jugendentwicklung auf Veränderungen im Erwachsenenalter bis ins hohe Alter übertragen, wobei Einflüsse durch Umweltfaktoren oder Lebensstile und -erfahrungen zunehmend an Bedeutung für eine positive oder negative Entwicklung erlangen.
Wichtig bleibt dabei, solche eher „natürlichen“ Entwicklungsprozesse, die bis ins hohe Alter auftreten können, von solchen abzugrenzen, die auf pathologischen Faktoren beruhen, denen wiederum biologische Faktoren (s. o.) zugrunde liegen (Kapitel 5: Altern des Gehirns).
2.2 Altern aus Sicht der Psychologie: ein lebenslanger Entwicklungsprozess
Während somit bei biologischen Alternstheorien die Frage nach den Mechanismen, die letztendlich zum Tod führen, im Mittelpunkt steht, will die Psychologie der Lebensspanne eine andere Frage beantworten: Wie verändert sich die Qualität des Lebens über die Lebensspanne in der Interaktion der verschiedenen Funktionsbereiche und mit der Umwelt und wie lässt sie sich beeinflussen?
Entwicklung als lebenslanger Prozess
In der Entwicklungspsychologie hat die Betrachtung des Alterns etwa seit den 1960er Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Vor allem in der Lebensspannenpsychologie (z. B. Baltes, 1990) wird seitdem der Begriff der Entwicklung auf die gesamte Lebensspanne bezogen, denn auch Altern ist Entwicklung. Biologische Veränderungen stellen hierbei nur einen Teilbereich dar. Altern umfasst demnach nicht nur Abbauprozesse und damit Einschränkungen von Kompetenzen, sondern Zuwächse im Sinne von Kompetenzerweiterungen im physischen, psychischen und sozialen Bereich.
Gewinne und Verluste
Jede Entwicklungsphase ist dabei durch Gewinne und Verluste („Gains and losses“) gekennzeichnet, wobei in jungen Jahren die Zugewinne und in späteren Jahren die Verluste überwiegen. Auf biologischer Ebene sind die Verluste im höheren Alter stärker ausgeprägt als bei jüngeren Menschen. In anderen Bereichen, wie zum Beispiel in persönlichkeitsbezogenen und anderen psychologischen Parametern, gibt es aber auch vermehrt Zugewinne oder Stabilität im höheren Alter.
Weisheit ist ein Beispiel für einen Entwicklungsprozess, der nicht mit der Geburt, sondern erst in späteren Phasen der Lebensspanne beginnt und durch steten Zugewinn gekennzeichnet ist. Dabei bezieht sich Weisheit auf den Bereich der wissensreichen Pragmatik der Intelligenz (Dittmann-Kohli & Baltes, 1983). Hauptkriterium für Weisheit ist Wissen, d. h. Fakten und Fertigkeiten bezogen auf Lebensfragen. Weise Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihre im Laufe des Lebens erworbene Expertise bzgl. schwieriger und unsicherer Lebenssituationen nutzen, um zu reifen Urteilen zu kommen und gute Ratschläge zu geben (Staudinger, 1990). Weisheit stellt den Prototyp der pragmatischen Altersintelligenz dar. Weisheit beinhaltet z. B. Wissen über die Veränderungen, Bedingungen und geschichtliche Abhängigkeit von Leben. Staudinger (1990) führt fünf Kriterien an, um das Wissen in diesen Bereichen näher zu beschreiben:
faktisches Wissen über grundlegende Fragen des Lebens,
strategisch-heuristisches Wissen über den Umgang mit grundlegenden Fragen des Lebens,
Denken in Kontexten des Lebensverlaufs und der gesellschaftlichen Entwicklung,
relativierendes Denken im Blick auf Wertvorstellungen und Lebensziele,
Denken, das die Ungewissheit des Lebens berücksichtigt und bewältigt.
Altern verläuft als Entwicklungsprozess im Verständnis der Entwicklungspsychologie der Lebensspanne multidimensional und multidirektional. Das heißt, die Richtung der ontogenetischen Veränderungen variiert nicht nur beträchtlich zwischen verschiedenen Verhaltensbereichen (z. B. Intelligenz versus Emotion), sondern auch innerhalb einer Verhaltenskategorie (z. B. fluide versus kristalline Intelligenz). So können in ein- und demselben Entwicklungsabschnitt und Verhaltensbereich manche Verhaltensweisen Wachstum und andere Abbau zeigen (Kapitel 6: Psychologisches Altern).
Multidirektionalität
Die unterschiedlichen Entwicklungsverläufe der fluiden und kristallinen Intelligenz (vgl. Abbildung 6.1) illustrieren das Konzept der Multidirektionalität. Die Veränderungen in verschiedenen Bereichen der menschlichen Entwicklung sind intraindividuell unterschiedlich. Eine multidirektionale Entwicklung behält sich demnach vor, die Richtung der Entwicklung offen zu lassen.
Multidimensionalität
Der Begriff Multidimensionalität beschreibt unterschiedliche Dimensionen innerhalb der menschlichen Entwicklung. Entwicklungsprozesse einer Person finden demnach in mehreren Dimensionen bzw. Verhaltenskategorien statt, die, wie beschrieben, unterschiedliche Entwicklungsverläufe aufzeigen können. So lassen sich u. a. physische, kognitive, emotionale und soziale Dimensionen der Entwicklung über die Lebensspanne unterscheiden. Die einzelnen Dimensionen lassen sich wiederum in weitere Komponenten oder Konstrukte (z. B. fluide und kristalline Intelligenz) differenzieren. Die multidimensionale Betrachtung bietet die Möglichkeit, unterschiedliche Altersverläufe für verschiedene Dimensionen empirisch zu festigen.
Variabilität
In der Entwicklungspsychologie – aber auch der Entwicklungsbiologie – wurde bei der Analyse von Entwicklungsverläufen lange Zeit der Standpunkt vertreten, dass Entwicklungs- und Alternsprozesse kaum beeinflussbar sind. Seit den frühen 1970er Jahren gewinnt jedoch das Grundkonzept der Variabilität zunehmend an Bedeutung. Beruhend auf der Erkenntnis, dass Entwicklungsverläufe variabel sind und jeder Verlauf einer von vielen möglichen ist, zeigen Befunde, dass
Menschen unterschiedlich schnell altern,
innerhalb einer Person verschiedene Fähigkeiten und Verhaltensbereiche unterschiedlich schnell und anders altern und
Alternsprozesse von Verhaltensweisen, Lebensbedingungen und Lebenserfahrungen einer Person beeinflussbar sind.
Es können zwei Typen der Variabilität unterschieden werden. Während interindividuelle Variabilität Unterschiede zwischen Personen bezüglich bestimmter Verhaltensvariablen beschreibt, bezieht sich der Begriff der intraindividuellen Variabilität auf Unterschiedlichkeiten bzw. die Veränderbarkeit innerhalb einer Person bezüglich verschiedener Verhaltensvariablen oder hinsichtlich einer bestimmten Variable über die Zeit hinweg (Abbildung 2.5, Kapitel 6: Psychologisches Altern).
Plastizität
Inter- und intraindividuelle Variabilität sind Ausdruck der Plastizität von Entwicklungsverläufen. Sie zeigen, wie unterschiedlich Entwicklungsverläufe, in Abhängigkeit interner und externer Einflussfaktoren auch bei gleichen genetischen Voraussetzungen, sein können. Plastizität wird sowohl durch biologische Voraussetzungen (wie Gene) bestimmt als auch durch Umwelt und Erfahrung (leistungsfördernde Unterstützung u. Ä.). Sie ist die Konsequenz der dynamischen Interaktion oder Verschmelzung von Charaktermerkmalen des Organismus eines Individuums und spezifischer Erfahrungen, die über die Lebensspanne gesammelt werden (Lerner, 1998).
Abb. 2.5: Beziehung zwischen interindividuellen und intraindividuellen Differenzen (Baltes & Kindermann, 1985).
* 1. und 2. Messung können sich im Zeitpunkt, in der Testbedingung oder in der Verhaltensweise unterscheiden.
Plastizität „[…] bezeichnet das Potential, welches Individuen zu verschiedenen Verhaltensformen und Entwicklungsverläufen befähigt“ (Baltes, 1990, S.11).
Der Begriff der Plastizität von Entwicklungsverläufen ist zentral für die Psychologie der Lebensspanne (Baltes, 1990) und auch in den Neurowissenschaften, welche sich mit dem Altern beschäftigen (Kapitel 5 und 6). Plastizität meint Veränderungen auf Neuro- und Verhaltensebene, innerhalb eines begrenzten Bereichs minimaler und maximaler Leistungsfähigkeit.
Potenziale
In der Psychologie der Lebensspanne beschreibt der Begriff Plastizität das Potenzial des normativen Entwicklungsverlaufs im Alter, innerhalb eines Individuums, und kann sich sowohl auf kognitive Funktionen als auch auf Persönlichkeitsmerkmale beziehen. Plastizität zeigt sich dabei sowohl im Bereich der Mechanik als auch der Pragmatik der Intelligenz (s. Kapitel 6). Beispielsweise kann eine ältere Person dem zu erwartenden kognitiven Abbau durch kognitiv anfordernde Tätigkeiten oder kognitives Training entgegenwirken (s. Kapitel 9).
In den Neurowissenschaften wird unter Plastizität die Veränderbarkeit des Gehirns in Folge von Erfahrung und Interaktion mit der Umwelt verstanden. Nach Mora et al. (2007) bestimmen individuelle Lebensstile und Eigenschaften der Umwelt, ob Gehirnplastizität induziert wird und ob das zu einer Verbesserung oder auch Verschlechterung der Hirnfunktionen und kognitiven Leistung führt.
Eine „klassische“ Studie von Kliegl et al. (1989) verdeutlicht, dass Plastizität auch im Alter erhalten bleibt. Die Aufgabe von vier jüngeren (M = 22.8 Jahre) und 20 älteren Erwachsenen (M = 71.7 Jahre) bestand in dem Erinnern von 40 Wörtern, die den Probanden jeweils im Prä- und Posttest vorgelegt wurden. Zwischen Prä- und Posttest wurden die Probanden in eine Erinnerungstechnik, die „Methode der Orte“ eingewiesen. Hierbei stellt man sich in Gedanken z. B. den Weg zur Arbeit vor und legt unterwegs an markanten Orten die zu merkenden Begriffe ab. Während sich die jüngeren und älteren Erwachsenen im Prätest nicht signifikant in ihrer Behaltensleistung unterschieden, ändert sich dieses Bild nach Beendigung der Trainingssitzungen. Durch das Training wurden bei beiden Altersgruppen beträchtliche Leistungssteigerungen erreicht, die jüngeren Erwachsenen erzielten jedoch signifikant höhere Zugewinne als die älteren Erwachsenen. Für das Konzept der Plastizität bedeutet dies, dass zwar in beiden Altersgruppen eine hohe Plastizität besteht, dass diese bei den Jüngeren aber größer sein kann als bei den Älteren.
Lange Zeit glaubte man, dass sich die Persönlichkeit ab einem Alter von ca. 30 Jahren nicht mehr verändert (Costa & McCrae, 1998). Neuere Befunde zeigen Plastizität jedoch auch für Persönlichkeitsmerkmale wie Offenheit, emotionale Reife oder Neurotizismus (Kessler & Staudinger, 2007; Staudinger et al., 1993).
Kontextualismus
Wechselwirkung dreier Systeme
Entwicklung wird sowohl durch biologische Voraussetzungen (z. B. Gene) bestimmt als auch durch Umwelt und Erfahrung (z. B. leistungsfördernde Unterstützung). Darüber hinaus muss Entwicklung auch im Kontext betrachtet werden. Im Sinne des Kontextualismus resultiert jeder individuelle Entwicklungsverlauf aus der Wechselwirkung dreier Systeme von Entwicklungseinflüssen: normativ altersbedingte, normativ historisch bedingte und nicht normative/idiosynkratische Einflüsse. Jede dieser Ursachen beeinflusst die individuelle Entwicklung und bewirkt die kontinuierliche Veränderung.
Normative altersbedingte Einflüsse
Normative altersbedingte Einflüsse umfassen organismische und umweltbezogene Merkmale, die zu vorhersagbaren Verhaltensänderungen führen und eine variable Altersbindung zeigen. Hierzu zählen das Lebensalter, die Genetik, das Wachstum, die Reifung, das Geschlecht, die psychischen und kognitiven Faktoren, die Bewegungsbiografie, die sozialkulturelle und materiale Umwelt.
Normative historisch bedingte Einflüsse
Normative historisch bedingte Einflüsse charakterisieren eine feste Bindung an geschichtliche Zeitdimensionen und kulturwandelbezogene Einflüsse, wie langfristige, dem epochalen historischen Wandel unterliegende Wertorientierungen oder periodenspezifische historische Wertewandel (politische, technologische Veränderungen, Zeittrends usw.). Von zentraler Bedeutung sind der Kulturkreis, die Volks- und Gruppenzugehörigkeit, die Familie, die Schule und der Freundeskreis.
Nichtnormative Einflüsse
Nichtnormative Einflüsse zeigen keine auffälligen Beziehungen zu altersgebundenen und geschichtlichen Faktoren. Sie treten im Lebenslauf unerwartet auf (z. B. Unfälle, Verletzungen, Krankheiten, aber auch Naturkatastrophen, Wirtschaftskrisen oder Kriege).
Selektion, Optimierung und Kompensation
Baltes und Baltes (1990) entwickelten das Modell der Selektion, Optimierung und Kompensation (SOK), um gewinn- und verlustbezogene Entwicklungsverläufe im Erwachsenenalter umfassend zu beschreiben. Ausgangspunkt ist eine sich mit zunehmendem Alter verschlechternde Gewinn-Verlust-Bilanz. Diese ergibt sich aus einer Verringerung der biologischen Ressourcen und zugleich aus einer in unserer Gesellschaft unbefriedigenden „Kultur des Alterns“.
Strategie für erfolgreiches Altern
Als geeignete Strategien zur Bewältigung dieser Negativ-Bilanz sehen die Autoren Selektion, Optimierung und Kompensation, die es ermöglichen sollen, auch im Alter ein zwar eingeschränktes, aber selbstwirksames Leben zu führen. Demnach ist der koordinierte Einsatz von Selektion, Optimierung und Kompensation zentral für eine erfolgreiche Entwicklung. Selektion meint die Entwicklung, Auswahl und Festlegung auf bestimmte Ziele, um die begrenzten Ressourcen zu fokussieren. Optimierung bezieht sich auf die Entwicklung und Investition von Ressourcen zum Erreichen der ausgewählten Ziele. Kompensation hebt die Entwicklung und Investition von Ressourcen hervor, die den Folgen von Verlusten entgegenwirken sollen.
Als Beispiel für eine erfolgreiche Umsetzung des SOK-Modells sei hier der Pianist Rubinstein angeführt. Um seine Konzerte „erfolgreich“ gestalten zu können, spielte Rubinstein mit zunehmendem Alter immer weniger Stücke (= Selektion), übte diese häufiger (= Optimierung) und kompensierte Probleme bei schnellen Passagen durch betont langsames Spielen der vorausgehenden Passagen (= Kompensation). Krampe (1994) erbringt für ältere erfolgreiche Pianisten den Nachweis, dass die verlangsamte motorische Geschicklichkeit durch wissensbasierte antizipatorische Bewegungsabläufe ausgeglichen wird. Ähnliches wurde auch für ältere Büroangestellte beim Schreibmaschineschreiben berichtet. Eine verlängerte Reaktionszeit wurde dadurch kompensiert, dass der zu bearbeitende Text antizipatorisch weiter vorausgelesen wurde (Salthouse, 1991, Kapitel 9: Interventionen). Sehr hoch entwickelte und eingeübte Fähigkeiten sowie das damit verbundene Wissen bedeuten Expertise, welche eng mit Weisheit (s. o.) verknüpft ist (Baltes & Smith, 1990).
2.3 Zusammenfassung
Die Ursachen menschlicher Seneszenz bleiben im Großen und Ganzen noch ein Rätsel. In der Gesamtheit leisten die biologischen Alternstheorien bzw. -hypothesen Erklärungen für das komplexe Phänomen Altern. Dabei beleuchten sie jeweils nur Ausschnitte des komplexen biologischen Alterns auf einer Erklärungsebene (Molekül, Zelle, Organ, Organismus) und damit ein spezifisches Phänomen der Alterung. So hat zum Beispiel – vereinfacht ausgedrückt – die Programmtheorie die Replikation der DNA, die Fehler-Katastrophentheorie die Reparatur von Replikationsfehlern und die Mutationstheorie Mutationen an der DNA zum Gegenstand. Die beschriebenen Prozesse wirken jedoch nicht isoliert, sondern z. T. ineinander und bedingen sich z. T. gegenseitig.
Die Theorien widersprechen sich aber teilweise auch, stellen konkurrierende Auffassungen dar. So könnte z. B. die Hypothese der genetisch aktiv gelenkten Alterung als konkurrierend zu den meisten anderen Theorien angesehen werden: Ist die Lebensdauer genetisch vorprogrammiert, kann den anderen Theorien ein Erklärungswert für das primäre Altern abgesprochen werden, sie können damit, im Sinne der proximaten Perspektive, höchstens das sekundäre Altern beschreiben.
Unabhängig davon, wie das primäre Altern auf molekularer oder zellulärer Ebene abläuft oder zustande kommt, die Sekundärerscheinungen auf höherer Organisationsstufe sind gleichartig. Es kommt zu Einschränkungen der Zellfunktion und zum Zelltod, mit entsprechenden Folgen für die Struktur und Leistung der einzelnen Organe. Letztendlich führt biologisches Altern zum Tod.
In der Entwicklungspsychologie, vor allem in der Lebensspannenpsychologie, wird Altern als Entwicklung verstanden, die durch Verluste und Gewinne, Plastizität und Variabilität gekennzeichnet ist. Alternde Individuen besitzen die Fähigkeit zur Kompensation. Altern wird als multidimensional und multidirektional verstanden und muss im Kontext betrachtet werden.
Weiterführende Literatur
Baltes, P. B. (1990). Entwicklungspsychologie der Lebensspanne: Theoretische Leitsätze. Psychologische Rundschau. 41: 1 – 24.
Bengtson, V. L. (2008). Handbook of Theories of Aging. Springer Publishing Company, New York.
Ho, A. D., Wagner, W., Eckstein, V. (2008). Was ist Alter? Ein Mensch ist so alt wie seine Stammzellen. In: Was ist Alter(n), Ursula M. Staudinger und Heinz Häfner (Hrsg.). Springer, Berlin Heidelberg.
2.4 Fragen zum Kapitel
1. Welche Lebensphasen des Alterns werden in der Biologie unterschieden und wodurch sind diese gekennzeichnet?
2. Was ist unter dem Begriff Seneszenz zu verstehen?
3. Welche zwei grundlegenden Perspektiven in den biologischen Alternstheorien gibt es und wie unterscheiden sich diese?
4. Auf welchen Vorstellungen beruht die Theorie der maximalen Lebensdauer?
5. Was haben Schadens- und Schädigungstheorien gemeinsam?
6. Wie können freie Radikale zum Alterungsprozess beitragen?
7. Welche Theorien postulieren einen Zusammenhang zwischen der Energieaufnahme und Alterungsprozessen?
8. Wie wird die Notwendigkeit übergreifender Theorien des Alterns begründet?
9. Was besagt die Homöostasistheorie?
10. Worin unterscheidet sich der Hippocampus in Bezug auf die Neubildung von Nervenzellen von anderen Hirnregionen?
11. Worin unterscheidet sich das Altern aus psychologischer Sicht von den biologischen Alternstheorien?
12. Auf welcher Ebene sind „Gewinne“ im Alter zu erwarten und weshalb?
13. Was ist unter einer multidimensionalen und einer multidirektionalen Entwicklung im Altersverlauf zu verstehen?
14. Welche Bedeutung hat die Plastizität (im Altersverlauf)?
15. Welche Theorie basiert auf der Annahme einer sich verschlechternden Gewinn- und Verlustbilanz und welche Kernaussagen zur Bewältigung werden dieser Theorie zugeordnet?