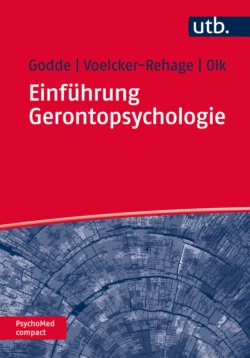Читать книгу Einführung Gerontopsychologie - Ben Godde - Страница 9
Оглавление1 Alter und Altern
Alter(n) ist mit einer Reihe körperlicher und kognitiver Funktionseinbußen sowie mit Veränderungen der Persönlichkeit und der sozialen Beziehungen verbunden. Altern birgt aber nicht nur Defizite und damit auftretende Probleme, es ist auch durch Kompetenzen, Potenziale und Chancen gekennzeichnet. Dementsprechend wird seit den 1970er-Jahren das Stereotyp eines durch Defizite und Verluste geprägten Alter(n)s von der Entwicklungsforschung und der Gerontologie als zu einseitig und unvollständig zurückgewiesen und durch ein differenzierteres Altersbild ersetzt, das auch die Facette des „produktiven“ und „erfolgreichen“ Alter(n)s umfasst. Neben den unbestrittenen Krisen und Verlusten werden in dieser Sicht auf das Alter(n) auch die Chancen und Optionen eines erfolgreichen Alterns betont. Natürlich verschiebt sich die Balance zwischen Zugewinn und Abbau, besonders im hohen Alter (ab ca. 80 Jahren), zugunsten des Letzteren. Aber dennoch kann eine gesunde ältere Person nach dem Renteneintritt noch einige gesunde Lebensjahrzehnte erwarten, verbunden mit einer Reihe körperlicher und kognitiver Herausforderungen, aber auch vielen neuen Erfahrungen.
1.1 Definition von Alter und Altern
Altern als unidirektionaler Prozess
Die traditionelle, bis in die 1960er Jahre dominierende biologische Perspektive auf das Altern beschreibt dieses als eine Phase zunehmender Seneszenz und stellt es der Reifung in der frühen Entwicklungsphase und einer Phase relativer Stabilität im frühen und mittleren Erwachsenenalter gegenüber. Demzufolge wäre das Altern ein unidirektionaler Prozess, der durch einen Verlust an biologischen und psychologischen Funktionen gekennzeichnet ist.
Altern als lebenslanger Prozess
Diesem Ansatz wurde in der Mitte des letzten Jahrhunderts die von K. Warner Schaie, Paul B. Baltes, James E. Birren, John R. Nesselroad und anderen begründete Lebensspannenperspektive gegenübergestellt. Damit veränderte sich die Entwicklungsforschung insbesondere in der Psychologie. Die bis dahin vorherrschende biologisch- und psychologisch-reduktionistische und an Altersgruppen ausgerichtete Sichtweise wurde abgelöst. Im Mittelpunkt steht die Erforschung der Entwicklung über die Lebensspanne und der Interaktion von biologischen und kulturellen Faktoren mit individuellem Verhalten (Lerner & Overton, 2010). Dieser Ansatz beruht auf der Beobachtung, dass Entwicklungsprozesse über die Reifung hinaus das ganze Leben lang bis zum Tod andauern können. Demzufolge ist Altern ein lebenslanger Entwicklungsprozess, der durch Veränderungen gekennzeichnet ist, die mehr oder weniger zwangsläufig mit zunehmendem Alter auftreten. Diese Veränderungen sind in verschiedenen Lebensphasen unterschiedlich stark ausgeprägt und geschehen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Altern beginnt also nicht etwa erst in der Lebensmitte oder gar am Ende des Lebens und Entwicklung ist nicht auf den Anfang des Lebens beschränkt (Baltes, 1990). Obwohl innerhalb einer Spezies alle Individuen ähnliche und vorhersagbare Entwicklungsschritte durchlaufen, führt die Tatsache, dass mit zunehmendem Alter die Umwelt einen immer größer werdenden Einfluss auf Entwicklungs- und Alterungsprozesse bekommt, zu einer hohen Individualität dieser Entwicklungs- und Alternsprozesse.
Nach Johnson und deHaan (2011) ist genetisch und evolutionär bedingt ein Teil der Entwicklungsprozesse für alle gleich. Ein anderer, sehr vom sozialen Umfeld abhängiger Teil ist für Personen in diesem Umfeld sehr ähnlich. Ein dritter Teil schließlich hängt vom individuellen Umfeld und dessen Einflüssen ab. Alle drei Teile bestimmen unsere Individualität.
Dabei ist das soziale Umfeld zum Beispiel der Ort, in dem man lebt, die Schule, die Einkommensstruktur. Das individuelle Umfeld betrifft Personen im selben sozialen Umfeld unterschiedlich: die eigene Familienstruktur, der Freundeskreis, das eigene Einkommen.
Plastizität von Altern und Entwicklung
Nach Hertzog et al. (2008) wird der individuelle Altersverlauf durch die biologisch-physiologischen, psychologischen und kulturellen Ressourcen bestimmt, die uns zur Verfügung stehen. Auch der eigene Lebensstil, das Ernährungsverhalten und die berufliche Tätigkeit beeinflussen das Altern. Das Altern ist also plastisch, d. h. sein Verlauf und damit der Zeitpunkt, zu dem Funktionseinbußen im Alltag wirksam werden, kann positiv und negativ beeinflusst werden (Abbildung 1.1).
Die Begriffe Alter und Altern sind dabei zu unterscheiden. Altern beschreibt die zeitgebundenen Veränderungsprozesse eines Menschen, die sich aus der Wechselwirkung von biologischen Prozessen, Umwelteinflüssen und individuellen Entscheidungen ergeben. Das Alter hingegen bezeichnet einen Zustand zu einem gegebenen Zeitpunkt und ist folglich als Ergebnis des Alterns oder der Entwicklung zu verstehen. Die Vielgestaltigkeit der Einflüsse, aus denen sich das Altern speist, führt über den Lebensverlauf zu wachsenden Unterschieden zwischen den Menschen und reduziert damit den Informationswert des kalendarischen Alters (Kapitel 2).
Abb. 1.1: Plastizität von Entwicklungsverläufen und ihre Beeinflussbarkeit durch interne und externe Ressourcen (nach Hertzog et al., 2008). Gezeigt sind vier Beispiele (A – D) für mögliche hypothetische Entwicklungsverläufe.
Normative und nicht-normative Einflüsse
In der Lebensspannenpsychologie spricht man von normativen und nicht-normativen Determinanten von Entwicklungs- und Altersverläufen. Normative altersbedingte Einflüsse sind Faktoren, die alle Individuen eines bestimmten Alters in ähnlicher Weise betreffen (z. B. biologische Reifung, Hörverlust im Alter, Verlangsamung der Informationsverarbeitung im Gehirn). Normative historisch-bedingte Einflüsse sind Faktoren, die mit bestimmten historischen Ereignissen oder Perioden verknüpft sind bzw. in historischen Perioden auftreten (z. B. durch Kriege). Nicht-normative oder idiosynkratische Faktoren sind individuelle Lebensereignisse (z. B. Unfälle, Heirat, Beruf).
Intrinsische und extrinsische Faktoren
In der biologischen Altersforschung wird eher von intrinsischen und extrinsischen Faktoren gesprochen, die das Altern beeinflussen. Unter intrinsischen Faktoren verstehen wir unveränderliche mit einer Person verknüpfte Faktoren, wie z. B. genetisch festgelegte Eigenschaften und Prozesse. Extrinsische Faktoren werden noch einmal unterteilt in Lebensstile oder Verhaltensweisen (z. B. Ernährung, körperliche Aktivität, Stress) und Umweltfaktoren (z. B. Umweltgifte, Temperatur, Traumata).
Primäres und sekundäres Altern
In diesem Zusammenhang spricht man auch von primärem und sekundärem (biologischem) Altern. Das primäre Altern wird als ein Prozess betrachtet, der überwiegend genetisch gesteuert wird. Er ist von intrinsischen Faktoren abhängig und trotz guter Gesundheit und der Abwesenheit von Krankheiten üblicherweise mit dem Älterwerden eng verknüpft. Sekundäres Altern demgegenüber wird durch die externen Faktoren bestimmt. Demzufolge treten primäre Alterseffekte eher zwangsläufig mit dem Älterwerden auf, während sekundäre Alterseffekte häufig durch entsprechende Maßnahmen und Verhaltensweisen vermieden oder zumindest verringert werden können.
Nature-Nuture-Debatte
Der wechselseitige Einfluss von internen und externen Faktoren auf das Altern und die Entwicklung kommt auch in der sogenannten „Nature-Nuture“-Debatte zum Ausdruck. Hierbei geht es darum, wie hoch im Verhältnis zu Umwelteinflüssen der Einfluss der genetischen Information auf die Entwicklung ist. Besonders heftig diskutiert wird diese Frage seit Jahrzehnten in Bezug auf die Intelligenz. Mal sehen sich die Befürworter einer starken Rolle der Genetik bestätigt, z. B. durch Zwillingsstudien, mal schlägt das Pendel eher zur Seite der Verfechter starker Umwelteinflüsse aus. Was wir jedoch mit Sicherheit heute wissen ist, dass beide Faktoren die Entwicklung, auch beispielsweise der Intelligenz, maßgeblich beeinflussen.
Mehrdimensionalität
Das Alter und Altern sind nicht einsondern mehrdimensional. So lässt sich beispielsweise das kalendarische (oder chronologische) Alter vom biologischen, psychologischen, sozialen und subjektiven Alter unterscheiden. Während das biologische (oder auch funktionale) Alter(n) vor allem die biologischen und physiologischen Funktionen und Prozesse im Körper betrifft, umfasst das psychologische Altern Facetten wie etwa die Entwicklung und Alterung des Geistes, der Persönlichkeit oder auch der sozialen Bezogenheit (Kessler et al., 2010). Das soziale Alter hingegen bezeichnet die Zugehörigkeit zu einer Alterskategorie und drückt die damit einhergehende Übernahme oder den Verlust von altersgebundenen Rollen und Positionen aus (Settersten & Mayer, 1997).
Im Arbeitskontext wird die Kategorie „alt“ anders als im Alltag vergeben. Man würde im Alltag niemals eine 50-jährige Person als alt bezeichnen. Im Arbeitskontext passiert dies jedoch schon ab einem Alter von 45 Jahren (Kessler et al., 2010).
Das subjektive Alter schließlich beschreibt, ob ich mich selbst jünger oder älter fühle, als es meinem tatsächlichen kalendarischen, biologischen, psychologischen oder sozialen Alter entspricht, und wird häufig im Vergleich zu Personen gleichen kalendarischen Alters bestimmt.
Der subjektiven Wahrnehmung des Alters, die weder mit dem kalendarischen noch dem biologischen, psychologischen oder sozialen Alter übereinstimmen muss, kommt in Bezug auf die Lebenszufriedenheit, die eigene Produktivität und sogar auf die Lebenserwartung eine große Bedeutung zu (Staudinger, 1996; 2008). Wir schätzen jedoch nicht nur unser eigenes Alter, sondern auch das anderer Personen ein und haben Vorstellungen darüber, was das Altern mit uns selbst macht, und durchaus unterschiedliche Vorstellungen davon, was das Altern mit anderen im Allgemeinen macht.
Mehrdirektionalität
Lange Zeit wurde Altern als ein eher eindimensionales Phänomen des biologischen Abbaus betrachtet. Die unterschiedlichen Alternsdimensionen weisen aber durchaus unterschiedliche Verläufe auf. So zeigen viele biologische Funktionen absteigende Verläufe, wohingegen zum Beispiel manche Persönlichkeitsmerkmale, soziale Kompetenz oder auch Erfahrung positive Verläufe oder Stabilität aufweisen. Anstatt früherer, eher defizitorientierter Sichtweisen, dominieren deshalb heute differenziertere Annahmen zur Multidimensionalität und Multidirektionalität der menschlichen Entwicklung. Diese betonen, dass die menschliche Entwicklung zu jedem Alter durch Gewinne und Verluste gekennzeichnet ist. Nach Baltes (1987) verändert sich allerdings mit zunehmendem Alter das Verhältnis zwischen beiden zu Ungunsten der Gewinne.
Die Multidirektionalität und -dimensionalität des Alterns kann am Beispiel der Kognition verdeutlicht werden. Wie in Kapitel 6 dargestellt ist, lassen sich für verschiedene Dimensionen der Kognition unterschiedliche Entwicklungsverläufe beschreiben, die entweder durch einen Abbau im Alter (z. B. Verarbeitungsgeschwindigkeit, Arbeitsgedächtnis) oder durch Stabilität und Zuwachs (z. B. sprachliche Fertigkeiten, Wissen) gekennzeichnet sein können.
Variabilität
Altern und Entwicklung weisen aber nicht nur ein hohes Maß an Multidimensionalität und Multidirektionalität auf, sondern auch eine große Variabilität. Diese kennzeichnet das Ausmaß, in dem die Leistung oder andere Merkmale eines Einzelnen oder einer Gruppe stabil sind. Die Differenzierung unterschiedlicher Lebensverläufe und die damit im Zusammenhang stehende Verschiedenheit von Fähigkeiten bei älteren Menschen sind in unserer alternden Gesellschaft von hoher Bedeutung. Diese Variabilität im Alter und die damit im Zusammenhang stehenden positiven oder negativen Veränderungen in den individuellen Fähigkeiten bergen auch individuelle Entwicklungspotenziale. Variabilität liegt aber nicht nur zwischen verschiedenen Personen vor (interindividuelle Variabilität), sondern auch zwischen und innerhalb von einzelnen Funktionsbereichen einer Person (intraindividuelle Variabilität).
Interindividuelle Variabilität (Diversität) spiegelt Unterschiede zwischen Personen wider. Intraindividuelle Variabilität bezeichnet Unterschiede innerhalb einer Person in unterschiedlichen Dimensionen oder Facetten (Dispersion) oder innerhalb einer Dimension zu verschiedenen Zeitpunkten (Inkonsistenz) (Bunce et al., 2004).
Auch Entwicklungsverläufe zeigen eine hohe interindividuelle Variabilität. So bleibt die kognitive Leistungsfähigkeit bei manchen Menschen bis ins hohe Alter stabil oder nimmt sogar noch zu, während sie bei anderen nach einem Höhepunkt im jungen Erwachsenenalter stetig abnimmt. Abbildung 1.2 zeigt beispielhaft, anhand der Daten der Seattle Longitudinal Study zum kognitiven Altern (Schaie, 2005), dass auch im hohen Alter von über 80 Jahren die Hälfte der Teilnehmer und Teilnehmerinnen noch Stabilität oder sogar Zugewinne in der Leistungsfähigkeit aufweisen.
Abb. 1.2: Anteil von untersuchten Personen, die entweder Stabilität, Abbau oder Zuwachs in kognitiver Leistung über einen Zeitraum von sieben Jahren zeigten (nach Schaie, 2005).
Die Betrachtung der intraindividuellen Variabilität gewinnt vor allem in der neurokognitiven Altersforschung zunehmend an Bedeutung, da die kognitive Leistung älterer Erwachsener häufig eine höhere Inkonsistenz aufweist als die jüngerer Personen und dies mit kognitiven Leistungseinbußen einher geht (MacDonald et al., 2003).
1.2 Zusammenfassung
Entwicklung und Altern sind lebenslange Prozesse, wobei Altern selbst als Entwicklungsprozess angesehen wird. Das Alter besteht neben dem kalendarischen oder chronologischen Alter aus vielen weiteren Facetten, wie dem biologischen Alter, dem psychologischen Alter, dem sozialen Alter oder dem subjektiven Alter, die innerhalb eines Individuums sehr unterschiedlich ausgeprägt sein können. Der Alternsprozess wird durch die Wechselwirkung von internen Faktoren (z. B. Genetik, Biologie), Verhaltensweisen und Lebensstilen (z. B. Ernährung, Aktivität, Beruf) und externen Faktoren (soziales Umfeld, sozioökonomischer Status) bestimmt. Dieser Prozess ist multidimensional, multidirektional, variabel und plastisch, d. h. beeinflussbar.
1.3 Fragen zum Kapitel
1. Wie wird Alter und Altern aus der traditionellen biologischen Perspektive verstanden?
2. Wie wird Alter und Altern aus der Perspektive der Lebensspannenpsychologie verstanden?
3. Welche Faktoren beeinflussen den individuellen Altersverlauf?
4. Was unterscheidet „Alter“ von „Altern“?
5. Was ist primäres und sekundäres Altern?
6. Worum geht es bei der „Nature-Nurture-Debatte?
7. Was versteht man unter der Multidimensionalität des Alters?
8. Was versteht man unter der Multidirektionalität des Alters?
9. Welche Arten der Variabilität von Altersverläufen gibt es?