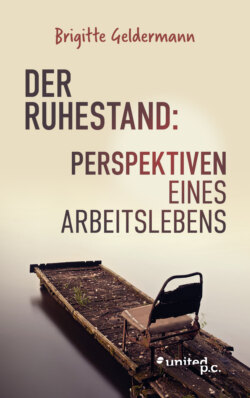Читать книгу Der Ruhestand: Perspektiven eines Arbeitslebens - Brigitte Geldermann - Страница 6
Unter den Professoren, die in Deutschland in Pension geschickt werden, lehren etliche noch mehrere Jahre in den USA. Zahlreiche weitere Beispiele ließen sich anführen. Es handelt sich dabei offensichtlich um privilegierte Personen, die sich auch nach mehr als vier Jahrzehnten im Beruf nicht aufgerieben haben und die Arbeit nicht als notwendiges Übel verstehen, dem man sich sobald wie möglich zu entziehen sucht. Auf den unteren Hierarchieebenen wird dagegen der Rentenbeginn zumeist herbeigesehnt, und sogar ein vorzeitiger Ausstieg trotz finanzieller Einbußen angestrebt. Allerdings finden sich nach wie vor - bzw. heute wieder vermehrt – „aktive Senioren“, die nachdem sie ihre angestammten Plätze in Fabriken und Büros geräumt haben, Minijobs als Putzfrau oder Aushilfe im Supermarkt übernehmen, um ihre magere Rente aufzubessern. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts waren 2017 12 Prozent der 65- bis 74-Jährigen erwerbstätig gegenüber 6 Prozent im Jahr 2007 (https://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/BevoelkerungSoziales/Arbeitsmarkt/Erwerb_Rentenalter.html). Insgesamt waren 1 182.000 Personen, 737.000 Männer und 445.000 Frauen im Alter von über 65 erwerbstätig https://www.destatis.de/DE/Publikationen/StatistischesJahrbuch/Arbeitsmarkt.pdf?__blob=publicationFile). Zur Historie Der Ruhestand als Phase in einem staatlich normierten Lebenslauf entsteht mit der Festlegung von Altersgrenzen, die zum Bezug einer Rente berechtigen. Pensionssysteme gab es zunächst für Beamte und Militärs. Die preußische Beamtenversorgung orientierte sich am 65. Lebensjahr, die staatliche Invaliden- und Altersversicherung der Arbeiter, die unter Reichskanzler Bismarck und Kaiser Wilhelm II. eingeführt wurde, sah das 70. Lebensjahr vor. Diese Altersgrenzen waren zunächst reine Verwaltungsdaten. In Verbindung mit anderen objektivierbaren Kriterien wie Beschäftigungsdauer und Verdienst waren sie Kalkulationsbasis für die Höhe der auszubezahlenden Rente und die Finanzierung des gesamten Systems (vgl. Borscheid 1992, 58). Ein automatisches Ausscheiden aus dem Arbeitsleben markierten sie nicht. Die Rente war nicht als Lohnersatz, sondern als Kompensation für nachlassende Arbeitskraft gedacht. Nach wie vor gab es Regelungen vor allem in Kommunalverwaltungen, nach denen Älteren zum Beispiel Tätigkeiten als Nachtwächter, Pförtner oder Rathausdiener übertragen wurden. Im bäuerlichen Umfeld wurde erwartet, dass sie mit leichten handwerklichen oder hauswirtschaftlichen Arbeiten wie Stricken, Spinnen, Besenbinden, Flechten oder Schnitzen zu ihrem Unterhalt beitrugen (vgl. Göckenjan 2000, 325). Nicht mehr Arbeitsfähige waren auf die Familie oder die Armenfürsorge verwiesen. Eine alimentierte Freistellung von Arbeit aufgrund des Lebensalters war nicht einmal Gegenstand von Sozialutopien (ebd. 309). Im Gegensatz dazu wurde Arbeiten auch im Alter noch bis ins 20. Jahrhundert hinein als moralische Pflicht angesehen und automatische Pensionierung als entwürdigend für die Menschen, die dann nur noch als nutzlose Population zählten (ebd. 326 f.). Erst mit den Nationalsozialisten wurde die Ausmusterung der Alten in einen wohlverdienten „Lebensfeierabend“ umgedeutet (ebd. 332). Die pauschale Entlassung ganzer Jahrgänge aus dem Arbeitsleben kam auf mit der Einführung neuer, „wissenschaftlicher“ Produktionsmethoden (Stichwort „Taylorismus“) zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die entsprechenden Rationalisierungsmaßnahmen stellten die Leistungsfähigkeit des einzelnen Arbeiters konsequent auf den Prüfstand. Sowohl im Zusammenhang der Zeit- und Bewegungsstudien des Taylorismus sowie der Untersuchungen des Vereins für Socialpolitik über „Auslese und Anpassung der Arbeiterschaft“, die ein Nachlassen der Leistungsfähigkeit ab dem 40. Lebensjahr konstatierten, wurde eine zwangsweise Pensionierung mit einem bestimmten Lebensalter gefordert. 1929 wurde in Kalifornien das 70. Lebensjahr als automatische Pensionsgrenze erstmals eingeführt (vgl. Borscheid 1992, 59). Dass der durchschnittliche Lohnarbeiter nach 40 Arbeitsjahren verbraucht, den Anforderungen an einem rentablen Arbeitsplatz nicht mehr gewachsen ist, wurde eine offiziell anerkannte Tatsache. In Deutschland wurde keine Zwangspensionierung eingeführt, jedoch wurden die Älteren zunehmend aus der Wirtschaft verdrängt. Die gesetzliche Altersgrenze für den Rentenbezug erspart es den Arbeitgebern, ihren älteren Mitarbeitern wegen nachlassender Leistungsfähigkeit kündigen zu müssen. Noch nach Einführung der dynamischen Rente im Jahr 1957 war der Renteneintritt nicht zwangsläufig mit einer Aufgabe der Erwerbstätigkeit verbunden. Speziell während der Boomphase der frühen 1960er Jahre stieg die Zahl der Männer und Frauen, die im Alter von 65 beziehungsweise 60 und mehr Jahren einer unselbstständigen Beschäftigung nachgingen, deutlich an. Erst infolge des Anstiegs der Arbeitslosigkeit in den Jahren 1967/68 und endgültig nach der ersten Ölkrise von 1973 nahm der Druck auf die Älteren zu, zugunsten der Jüngeren aus dem Berufsleben auszuscheiden (vgl. 6. Altenbericht 2010, 84). Der systematische Austausch der älteren gegen leistungsfähigere, jüngere Erwerbspersonen sichert einen kontinuierlichen Zu- und Abfluss von Arbeitskräften und Qualifikationen. Dieser wird gewährleistet durch die staatliche Garantie eines „Lohnersatzes“, der von der Arbeitsbevölkerung als Lohn für eine Lebensleistung akzeptiert wird.
Оглавление| Zwangspensionierung in bestimmten BerufenBezirksschornsteinfegermeister können ihren Beruf nur bis zum 65. Lebensjahr ausüben (§ 9 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz).Notare werden von den Landesjustizverwaltungen bestellt. Die Altersgrenze für Notare ist in der Bundesnotarordnung auf 70 Jahre festgelegt. Der Bundesgerichtshof hat ihre Zulässigkeit damit begründet, dass auch jüngeren Anwärtern eine Chance auf Berufsausübung gegeben werden solle.Eine Besonderheit der Beamtenversorgung sind besondere Altersgrenzen für ausgewählte Berufsgruppen. Zu nennen sind insbesondere Beamtinnen und Beamte im Einsatzdienst der Polizei und der Feuerwehr sowie Vollzugsbeamte der Justiz2.2 Das Bundesbeamtengesetz sieht vor: „Beamtinnen auf Lebenszeit und Beamte auf Lebenszeit im Feuerwehrdienst der Bundeswehr treten mit dem Ende des Monats in den Ruhestand, in dem sie das 62. Lebensjahr vollenden. Dies gilt auch für Beamtinnen auf Lebenszeit und Beamte auf Lebenszeit in den Laufbahnen des feuerwehrtechnischen Dienstes, die 22 Jahre im Feuerwehrdienst beschäftigt waren. Beamtinnen und Beamte im Sinne der Sätze 1 und 2 treten mit dem Ende des Monats in den Ruhestand, in dem sie das 60. Lebensjahr vollenden, wenn sie vor dem 1. Januar 1952 geboren sind.“ Für Beamtinnen und Beamte im Sinne der Sätze 1 und 2, die nach dem 31. Dezember 1951 geboren sind, wird die Altersgrenze schrittweise angehoben (Bundesbeamtengesetz § 51 Abs. 3).Für die Wählbarkeit von Bürgermeistern gilt in den einzelnen Bundesländern eine Altersgrenze zwischen 60 und 65 Jahren (vgl. 6. Altenbericht, 383).In seinen beiden Urteilen vom 12.01.2010 entschied der Europäische Gerichtshof, dass Höchstaltersgrenzen für die Einstellung in einen Beruf oder für die Ausübung eines Berufes zum Schutz der Gesundheit oder durch legitime Ziele in den Bereichen Beschäftigungspolitik, Arbeitsmarkt oder berufliche Bildung gerechtfertigt sein können und mit der Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie (Richtlinie des Rates 2000/78) vereinbar sind.Weitere Details zu Altersgrenzen auch im Ehrenamt finden sich im 6. Altenbericht (ab S. 373). |