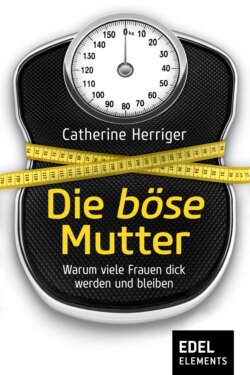Читать книгу Die böse Mutter - Catherine Herriger - Страница 9
ESSSUCHT – WAS IST DAS?
ОглавлениеWarum essen bereits massiv übergewichtige Frauen auch weiterhin viel zu viel, bis Kleidergrößen unaufhaltsam in die Höhe klettern und ihre Füße schmerzhaft aus zu eng und klein gewordenen Schuhen herausquellen? Bis Kurzatmigkeit, Schweißausbrüche, Rückenschäden, Krampfadern, Gelenkschmerzen, Kreislaufstörungen und Herzbeschwerden sich einstellen? Warum tun sie sich dies an?
Sie fressen ohne jedes Sättigungsgefühl, bis unerträgliche Schamgefühle und depressive Verstimmungen Platz greifen und der eigene Körper längst zu einem ungeliebten Objekt, ja sogar zum gefürchteten Gegner degradiert wurde. Bis langjährige Arbeitsstellen aus gesundheitlichen Gründen verlassen werden müssen und Beziehungen wie ganze Familien terrorisiert werden durch die endlosen und vergeblichen Versuche einer Esskontrolle. Warum nur?
Welcher innere Dämon treibt diese Frauen an? Warum sind sie derart autoaggressiv? Warum versagen bei ihnen früher oder später sämtliche guten Vorsätze, motivierend gemeinte Ratschläge, medizinisch verordnete Kuren und Diäten, gezielte Ess- und Bewegungsprogramme? Wo überhaupt bleibt bei ihnen ein respekt- und liebevolles Ich-Gefühl?
Zudem: Warum gibt es nach wie vor wesentlich weniger Männer mit derartigen Essstörungen? Nur weil das gängige Modediktat und das Rollenbild der Männer noch nicht so absolut und häufig absurd auf Schlank-um-jeden-Preis zielt?
Eine wenig plausible, unbefriedigende Erklärung ...
Wohl ist ein dicker Mann in unserer Leistungsgesellschaft nach wie vor weniger dem gesellschaftlichen Druck und der Kritik ausgesetzt als eine übergewichtige Frau. Bei Männern gelten teilweise noch immer »alte« Rollenbilder, die ihnen nach wie vor Wohlstands- und Bierbäuche zubilligen. Solche Klischees können aber schwerlich der Hauptgrund sein, warum unaufhaltsame Fettleibigkeit hauptsächlich Frauen betrifft.
Eine nachvollziehbare, psychische Prädisposition zu einer späteren Essproblematik kann durchaus ihre Wurzeln im Säuglingsalter haben. Nämlich dann, wenn ein weinendes oder zorniges Kleinkind mit Essen oder Trinken getröstet, besänftigt oder belohnt wird, statt dass seine Bezugspersonen sich um seine tatsächlichen Gefühle und Bedürfnisse kümmern.
So kann eine spätere Fehlschaltung »programmiert« werden. Das heißt Essen und/oder Trinken statt Erkennen und Verarbeiten eines ungestillten Anliegens oder eines schmerzhaften Konfliktes; Essen als Trost und Ersatzhandlung, um sich doch noch »etwas Gutes« zu tun.
Aber: Es gibt viele Frauen (und Männer), die mit dieser Art Esskonditionierung aufwuchsen und später trotzdem keinerlei Probleme mit der Nahrungsaufnahme entwickelten.
Seit Jahren bieten Fachstellen und Selbsthilfegruppen wie auch die psychologische Sachliteratur die verschiedensten Erklärungsmodelle an für eine unkontrollierbare Gier nach zu viel Essen.
Hier einige der bekanntesten Beispiele:
Der gesellschaftliche Protest: Übergewicht als demonstratives Nein-Sagen gegen das in unserer westlichen Gesellschaft vorherrschende Konsum- und Modediktat, dass ein Mensch angeblich nur dann als wirklich attraktiv gilt, wenn er dem Zeitgeist angepasst schlank und fit ist.
Die Abgrenzung zur Mutter: Übergewicht als Protesthaltung gegenüber einer übermächtigen Mutter. Ein manifestiertes Nein zu etwaigen mütterlichen Plänen, ein unbewusster Versuch einer (zumindest körperlichen) Abgrenzung.
Die Frust-Schicht: Übergewicht als Hinweis auf sexuelle Frustration und mangelnde Zuwendung. Übermäßige Nahrungsaufnahme als Ersatz für vermisste körperliche und seelische Streicheleinheiten.
Das Vermeidungs- oder Verlagerungsverhalten: Übergewicht als Hinweis, dass unangenehme Empfindungen wie Stress, Langeweile, Wut, Trauer und Ärger mittels Essen unterdrückt beziehungsweise die negativen Gefühle zumindest »thematisch« verlagert werden.
Die Verführung zum Konsum: Übergewicht als ein Zeichen mangelhaft vermittelter Information und somit fehlender persönlicher Abgrenzung gegenüber einem Überangebot an offensiv und attraktiv angebotenen Nahrungsmitteln.
Meiner langjährigen therapeutischen Erfahrung nach stimmen diese Erklärungsmodelle bei Esssüchtigen nur mehr oder weniger partiell, da sie allzu leicht falsch interpretierbar sind. Auch treffen sie im Ansatz sowohl für fettleibige Frauen als auch für Männer zu.
Keines davon aber beleuchtet hinreichend, warum es vorwiegend Frauen sind, die im Laufe der Jahre sich nicht nur eine massive Körperpanzerung angefuttert haben, sondern auch weiterhin drauf und dran sind, sich allen medizinischen Indikationen zum Trotz praktisch zu Tode zu fressen. Essgestörte Männer sind da nach wie vor in einer deutlichen Minderheit (siehe »Noch immer ein Randthema: Esssucht beim Mann«, S. 191 ff.).
1984 begann ich mich erstmals mit dem Thema Essstörungen zu beschäftigen und spezialisierte mich dann therapeutisch auf Adipositas bei Frauen.
Für mich waren und sind diese angeblich so gemütlichen, stets kraftvoll auftretenden, dabei hochsensiblen »Nanas« eine Randgruppe der besonderen Art, auch dadurch gekennzeichnet, dass sie, sollten sie sich im sozialen Kontext exponieren, wegen ihrer Körperlichkeit schnell auf Verständnislosigkeit, absolute Intoleranz und Geringschätzung stoßen.
Bei der Analyse von rund 700 Biografien aus meiner nunmehr über 25-jährigen therapeutischen Arbeit mit Frauen, welche ohne medizinisch begründbare Ursachen (keine hormonellen Störungen, Schilddrüsenunterfunktion etc.) fettleibig, also adipös wurden, wie auch in der Auswertung von Daten aus rund 2000 anonymisierten Fragebogen (»Standortbestimmung«) stellte ich analoge Lebensmuster und signifikante Übereinstimmungen fest, die ich – wenn auch mit einer geringeren Datenmenge – bereits 1988 in der ersten Auflage dieses Buches (»Die Böse Mutter«) publizierte.
Die folgenden diagnostischen Aussagen haben somit nichts an Aktualität und Relevanz verloren, sondern sich im Gegenteil im Laufe der Jahre noch erhärtet und weiter differenziert:
Aus psychischen Gründen adipöse Frauen unterwerfen sich dem ununterbrochenen, aber vergeblichen Versuch, ihre Nahrungsaufnahme zu kontrollieren. Der Stressfaktor ist entsprechend enorm. Wohl hegen sie insgeheim die Überzeugung, dass ihnen »etwas« fehlen könnte – interpretieren es aber mit schwachem Willen und löchriger Disziplin. Hierfür dienen ihnen ihre unzähligen abgebrochenen, beziehungsweise erfolglosen Diäten und Kuren als frustrierende Beweisführung.
Sie haben eine getrübte Wahrnehmung ihrer selbst und meinen, genau zu wissen, warum sie wann und zu viel essen. Gerne führen sie es auf genetische Bedingungen, äußere Umstände wie Stress und Hektik, negative Gefühle, Zurückweisungen, Überangebote in Lebensmittelgeschäften etc. zurück. Diese Erklärungen geben ihnen zwar das Gefühl, letzten Endes doch »alles im Griff zu haben«, sind aber für sie trügerisch, da nur oberflächlich zutreffend.
Sie verfügen über wenig echte Sozialkompetenz aufgrund schmerzhafter Nähe-Distanz-Probleme. Sie treten zwar kommunikativ-offen und belastungsfähig auf, sind aber äußerst verletzlich und reagieren auf vermeintliche oder tatsächliche Kritik mit innerem Rückzug oder mit unangepasster Aggressivität. Dabei ist der innere Wunsch nach Anerkennung und Zuwendung überwältigend.
Sie sind praktisch unfähig, Respekt einzufordern, sich abzugrenzen und ihre emotionalen Bedürfnisse beziehungsweise ihre Ansprüche zu formulieren, geschweige denn durchzusetzen. Schwierigkeiten in Beziehungen, im Alltag überhaupt, sind vorprogrammiert. Ihr sexuelles Erleben ist, falls überhaupt existent, gering und unbefriedigend.
Sie stehen unter dem Eindruck, dass sie ihre mit Krisen und Depressionen durchzogene Lebenssituation irgendwie selbst verschuldet haben, sei es durch zu hohe Ansprüche oder schlicht aus eigenem Unvermögen. So oder so sind die Gefühle eigener Unzulänglichkeit beziehungsweise Minderwertigkeit jeweils gewaltig.
Sie verschweigen beziehungsweise verleugnen konsequent ihr gestörtes Essverhalten und die demütigenden Fressattacken. Der Umwelt (und auch sich selbst) gegenüber »verschlanken« sie ihre gravierende Problematik und betonen gerne, dass sie, trotz einer angeblich geringen Kalorienaufnahme, jeweils »einfach sofort zunehmen« würden, beziehungsweise dass ihnen ihr Gewicht/Aussehen eh gleichgültig sei.
Sie haben eine ausgesprochen starke, wenn auch häufig ambivalente bis feindselige Beziehung zu ihren Müttern. Es ist, als wäre bei ihnen die Nabelschnur nie wirklich durchtrennt worden, unabhängig davon, wie groß die geografische Distanz sein mag oder ob die Mutter inzwischen verstorben ist. Die Mutter beziehungsweise deren Schatten beherrscht im Positiven wie im Negativen das Leben esssüchtiger Frauen.
Es geht hier immer um Frauen, die offensichtlich ihren »inneren Raum«, ihr eigentliches Ich samt seinen ganz persönlichen Bedürfnissen und Anliegen kaum oder gar nie wirklich ausloten und spüren durften. Frauen, die im übertragenen Sinne ein beschnittenes, in seiner Weiblichkeit kastriertes Leben führen.
Zusätzlich erschwerend ist die Tatsache, dass Dicksein in der heutigen, nicht nur mode- sondern zunehmend gesundheitsbewussten Gesellschaft ganz allgemein eine neue Art von physischem und psychischem Leistungszwang beinhaltet.
So kann auch hier Nicht-Genügen zu einer subtilen Form der Ausgrenzung führen – zu einer Zweiklassengesellschaft, die nachweisbaren Erfolg über Kleidergröße, Fitness, Body-Maß-Index, Nahrungsmanagement und Kalorienabbau definiert. Der psychosoziale Druck auf die Randgruppe der Adipösen, und speziell auf die der Frauen, nimmt somit ständig zu.
Krankenkassen bangen um ihr Geld, Unternehmen um die zuverlässige Leistungsfähigkeit übergewichtiger MitarbeiterInnen – die vermeintlich Ach-so-aufgestellten-und-robusten-Dicken werden immer mehr als (finanzielle) Risikofaktoren wahrgenommen, als gesundheitliche Zeitbomben.
Dementsprechend wird inzwischen gezieltes Abnehmen in Kombination mit körperlicher Ertüchtigung quasi als Volkssport betrieben, erweist sich in seiner Vielfalt wiederholt als Kassenschlager, macht Schlagzeilen und gehört sogar in politische Programme −, aber jene Adipositas, welche ausschließlich psychische Wurzeln hat, ist der Öffentlichkeit und dem Gesundheitswesen fremder (und unbequemer) denn je.
Dies, obwohl in den 90er-Jahren der diagnostische Begriff Binge-Eating-Disorder entstand, welcher jene Essstörung kennzeichnet, die bei den Betroffenen periodische Heißhungeranfälle auslöst und mit dem Verlust einer bewussten Esskontrolle einhergeht. Der treffend charakterisierende Name dieser Krankheit leitet sich aus dem englischen »Binge-Eating« her: ein »Fressgelage abhalten«.
Die diagnostischen Kriterien zur Erkennung dieser Binge-Eating-Disorder für Frauen wie für Männer wurden von der Psychiatrischen Vereinigung in den USA wie folgt definiert:
Mindestens zwei Essanfälle in der Woche über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten
Kontrollverlust während der Nahrungsaufnahme mit Verlust des Sättigungsgefühles
Sehr hohe Kalorienzufuhr bei einem Essanfall
Extrem hastiges Essen (Schlingen)
Essen bis zu einem starken Völlegefühl
Der Essanfall wird nicht durch starken Hunger ausgelöst.
Nach dem Essanfall treten Schuld- und Schamgefühle auf, teilweise bis zu Depressionen.
Die Betroffenen leiden unter den Essanfällen.
Wiederholte Untersuchungen in den USA ergaben zudem, dass der männliche Anteil bei Adipositas-Erkrankungen nur etwa ein Drittel beträgt. Der Löwenanteil betrifft Mädchen und Frauen. Warum? Mir schien diese Frage schon früher von zentraler Bedeutung und ihr habe ich meine therapeutische Arbeit mit adipösen Frauen gewidmet.
Durch die autoaggressive, scheinbar freiwillig vorgenommene Verunstaltung ihres Körpers mittels übermäßiger Nahrungsaufnahme führt eine Frau (oder ein Mädchen) ein immer stärker eingeschränktes Dasein. Ein Dasein zweiter Klasse – in unserer mode- und gesundheitsbewussten Gesellschaft im Grunde genommen das Leben einer Kastratin. Und dies nicht aufgrund einer ritualisierten und schrecklichen, mehr oder weniger totalen Klitorisbeschneidung, sondern wesentlich »zivilisierter« beziehungsweise mit gänzlich anderen Wurzeln und Motiven ...
Kastration ist uns längst bekannt, vorwiegend aus der Geschichte des Mannes. Ein kastrierter Mann, ein Eunuch, war von jeglicher sexueller Rivalität ausgeschlossen, er war »entmannt«, »entmachtet« und somit, gesellschaftlich gesehen, ein durch seine eingeschränkte Körperlichkeit stigmatisierter Außenseiter.
Nie mehr durfte/konnte er seine »Manneskraft« beweisen, sich damit auszeichnen oder andere Männer herausfordern. Durch die Verstümmelung seines Körpers, das Wissen um dessen Unzulänglichkeit, musste auch der Charakter des Kastraten angepasstere und gefügigere Züge annehmen. Typisch männliches, aggressives Rivalitätsgebaren war ohnehin sinnlos und wurde tunlichst vermieden. Es wäre lediglich lächerlich gewesen.
Die von der Wahrnehmung ihrer Körperlichkeit her »ganzen« Männer sahen in dem Kastraten keinerlei Bedrohung und benützten ihn gerne als Vertrauten und Lustknaben, schenkten ihn der eigenen Frau als Spielgefährten und Begleiter oder setzten ihn als Wächter weiblicher Tugend ein (z.B. in Harems).
Hingegen war es durchaus möglich, dass der Kastrat, je nach seinen Fähigkeiten (Musik, Theater, Kunst etc.), ein hohes Ansehen in bestimmten Kreisen genießen konnte, wie auch den Schutz eines jeweiligen Gönners. Der gewaltsame Eingriff, der sämtliche geschlechtsspezifischen Eigenschaften und Äußerungen für immer ausschloss, konnte durchaus eine goldene Seite haben.
Für unsere Kultur und unsere Begriffe beinhaltete (und beinhaltet) Kastration eindeutig den unmissverständlichen und zutiefst grausamen Ausdruck von Entpersönlichung, Entmachtung und Geringschätzung jeglicher Individualität.
Wie sieht ein Vergleich mit der aus psychischen Gründen fettleibigen Frau aus?
Ihr mit ständigem Binge-Eating geplagter Körper wird zunehmend aufgeschwemmt und damit reizloser. So wirkt auch sie im geschlechtlichen Wettbewerb harmlos. Als fettleibige Frau stellt sie für andere Frauen keine ernstzunehmende Konkurrenz dar – schon gar nicht im Wettbewerb um die Aufmerksamkeit eines Mannes oder mehrerer Männer.
Ihre Umwelt traut ihr kaum geschlechtliche Triebe und Wünsche zu, geschweige denn eine aktiv gelebte Sexualität. Auch sie ist körperlich stigmatisiert, hätte aber ihrerseits durchaus die (Verdrängungs-)Möglichkeit, gerade wegen ihrer Körperfülle und/oder mittels einer darstellerischen Begabung ihre Sucht im Showbusiness effektvoll zu überspielen oder, mit Rückzug auf sich selbst, ihr Leiden in einem aufopfernden Helferberuf zu kompensieren. So kann durch Esssucht bedingte weibliche Kastration ihre ebenfalls »goldenen« Seiten haben.
In den Interaktionen mit anderen Menschen und im Arbeitsumfeld schützt sie sich – da sie um ihre Verletzlichkeit weiß – gerne mittels Überanpassung, gepaart mit betont fröhlicher Zuvorkommenheit und teilweise ausufernder Hilfsbereitschaft. Dadurch bietet sie sich förmlich an, in ihren persönlichen Ansprüchen unterschätzt und so emotional ausgebeutet zu werden.
Kaum jemand interpretiert die Körperlichkeit einer durch Binge-Eating verunstalteten Frau richtig beziehungsweise macht sich die Mühe, diese überhaupt anzusprechen und zu hinterfragen. Diesbezüglich gut gemeinte Versuche scheitern sowieso meistens an einer ausgesprochen defensiven bis aggressiven Reaktion der betroffenen Frau. Oft dauert es Jahre, bis sie sich damit abfinden kann, dass ihr Essverhalten krankhaft, also außerhalb der Norm ist. So bleibt deren innere Isolation, die häufig depressive Stimmungslage, der mangelnde Selbstwert, das latente Misstrauen, der drängende Wunsch nach Zugehörigkeit und Zuwendung, der sexuelle Notzustand unbemerkt – die Sucht wuchert weiter.
Die gesellschaftlichen Umstände sind da wenig hilfreich: Fettleibigkeit mag zwar unschön sein, ist aber sozial kompatibel, das heißt sie »eckt« nirgendwo an und kann daher in der Schwere ihrer psychischen Tragweite nach wie vor missverstanden beziehungsweise übergangen werden. In der allgemeinen Wahrnehmung ist dick einfach dick. Und solange niemand dadurch deutlich genug zu Schaden kommt...
So genießen esssüchtige Menschen, gemeinsam mit den »üblichen Dicken«, wohl eine gewisse, aber eher geringschätzig gefärbte Nachsicht, durchzogen mit einem kleinen Mitleidbonus. Die gängigen Kommentare sind unsensibel und in ihrer herabsetzenden Art im höchsten Maß kränkend:
Tja, essen müssen schließlich alle, aber ganz offensichtlich gibt es solche, die keine Grenzen kennen und sich grundsätzlich überfressen ...
Bei Frauen sieht’s noch schlimmer aus als bei Männern ... Echt abstoßend!
Mensch, deren Body-Maß-Index muss ja sämtliche Rekorde brechen.
Unter der bricht garantiert jede Kloschlüssel zusammen...
Guck mal: Die braucht dringendst ein Magenband, sonst platzt sie mal.
Wohl noch nie was von vernünftig essen, von Diäten gelesen oder gehört?
Wie wäre es denn mit mehr Bewegung, etwas sportlicher Betätigung? Im Flieger muss die sicherlich immer gleich zwei Sitze belegen, haha.
Selber schuld, die hat halt null Disziplin. Pech, ist ja nur ihr Körper ...
Psychisch bedingte Adipositas existiert noch nicht in der öffentlichen Wahrnehmung, Esssucht bleibt unerkannt, das Thema in seiner gesamten Unerfreulichkeit tabu – ganz im Gegensatz zu Anorexie und Bulimie, welche als Erkrankungen sozial kompatibler sind, wohl auch aus dem Grund, dass sie »ästhetischer« daherkommen.
Und so wird der eigentlich demonstrative Ruf einer esssüchtigen Frau nach echter Hilfe trotz (oder wegen?) aller zur Schau gestellten Körperfülle übersehen und überhört. Die betroffene Frau wird alleine gelassen in ihrer Krankheit, bleibt so nach wie vor der Gier ihres immer unförmiger werdenden Körpers ausgeliefert – die Negativ-Spirale der Sucht dreht sich in all ihren Konsequenzen gnadenlos weiter.