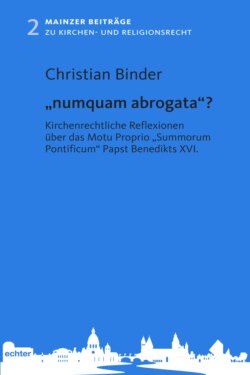Читать книгу "numquam abrogata"? - Christian Binder - Страница 7
ОглавлениеVorwort
Die Liturgie stellt zweifelsohne den Mittelpunkt der Kirche dar. Somit liegt es auf der Hand, dass Reformen auf liturgischer Ebene enormen innerkirchlichen Sprengstoff bergen – wie dies auch bei der in der Folgezeit des Zweiten Vatikanischen Konzils durchgeführten Liturgiereform der Fall war. Vor allem die reformierte Form der Messe war – neben enormem Zuspruch – auch starker Kritik ausgesetzt und zog Fragen nach sich: darf überhaupt eine neue Form der Messe eingeführt werden? Was muss sie enthalten, beziehungsweise, darf sie nicht enthalten? Und natürlich: darf die alte Form der Messe weiterhin gefeiert werden? Dass besonders die letztgenannte Frage von starker Relevanz war, wird bereits aus der Stück für Stück erfolgten teilweisen Wiedererlaubnis der Messe von 1962 in den Jahrzehnten nach der Liturgiereform ersichtlich. Nun ist diese Thematik jedoch im Jahr 2007 wieder in den breiten Fokus der Öffentlichkeit gerückt, als Papst Benedikt XVI. durch das Motu Proprio Summorum Pontificum eine weitgehende Gleichstellung der alten mit der neuen Form der Messe vornahm1. Benedikt XVI. versuchte hier einen Brückenschlag, indem er bestrebt war, sowohl die Anhänger der neuen Messe, als auch der alten Messe zufrieden zu stellen. Um die Legitimität dieser Maßnahme zu steigern, erklärte er die alte Messe für „niemals abgeschafft“2 – numquam abrogata3. Auch in seinem anlässlich des Motu Proprio Summorum Pontificum an die Bischöfe gerichteten Begleitschreibens betonte Benedikt XVI., dass das Missale von 1962 „nie rechtlich abrogiert“ worden sei4. Diese numquam abrogata-Formulierung stellt zweifelsohne den strittigsten und rätselhaftesten Passus des gesamten Motu Proprio dar. Der Papst lässt offen, was er damit meint und wie er zu dieser Feststellung kommt. Denn Erklärungen hierfür wären angesichts der Realität der vorhergehenden Jahrzehnte durchaus angebracht. Was könnte Benedikt XVI. mit dieser Formulierung meinen? Wie kommt er zu diesem Schluss? Und hat er bei Betrachtung der Fakten damit überhaupt Recht? Es soll folglich das Ziel dieser Arbeit sein, nach möglichen Lösungen für diese Fragestellungen zu suchen und Licht in die numquam abrogata-Formulierung Benedikts XVI. zu bringen. Angemerkt sei an dieser Stelle, dass – wie noch deutlich werden wird – der Diskurs zwischen Anhängern der „alten“ und „neuen“ Form der Messe sich oftmals auf einer ideologischen Ebene abzuspielen scheint. Jene ideologischen Grabenkämpfe gilt es jedoch gerade nicht weiter fortzuführen, sondern die relevanten Sachverhalte vielmehr möglichst objektiv darzustellen, zu untersuchen und letztendlich zu bewerten. Tatsächlich existierten bereits vor Summorum Pontificum verschiedenste Theorien, die eine weitere Geltung der Messe von 1962 zu begründen versuchten und somit als mögliche Erklärungsansätze in Frage kommen. Um diese Theorien auf ihre Stichhaltigkeit untersuchen zu können, ist es im Rahmen dieser Arbeit nötig, den Bogen zwischen der Kirchengeschichte und der aktuellen kirchlichen Entwicklung zu spannen, die für die verschiedenen Thesen relevanten Teilbereiche des Kirchenrechts zu berücksichtigen und auch einen großen Fokus auf die Liturgiewissenschaft zu legen. Zu beachten ist, dass auf kirchenrechtlicher Ebene keine Konsultation der Fontes des Codex Iuris Canonici vorgenommen werden wird, sondern der Schwerpunkt auf den kodifizierten Gesetzen liegen wird, da diese für die nachkonziliare Zeit – und damit für die Frage einer etwaigen Weitergeltung der alten Messe – maßgeblich sind. Am Beginn dieser Arbeit steht eine genauere Vorstellung des Motu Proprio Summorum Pontificum, gefolgt von einem kurzen Überblick über den Forschungsstand bezüglich Benedikts XVI. strittiger Formulierung. Anschließend werden die unterschiedlichen Thesen der vergangenen Jahrzehnte, welche die numquam abrogata-Behauptung Benedikts XVI. erklären könnten, einer Überprüfung unterzogen werden. In einem ersten Schritt werden verschiedene traditionsbasierte Theorien im Mittelpunkt stehen, die ihren Gültigkeitsanspruch aus der ersten gesetzlichen Regelung der Messe im Jahr 1570 unter Papst Pius V. und aus der darauf folgenden Zeit – bis zur Reform der Messe in der Folgezeit des Zweiten Vatikanischen Konzils – herleiten. Zunächst wird hierbei ein zeitlicher Abriss der Vorgeschichte der Messe bis zum Jahr 1570 vorgenommen und anschließend die Promulgationsbulle Quo primum des Missale von 1570 untersucht werden. Darauf aufbauend sollen die unterschiedlichen traditionsbasierten Theorien einer Überprüfung ihrer Stichhaltigkeit unterzogen werden. Erstens wird die Unwiderruflichkeitstheorie des Missale von 1570 aufgrund der entsprechenden Wortwahl von Papst Pius V. in der Bulle Quo primum untersucht werden. Zweitens wird die Privilegientheorie, nach welcher Papst Pius V. in der Bulle Quo primum das Privileg verliehen habe, in alle Zeit die Eucharistie nach dem Missale aus dem Jahr 1570 zu feiern, einer Betrachtung unterzogen werden. Und drittens wird die Gewohnheitsrecht-Theorie, nach welcher die Feier der Eucharistie in der tridentinischen Form ein Gewohnheitsrecht darstelle, das nicht explizit widerrufen worden sei, analysiert werden. Im zweiten Schritt steht die Immunisierungstheorie im Mittelpunkt, welche unter Rückgriff auf den vierten Artikel der Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium behauptet, dass das Zweite Vatikanische Konzil selbst das Missale von 1962 gegen eine ersetzende Reform immunisiert habe. Im Zuge der Überprüfung der Plausibilität dieses Erklärungsansatzes wird hierbei zunächst der Weg zur Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium – angefangen von der Liturgie nach dem Trienter Konzil bis in das 19. Jahrhundert, weiter gehend über die Liturgische Bewegung und ihrem Streben nach participatio actuosa, über die Enzyklika Mediator Dei aus dem Jahr 1947, bis hin zum Missale Romanum von 1962 – betrachtet werden. Anschließend wird die Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium selbst in den Mittelpunkt rücken, um zu ergründen, ob sich die Immunisierungstheorie tatsächlich aus der Konstitution herleiten lässt. In der Folge sollen zur Ermöglichung einer abschließenden Bewertung der Theorie noch die Umsetzung der Konzilsbeschlüsse einer genaueren Betrachtung unterzogen werden. Zunächst werden hierbei die Reformschritte in der Liturgie in den Jahren nach dem Konzil im Mittelpunkt stehen, um anschließend die Umsetzung von Sacrosanctum Concilium im Missale Romanum von 1970 und im Codex Iuris Canonici von 1983 zu untersuchen. Abschließend wird die Frage zu klären sein, ob ein Liturgieverständnis der vorkonziliaren Zeit mit der des Konzils ekklesiologisch überhaupt zu vereinbaren ist. In einem dritten Schritt wird die Theorie der fehlenden Rechtmäßigkeit der Liturgiereform untersucht werden, die hauptsächlich von Georg May vertreten wurde und nach welcher der Ordo Missae Papst Pauls VI. ein ungerechtes Gesetz darstelle, dem man keine Folge leisten müsse, da die neue Form der Messe dem Gemeinwohl abträglich sei. Zu untersuchen wird hier sein, ob und inwieweit die – zumindest in Westeuropa – in den letzten Jahrzehnten hervorgetretenen Krisenerscheinungen der Katholischen Kirche tatsächlich auf die liturgischen Reformen seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil bis zur Etablierung der neuen Messe zurückgeführt werden können. Im vierten Schritt werden Theorien im Mittelpunkt stehen, die unter Rückgriff auf die Abänderungsklausel der Apostolischen Konstitution Missale Romanum aus dem Jahr 1969 versuchen, eine vermeintlich weiter bestehende Gültigkeit der Messe von 1962 zu begründen. Zunächst werden hierbei Argumentationen untersucht werden, welche versuchen, die Existenz der Schlussklausel der Apostolischen Konstitution Missale Romanum zu verschweigen. Anschließend wird die Derogatio-Theorie, welche aufgrund der Verwendung von derogatio in der Abänderungsklausel mutmaßt, dass Papst Paul VI. gar nicht die Abschaffung der alten Messe intendiert habe, sondern lediglich ein Zusatzangebot zum Missale Papst Pius’ V. habe schaffen wollen, sowie die Theorie einer Kardinalskommission im Jahr 1986, nach welcher liturgische Normen keine Gesetze im eigentlichen Sinne seien und man sie daher auch nicht wirklich abschaffen könne, einer Überprüfung unterzogen werden. In einem fünften Schritt sollen dann Theorien einer Weitergeltung der alten Messe analysiert werden, welche die nach der Einführung der neuen Messe bestehenden Ausnahmeregelungen für die Messe von 1962 als Beleg für ihre weitere Gültigkeit anführen. Einerseits wird hier nur das als verboten angesehen, was niemals auch nur im Rahmen einer Ausnahmeregelung weiterhin erlaubt war – die Ausnahmen von der Verpflichtung zur Feier der neuen Messe, die für alte und kranke Priester gemacht wurden, dienen hier als Ausgangspunkt der Argumentation. Andererseits ist auf Grundlage der im Jahr 1984 durch Papst Johannes Paul II. erteilten Vollmacht an die Diözesanbischöfe zum Gebrauch des Indults – welches die Feier der Messe nach dem Missale Romanum von 1962 unter bestimmten Umständen wieder ermöglichte – die theoretische Möglichkeit zu berücksichtigen, dass eine spätere Erlaubnis mit einer durchgängigen Erlaubnis gleichgesetzt werden könnte. Letztendlich soll in diesem Zusammenhang noch der Ausschluss und die Integration von Anhängern der alten Messe am Beispiel der Pius- und Petrusbruderschaft beleuchtet werden. In einem letzten großen Schritt ist schließlich noch nach den Intentionen Papst Benedikts XVI. zu suchen, welche ihn zur Herausgabe des Motu Proprio Summorum Pontificum, mitsamt der numquam abrogata-These in Bezug auf die alte Form der Messe, veranlasst haben könnten. Am Anfang steht hier das Wirken Joseph Ratzingers bis zur Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils. Anschließend soll das Zweite Vatikanische Konzil in den Mittelpunkt rücken, um zu klären, welchen Einfluss Joseph Ratzinger möglicherweise selbst, oder in indirekter Form durch Josef Kardinal Frings, auf das Konzil gehabt haben könnte. Im Anschluss werden die für die Liturgie relevanten Äußerungen Ratzingers, welche er in seinen Werken in der nachkonziliaren Zeit bis zum Beginn seines Pontifikats getätigt hat, einer Untersuchung unterzogen werden. Auch sollen mögliche Tendenzen untersucht werden, die auf eine zunehmende Beschneidung der postestas ordinaria propria der Ortsordinarien auf liturgischer Ebene hinweisen könnten – denn nichts anderes hat ja Benedikt XVI. getan, als er nun primär nur noch den Willen der jeweiligen Gläubigen als Entscheidungskriterium für die Feier der Messe von 1962 festgemacht hat. Abschließend bleibt in diesem Kontext die Frage zu beantworten, ob Papst Benedikt XVI. mit seiner numquam abrogata-These möglicherweise eine verbindliche Neudeutung des Gesetzgebungsaktes Papst Pauls VI. unter Rückgriff auf die primatiale Vollgewalt vornehmen wollte. Im Anschluss an die verschiedenen Erklärungsansätze für die numquam abrogata-Theorie Papst Benedikts XVI. wird noch ein kurzer Abriss der Entwicklungen der letzten Jahre vorgenommen werden, der einerseits die Untersuchung der receptio legis beinhalten wird, andererseits die Haltung von Papst Franziskus zur alten Messe anhand seines Apostolischen Schreibens Evangelii Gaudium beleuchten soll. Am Ende der Arbeit soll ein Gesamtfazit der zuvor behandelten Aspekte und Theorien gezogen werden.
1 Vgl. Benedikt XVI., Apostolisches Schreiben Motu Proprio Summorum Pontificum vom 7. Juli 2007, in: AfkKR 176 (2007), 519-525.
2 Vgl. ebd., 521.
3 Benedikt XVI., Litterae apostolicae. «Motu proprio» datae. De usu extraordinario antiquae formae Ritus Romani, in: AAS 99 (2007), 779.
4 Benedikt XVI., Brief des Heiligen Vaters Papst Benedikt XVI. an die Bischöfe anlässlich der Publikation des Apostolischen Schreibens Motu Proprio Summorum Pontificum über die römische Liturgie in ihrer Gestalt vor der 1970 durchgeführten Reform vom 7. Juli 2007, in: AfkKR 176 (2007), 526.