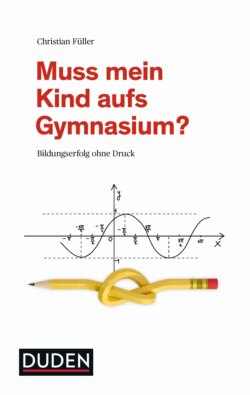Читать книгу Muss mein Kind aufs Gymnasium? - Christian Füller - Страница 6
ОглавлениеEINLEITUNG
Im Frühjahr 2018 wurden Baden-Württembergs Abiturienten weltberühmt. Kaum hatten sie ihr Englisch-Abitur geschrieben, schlugen Tausende Prüflinge Alarm. »Das Abitur 2018 im Fach Englisch war unfair!«, schimpften sie in einer Petition: zu schwer und nicht mit dem Vorjahresabi zu vergleichen. Selbst die New York Times widmete sich dem Abi-Protest im Ländle. »Sich zu beschweren, dass deine Abschlussprüfungen zu hart sind, ist fast schon Tradition«, lästerte die angesehene Zeitung. Aber diese Abiturienten jammerten, »noch bevor die Ergebnisse veröffentlicht wurden«.1
Das deutsche Abitur war lange der Inbegriff für eine ernste und schwere Prüfung. Nun aber wollen Abiturienten die Hochschulreife nicht nur bestehen, sie wollen sie narrensicher haben. Was wie eine skurrile Anekdote wirkt, steht beispielhaft für einen erstaunlichen Wandel, der das Abitur erfasst hat. Der Umschwung hatte sich schon angedeutet, als die Abiturienten von heute geboren wurden.
Im Jahr 2001 veröffentlichte die OECD – die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung – ihren ersten weltweiten Bildungstest. Der Ländervergleich, der unter dem Namen »Pisa« berühmt werden sollte, bedeutete für Deutschland nicht weniger als eine Demütigung. Über Nacht mussten sich die Deutschen damit arrangieren, dass nun »funktionale Analphabeten« zur Familie gehörten. Damit sind Risikoschüler gemeint, die Texte zwar lesen können, sie aber nicht verstehen. »Dummkopf!«, titelte der britische Economist – auf Deutsch.2 Die Stuttgarter Zeitung sprach von einer »nationalen Katastrophe«.3
Der Pisa-Schock scheint inzwischen überwunden. Die deutschen Schüler liegen heute deutlich über dem OECD-Durchschnitt. Die Schulen bringen weniger Risikoschüler und dafür umso mehr Abiturienten hervor. Fünf von zehn Jugendlichen eines Jahrgangs erlangen die Hochschulreife – eine Entwicklung, die für ein so großes Land in so kurzer Zeit nicht machbar schien. Die größten Pisa-Defizite sind also ausgeräumt, und dennoch gehört die Schule heute schon wieder auf den Prüfstand. Der Wandel hat nämlich das Gleichgewicht zwischen Schulen und Berufsbildung aus der Balance gebracht. Wenn mehr Schüler studieren wollen, fangen weniger eine Lehre an. Die Zahl der 1,0-Abiture nimmt auf wundersame Weise zu, während Jahr für Jahr Zehntausende Lehrstellen unbesetzt bleiben und die Hauptschulen dahinsiechen.
In diesem Moment nun demonstrieren ausgerechnet jene, die auf dem Sonnendeck des Bildungssystems gelandet sind: Gymnasiasten. Sie stänkern gegen ein Abitur, das vielen schon als Billigvariante gilt. Hinter dem Schülerspektakel steckt mehr als die Unbescheidenheit von Teenagern. Es ist ein Hinweis darauf, dass der Traum vom Aufstieg durch Bildung in der Krise ist – trotz und zugleich wegen des Abi-Booms. Längst ist daraus ein Anspruch geworden, den nicht nur bürgerliche Sprösslinge erheben. Die Aussicht auf ein Studium hat die Bildungsdebatte seit den 1960er-Jahren geprägt. Diese Chance will sich heute keiner mehr durch eine komplizierte Prüfung verbauen lassen. Die Schüler sind damit übrigens nicht allein. Immer mehr Eltern fordern ein leichteres Abitur, in ihrer Sprache ist es ein Abitur ohne Druck. Und es sind längst nicht mehr nur die viel zitierten Montessori-Mütter, die ein sanftes Lernen wünschen – mit Abiturgarantie, versteht sich. Hinzu kommt eine Gruppe, die kein bisschen sanft ist: die Elterninitiativen, die gegen das achtjährige Gymnasium protestieren.
Was wir gerade erleben, ist das Ende des Abiturs alter Prägung. Als Preußens König Friedrich Wilhelm III. es 1834 per Dekret einführte, wurde es schnell zum Goldstandard aller Bildungsabschlüsse. Es sollte streng sein – und ein Nadelöhr. Gerade mal ein Prozent der Bevölkerung erreichte im 19. Jahrhundert die allgemeine Hochschulreife. Mitte des 20. Jahrhunderts waren es nach wie vor nur sieben Prozent – das war, kurz bevor Willy Brandt die erste Bildungsexpansion ausrief. Mit dem Abi-Boom unserer Tage ist die Hochschulreife nun Standard geworden. Das hat Folgen.
Ein Abitur, das mehr als die Hälfte eines Altersjahrgangs schaffen soll, kann jedenfalls nicht schwerer gemacht werden. Stattdessen breitet sich die Idee eines Slow Abi aus, sanft zur Hochschulreife. Wenn man so will, erleben wir die Versöhnung zwischen dem wilhelminischen Abitur als staatlich zertifizierter Lizenz zum Aufstieg und Humboldts Idee vom Lernen als einem Prozess innerer Vervollkommnung.
Ein dergestalt neu definiertes Abitur bedeutet einen Umbruch historischen Ausmaßes. Die Bildungsexpansion, die wir gerade erleben, wird die Schulen von Grund auf revolutionieren. Und das ist nur das Präludium. Der Nation wird schon bald die nächste Bildungsrevolution bevorstehen. Beinahe unbemerkt hat sich nämlich eine Vielzahl neuer integrativer Schulformen ausgebreitet. Gemeinschaftsschulen, Stadtteilschulen, Oberschulen und viele Gesamtschulen werden einer neuen Schicht von Schülern die Tore zum Studium öffnen. Ein Kind muss heute nicht mehr aufs Gymnasium, um sich den Weg zum Abitur offenzuhalten. In fast allen Bundesländern entstehen Schulen, die die Abschlussziele ihrer Schüler nicht mehr schon im Alter von zehn Jahren festlegen.
Diese neuen Schulformen werden zugleich etwas von dem Traum erfüllen, den die eingangs erwähnten Abiturienten in Baden-Württemberg haben: Es ist der Traum von einem Bildungserfolg, der Spaß machen darf, einem Abitur ohne Druck. Der klassische Frontalunterricht verschwindet, während das individuelle Lernen Einzug hält. Es entstehen Lernformate, wie wir sie in diesem Buch kennenlernen werden, Lernbüros etwa, in denen die Schüler selbst entscheiden, wann und was sie lernen. Auch Projekte und Exkursionen zählen dazu, bei denen Schüler Forscherthemen und Reiseziele frei wählen – und Methoden digitaler Bildung wie »flipped classrooms«, Tabletklassen oder Makerspaces.
Leidet deswegen das Gymnasium, wird es gar überflüssig? Das ist weder vorstellbar, noch ist es die richtige Frage. Dafür ist die Marke Gymnasium viel zu stark. »Abitur haben oder nicht haben«, das war früher wie »Sein oder Nichtsein«. Es zerschnitt Familien und sortierte Einladungen zum Abendessen. Jeder Politiker, der laut sagen würde, er wolle das Gymnasium abschaffen, würde sofort abgewählt. Weil man einem Bildungswesen nicht das Herz herausreißen kann. Sonst stürzt das ins Chaos, was in den Augen vieler Eltern zu ihrer letzten Bastion geworden ist: die Bildung ihrer Kinder.
Bei der Recherche für dieses Buch, bei vielen Besuchen in Schulen überall im Land und Gesprächen mit Pädagoginnen und Pädagogen schälte sich eine zentrale Erkenntnis heraus: Das Gymnasium ist nicht etwa deshalb wichtig für diese Zeit, weil es eine große Tradition hat. Es trägt vielmehr Tugenden im Gepäck, die bei der folgenschwersten Entwicklung, die wir gerade erleben, wichtig werden könnten: der Digitalisierung. Kritisches Denken unter aktiver Einbeziehung der Schüler sind Humboldtsche Qualitäten des Gymnasiums. Leider blieben sie lange unterentwickelt. Wir wollen sehen, welche Rolle sie spielen können, wenn der Online-Tsunami über die Schulen hinwegrollt.